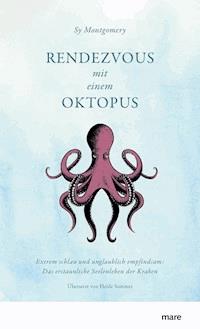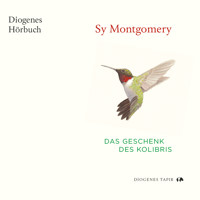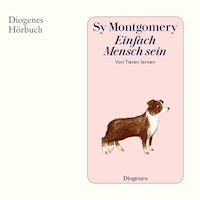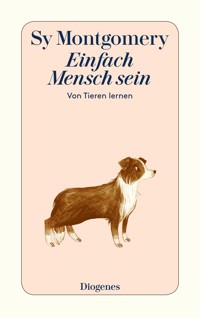19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Sy Montgomery ist mit ihrem Bestseller »Rendezvous mit einem Oktopus« in die erste Liga der Nature Writer vorgestoßen, auch in Deutschland. Doch nicht nur Oktopoden liegen der Naturforscherin und Autorin am Herzen – sie hat für viele faszinierende Kreaturen Leib und Leben riskiert, aber insbesondere für die rosa Amazonas-Delfine. Viermal ist sie ins Amazonas-Delta gereist, um ihnen auf die Spur zu kommen, wurde von Ameisen gebissen, teilte mit Spinnen das Quartier und schwamm mit Piranhas. Schnell wird ihr klar: Man kann den rosa Delfin nicht erfassen, wenn man nicht begreift, wo er in der Evolution steht und welche Rolle er im Ökosystem Regenwald spielt – es ranken sich zahlreiche Mythen um die »Botos«, die Amazonas-Bewohner verehren und fürchten sie. Sy Montgomery begegnet allen auf Augenhöhe: Den »Indigenas«, die mit dem ständigen Schwund ihres Lebensraumes ringen müssen, den Forscher*innen, die ihr Leben dem Studium des Amazonas-Deltas gewidmet haben, und nicht zuletzt den Tieren und Pflanzen der Region. Ihre Liebe zu den Geheimnissen unserer Natur ist ansteckend – und in Zeiten des Klimawandels notwendiger denn je!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Es gibt keinen zweiten Regenwald: Eine Bestandsaufnahme zwanzig Jahre nach der Erstveröffentlichung
Wie ich mein Herz an den Amazonas verlor: Einführung in die Ausgabe von 2008
Das Abenteuer beginnt
Manaus: Das Paris der Tropen
Ein rosa Rücken kann auch entzücken
Die Verführungskünste der Botos
Meeresmenschen: Die Legende von Encante
Iquitos: Alltag in der Unterwasserstadt
Vanilleduft im Regenwald
Ein Kampf auf Leben und Tod
Die Seele des Amazonas
Ich sehe meinen inneren Jaguar
Der Natur ganz nah: Im Reservat von Tamshiyacu-Tahuayo
Eine Reise in die Vergangenheit
Magische Unterwasserwelt
Alles eine Frage der Frequenz
Der Blick unter die Oberfläche
Endlich am richtigen Ort
Die mit dem Delfin schwimmt
Der Tanz des rosa Delfins
Bibliografie
Nützliche Adressen für Interessierte
Dem Andenken meines Vaters Brigadegeneral A. J. Montgomery
Es gibt keinen zweiten Regenwald: Eine Bestandsaufnahme zwanzig Jahre nach der Erstveröffentlichung
Von allen Büchern, die ich bis heute geschrieben habe – selbst zwanzig Jahren nach der Erstveröffentlichung –, liebe ich dieses Buch am meisten.
Ich hatte immer davon geträumt, den Amazonas zu erforschen. Als mir die Recherche zu diesem Buch schließlich die Gelegenheit gab, war die Erfahrung noch reicher, vielschichtiger, überraschender und glorreicher, als ich es mir erträumt hatte.
Manchmal wird das Schreiben eines Buches, das beim Forschen noch Spaß gemacht hatte, zur endlosen Qual. Nicht jedoch bei diesem Buch. Jeden Tag erwachte ich hungrig, um noch einmal das seidige Gefühl der Streicheleinheiten des schwarzen Wassers auf meiner Haut zu spüren, den Vanilleduft von Baumwipfel-Orchideen erneut zu riechen und das sinnliche Auf und Ab einer niedrigen, rosafarbenen Flosse, das Kribbeln in meinen Zähnen und Knochen, wenn ein rosafarbener Delfin mit Schallimpulsen wie Ultraschall in meinen Körper hineinsah, für meine Leser*innen neu zu erschaffen.
Trotz der vielen schönen Momente hat es mir jedoch auch das Herz gebrochen. Ich schrieb diese Seiten als Loblied auf ein unvergleichliches Paradies und als Bitte, es zu schützen. Zu meinem unermesslichen Leid ist das Amazonasgebiet heute, in den zwanzig Jahren seit der Veröffentlichung dieses Buches, noch schlimmer bedroht als zuvor.
Vor zwei Jahrzehnten stellte ich mit Bestürzung fest, dass der Amazonas brennt. Als ich 1987 zum ersten Mal einen Fuß in den geheiligten Dschungel setzte, überlebten 87,2 Prozent des Regenwaldes aus der Zeit von vor 1970. Und noch ehe ich meine Forschungen abgeschlossen hatte, waren ganze 34.188 Quadrathektar verbrannt – meist durch Brände, die von Bauern, Landspekulanten und Viehzüchtern gelegt wurden. In der Bibel heißt es, als Gott wollte, dass Moses die Israeliten aus Ägypten herausführte, brauchte es nur einen brennenden Busch, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Nun stand der größte Wald der Welt in Flammen! Wie konnten die Menschen da nicht aufhorchen?
Mittlerweile brennt der Amazonas nicht bloß. Er stirbt vielleicht.
Knapp achtzig Prozent des Amazonas-Regenwaldes sind noch erhalten. Jedes Jahr wird dem Dschungel durch Bergbau, Landwirtschaft und Viehzucht mehr Land gestohlen. Und das Tempo der Abholzung nimmt zu.
Im vergangenen Jahr, im Jahr 2019, stieg die Zerstörungsrate auf den höchsten Stand seit elf Jahren. In den zwölf Monaten bis Juli 2019 wurde ein Verlust von 9.762 Quadratkilometern verzeichnet. Es werden immer mehr Brände. Erstaunliche 74.000 Einzelbrände – ein Anstieg um 84 Prozent gegenüber dem Vorjahr – brannten allein im Monat August auf 125.000 Hektar. Satellitenanalysen zeigen, dass der größte Teil dieses Landes Anfang des Jahres absichtlich gerodet wurde, und zwar als direkte Folge der Politik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der sich für das Vorhaben einsetzte, den größten Regenwald der Welt für das Agrobusiness umzuwandeln. Die beispiellosen Feuersbrünste schwärzten den Himmel in São Paulo, fast dreitausend Meilen vom Regenwald entfernt. Sie zwangen den an Peru grenzenden Bundesstaat Acre, Umweltalarm und die Stadt Manaus, die Hauptstadt des Amazonas, den Ausnahmezustand auszurufen.
Wenn die Rodungen morgen aufhören würden, wenn man jetzt eingreifen würde, um dem globalen Klimawandel zu begegnen, würden Wissenschaftler*innen uns sagen, dass es Jahrhunderte dauert, bis sich der Regenwald vollständig erholt. Am beängstigendsten ist jedoch die Warnung der Forscher*innen, dass der Amazonas bald einen Kipppunkt erreichen könnte, von dem er sich überhaupt nicht mehr erholen kann. Wenn zu viel lebensspendender Wald verbrennt, wird der Wasserkreislauf irreversibel unterbrochen. Und der mächtigste Regenwald der Erde verkommt zu unfruchtbarem Gestrüpp.
Sollte es dazu kommen, sagen Expert*innen neben der offensichtlichen Tragödie des Verlustes der prächtigen Geschöpfe des Amazonas, darunter auch der rosa Delfin, eine weltweite Katastrophe voraus. Anstatt der Atmosphäre Kohlenstoff zu entziehen, würde der größte Regenwald verschwinden, der globale Klimawandel würde sich dramatisch beschleunigen, was wiederum zu massiven Dürren, Überschwemmungen und Waldbränden auf der ganzen Welt führen würde.
Ich schreibe diese Worte von zu Hause in New Hampshire, während unsere Welt eine weitere Krise durchlebt. Wie es scheint, wird die gesamte menschliche Bevölkerung durch den Griff eines neuartigen Coronavirus gelähmt. Führende Politiker*innen der Welt tun überrascht, dabei warnen Wissenschaftler*innen, Schriftsteller*innen und Filmemacher*innen seit Jahren vor einer bevorstehenden Pandemie, die durch ein auf den Menschen überspringendes Tiervirus verursacht wird. Eine neue Studie der Universität Stanford zeigt, dass die Zerstörung der Wälder in fragmentierte Flecken sehr wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass der Virus übergreifen konnte. Das ergibt Sinn. Schließlich dringen die Menschen zunehmend in die Lebensräume der Wildtiere ein. Tiere, die man ihrer natürlichen Heimat beraubt, werden in die Nähe des Menschen gezwungen. In Gebieten, in denen die Wälder fragmentiert sind, halten Menschen oft Wildtiere gefangen und essen ihre geschlachteten Kadaver. Die Zerstörung der Wälder lädt Krankheiten – wie Covid-19 und SARS, AIDS, Ebola und viele andere – dazu ein, über die Artengrenzen zu springen und Menschen zu infizieren.
Wenn wir die Zerstörung fortsetzen, ist unsere Zukunft Feuer, Flut und Pest. Ganz richtig: Das klingt wie eine Geschichte aus der Bibel – ein Buch, das wie diese Geschichte im Garten Eden beginnt.
Die rosa Delfine des belagerten Amazonas geben mir trotz allem noch immer Hoffnung. Geschichten von Delfinen, die Menschen helfen, werden seit Jahrtausenden überliefert. Sie haben Menschen vor dem Ertrinken gerettet und sie so einiges über das Leben gelehrt. Ich weiß, dass diese Geschichten wahr sind, denn ich habe es selbst erlebt: Wie eine Jüngerin folgte ich den rosa Delfinen und fand den Garten Eden, den ich suchte. Ich folgte ihnen durch die Zeit: rückwärts, in die Vergangenheit, in der ich eine erstaunliche Evolutionsgeschichte sah; und vorwärts, um einen Blick auf mögliche Zukünfte zu werfen – Zukünfte, die wir wählen oder ablehnen können.
Die rosa Delfine führten mich zu heiligen Geschichten, die die Einheimischen bis heute für wahr halten. Sie sagen, dass rosa Delfine Magie in sich bergen. Sie sagen, dass sie genau wie Menschen der Liebe fähig sind. Sie sagen uns, dass Delfine und Menschen tief miteinander verbunden sind. Und sie sagen, dass der Wandel real ist. Auch diese Geschichten sind wahr – genau wie das Versprechen, das sie uns geben: dass wir die Ganzheit unserer süßen, grünen Welt aufrechterhalten können, wenn wir die Verbindungen zwischen uns ehren.
Sy Montgomery
April 2020
Hancock, NH
Wie ich mein Herz an den Amazonas verlor: Einführung in die Ausgabe von 2008
Obwohl meine Arbeit normalerweise als wissenschaftlich eingestuft wird, handelt es sich bei diesem Buch, so wie bei all meinen Büchern, um eine Liebesgeschichte. Wobei die folgende Geschichte wohl das Leidenschaftlichste ist, was ich je geschrieben habe.
Ich habe mich in den Amazonas verliebt, lange bevor ich auch nur einen Fuß nach Südamerika setzte. Als Kind träumte ich von den riesigen, unerforschten Wäldern und dem unbekannten Leben, das dort pulsiert. Mein Vater, ein Weltenbummler und Armeegeneral, erzählte mir damals Geschichten von listigen Jaguaren, Schwärmen lärmender Papageien, menschenfressenden Fischen und Schlangen, die einen mit Haut und Haar verschlingen. Als kleines Mädchen war ich fasziniert von den tierischen Kräften der Wildnis. Ich stellte mir elektrische Aale vor, so lang wie Limousinen, und leuchtend blaue Schmetterlinge mit Flügeln, größer als die der Vögel.
Weder mein Vater noch ich wussten damals von der Existenz der rosa Delfine, nur die wenigsten taten dies. Sicher, die Einheimischen kannten sie und auch die Wissenschaft hatte ihre Art erfasst, doch für die meisten Menschen schienen rosa Delfine genauso unmöglich wie rosafarbene Elefanten. Mal ehrlich: rosa Delfine? Wer glaubt denn so etwas? Wobei ich als Kind sicher keine allzu großen Schwierigkeiten gehabt hätte, mir einen rosa Delfin im Amazonas vorzustellen. Wenn es so etwas irgendwo auf der Welt geben könnte, dann im größten Dschungel der Welt. Meine junge Seele war wie besessen von seinen Wundern.
Ein Vierteljahrhundert später, acht Jahre nach dem Tod meines Vaters, unternahm ich schließlich meine erste Reise in den Regenwald. Ich konnte dem Anblick der schelmischen Flussbewohner einfach nicht widerstehen. Und so führte mein wissenschaftlicher Ansatz, die vielen ungeklärten Fragen um jene rosarote Walart zu beantworten, mich auf die Suche, von der diese Erzählung handeln soll.
Zunächst glaubte ich noch, ich könne ihnen im wörtlichen Sinne folgen, indem ich den Weg eines Tiers von Punkt A nach Punkt B zurückverfolgte. Doch die Delfine erwiesen sich als schwerer fassbar und zugleich aufschlussreicher, als ich vermutet hatte. Sie führten mich auf den Grund eines weit tieferen Geheimnisses: Sie führten mich ins nasse, pulsierende Zentrum der Welt meiner Träume.
Stück für Stück gewährten sie mir auf ihre aberwitzige Art Einblicke unter die Flussdecke. Rosa Delfine springen nicht wie Meeresdelfine aus dem Wasser empor; unter den dunklen Gewässern des Amazonas bleiben sie so gut wie unsichtbar. Doch selbst ungesehen lockten sie mich, neckten mich, verspotteten, frustrierten und verführten mich.
Ich konnte nicht anders, als mich Hals über Kopf in sie zu verlieben. Ich hatte dies kommen sehen; all die mir bekannten Legenden berichten von der transformativen Kraft und den Verführungskünsten des rosa Delfins. Was folgt, ist die Geschichte meiner Verführung. Und ich fürchte, auch Sie werden sich seinem Charme nicht entziehen können. Drum seien Sie auf eins gefasst: Die Zwillingsschwester der Liebe ist die Angst, der Geliebte könne verletzt oder einem für immer genommen werden. Auch darum geht es in diesem Buch. Der Amazonas und seine rosa Delfine sind heute noch größeren Bedrohungen ausgesetzt als jenen, denen ich damals begegnete, als ich Ende des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal den Weg auf mich nahm.
In den acht Jahren seit der ersten Veröffentlichung dieses Buches hat eine Reihe von weltweiten Ereignissen den Naturschutznotstand im Amazonasgebiet auf herzzerreißende Weise herbeigeführt. Ein Fünftel des gesamten Gebietes ist bereits zerstört.
In Brasilien, inmitten dessen Grenzen der größte Teil des Amazonas verläuft, wurde zwischen Mai 2000 und August 2005 eine Rekordfläche von 50.950 Quadratmeilen Wald gefällt – eine Fläche, die noch größer ist als Griechenland. Der schrumpfende Amazonas muss zunehmend auf die Anforderungen der Agrarindustrie umgestellt werden, was wiederum den drohenden globalen Klimawandel dramatisch beschleunigt.
Die Folgen des Klimawandels sind in Brasilien bereits erschreckend deutlich: Ein unerwarteter Hurrikan – der einzige, der jemals im Südatlantik gemeldet wurde – verwüstete im März 2004 die Ostküste. Eine beispiellose Dürre im Jahr 2005 ließ die Ernten schrumpfen, stoppte den Reiseverkehr und verbreitete Feuer und Krankheiten. Im Jahr 2007 folgte eine weitere Dürre. Sterbende Fische lagen keuchend in Trockenbecken, die einst Seen waren; Menschen erstickten am Rauch von Waldbränden; die Krankenhäuser waren voller Patienten, die an Cholera, Malaria und anderen Krankheiten litten, welche sich ausbreiten, wenn das Trinkwasser knapp, schmutzig und stagnierend wird.
Brasilien ist heute weltweit der viertgrößte Produzent der vornehmlichen Treibhausgase, die für den globalen Klimawandel verantwortlich sind. Drei Viertel davon entstehen durch das Verbrennen und Fällen von Bäumen. Ironischerweise wird heute ein Großteil des Amazonasgebietes abgeholzt, um Pflanzen für die Produktion von Biokraftstoffen anzubauen – ein Mittel zur Bekämpfung der globalen Erwärmung. Kein Wunder, dass die heilenden, treibhausgasabsorbierenden Kräfte des Amazonas immer schwächer werden, je mehr Bäume getötet werden.
Auch Peru leidet unter diesen Auswirkungen. Wie in Brasilien verteilt nun auch die peruanische Regierung Holz- und Ölkonzessionen wie Pfefferminzbonbons. Und die globale Gaskrise treibt die Ölgier nur noch weiter an; so sehr, dass sie mit der Gier nach Gold vergleichbar ist. Das Öl erzielt einen so enormen Preis, dass inzwischen kein Gebiet mehr vor der Exploration und Entnahme gefeit ist.
Obwohl die Menschen vor Ort teils jene neu geschaffenen Arbeitsplätze begrüßen, die das Öl mit sich bringt, könnten ihre Sorgen nicht größer sein: Umweltverschmutzung, übermäßiges Jagdverhalten, kultureller Verlust, sexuell übertragbare Krankheiten. Viele Naturschutzorganisationen arbeiteten hart daran, peruanischen Beamten bei der Ausarbeitung von Beschränkungen für Holz- und Ölgenehmigungen zu unterstützen. Doch diese Beschränkungen existieren nur auf dem Papier. Öl- und Holzfirmen verweigern die Verwaltung der Konzessionsgebiete und beschränken ihre Aktivitäten in keiner Weise auf die ihnen zugewiesenen Gebiete. Und auch von der peruanischen Regierung ist keine Durchsetzung ihrer Vorschriften zu erwarten.
Trotz alledem besteht Hoffnung: Brasilianische Politiker*innen, die lange Zeit davon ausgingen, dass Naturschutzprojekte in Wahrheit schlecht getarnte Verschwörungen des Westens seien, um in den Amazonas einzudringen, ihn zu erobern und seinen Reichtum zu stehlen, erwägen endlich die Möglichkeit, das Tempo, mit dem sie den Regenwald abtöten, zu reduzieren. Die Beweise für den vom Menschen verursachten Klimawandel sind nicht länger zu übersehen. Selbst der brasilianische Präsident ist mittlerweile alarmiert: Wenn „die Regenmaschine des Amazonas“ gestört wird, ist Brasiliens südlicher Brotkorb dem Untergang geweiht. Umweltschützer hierzulande und in Brasilien hoffen, dass sich die Naturschutzpolitik als Folge dieser Bedrohung ändern wird.
Die Politik Perus steht zwar nicht unter Überwachung, handelt jedoch um einiges vernünftiger. Hier gibt es zumindest Schutzgebiete – und ein Schutz auf dem Papier ist immer noch besser als gar kein Schutz. Laut einer 2007 veröffentlichten Studie der Abteilung für globale Ökologie der Carnegie-Institution sind Perus Schutzgebiete 18-mal wirksamer, wenn es um die Reduzierung der Entwaldung geht, als ungeschützte Gebiete. Im Bericht heißt es, dass die Entwaldungsrate in Peru dank der Schutzgebiete zu den niedrigsten aller tropischen Länder zählt. (Dennoch stellt jene Studie, die auf Satellitenerhebungen basiert, ebenfalls fest, dass zwischen 1999 und 2005 jährlich 249 Quadratmeilen Wald zerstört wurden, wobei jedes Jahr weitere 244 Quadratmeilen Wald beschädigt, aber nicht zerstört wurden.)
Im Jahr 2007 wurde das Gemeinschaftsreservat Tamshiyacu-Tahuayo in Peru, in dem ein Großteil der Erzählung in diesem Buch spielt, erheblich vergrößert, was zum Großteil auf die langjährige Arbeit des Regenwaldschutzfonds mit den örtlichen Gemeinden zurückzuführen ist. Ich unterstütze diese Arbeit, indem ich dem Vorstand des RCF beigetreten bin. Als meine Mutter starb, habe ich den Erlös aus dem Verkauf ihrer häuslichen Habseligkeiten der Organisation gespendet. Die Adresse von RCF sowie weiterer wichtiger Akteure im Amazonas-Schutzgebiet finden Sie auf der Rückseite dieses Buches.
Nicht alles ist verloren. Noch nicht. Ich liebe die Delfine und den Amazonas zu sehr, um aufzugeben. Die rosa Delfine geben mir eine besondere Hoffnung. Schließlich waren diese geschmeidigen Wale, wie alle Wale, einst schwerfällige Landtiere. Wie die Einheimischen des Amazonas berichten, kehren sie noch immer ab und an zurück an Land. Legenden besagen, dass sie dabei sogar manchmal die Gestalt von Menschen annehmen. Rosa Delfine sind der Beweis dafür, dass eine wundersame Wandlung möglich ist – vielleicht sogar für uns.
Sy Montgomery
26. April 2008
Hancock, NH
Das Abenteuer beginnt
Die Tage sind voller Wasser. Die Regenzeit hat die Fußballplätze, die Bananenhaine und die Maniokfelder überflutet, ja sogar ein paar Pfahlhäuser, die zu nahe am Ufer des Flusses stehen. Junge Bäume ragen kaum noch aus dem Wasser und Fische fliegen wie Vögel durch ihre Zweige. Auch bei den großen Bäumen reicht die Flut so hoch hinauf, dass man die Orchideen, die auf ihnen wachsen, und die Nester, die Papageien und Bambusratten sich in den Höhlen des Stammes eingerichtet haben, in Augenhöhe hat, wenn man im Kanu steht. Die Tank-Bromelien auf den weit gebreiteten Ästen sind kleine Seen für sich. Ihre Blätter formen Schalen, die das Wasser halten. Über fünfhundert verschiedene Arten von Lebewesen hat man in einer einzigen Bromelie gezählt. Sie sind eigene kleine Wasserwelten.
Jeder Tag bringt neue, überraschende Formen von Regen. Manchmal wütet ein Unwetter mit Blitz und Donner, bricht Äste, schleudert Tiere aus den Bäumen und verzieht sich dann wieder. »Das ist ein männlicher Regen«, sagt Moises, unser einheimischer Guide. Ein Regen, der stundenlang anhält, an- und abschwillt und kein Ende nehmen will, so erklärt er, ist dagegen ein weiblicher Regen, »denn eine Frau kann einen ganzen Tag lang weinen«.
Und so, wie die Tage voller Wasser sind, sind die Nächte voller Geräusche. Es ist, als ob alles, was man am Tag sehen kann – Bäume, die mit Lianen verschleiert sind wie Bräute, Blätter von der Größe eines Paddels, Vogelnester, Ameisen- und Termitenbauten, die wie Geschwüre, wie Kröpfe oder wie Brüste an den Stämmen hängen –, nachts in Geräusche verwandelt würde. Aus den Bäumen, aus dem Boden, aus dem Wasser dringen Stimmen wie Glöckchen oder kleine Flöten: Triller, Schreie, Warnlaute, Klagetöne. Sie sprechen die Sprache des Wassers. In der Regenzeit klingt der Nachtruf des Sonnentauchers wie Wassertropfen, die in eine Blechtasse fallen. Eine Nachtschwalbe schreit den Namen des Flusses: »Ta-hua-yo! Ta-hua-yo!« Die Stimmen der Baumfrösche klingen wie Blasen, die im Wasser aufsteigen und durch die Oberfläche stoßen.
Der Fluss ist der Spiegel, der in eine andere Welt führt. Er ist glatt wie Glas und spiegelt am Tage Wald und Himmel in vollkommener Ruhe wider – und doch fließt er so schnell, dass die Strömung jeden, der sich ohne Schwimmweste hineinwagt, sofort auf den Grund zieht. Die Leute am Fluss erzählen von Encante, einer verzauberten Stadt unter Wasser, deren Bewohner und Bewohnerinnen sie encantados, die Verzauberten, nennen. Wer einmal dorthin kommt, will nicht wieder zurück. So schön ist Encante.
Nachts scheinen die Sterne im Wasser sogar noch heller als am Himmel. Oben leuchten die Sternbilder, unten ihre funkelnden Spiegelbilder und in den Bäumen die glühenden Augen von Wolfsspinnen, Schlangen und Baumfröschen. Im Kanu hat man das Gefühl, durch die zeitlose Sternenlandschaft des Weltraums zu gleiten.
Aber wenn man stehen bleibt und wartet, kommen die Encantados. Zuerst fühlt man nur kleine Blasen unter dem Boot aufsteigen wie Perlen an einem Zaubernetz, das von unten her ausgeworfen wurde. In mondlosen Nächten hört man nur den Atem. Aber bei Mondschein kann man sehen, wie sich etwas aus dem Wasser erhebt und die Gestalt eines Delfins annimmt. Vielleicht bricht direkt neben dem Kanu ein Gesicht aus dem Fluss, das einer anderen Welt angehört und trotzdem auf eine unheimliche Weise vertraut wirkt. Die Stirn ist klar umrissen, wie bei einem Menschen. Der lange Schnabel ragt heraus wie eine Nase. Die Haut ist zart wie unsere eigene. Manchmal ist sie weiß oder grau – und manchmal, erstaunlicherweise, auch rosa. Er wendet sich dir zu, schaut dich an und keucht: »Tschaaaaah!«
In Brasilien nennt man den rosa Delfin boto. Man erzählt sich, der Boto könne sich in einen Menschen verwandeln. Bei den dörflichen Festen verführe er Männer und Frauen. Man müsse vorsichtig sein, sonst werde man für immer nach Encante entführt, in die Märchenstadt unter Wasser. Die Schamanen sagen, schon allein sein Atem hätte Zauberkraft und könne vergiftete Pfeile abschießen. Sein wissenschaftlicher Name ist Inia geoffrensis. Er gilt als Vertreter einer sehr alten Art der Zahnwale – er ist ein Süßwasserdelfin, der in einer Zeitkapsel aus dem Miozän überlebt hat, aus einer Zeit, als riesenhafte Alligatoren, größer als der Tyrannosaurus Rex, im flachen Wasser lauerten, und mannsgroße, flugunfähige Raubvögel mit messerscharfen Klauen ihre Beute rissen.
Jeder, der einem Encantado begegnet, wird von seinem Zauber berührt. Sein Bewusstsein verändert sich, es hat Geisterstimmen und fremde Träume in sich aufgenommen und den heißen, wispernden Atem des Regens auf dem Fluss. Hier im Amazonasgebiet, wo die Begierden verzehrender und die Tragödien düsterer sind als anderswo, kann auch das Unmöglichste wahr werden.
Der Zusammenfluss
Manaus: Das Paris der Tropen
Mitten im größten Regenwald der Erde, tausend Meilen von der Küste entfernt, steht am Amazonas ein Opernhaus.
Jedes einzelne Teil davon ist per Schiff über den Atlantik gebracht worden. Das gusseiserne Gerippe kam aus Glasgow, der Marmor aus Verona und Carrara, das Zedernholz aus dem Libanon, die Seide aus China. Hundert Seekisten voll Mobiliar, fein geschnitzt und mit Samt gepolstert, wurden aus London herangeschafft. Nur das Holz der Parkettböden – Eiche, Brasilholz und Jakaranda, insgesamt 12.000 Teile – stammte aus Brasilien. Aber sogar das wurde in Europa bearbeitet und schließlich von portugiesischen Fachleuten verlegt, die man eigens herübergebracht hatte.
Die Innenwände wurden von Domenico de Angelis, dem berühmtesten italienischen Kirchenmaler, nach dem Vorbild europäischer Kirchen gestaltet. Auf den Deckenfresken sind die vier beteiligten Künste dargestellt, umgeben von Engeln und Putten: rechts von der Bühne der Tanz, links die Musik, hinten die Tragödie und vorne die höchste Kunst, die Oper, in der sich die anderen drei vereinigen. Ein Mosaik aus 36.000 glasierten Kacheln in Blau, Grün und Gold krönt die Kuppel. Das Gewölbe erhebt sich über einer klassizistischen Konstruktion mit geschwungenen Aufgängen und säulengetragenen Vorhallen. Mit seinen überreichen weißen Verzierungen erinnert das ganze Gebäude ein bisschen an eine Hochzeitstorte. Die Fassade ist rosa wie die Delfine der Gewässer, die dieser Stadt ihren unermesslichen Reichtum brachten.
Der Bau des Teatro Amazonas dauerte über 15 Jahre und kostete zwei Millionen Dollar. Bei seiner Eröffnung im Jahr 1896 wurde es als schönstes Opernhaus der Welt gerühmt. Man sagt, es sei eigens errichtet worden, um Enrico Caruso anzulocken. Aber er ist nie gekommen. Während man auf den großen Tenor hoffte, starben 16 Mitglieder der italienischen Operntruppe, die gerade in Manaus auftrat, bei einer Gelbfieberepidemie. Im Durchschnitt fielen jährlich etwa dreihundert Einwohner der Malaria zum Opfer. Auch Todesfälle durch Schlangenbisse waren nicht selten. Auf den Straßen ging es zu wie im Wilden Westen: Es war zwar verboten, mit Pistolen oder mit Pfeil und Bogen zu schießen, aber kaum jemand hielt sich daran.
Trotzdem strömten die Menschen ins Theater, festlich gekleidet, mit Diamanten geschmückt, und füllten die 1.600 Plätze des harfenförmigen Zuschauerraums. Mit der steigenden Autoproduktion wuchs der Bedarf an Reifen. Der milchige Saft des Gummibaums, den man dafür brauchte, wurde aus Tausenden Nebenflüssen nach Manaus geschafft und bescherte der Stadt einen sagenhaften Reichtum. Diamanten wurden eine Art Zweitwährung, mit der die Menschen nur so um sich warfen. Sie blitzten in der schwarzen Spitze der Fächer, manche Damen ließen sich die Zähne damit besetzen. Eine Kellnerin, die einem Gast eine Kleinigkeit servierte, konnte durchaus einmal einen Diamanten als Trinkgeld bekommen und eine erstklassige Kurtisane durfte ein Brillantcollier als Bezahlung erwarten. Die Preise in Manaus waren viermal so hoch wie in New York, und trotzdem tränkten die Kautschukbarone ihre Pferde mit französischem Champagner und ließen sich Armaturen aus purem Gold in die Bäder einbauen. Es gab Damen, die ihre Wäsche in Portugal waschen ließen.
Die Kehrseite der Medaille war, dass diejenigen, die den Kautschuk sammelten und verarbeiteten, die Ureinwohner des Amazonas, versklavt und in Ketten gehalten wurden. Die viertausend Tonnen Gummi, die der Kautschukbaron Julio César Arana in zwölf Jahren verschiffte, brachten ihm in London siebeneinhalb Millionen Dollar ein und kosteten dreißigtausend Menschen der indigenen Bevölkerung das Leben. »Tatsache ist«, schreibt der Historiker Richard Collier in seinem Buch The River That God Forgot, »dass die Kautschukbarone ihre reiche, verruchte Stadt auf den Leichen der Ureinwohner errichteten – und die Exzesse ihrer Lebensweise lassen ahnen, dass ihnen das auch bewusst war.«
So strömten sie in ihr Opernhaus wie Büßer in die Kirche, um unter den Engeln zu sitzen, umgeben von den Namen der größten europäischen Künstler. Auf den 22 Marmorsäulen zwischen den Logen sind Masken der griechischen Tragödie angebracht, und die dazugehörigen Schriftbänder tragen die Namen von Goethe, Rossini, Molière, Shakespeare, Mozart, Wagner, Beethoven, Lessing, Verdi …
Die Masken blicken auf den Amazonas, wie er in den schwärmerischen Vorstellungen der Europäer aussah. Blickfang im Opernhaus ist das Gemälde auf dem Bühnenvorhang, das den Titel Der Zusammenfluss trägt. Es stammt von Crispim do Amaral, einem Brasilianer, der in Paris lebte und Bühnenbildner an der Comédie-Française war. Die hellhäutige, nackte Göttin Amazonas ruht lässig auf einem weichen Lager. Sie lehnt sich zurück, ein Knie gebeugt, als wolle sie die Schenkel öffnen für die zwei bärtigen Flussgötter zu ihren Seiten, den Solimões und den Negro. Die beiden umspielen sie wie Delfine und bringen ihr Blumengirlanden. Ihre Wasser sind so blau wie die Donau im Lied.
Der wirkliche Zusammenfluss ist etwa zehn Kilometer von Manaus entfernt, und die Fluten sind durchaus nicht einheitlich blau, sondern sehr unterschiedlich. Der Solimões (wie der Amazonas in seinem Mittellauf auch genannt wird) ist rahmfarben, der Rio Negro kaffeebraun. Die gegensätzlichen Flüsse vereinigen sich hier, um die restlichen 1.600 Kilometer bis zum Meer unter dem Namen Amazonas zurückzulegen. Das dunkle Wasser des Negro stammt aus dem seit Jahrmillionen ausgelaugten brasilianischen Hochland; es kann organische Chemikalien nicht auflösen und enthält daher Säuren. Für die Färbung sind Tannine verantwortlich. In diesem Wasser gibt es kaum Leben. Das schlammige Wasser des Amazonas dagegen verdankt seine helle Farbe dem nahrhaften Schlick, den seine Quellflüsse in großen Mengen aus den geologisch jungen Anden mitbringen. Es wimmelt darin von Piranhas und Zitteraalen und sonstigem Wassergetier. Die rosa Delfine jagen gern an diesem Zusammenfluss, weil die Fische, verwirrt durch die plötzliche Änderung der Bedingungen, hier leichte Beute sind.
Wegen ihrer verschiedenen physikalischen Dichte vermischen sich die Flüsse nicht sofort, sondern laufen etwa sechs Kilometer lang nebeneinander her wie Liebende, die nicht zusammenkommen können. So geben sie kein schlechtes Symbol ab für das Leben im Amazonasgebiet, für den Zusammenprall verschiedener Historien und gegensätzlicher Wesensarten, für das Nebeneinander von Schönheit und Grausamkeit, Leidenschaft und Verzweiflung, Leben und Tod.
Morgen werde ich an diesem Zusammenfluss übernachten, auf dem Boden einer Hütte, die auf Balken schwimmt und an einem Baum festgebunden ist. Heute aber blicke ich über eine rote Samtbrüstung, auf Augenhöhe mit einem französischen Kronleuchter aus Gold und Kristall, in Gesellschaft von Mozart und Molière, den Musen des Tanzes und der Tragödie, und leider auch von Moskitos, die sich an meinen Knöcheln laben.
Der Bühnenvorhang ist hochgezogen; man sieht nur mehr den unteren Teil des Gemäldes. Die Wasser des Amazonas scheinen sich über den Saum ins Publikum zu ergießen. Das Orchester stimmt sich ein. Die Pauke klingt wie ein Donner.
Donner war es auch, der mich in meiner ersten Nacht in Brasilien weckte. Der Lärm war so stark, dass ich ihn in allen Knochen schmerzhaft spürte. Blitze zuckten grell durchs Zimmer. Der Regen tobte gegen Dach und Mauern wie ein rasender Dämon aus dem Dschungel. Ich brachte es nicht fertig, aufzustehen und aus dem Fenster zu schauen; die Gewalt des Regens lähmte mich förmlich.
Meine Freundin und Fotografin Dianne Taylor-Snow lag im Bett neben mir. Ich sah die Glut ihrer Zigarette in der Dunkelheit und hörte, wie sie sagte: »Wir sind hier nicht in Kansas, Sy.«
Dianne war wie immer schon seit Stunden wach. Dass sie mit extrem wenig Schlaf auskommt, ist nur eins ihrer vielen Talente. Sie kann vom Heck eines Bootes aus ins Wasser pinkeln und auf Indonesisch fluchen.
Vor fünf Jahren hatten wir gemeinsam in Bangladesch unsere ersten rosa Delfine gesehen. Wir waren per Boot in den schlammigen Gewässern von Sundarbans unterwegs, um nach Tigern Ausschau zu halten. In diesem größten Mangrovensumpf der Welt gibt es eine Menge Tiger, doch wir bekamen keinen zu Gesicht.
Eines Tages öffnete sich das braune, undurchsichtige Wasser für einen Augenblick und drei graurosa Wesen tauchten auf, glitzerten in der Sonne und verschwanden wieder. Verwundert starrten wir ihnen nach; sie erschienen noch einmal, seidig glänzend, und glitten dann endgültig zurück in die Tiefe. Erst dann wurde mir klar, was wir da gesehen hatten: Delfine!
Immer, wenn ich Delfine sehe, spüre ich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit – als sähe ich mein eigenes Spiegelbild im Wasser. Ich habe schon in vielen Meeren und in manchem Aquarium Delfine gesehen, aber ihr Anblick überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Äußerlich sind sie Fischen ähnlicher als Säugetieren, sie leben in einer Welt, die uns Landbewohnern gänzlich fremd ist. Und dennoch scheint es eine geheimnisvolle Verwandtschaft zwischen ihnen und uns zu geben. Der Verhaltensforscher John Lilly, der sich auch mit der Kommunikation zwischen Menschen und Delfinen befasst hatte, nennt sie »Meeresmenschen«.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Delfine in so trübem Wasser wie in Sundarbans leben könnten. Aber dann erinnerte ich mich, dass sie zwar sehen können, sich aber hauptsächlich mithilfe eines außerordentlich feinen Sonarsystems zurechtfinden.
Sekunden nur, und sie waren wieder verschwunden. Ihr Bild blieb mir jedoch lange in Erinnerung; für mich kam es einer Verheißung gleich.
Ich reiste noch drei weitere Male nach Sundarbans. Und obwohl ich dabei jedes Mal Delfine sah, überraschten sie mich stets so sehr, dass ich nur flüchtige Blicke auf einen Hinterkopf oder eine Rückenflosse erhaschen konnte. In der Fachliteratur fand ich kaum etwas über Süßwasserdelfine. Es gibt weltweit fünf Arten davon, über keine von ihnen weiß man wirklich viel.
Die Flussdelfine ließen mich nicht mehr los. Zu Hause in New Hampshire schwammen sie verführerisch durch meine Träume. Jahre später, bei einer Tagung über Meeressäuger, traf ich einen Mann, der mir den Grund dafür nannte. Er sagte, rosa Delfine würden die Seele gefangen nehmen.
Er erzählte mir außerdem, dass im Amazonasgebiet eine andere Art rosa Delfin vorkommt, die den Namen Inia geoffrensis trägt (Inia ist die Bezeichnung der Guarayos für »Delfin«). Benannt ist sie nach Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, der den Portugiesen ein paar Exemplare stahl und sie Napoleon mitbrachte. Diese Delfine sind lebhafter und auch zahlreicher als die von Sundarbans, aber genauso rätselhaft.
Auf dieser Tagung waren ein paar Forscherinnen und Forscher anwesend, die sich mit den Delfinen befassten, doch ihre Ergebnisse waren mager. Meist wussten sie nicht einmal, wie viele Delfine sich in ihrem Untersuchungsgebiet aufhielten, welche sozialen Strukturen es in den Gruppen gab und ob sie sich immer in derselben Gegend aufhielten oder wanderten. Genauso wenig wussten sie, warum die Delfine rosa sind. Die meisten Fachleute gaben sogar zu, dass sie auch nach langjähriger Forschung die einzelnen Tiere nicht auseinanderhalten konnten.
Für die Leute, die am Fluss leben, ist dies keine Überraschung. Sie behaupten, dass die rosa Delfine ihre Gestalt verändern können. Sie würden sich einzelner Seelen bemächtigen und die Menschen in ihre verzauberte Welt am Grund des Flusses mitnehmen.
Die rosa Flussdelfine leben tatsächlich in einer Zauberwelt: dem Amazonasgebiet. Ich hatte mir schon immer gewünscht, eines Tages dort hinzureisen. Wie viele Mythen, wie viele magische Worte verbanden sich mit dieser Welt: El Dorado, das Goldland, ein weißer Fleck auf der Landkarte, ein legendäres Volk mutiger Kriegerinnen, ein unberührtes Paradies. Auch heute übt der Amazonas eine magische Anziehungskraft aus; er ist das Ziel vieler Sehnsüchte.
Ich erkannte auf jener Tagung, was mein nächstes Ziel sein würde: Ich würde den Delfinen folgen. Dianne war begeistert und schloss sich mir an.
Und so hat es uns beide in diese unwirkliche Stadt verschlagen, dieses Paris im Dschungel, wo das Wasser nicht nur im Fluss strömt, sondern auch Himmel und Erde überschwemmt. Am Zusammenfluss von Rio Negro und Solimões, so hatte man uns gesagt, würden wir Delfine finden. Und wir hatten keine Ahnung, wohin sie uns führen würden.
Nach diesem ersten Unwetter in Brasilien wussten wir jedoch eines mit Sicherheit: Wo auch immer uns die Reise hinführen würde, es würde dort nass sein.
Dianne hatte wie üblich ihre Ausrüstung im ganzen Zimmer verstreut. Es sah aus wie ein Warenlager: hier ein kleiner Föhn mit Adapter; dort eine Hängematte, die zusammengerollt nicht größer war als eine Grapefruit; ein aufblasbares Reisekissen (aus Diannes Zeit als Stewardess); vier Toilettentaschen mit Lippenstiften und Wimpernzange, Augenbrauenstift und ähnlichem Kram aus ihrer Zeit als Model; Babyflaschen und Milchpulver für den Fall, dass wir verwaiste Tierbabys fanden (das stammte aus der Zeit, als sie in einer Auswilderungsstation für Orang-Utans arbeitete); luftdicht verschweißte Päckchen mit Rosinen, Erdnüssen und Gatorade-Pulver; Pillen gegen Würmer in den inneren Organen; ein beheizbarer Lockenstab; eine chirurgische Ausrüstung mit Skalpellen und Einwegspritzen; ein Wasserfilter (für vierhundert Dollar!), der Viren aussortiert; Taschenmesser und Feuerzeuge als Geschenke für die Dorfbewohner; ein Gerät, mit dem man Schlangenbisse aussaugen konnte – und Opernkleidung.
Ich wickelte mich in meinen feuchten Poncho und schlief wieder ein. Der Regen folgte mir bis in meine Träume.
Am Morgen war das Unwetter in einen normalen Regen übergegangen, dessen Tröpfeln, Spritzen und Platschen sich mit den Autohupen und den Trillerpfeifen der Polizisten mischte. Auf den nassen Straßen von Manaus glitten die Autos dahin wie Kanus. Es hatte durchs Hoteldach geregnet und man versuchte, die Pfützen in der Halle mit alten Badematten aufzuwischen. Der Pool auf dem Dach war übergelaufen.
Wir saßen im Restaurant des Hotels Monaco im zwölften Stock und schauten hinunter auf die glänzende Kuppel des Teatro Amazonas, auf das viktorianische Zollgebäude und diese genialen Schwimmdocks – von britischen Ingenieuren gebaut –, die bis zu zehn Meter steigen können, wenn der Rio Negro anschwillt.
Der Plan, ein »Paris der Tropen« zu schaffen, stammte von Eduardo Gonçalves Ribeiro, einem Ingenieur, der schon mit dreißig Jahren Gouverneur des ungeheuren Staates Amazônia wurde. »Ich kam in ein Dorf«, so rühmte er sich später, »und habe eine moderne Stadt daraus gemacht.« So klein seine Statur auch gewesen sein mag, so groß war seine Begierde: nach Gold, Frauen und Ruhm. Noch vor der Amtsübernahme entwarf er schon Pläne für das Projekt, das ihm besonders am Herzen lag: das Opernhaus. Es trägt seinen Namen in mannshohen Lettern auf seiner rosa Fassade.
Er erhob eine zwanzigprozentige Steuer auf allen Kautschuk, der die Stadt verließ, legte dreißig Meter breite Straßen an, ließ sie mit Kopfsteinen aus Portugal pflastern und mit Bäumen aus Australien und China säumen. Er verpflichtete keinen Geringeren als Gustave Eiffel für den Entwurf einer Markthalle, die wie die Pariser Hallen aussehen sollte, und eines Justizpalasts, der dem Schloss von Versailles gleicht. Manaus bekam den elektrischen Strom früher als London und ein Telefonsystem früher als Rio de Janeiro. Während New York und Boston sich noch mit der Pferdebahn begnügten, genoss man in Manaus den Luxus einer elektrischen Straßenbahn, die rund um die Uhr verkehrte. Wie wir so von der Höhe des Dachrestaurants auf die Stadt hinunterschauten, bevölkerten wir sie in der Fantasie mit eleganten Damen in Seidenkleidern und extravaganten Hüten.
Als wir schließlich hinabstiegen, fanden wir stattdessen jedoch Frauen in engen Polyesterkleidern, mit grellbunten, billigen Plastikspangen im Haar. Was wir zunächst für die Aufmachung von Prostituierten hielten, stellte sich sehr bald als normale Alltagskleidung heraus. Ganz gleich ob in der Bank, in der wir Geld wechselten, im supermercado