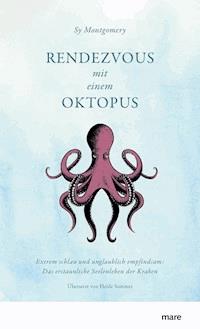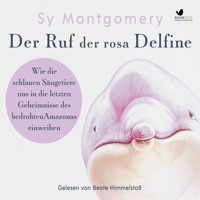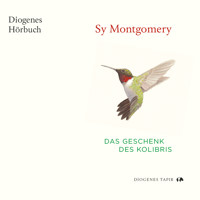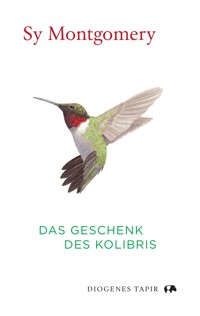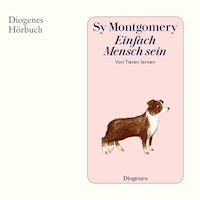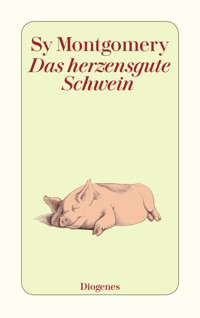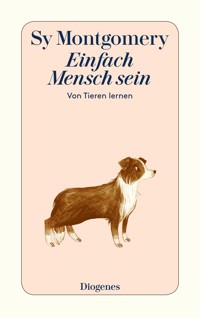22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Sie wurden ausgesetzt oder von Trucks überfahren – und heißen nun »Pizza Man«, »Fire Chief« oder »Snowball«. Zu Hunderten haben sie Zuflucht gefunden in einem Haus in Massachusetts. In diesem Refugium für Schildkröten tritt Sy Montgomery einen Freiwilligendienst an – und lässt uns an einer lebensverändernden Erfahrung teilhaben: Wenn wir unsere Existenz mit den Augen dieser uralten, gemächlichen und langlebigen Wesen betrachten, bekommen wir eine Ahnung von dem, was uns überdauern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sy Montgomery
Tête-à-Tête mit einer Schildkröte
Was die Urwesen uns zu sagen haben
Aus dem amerikanischen Englisch von Stefanie Schäfer Mit Illustrationen von Matt Patterson
Diogenes
Manche Orts- und Personennamen wurden geändert, um die Eiablageplätze der Schildkröten zu schützen.
Für Dr. A.B. Millmossin ewiger Liebe
Die Natur eilt nicht;dennoch ist alles vollkommen.
Laotse
1.Panzerknacker
Pizza Man, eine Köhlerschildkröte
Zwischen den typischen Vorstadthäusern, die die Straße säumen – weiß, beige, grau, hellblau, hellgelb –, sticht eines heraus, das ganz anders aussieht: ein »Saltbox« genanntes asymmetrisches Gebäude im Stil der Kolonialzeit, bei dem eine Hälfte zwei- und die andere einstöckig ist und das Dach sich auf einer Seite lang und schwungvoll hinunterzieht. Als wäre das nicht ungewöhnlich genug, ist es außerdem leuchtend neongrün gestrichen, eine Extravaganz, die vom grell-violetten Schuppen auf der Rückseite noch getoppt wird. Vor dem Haus warnt ein Schild »Turtle Lover Parking Only. Violators Better Shut the Shell Up«. Wer mit Schildkröten nichts am Hut hat, sollte sich also besser fernhalten.
In der Einfahrt parken ein weißer Smart und ein schwarzer Toyota Scion. Beide haben ein Blaulicht auf dem Dach, wie Rettungsfahrzeuge – und genau das sind sie auch, wie man am Logo der Turtle Rescue League und den Aufklebern mit der Aufforderung »Bremst für Schildkröten auf der Straße – helft ihnen rüber!« erkennen kann.
Mein Freund, der Tierillustrator und -plastiker MattPatterson, und ich steigen die Treppe zur Holzterrasse hinauf und klopfen an die Tür. Dabei werden wir von einer Videokamera beobachtet – nur eine von mehreren Sicherheitsmaßnahmen, denn selbst kranke oder verletzte Schildkröten sind auf dem Schwarzmarkt so wertvoll, dass für die Patienten hier die Gefahr der Entführung besteht. Alexxia Bell, die Vorsitzende der Turtle Rescue League, lässt uns herein. Sie ist sechsundvierzig, schlank, groß und schick angezogen wie für eine Party: schwarzglänzendes, schulterfreies Langarmtop zu hellblauen Samtjeans. Im Haus müssen Matt und ich vorsichtig über eine kniehohe Holzbarrikade steigen, um das Wohnzimmer betreten zu können.
Und schon begrüßt uns auch schon der Grund für die Absperrung. Pizza Man, ein zwanzig Jahre altes, neun Kilo schweres Köhlerschildkrötenmännchen mit hochgewölbtem schwarz-gelbem Rücken und blassgelbem Bauchpanzer oder Plastron, kommt zielstrebig wie eine Rakete in Zeitlupe auf uns zu. Auf hohen, säulenartigen Beinen, mit Stelzengang und leise auf den Holzboden klopfenden Krallen schreitet er entschlossen durch den Raum. Fünf Zentimeter vor meinen Füßen bleibt er stehen. Ruckartig wendet er den Kopf mit dem schrumpeligen Hals nach rechts, hält eine Sekunde lang inne, schwingt den Kopf abrupt wieder in die Mitte und dann nach links. Anschließend dreht er ihn wieder in die Mitte und starrt hinauf in mein Gesicht.
Eine so temperamentvolle Reaktion seitens einer Schildkröte mag überraschen. Obwohl die meisten Menschen Schildkröten mögen, haben viele, sogar in der biologischen Fachwelt, diese Reptilien bis vor wenigen Jahren für kaum schlauer als ein Zierkiesel gehalten. Tatsächlich sind die Gehirne von Schildkröten im Vergleich zu ihren teils kolossalen Körpern (den Rekord hält eine Lederschildkröte, die mit einer Panzerlänge von 256 Zentimetern und einem Gewicht von 916 Kilogramm in Wales an den Strand gespült wurde) bemerkenswert klein, was als Zeichen für eine geringe Intelligenz gewertet wurde. »Schildkröten brauchen keine Intelligenz«, behauptete der Feldbiologe AlexNetherton in einem Online-Forum, »also verschwenden sie keine Energie dafür.« Da Schildkröten bekanntlich langsam sind und viel Zeit in absoluter Starre verbringen, kann man wirklich leicht den Eindruck gewinnen, dass sie nicht viel denken, fühlen oder wissen – oder überhaupt irgendetwas tun.
Doch Pizza Man reagiert eindeutig auf mich. Es ist, als würde er mich begrüßen.
»Diese Schildkröte ist aufmerksamkeitssüchtig«, erklärt Alexxia. Ich beuge mich hinunter, um den weichen, ausgestreckten Hals und den Kopf des Tieres zu streicheln, und bewundere die roten Flecken auf seinen Wangen, seiner Nase und rings um seine ausdrucksvollen dunklen Augen. Dann marschiert Pizza Man weiter, um Matt Hallo zu sagen. Auf ihn reagiert er womöglich noch überschwänglicher. Selbst jetzt, im Februar hier oben in Neuengland, trägt Matt wie üblich Flip-Flops und sein typisches Stirnband mit Schildkrötenmuster, und Pizza Man stellt sich direkt auf Matts warme Zehen, während er ihn willkommen heißt.
Der begeisterte Empfang von Pizza Man ist ein Pluspunkt für uns. Matt, der trotz seiner erst achtunddreißig Jahre bereits ein renommierter Naturkunde-Künstler ist, und ich sind zwei Stunden von NewHampshire aus, wo wir wohnen, hierher nach Southbridge, Massachusetts, gefahren, um einen Gefallen zu erbitten. Seit dem letzten Sommer, als wir anfingen, Freunden beim Schutz eines Nistplatzes für fünf Arten von Neuengland-Schildkröten zu helfen, sind wir immer tiefer in die Welt dieser beliebten, aber wenig bekannten Reptilien hineingezogen worden. Letztes Jahr nahmen wir hier bei der Liga an einem Schildkröten-Gipfel teil, einem Symposium für Schildkröten-Retterinnen und -Retter. Wir waren davon so überwältigt, als wären wir nach Lourdes gepilgert.
Alexxia hatte ein Dia von einer ihrer Patientinnen gezeigt, einer Schnappschildkröte. Das gesamte erste Drittel ihres Panzers war zertrümmert, drei ihrer Beine waren zerschmettert, ein Auge fehlte; stundenlang hatte sie am Rand der Straße gelegen, wo sie angefahren worden war, mitten in der prallen Sonne. Zwei Jahre später war sie geheilt und wurde wieder ausgewildert. »Verletzungen, die für andere Tiere tödlich wären, kann eine Schildkröte durchaus überleben«, hatte Alexxia dem Publikum erklärt. »Solange die inneren Organe der Schildkröte nicht über die ganze Straße verteilt sind, kann man sie vielleicht noch retten. Wir geben keine Schildkröte auf, ehe wir nicht alles versucht haben.«
Und nun sind wir also wieder hier. Wir wollen an diesem Wunder teilhaben. Wir sind gekommen, weil wir fragen wollen, ob wir im Frühling, wenn die Schildkrötenwanderung beginnt, als Freiwillige in der Klinik der Liga mithelfen dürfen, geschundene Kreaturen zu heilen.
Alexxia hebt Pizza Man hoch und küsst ihn auf den Kopf. »Ich werde von Schildkröten nicht krank«, betont sie. Obwohl alle gesunden Schildkröten das Salmonellenbakterium in sich tragen – ein Grund, warum der Verkauf von Jungtieren vieler Arten verboten wurde –, sagt Alexxia, sie würde sich eher anstecken, wenn sie ein Kind küsst. »Ich bin siebenunddreißig Grad warm«, erklärt sie, »und er ist ein Reptil.« Man sieht, dass Pizza Man an Alexxias Küsse gewöhnt ist; obwohl er gerade von einem sechsmal so großen Säugetier in die Luft gehoben wurde, zieht er seinen Kopf bei ihrer Berührung nicht ein, sondern streckt ihn aus.
»Pizza Man will immer in meiner Nähe sein«, erzählt Alexxia. Unter den mehr als 150 Schildkröten, die derzeit hier leben – Schildkröten, die sich von einer Krankheit oder Verletzung erholen, Schildkröten, die von ihren ehemaligen Besitzern abgegeben wurden und auf ein neues Zuhause warten, Jungtiere, die zu spät oder zu klein geschlüpft sind und im Frühjahr freigelassen werden, Schildkröten, die missgebildet geboren wurden oder dauerhaft behindert sind und für immer hier leben werden –, ist Pizza Man, der aus dem Keller eines Drogendealers gerettet wurde, einer der ganz wenigen, die Alexxia als Haustiere hält. Schon in den Anfängen hat das Schildkröten-Rettungsteam beschlossen, sich in der Regel nicht zu eng an die Tiere zu binden, da die meisten von ihnen entweder freigelassen werden oder – im Falle der nicht einheimischen Schildkröten, die draußen nicht überleben könnten – in ein gutes Zuhause vermittelt werden. Aber Pizza Man ist eine Ausnahme.
Die andere ist Sprockets, eine fast vierzehn Kilo schwere burmesische Bergschildkröte. Mit zwölf Jahren hat er nicht einmal ein Drittel seiner endgültigen Größe erreicht, und wenn alles gut geht, kann er hundert Jahre alt werden. Mit seinem dunklen, kantigen Kopf und dem markanten Schnabel stapft er auf Beinen, die so schuppig sind wie ein Monterey-Kiefernzapfen, aus dem Badezimmer im ersten Stock. Im selben Moment kommt die vierundvierzigjährige Natasha Nowick in einem grünen Polohemd mit dem TRL-Logo und passenden grünen Strähnen im kinnlangen dunklen Haar aus dem Büro im Obergeschoss herunter.
Es ist kein Zufall, dass Sprockets auftaucht, als Natasha, die Mitbegründerin der Liga, den Raum betritt. Sprockets ist Natasha genauso zugetan wie Pizza Man Alexxia. Sprockets gehört zu einer Spezies, die in Myanmar, Malaysia, Thailand und Sumatra beheimatet ist. Er wurde an einem Septembertag vor fünf Jahren gefunden, als er durch den Park neben dem Worcester Polytechnic Institute streifte. Er war ausgesetzt worden, und kurzzeitig wurde er von einigen Studierenden des Instituts aufgenommen. Einer von ihnen war Natashas jüngerer Bruder, und schließlich rief er Natasha und Alexxia an und bat sie, die Schildkröte abzuholen. »Er war schrecklich nervös«, erinnert sich Natasha. »Seine Atmung ging ganz zittrig, und anfangs hat er sich die ganze Zeit in einer Ecke versteckt.« Doch seitdem sich Sprockets bei der Liga eingelebt hat, schlummert er sanft und selig ein, wenn Natasha ihn auf den Schoß nimmt. Und schon bald nach seiner Ankunft, so erzählt sie uns, »begann er uns seine Lebensgeschichte zu erzählen, indem er Geräusche machte und mit dem Kopf wippte. Manchmal hat er zwanzig Minuten am Stück geredet.«
Die meisten Leute glauben, Schildkröten wären stumm, aber nein: Manche sind ziemlich gesprächig, und verschiedene Arten quaken, quietschen, rülpsen, pfeifen und wimmern. (Dem Gebell der Velociraptoren in Jurassic Park legte das Filmteam die Geräusche von Schildkröten beim Sex zugrunde.) Einige Arten australischer und südamerikanischer Flussschildkröten kommunizieren untereinander und mit ihren Müttern, während sie sich noch im Ei befinden.
Natasha beschreibt Sprockets’ Stimme als »eine Mischung aus Grunzen und einem Zischen und Blubbern, als ließe man Luft aus einem Ballon«. Inzwischen sei er nicht mehr so mitteilsam, erzählt sie: »Am Anfang war er wie ein Kindergartenkind, das ständig über seine Lieblingsthemen sprach«, sagt sie. »Jetzt ist er reifer und zurückhaltender.« Aber er wippt immer noch mit dem Kopf, wenn er aufgeregt ist, und das tut er auch jetzt, wie ein Zeichen für die große Aufregung, die unsere Ankunft in seinen Augen auslöst. »Er ist begeistert, eure Bekanntschaft zu machen«, interpretiert Natasha.
Schildkröten hätten ausgeprägte Persönlichkeiten und empfänden starke Emotionen, erklären Alexxia und Natasha. Aber weil ihnen die Gesichtsausdrücke von Säugetieren fehlten, sei es für Menschen schwierig, dies zu erkennen. Die Vorfahren von Menschen und Schildkröten trennten sich vor etwa 310 Millionen Jahren, noch bevor die Pflanzen gelernt hatten, sich durch Blüten fortzupflanzen, bevor sich Korallen und ihre mächtigen Riffe entwickelten und nicht lange nachdem unsere fischigen Vorfahren aus dem Wasser an Land gekrochen waren. Doch mithilfe von Aufmerksamkeit und Übung, Intuition und Einfühlungsvermögen könne man lernen, die manchmal subtilen, manchmal fremdartigen Signale der Schildkröten zu deuten.
»Wir lernen sie nach und nach kennen«, erzählt Alexxia. »Die Persönlichkeiten schälen sich langsam heraus. Es ist eine Kommunikation ohne Laute, aber sie funktioniert.«
Dies sei der Schlüssel zu ihrem außergewöhnlichen Erfolg, sagen die beiden Frauen. Sie haben inzwischen Tausende von Schildkröten gerettet und oft auch wieder ausgewildert, die sonst gestorben wären – darunter viele, die so schwer verletzt waren, dass selbst Tierärzte, die auf die Rettung von Wildtieren spezialisiert sind, sie eingeschläfert hätten.
Natasha und Alexxia haben über ein Jahrzehnt gebraucht, um an diesen Punkt zu gelangen. Die beiden lernten sich vor einundzwanzig Jahren in einem Modegeschäft kennen, in dem Natasha Managerin war und Alexxia sich für einen Job als Make-up-Artist beworben hatte. Obwohl sie in vielerlei Hinsicht gegensätzlich sind – Alexxia ist eine auffällige, extrovertierte Frau, die früher bis zum Morgengrauen in Bostoner Tanzclubs gefeiert hat, Natasha eine introvertierte Person, die Videospiele und Computer mag –, lieben sie beide Tiere. Eine von Alexxias frühesten Kindheitserinnerungen ist, wie ihr Vater einer Schnappschildkröte über die Straße half. Als Natasha klein war, nahm ihre Familie verwaiste und verletzte Wildtiere auf, darunter ein Waschbär, ein Murmeltier und eine Möwe.
An einem Frühlingstag fand das Paar dann unterwegs zu seiner Wandergruppe eine Schildkröte auf der Straße, die ganz zerquetscht war, aber noch lebte und offensichtlich Schmerzen hatte. Sie war eindeutig tödlich verwundet. Die Frauen kannten keine Tierarztpraxis, wo man dem Tier hätte helfen oder es hätte einschläfern können. In ihrer Hilflosigkeit legte Alexxia die Schildkröte mit dem Kopf voran unter den Reifen ihres Autos und überfuhr sie, um sie schnell zu töten, damit sie nicht leiden musste. Heute gilt diese Art der »mechanischen Euthanasie« übrigens als humane Option für Schildkröten, für die es keine Hoffnung auf Heilung gibt. Die beiden Frauen waren jedoch am Boden zerstört. Bis heute haben sie die schlimme Erfahrung nicht ganz verkraftet.
Am nächsten Tag sahen sie wieder eine Schildkröte. Sie war zwar unverletzt, hatte sich aber auf ein Kleeblatt-Autobahnkreuz verirrt und schwebte in Lebensgefahr. Die beiden Frauen lasen sie auf und ließen sie in einem Teich frei. »Wir fanden immer wieder Schildkröten«, erinnert sich Alexxia. »Eines Tages beschlossen wir, das Wandern aufzugeben und stattdessen aktiv nach Schildkröten zu suchen und ihnen beim Überqueren von Straßen zu helfen.«
Sie entwarfen Plakate und Flugblätter, auf denen sie andere aufforderten, ebenfalls den Tieren zu helfen. Doch immer wieder fanden sie Schildkröten, die von Autos angefahren, von Rasen- und Heumähern überfahren oder von Hunden angefressen worden waren. Manchmal waren die Tiere auch erkrankt, weil diejenigen, die sie als Haustiere gekauft oder der Natur entnommen hatten, sie vernachlässigt oder nicht richtig gepflegt hatten.
»Wenn wir so eine verletzte Schildkröte vor uns hatten«, erzählt Natasha, »wussten wir nicht, was wir mit ihr machen sollten. Wenn wir jede Schildkröte, die wir gefunden haben, in eine Wildtierklinik gebracht hätten, hätten wir die Leute dort hoffnungslos überfordert.« Sie erinnert uns daran, »dass es 2008 noch keine Smartphones gab und die meisten Internetrecherchen nicht hilfreich waren. Wir suchten verzweifelt nach Antworten, doch es gab sie nicht. Wie konnten wir die Lage der Schildkröten verbessern?«
»Damals konnten wir noch nicht einmal einen Panzer flicken«, sagt Alexxia. »Aber wir haben dazugelernt.«
Sie lernten von den Fachleuten der Tufts Wildlife Clinic. Sie lernten vom Direktor des Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary auf Cape Cod, das gefährdete Meeresschildkröten rettet. Sie lernten von der leitenden Tierärztin des New-England-Aquariums. Eine ihrer inspirierendsten Mentorinnen war eine Wildtierretterin, die sie bei einem Schildkröten-Intensivseminar in New Jersey kennenlernten. Während sie im New Yorker Zentrum für Schildkrötenrettung Tausende kranker Tiere behandelte, überstand Kathy Michell selbst eine Krebserkrankung, Multiple Sklerose und einen Krebsrückfall mit einer Überlebensprognose von sechs Monaten – woraus ein Jahr, dann zwei und schließlich fünf Jahre wurden. »Sie vermittelte uns Beharrlichkeit«, sagte Natasha. »Sie hat uns beigebracht, nicht aufzugeben.«
Die erste gerettete Schildkröte, die sie mit nach Hause nahmen, war eine erbärmlich unterernährte einjährige Schnappschildkröte, die sie Nibbles nannten. Alexxia entdeckte sie eingepfercht in einen Plastikschuhkarton mit einem halben Zentimeter schmutzigem Wasser bei einer Kundin und überredete die Besitzerin, sie abzugeben. Das Paar gab zweihundert Dollar in der nächsten Tierhandlung aus, damit sie das Tier artgerecht ernähren und unterbringen konnten. Schon bald darauf lebten Alexxia und Natasha mit fünfundsiebzig geretteten Schildkröten und einem halben Dutzend 120-Liter-Becken zusammengepfercht in einer 80 Quadratmeter großen Zweizimmerwohnung in Webster, Massachusetts. Die vielen Filter, Wärme- und Vollspektrumlampen, die ihre Schützlinge brauchten, überforderten das Stromnetz in der Wohnung, und sie mussten eine zusätzliche Leitung verlegen – zum Glück wusste Alexxia (die inzwischen ein eigenes Geschäft für die Reparatur von Haushaltsgeräten besitzt), wie man das macht. Wenn Freunde zu Besuch kamen, fragten sie: »Und wo wohnt ihr?« Sie schliefen unter einem Kajak, das sie für die Wasserrettung brauchten und an Seilen über dem Bett aufgehängt hatten.
»Anfangs haben wir nicht im Traum daran gedacht, eines Tages in so ein Haus zu ziehen«, erzählt Alexxia. (Sie hatten es sieben Jahre zuvor gekauft, laut Natasha »trostlos und runtergekommen«.) »Und eine Schildkrötenstation zu haben«, fährt Alexxia fort, »zwei Autos, einen Vorstand und Michaela …«
Die zierliche, blonde Michaela Conder, achtzehn Jahre alt, hat sich inzwischen zu uns gesellt. Wir sitzen auf Hockern rings um einen hohen Tisch, während Sprockets und Pizza Man unter unseren Füßen hindurchstapfen. Sie ist schüchtern und sagt nicht viel, aber ihre blauen Augen und ihr breites Lächeln strahlen Eifer und Energie aus. Sie ist die einzige weitere Angestellte bei der TRL und kümmert sich um die Kommunikation und den täglichen Betrieb der Schildkrötenauffangstation und der Klinik. Michaela kommt aus Kansas und lernte die Schildkrötenretterinnen kennen, als sie mit sechzehn zu Besuch bei ihrer Tante war, die in der Nähe wohnt. Um hier arbeiten zu können, ist sie zu ihrer Großmutter nach Rhode Island gezogen. »Wenn ich einer Schildkröte in die Augen schaue«, sagt sie, »kommt es mir fast so vor, als ob das ganze Universum in ihnen steckt. Sie verstehen und wissen so viel!« Michaela arbeitet nebenbei auch noch in einem Café, aber trotzdem fährt sie jede Woche anderthalb Stunden von ihrer Großmutter hierher, um neben ihrem bezahlten Job zusätzlich als Freiwillige für die Organisation zu arbeiten.
Sie wollte schon immer etwas Sinnvolles mit ihrem jungen Leben anfangen, wusste aber nicht genau, was, und schob deshalb ihr Collegestudium auf. Doch inzwischen hat sie ihre Berufung gefunden. »Das ist noch etwas, was mir die Schildkröten gegeben haben«, sagt sie, »einen Sinn im Leben. Die Schildkröten geben mir einen Grund, jeden Morgen aufzustehen.«
Matt und ich erkennen, dass die Pflege der Schildkröten für diese drei Menschen mehr ist als ein Job, mehr als eine gute Tat: Es ist ihnen eine Herzensangelegenheit. »Wenn ich die Schildkröten auf dem Behandlungstisch habe, bin ich froh, dass meine Körperteile nicht zu ihnen passen«, gibt Alexxia zu. »Nach ein, zwei Saisons hätte ich keine mehr. Mein Blut, meine Knochen – ich würde alles ihnen geben.«
Warum Schildkröten? Natasha und Alexxia haben in den letzten Jahren auch andere Tiere gerettet, von Eichhörnchen bis hin zu Salamandern (und sogar ein Stinktier, das sie unterwegs zu einer verletzten Schildkröte fanden; in ihrem kleinen Auto, mit noch einer Stunde Fahrt vor sich, versprühte es mit Hingabe sein stinkendes Sekret). Was ist das Besondere an Schildkröten?
Diese Frage beschäftigte mich schon seit Längerem, denn Schildkröten haben wirklich eine große Fangemeinde. In manchen Fällen ist das sogar wörtlich zu nehmen: Im New England Aquarium ist Myrtle, eine neunzig Jahre alte, 250 Kilo schwere Grüne Meeresschildkröte, die seit 1970 dort lebt, das bei Weitem beliebteste unter Zehntausenden von Tieren. Sie hat ihre eigene Facebook-Seite mit siebentausend Followern. Schildkröten sind die Helden von Geschichten, Comics und Filmen, von der Schildkröte in Äsops 2600 Jahre alter Fabel über die Teenage Mutant Ninjas bis hin zum weisen Crush und dem kleinen Squirt in Findet Nemo. Schildkröten sind beliebte Motive für Kunstwerke, Sammlerstücke und Spielzeug; es gibt in den USA sogar ein Turtle-Splash-Frühstücksmüsli, dem ein kostenloses Adoptionsset für Baby-Meeresschildkröten beiliegt.
Fast jeder hat schon einmal eine Schildkröte gesehen, und die meisten Leute in meinem Alter hatten irgendwann mal eine. In den 1950er, 60er und bis Mitte der 70er-Jahre gab es in jedem Billigladen in den Vereinigten Staaten wenige Zentimeter lange Baby-Rotwangen-Schildkröten zu kaufen, zusammen mit winzigen runden Terrarien mit einer spiralförmigen Rampe, die von einer Plastikpalme gekrönt wurde. Leider war das ein völlig ungeeignetes Habitat für die Tiere, die einen in Quadratkilometern gemessenen Lebensraum brauchen und fünfzig Jahre alt werden können. Und auch das Futter war falsch: Den meisten von uns wurden Ameiseneier als Futter verkauft, obwohl junge Rotwangenschildkröten eigentlich eine große Bandbreite von Insekten und wirbellosen Tieren sowie Gemüse und andere Pflanzen zum Fressen brauchen.
Aber es war kein Wunder, dass diese todgeweihten Schildkrötenbabys so beliebte Haustiere waren. Eine Baby-Schildkröte passt perfekt in eine Kinderhand. (Und auch anderswohin – deshalb bekamen einige Kinder Salmonellen und der Verkauf von Schildkröten, die weniger als zehn Zentimeter lang waren und damit in einen Kindermund passten, wurde in den USA1975 verboten). Im Gegensatz zu den meisten Reptilien haben Schildkröten keine Angst vor uns Menschen; sie beißen nur selten und laufen nicht davon, sondern bewegen sich so langsam, dass wir in Ruhe beobachten können, wie sie ihr »Haus« so niedlich mit sich herumtragen. Ich bin in Virginia, New York und New Jersey aufgewachsen, und damals hatte jedes Kind eine Schildkröte – oft mehrere hintereinander, weil die meisten schnell starben. (Meine Eltern ersetzten sie immer schnell, ehe ich es merkte.) Meine hießen alle Miz Yellow Eyes.
Ebenso wie ich hat auch Matt Schildkröten von klein auf geliebt. »Ich war mein ganzes Leben lang ein Schildkröten-Nerd«, erzählt er stolz. Zu seinen frühesten Erinnerungen gehört, wie er mit seinem Vater, der Biologielehrer war, in einem Ruderboot auf die Suche nach Schildkröten ging, als er drei Jahre alt war. Später bauten er und sein Vater eingezäunte Außengehege für Schildkröten, die sie fanden und mit nach Hause nahmen. »Damals war uns nicht bewusst, dass das nicht richtig war«, erklärt er, der heute natürlich weiß, dass es illegal ist, wild lebende Tiere einfach mitzunehmen. »Ich mochte sie einfach gerne und wollte sie in meiner Nähe haben, damit ich sie beobachten konnte.«
Diese jugendliche Huck-Finn-Attitüde hat er nie verloren, ebenso wenig wie seine Liebe zu Abenteuern in der Natur. Er ist selbst ein bisschen wild. Schon sein Äußeres verrät, dass es ihn nicht lange im Haus oder in einem Büro hält – und das ist schon immer so gewesen. Nach seinem Abschluss an der Kunsthochschule arbeitete er knapp zweieinhalb Jahre als Illustrator für Produktdesign in verschiedenen Unternehmen, »immer mit dem Blick aus dem Fenster und dem Wunsch, anderswo zu sein«. Eines der Unternehmen, für das er arbeitete, lag an einem Fluss, und so nahm er sein Kajak mit zur Arbeit, um in der Mittagspause angeln und nach Schildkröten Ausschau halten zu können. Sobald es ihm möglich war, kündigte er seine feste Arbeitsstelle, machte sich selbstständig und konzentrierte sich ausschließlich auf die künstlerische Darstellung von Wildtieren. Dabei schuf er derart realistische Bilder, dass ich beim Anblick eines Fotos von einem seiner Schildkrötengemälde, auf dem zufällig seine Hand am Rahmen zu sehen war, dachte, die Hand sei unecht und die Schildkröte sei lebendig.
Matt ist jederzeit bereit, in seinen Flip-Flops in einen Fluss, Bach oder Sumpf zu steigen. Überall, wo es Schildkröten gefällt, gefällt es auch Matt Patterson, und er würde jede Hürde überwinden und alles dafür tun, um sie zu beobachten, zu malen oder ihnen zu helfen.
Er hat schon sein Wissen über Schildkröten mit seinen Ringerqualitäten aus Collegezeiten kombiniert, um riesige Schnappschildkröten in sein Kanu zu hieven und sie aus nächster Nähe zu betrachten. Mit der Naturschutzorganisation Turtle Survival Alliance ist er in die Dornwald-Wüste Madagaskars gereist, um vom Aussterben bedrohte Strahlenschildkröten in freier Wildbahn zu beobachten. Er besucht Herpetologiekonferenzen und Fachmessen, bei denen Schildkröten im Mittelpunkt stehen und wo sich die Besuchenden zum Entsetzen seiner Frau oft gegenseitig fragen: »Und, wie viele Herpis hast du?« (»Das klingt wie ein ekliger Ausschlag!«, gruselte sie sich.)
Er hat seine Drei-Zehen-Dosenschildkröte Polly schon länger, als er seine Ehefrau Erin kennt. Erin ist Logopädin, und die beiden sind seit zehn Jahren verheiratet. Polly dagegen begleitet ihn schon seit vierundzwanzig Jahren. Matt hat insgesamt vier Schildkröten; die größte von ihnen ist Eddie, eine afrikanische Spornschildkröte, die er zuerst für ein Männchen hielt. Bisher wiegt sie nur neun Kilo, aber sie könnte bis zu 45 Kilo schwer und bis zu 150 Jahre alt werden. (Matt plant, für Eddie einen eigenen Stall zu bauen, und hat in seinem Testament Vorsorge für sie getroffen.)
Woher kommt diese Verbundenheit mit den Tieren? Einmal hat Matt seine Gefühle in einer E-Mail an seine Mutter ausgedrückt. Obwohl sie es geduldig ertrug, dass er Tiere aller Art zu Hause anschleppte – entwischte Schlangen, eine Schildkrötensammlung mit einst vierzehn Arten und auch einen zahmen Alligator –, schätzt sie, zu Matts großem Kummer, Schildkröten nicht so sehr wie er.
»Wusstest du«, schrieb ihr Matt mit messianischem Eifer, »dass die ersten Tiere, die den Mond umkreisten, Schildkröten waren?« (Es handelte sich um ein Paar namenloser Steppenschildkröten an Bord der sowjetischen Raumsonde Zond 5 im September 1968.) »Wusstest du, dass manche Arten über 200 Jahre alt werden? Schildkröten gibt es seit der Entstehung der ersten Dinosaurier vor über 250 Millionen Jahren; sie kamen noch vor den ersten Krokodilen. Im Gegensatz zu uns«, erklärte er, »sind Schildkröten extrem wichtig für die Artenvielfalt auf der Erde! Manche von ihnen, etwa Schnappschildkröten, sind die Geier der Teiche, Seen und Flüsse, wo sie tote und verwesende Tiere und Pflanzen fressen. Gopherschildkröten gelten als Schlüsselarten«, fuhr er fort und wies darauf hin, dass das Überleben von über 360 anderen Tierarten von dieser einen Schildkrötenart und ihren Höhlen abhängt. Auch andere Schildkrötenarten sind für ihr Ökosystem unverzichtbar: Echte Karettschildkröten schützen Korallenriffe, indem sie Schwämme fressen, und andere Meeresschildkröten fressen Quallen, womit sie eine Überpopulation verhindern.
Und so fuhr Matt fort und füllte eine ganze Seite mit einzeiliger Schrift. »Deshalb liebe ich Schildkröten«, schloss er, »und deshalb will ich mit meiner Arbeit dazu beitragen, sie zu schützen.«
Viele dieser Gründe inspirieren auch Alexxias, Natashas und meine eigene Liebe zu Schildkröten, und da sie uns so vertraut sind, wissen wir ihre Fremdartigkeit zu schätzen. Schildkröten sind ungewöhnliche, überraschende Tiere. Die mehr als 350 Schildkrötenarten, die auf sechs Kontinenten beheimatet sind, verfügen über atemberaubende Talente. Eines davon ist natürlich ihre Langlebigkeit: Eine Schildkröte, die vor Kurzem im Alter von 288 Jahren gestorben ist, lebte schon, als George Washington geboren wurde, als Häuser noch mit Kerzen beleuchtet wurden, die Medizin hauptsächlich aus Einläufen und Aderlässen bestand und Geisteskrankheiten mit Pulver aus Elchhufen behandelt wurden. Eine andere Schildkröte bekam im Alter von 140 Jahren ein Junges. Manche können einen See oder Teich aus einer Entfernung von anderthalb Kilometern wahrnehmen; andere durchziehen ganze Ozeane, um genau den Strand zu finden, an dem sie vor Jahrzehnten geschlüpft sind. Einige atmen durch ihren Hintern, andere pinkeln durch den Mund. Einige bleiben unter eisbedeckten Gewässern aktiv, andere klettern auf Zäune und Bäume. Manche sind rot, andere gelb und wieder andere wechseln einmal im Jahr auf dramatische Weise ihre Farbe. Es gibt Schildkröten mit weichen Panzern, Schildkröten, deren Hälse länger sind als ihre Körper, Schildkröten, deren Köpfe so groß sind, dass sie sie nicht einziehen können, und Schildkröten, deren Panzer im Dunkeln leuchten. Einige Schildkröten könnten uns sogar helfen, Krebs zu heilen. Der Asiatische Maiapfel, aus dem der Wirkstoff Etoposid gewonnen wird, welcher zur Behandlung von Lungen- und Hodenkrebs eingesetzt wird, wurde fast bis zur Ausrottung abgeerntet. Die Wurzeln des Amerikanischen Maiapfels bieten einen wirksamen Ersatz, obwohl die Samen der Pflanze extrem schwer zu vermehren sind – es sei denn, sie werden von Dosenschildkröten aufgenommen und ausgeschieden.
Alexxia bewundert die Schildkröten und ihre Talente, findet sie aber auch rasend komisch. »Sie sehen richtig doof aus«, sagt Alexxia. »Nehmen wir an, wir würden ein Tier entwerfen, das fast dreihundert Millionen Jahre überdauert. Da würden wir doch keine Schildkröten mit hübschen Panzern konstruieren. Wir würden ein Wesen mit mächtigen Kiefern und einem riesigen Gehirn designen, und keines, das nicht allein aufstehen kann, wenn es auf dem Rücken liegt.«
Natasha räumt ein, dass »viele Leute es für völlig plemplem halten, dass wir so viel Zeit, Geld und Energie in Schildkröten investieren«. Zwar mögen die meisten Leute Schildkröten, und viele lieben sie sogar. »Aber wie oft ist schon bei einer Veranstaltung jemand zu unserem Stand gekommen und hat gefragt: ›Sagt mal, welchen Zweck haben Schildkröten eigentlich?‹«
Alexxia ist frustriert, wenn die Leute fragen, welchen Nutzen Schildkröten haben. »Sie müssen uns gar nichts nützen!«, stößt sie mit verhaltener Wut hervor. »Die Frage ist: Was nützen wir ihnen?«
»Warum Schildkröten? Warum Kunst?«, fragt Natasha. »Warum Kinder bekommen? Warum überhaupt irgendwas?«
»Sie waren zuerst da!«, beharrt Alexxia. »Sie sind Leben, sie gehören zum Ökosystem, und sie sind es wert, gerettet zu werden!«
»Wir haben hier ein Tier, das schon mit den Dinosauriern umhergezogen ist«, erklärt Natasha. »Die Erde hat sich erwärmt und abgekühlt, erwärmt und abgekühlt, und die Schildkröten sind immer noch da. Aber wir vernichten sie. Warum sollten wir nicht von dem Wunsch getrieben sein, sie und ihre Umwelt zu erhalten?«
Auch für Alexxia ist die Sache ganz einfach: »Schildkröten brauchen mehr Hilfe als alle anderen Tiere«, sagt sie. Und sie hat recht: Schildkröten sind die am stärksten gefährdete Gattung der Erde. Ebenso wie andere Wildtierpopulationen schrumpft auch die der Schildkröten, wenn Häuser, Straßen und Geschäfte ihren Lebensraum einengen. Sie leiden unter Umweltverschmutzung, Klimawandel und invasiven Arten. Sie werden von Autos überfahren. Hunde, Waschbären, Stinktiere und Otter verletzen sie. Und zu allem Überfluss existiert ein mörderischer, monströser illegaler Handel mit Schildkröten – mit ihrem Fleisch, ihren Eiern, ihren Panzern und mit ihnen als Haustier. »Es ist immer eine gute Sache, Tieren zu helfen, egal welchen«, erklärte Alexxia dem Publikum, das sich im Jahr zuvor zum Schildkrötengipfel versammelt hatte. »Ein Streifenhörnchen zu retten, ist eine gute Sache. Aber wenn man eine Schildkröte rettet, besonders eine weibliche, kann sie vielleicht noch hundert Jahre lang Eier legen. Mit jeder Schildkröte, die man rettet«, präzisierte sie, »rettet man mehrere Generationen.«
»Und hier«, sagt sie zu Matt und mir, »kommen wir also ins Spiel. Wir haben uns Schildkröten ausgesucht, um die Welt zu verbessern.«
»Könnten wir vielleicht mitmachen?«, frage ich schüchtern.
»Klar«, sagt sie und Natasha nickt zustimmend. »Kommt, ich zeige euch den Keller.«
2.Auf der Suche nach der Schildkrötenzeit
Percy, eine 100 Jahre alte Drei-Zehen-Dosenschildkröte
Als wir in den Keller hinuntersteigen, betreten wir eine andere Welt. Schwüle, 23 Grad warme Luft schlägt uns entgegen, erfüllt vom Geruch Hunderter Schildkröten und Zehntausender Liter Aquarienwasser, der an einen warmen, grünen Tümpel im Sommer erinnert.
Unten an der Treppe angekommen, sehen wir als Erstes den Operationssaal: makellose Untersuchungs- und Operationstische aus Aluminium, starke Scheinwerfer und eine Lupenbrille, ein Doppler-Ultraschallgerät, das den Blutfluss durch das Herz und die Blutgefäße messen kann, Ablageflächen für chirurgische Instrumente, Verbandsmaterial, Tierarzneimittel und Spritzen, Waagen zum Wiegen der großen und kleinen Schildkröten, Tafeln, auf denen die für die verschiedenen Patienten vorgesehenen Medikamente und Eingriffe aufgelistet sind, ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank zur Lagerung von Lebensmitteln und Medikamenten, eine Waschmaschine und ein Trockner, übereinanderstehend, Körbe voller sauberer, gefalteter Handtücher, ein tiefes Doppelwaschbecken.
Aber natürlich sind wir am meisten auf die Schildkröten gespannt.
Als wir um eine Ecke biegen, erhebt Alexxia die Stimme, um das Summen der Pumpen und Filter zu übertönen: »Das ist Sergeant Pockets«, erklärt sie. Sergeant Pockets liegt unter einer Wärmelampe neben der Rampe, die zu seinem 200-Liter-Becken führt, und hat seinen langen, faltigen Hals ausgestreckt. Ihm fehlen die roten »Wangen«-Flecken, nach der seine Art benannt ist, und er hat eine außergewöhnlich dunkle Farbe. Noch nie habe ich eine so große Rotwangen-Schmuckschildkröte gesehen! Sein fast schwarzer Panzer misst 25 Zentimeter – enorm für ein Männchen (die Weibchen werden größer). »Er ist über fünfzig Jahre alt«, erklärt Natasha. Er wurde zu Ehren eines Polizisten benannt, der dabei half, den Lebensmittelmarkt endgültig zu schließen, in dem die große Schildkröte für 3,47 Dollar pro Pfund zum Verkauf angeboten wurde. »Er war sehr krank«, erzählt Alexxia. »Er hatte eine Lungenentzündung und eine stoffwechselbedingte Knochenerkrankung und konnte seine Hinterbeine nicht benutzen. Er gehört zu einer bei uns nicht heimischen Art« – Schmuckschildkröten leben im Süden und in der Mitte der USA, nicht in Neuengland –, »und er ist ein mürrischer Typ. Man kann ihn nicht auswildern, deshalb behalten wir ihn bei uns.«
Auf den Regalen neben, über und unter dem Sergeant befinden sich die Gehege für die Dosenschildkröten, die einer waldigen Umgebung nachempfunden sind, und die Wasserbecken mit Rampen für fünf weitere große Rotwangen-Schmuckschildkröten. Natasha stellt uns jedes einzelne Tier mit Namen vor: Razz, Walnut, Acorn, Speedy, Cherry, Sammy, Willow, Cottonwood … »Diese sind in gute Hände abzugeben«, erklärt sie. »Wenn wir niemand Geeigneten finden, bleiben sie für immer bei uns.«
In einem anderen Regal, gegenüber von Sergeant Pockets, lebt ein weiteres besonders Exemplar. In einem geräumigen Terrarium mit Torfmoos-Substrat, Plastikpflanzen (echte Pflanzen würden nicht lange überleben), mehreren Unterschlüpfen und einem Planschbecken sitzt Percy, der einen außergewöhnlich glatten, gewölbten Panzer und stechend rote Augen hat. Er ist eine Drei-Zehen-Dosenschildkröte und mindestens hundert Jahre alt. Dr. Barbara Bonner, eine für ihre Schildkröten-Rettungsaktionen verehrte Tierärztin, entdeckte ihn in einer Zoohandlung in Massachusetts. Er war sehr krank, weil er auf einer von Wasser umgebenen Betonplatte lebte – völlig unpassend für eine Waldschildkröte. Alexxia hebt Percy aus seinem Gehege und setzt ihn auf den Betonboden. Zu unserem Erstaunen rennt Percy wie ein Aufziehspielzeug sofort auf Michaela zu. Als sie spielerisch zurückweicht, kann sie kaum mit dem heranstürmenden Hundertjährigen mithalten.
»Schau mal, er jagt dich!«, scherzt Natasha. »Er ist mit seinen über Hundert eine bemerkenswert alte Schildkröte. Und nachdem er sich erholt hat, nutzt er sein gutes Leben hier aus, um zu zeigen, dass er hier der Chef ist. Er ist immer noch in seinen besten Jahren!«
Christopher Raxworthy, stellvertretender Kurator für Herpetologie am American Museum of Natural History, würde ihr zustimmen. »Schildkröten sterben in der Regel nicht an Altersschwäche«, hat er einmal einem Reporter erklärt. Die wichtigsten Organe einer hundert Jahre alten Schildkröte seien nicht von denen eines jugendlichen Exemplars derselben Art zu unterscheiden. Es scheint fast so, als besäßen Schildkröten die Fähigkeit, die Zeit anzuhalten. Ihr Herz kann für lange Zeit aufhören zu schlagen, ohne Schaden zu nehmen. Bei Arten, die Winterschlaf halten (bei Reptilien nennt man das Kälte- oder Winterstarre), können die Tiere monatelang im Schlamm oder in der Erde vergraben überleben, ohne einen Atemzug zu tun. Wenn es nicht zu Infektionen oder Verletzungen käme, so der Kurator, könnten Schildkröten möglicherweise ewig leben.
Doch in einem Lebensraum, der von Menschen und ihren Maschinen beherrscht wird, gibt es fast kein Entkommen vor Traumata. Das beweist die Schildkröte, die wir als Nächstes kennenlernen: Snowball, eine weibliche Schnappschildkröte, die an die fünf Kilo wiegt und eine große, tropfenförmige Narbe im vorderen Drittel ihres Panzers aufweist. Sie sitzt so reglos in ihrem kleinen, flachen Becken, dass sie wie tot aussieht. Ihr Kopf ist deutlich nach rechts geneigt. Sie wurde vor drei Jahren im Sommer eingeliefert. »Sie wurde von einem Auto angefahren und mitgeschleift. Ein anderes Rettungsteam hat sie zu uns gebracht, weil sie nicht wussten, wie sie ihr helfen sollten«, erzählt Alexxia. Einer ihrer Hinterfüße war so stark verstümmelt, dass die meisten Tierärzt:innen ihn amputiert hätten. Alexxia entfernte drei Zehen, säuberte die Wunden, versorgte das Tier mit Flüssigkeit, reparierte seinen Panzer und bekämpfte seine Infektion mit Antibiotikaspritzen. Sie fütterte Snowball, indem sie einen Schlauch in ihren Hals und ihren Magen einführte.
Doch nur die Zeit kann eventuell irgendwann ihre Kopfverletzung heilen. »Snowball hat neurologische Probleme; manchmal fällt sie einfach um.« Eines Nachts, nachdem sie seit sechs Monaten in der Obhut der Liga war, kippte Snowball im Wasser um und ertrank. »Ich habe mit dem Dopplerultraschall ihren Herzschlag überprüft, hörte aber nichts«, erinnert sich Alexxia. »Also war sie tot. Was hatte ich zu verlieren? Ich nahm sie raus, führte einen Schlauch in ihre Lunge ein und beatmete sie. Und dann, auf einmal, hörte ich einen Piepton auf dem Doppler! Ich fand ihren Herzschlag wieder. Also dachte ich: ›Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ich diese Schildkröte nicht durchkriege!‹«
Ein paar Stunden später öffnete Snowball die Augen. Später am Tag zeigte sie schwache Bewegungen in ihren Zehen.
»Es hat drei Monate gedauert, bis sie wieder in dem Zustand wie vor dem Ertrinken war«, sagt Alexxia. »Geistig hat sie sich inzwischen zu etwa vierzig Prozent erholt.«
»Ich glaube, sie macht Fortschritte«, meint Natasha.
»Vielleicht ein halbes Prozent pro Monat«, antwortet Alexxia. »Wie ein Bummelzug, der eine lange Steigung hinaufkriecht.«
In dem Becken neben Snowball sitzt Chutney, eine etwas kleinere, aber ebenfalls beeindruckende männliche Schnappschildkröte, die im Frühjahr vor zwei Jahren mit einem ähnlichen Problem wie Snowball eingeliefert wurde. Das Auto, das ihn angefahren hatte, verletzte seinen Rückenpanzer, brach ihm den Kiefer und verursachte eine Gehirnerschütterung. »Er hat sich die ganze Zeit herumgewälzt«, seufzt Alexxia. Er rollte sich in seiner Pflegebox immer wieder auf den Rücken, und weil Schnappschildkröten mit dem Kopf und dem Hals gegen den Boden drücken, um sich wieder aufzurichten, musste Alexxia jedes Mal seinen gebrochenen Kiefer wieder richten. »Jede andere Klinik hätte ihn eingeschläfert«, seufzt Alexxia. Fälle wie Chutney gelten als aussichtslos.
Alexxia und Natasha versuchten, ihn mit Klebeband zu fixieren, damit er sich nicht drehen konnte. Doch das Klebeband hielt nicht. Sie versuchten, den Panzer zu beschweren, doch sie durften nicht zu viel Druck auf die Wunde ausüben. Sie mussten eine andere Lösung finden. Schließlich kamen sie auf eine geniale Idee: Sie schoben die Schnappschildkröte in eine Tupperware-Kanne, die gerade breit genug war, damit er hineinpasste. »Der Griff diente als Ständer, damit er nicht wegrollen konnte«, erklärt Natasha. Und weil die Kanne durchsichtig war, konnte Chutney trotzdem etwas sehen; hätte die Erde aufgehört, sich zu drehen, hätte er es gemerkt. Sie nannten ihre Erfindung Chutney Tube, und sie hielt ihn vier Monate lang aufrecht und sicher – bis er sie nicht mehr brauchte. Eines Tages, vielleicht schon in diesem Frühjahr, wird Chutney freigelassen werden.
»Ein Schädel-Hirn-Trauma heilt wieder«, sagt Natasha. »Aber es dauert lange.«
Für eine Schildkröte dauert alles sehr lange.
Sie leben langsam. Sie atmen langsam. (In kaltem Wasser kann eine Oliv-Bastardschildkröte sieben Stunden lang die Luft anhalten.) Ihre Herzen schlagen langsam. (Das Herz einer Rotwangenschildkröte kann sich auf einen Schlag pro Minute herunterregulieren.) Bei dem Schildkrötengipfel erfuhren wir zu unserem Erstaunen, wie langsam die Patienten hier auch auf Medikamente reagieren. Viele Schmerzmittel sind nutzlos, denn eines, das bei einem Säugetier innerhalb von Sekunden oder Minuten wirkt, braucht bei einer Schildkröte Stunden oder sogar Tage, um ihr zu helfen.
Schildkröten sterben auch langsam – so langsam, dass The Turtle Hub, eine Website, die Schildkrötenbesitzer über die richtige Pflege berät, ein Video mit dem Titel »Woran du erkennst, dass deine Schildkröte tot ist« veröffentlicht hat. Der Körper von Schildkröten unterscheidet sich so sehr von unserem, dass wir den Unterschied zwischen Leben und Tod nicht nach Säugetiermaßstäben beurteilen können: In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1957 wird berichtet, dass das Herz einer Alligator-Schnappschildkröte, die von einem College-Studenten in Mariana, Florida, gefangen wurde, noch fünf Tage lang weiterschlug, nachdem die Schildkröte enthauptet worden war. In Laborexperimenten wurde festgestellt, dass die Gehirne von Schnappschildkröten manchmal noch tagelang weiterarbeiten, selbst wenn sie keinen Sauerstoff mehr erhalten. Aus diesem Grund erklären Alexxia und Natasha von der Turtle Rescue League eine Schildkröte erst dann für tot, wenn die Leichenstarre einsetzt und/oder sie Verwesungsgeruch wahrnehmen. Bis dahin gibt es dank der erstaunlichen Heilkräfte der Schildkröten immer noch Hoffnung. »Wir geben keine Schildkröte auf, niemals«, wiederholt Alexxia.
Zwar besitzen Schildkröten erstaunliche Heilkräfte, aber sie benötigen lange Erholungszeiten. »Es braucht Zeit, aber die können wir ihnen geben«, sagt Natasha. »Schildkröten haben ja nun mal viel Zeit.«
Der Faktor Zeit ist ein weiterer Grund, warum ich mich zu Schildkröten hingezogen fühle. Wie das Bewusstsein gehört auch die Zeit zu den vertrackteren Problemen der Philosophie; ein Rätsel, mit dem sich große Geister seit Jahrhunderten auseinandersetzen und das mich schon immer fasziniert hat. Ich habe die Zeit oft als Widersacher betrachtet. Als junge Journalistin, die für eine Zeitung mit fünf Ausgaben schrieb, arbeitete ich vierzehn Stunden am Tag und stand unter dem Druck, täglich fünf Abgabetermine einhalten zu müssen. In den fünfunddreißig Jahren danach, in denen ich als freiberufliche Autorin über Tiere schrieb, genoss ich meine abenteuerlichen Reisen und meine kreative Freiheit. Es gab Momente, in denen ich in Gesellschaft eines Falken, eines Schweins oder eines Tintenfischs das Gefühl hatte, der normalen Zeit entfliehen zu können. Auch Matt hat diese Erfahrung gemacht: »Wenn ich kreativ bin – Malen liebe ich besonders –, hat das fast etwas Meditatives. Ich gerate in einen Flow, und die Zeit verlangsamt sich. Genauso ist es, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Die Zeit vergeht langsamer, und ich denke an nichts anderes als an das, was ich gerade tue.«
Für mich ist diese Pause von der Uhr und dem Kalender immer zu kurz. Ich reise viel, und wenn ich für ein neues Werk recherchiere, auf Lesereise bin oder Vorträge halte, habe ich manchmal das Gefühl, als würde ich ständig aus dem Bett springen und quasi noch im Bademantel aus dem Hotel eilen, um ein Flugzeug zu erwischen. Wenn ich dann an meinem Buch oder einem Artikel arbeite, habe ich immer eine Deadline, die wie ein Damoklesschwert über meinem Kopf schwebt. In meinem glücklichen und beneidenswerten Erwachsenenleben blieben keine Wünsche offen außer einem: dass die Zeit langsamer verginge.
Stattdessen tat die Zeit das Gegenteil. »Als wir jung waren, kroch die Zeit nur so voran«, bemerkte einmal meine beste Freundin, die Schriftstellerin Elizabeth Marshall Thomas, geboren im Jahr 1931. Mir ging es genauso: Ich erinnere mich, dass ich als Kind das Gefühl hatte, dass Weihnachten, mein Geburtstag oder der Sommer so weit weg waren, dass ich sie womöglich niemals erleben würde; mit vierzehn waren die sweet sixteen in weiter Ferne, und als Teenager hatte ich das Gefühl, dass sich die Jahre bis zum Erwachsensein quälend lang hinzogen. »Aber wenn wir anfangen zu altern«, stellt Liz fest, »vergeht die Zeit wie im Flug.« In ihrem Buch Growing Old: Notes on Aging with Something Like Grace erklärt sie, warum: In den ersten zwei Jahrzehnten lernen wir laufen, sprechen, lesen, analysieren, schwimmen, Fahrrad und Auto fahren. Wir schließen die Highschool und vielleicht auch das College ab. Viele von uns heiraten und bekommen Kinder. In diesen zwanzig Jahren verzwölffachen wir unser Körpergewicht; wir verwandeln uns von einem hilflosen, bedürftigen Bündel in einen aufrechten und selbständigen Erwachsenen.
In ihren ersten beiden Lebensjahrzehnten, so schreibt Liz, »machte ich Dutzende, vielleicht Hunderte von wichtigen Erfahrungen, die mich verändert haben, in meinem Sein und meinem Handeln«. Ganz im Gegensatz zu den Jahrzehnten danach. In dieser Phase machen die Leute im Grunde alle das Gleiche: Sie arbeiten und gründen eine Familie. In den letzten zwanzig Jahren, schreibt Liz, sei für sie eine der wenigen Veränderungen, die sie zu den lebensverändernden Ereignissen zählt, ein neues Verständnis für die Verwendung des Kommas gewesen.
In dem Jahr, in dem ich sechzig wurde, spürte ich eine tiefgreifende Veränderung. Ich fühlte, dass ich bereit war, in eine neue Lebensphase einzutreten. »Altern bedeutet, sich eine neue Persönlichkeit zu schaffen«, sagt der Natur- und Reiseschriftsteller Edward Hoagland, ein Zeitgenosse meiner Freundin Liz, »genau so, wie man es in seiner Jugend getan hat.« Mit sechzig Jahren gehörte ich mit einem Mal zu den Älteren, und in dieser Rolle konnte ich nun ein Ziel verfolgen, das sich deutlich von jenen unterschied, die ich in den vorangegangenen zehn Jahren meines Erwachsenenlebens verfolgt hatte – eines, das definitiv moralisch verlockender ist: die Suche nach Weisheit. Und wer könnte mir besser zeigen, wie ich Weisheit erlangen und meinen Frieden mit der Zeit machen kann, als Schildkröten – uralte, gemächliche, langlebige Wesen, die als Ikonen der Gelassenheit und Ausdauer verehrt werden?
Das 450-Liter-Aquarium von Fire Chief steht in einer Ecke. »Er ist einer meiner Lieblinge«, sagt Alexxia. Sie hebt den Drahtdeckel über dem Aquarium an und lässt eine ganze ungeschälte Banane hineinfallen. Ein Kopf, der mir fast so dick und lang wie mein Oberschenkel vorkommt, ragt aus dem Wasser, als Fire Chief sich auf das Stück Obst stürzt, um es zu packen. Er verschlingt es wie ein Krokodil. Die riesige Schnappschildkröte sei wahrscheinlich sechzig bis achtzig Jahre alt, erzählt uns Alexxia. Bei ihrer Ankunft am 8. Oktober vor zwei Jahren wog sie 19 Kilo.
Fire Chief pflegte den Sommer in einem Teich neben der Feuerwache zu verbringen, und alle Feuerwehrleute kannten ihn. Wie viele Schildkröten bewohnte Fire Chief im Sommer einen Teich und nutzte einen anderen, um zu überwintern. Die Feuerwehrleute sahen ihn jedes Jahr im Frühling und im Herbst zwischen seinem Winterquartier und seinem Sommerteich hin und her wandern. Doch die beiden Teiche waren durch eine Hauptverkehrsstraße getrennt, und eines Tages wurde er auf dem Weg zu seinem Winterquartier von einem LKW angefahren.
»Wir erhielten eine Meldung über den Unfall, aber der Mann, der uns angerufen hatte, konnte nicht bei ihm bleiben«, erzählt Alexxia. Sie und Natasha machten sich eilig mit ihrem Kajak und Netzen auf den Weg. »Die komplette Feuerwehr kam uns entgegen, sie waren alle furchtbar besorgt.« Die verletzte Schildkröte hatte es inzwischen geschafft, zurück in den Teich an der Feuerwache zu krabbeln. Alexxia stieg ins Kajak und fand die Schildkröte erstaunlicherweise im einen Meter tiefen schlammigen Wasser. Aber Fire Chief sah sie kommen, tauchte unter und schwamm zu einer noch tieferen Stelle – also sprang Alexxia in den achtzehn Grad kalten Teich und kam mit der Riesenschnappschildkröte in ihren Armen wieder heraus.
Der Aufprall des Lastwagens hatte eine hässliche Wunde im Panzer hinterlassen, aber schlimmer noch: Fire Chiefs Wirbelsäule war gebrochen. Seine Hinterbeine waren gelähmt. Aber das ist eine der erstaunlichen Eigenschaften von Schildkröten: Ihr Nervengewebe kann nachwachsen und sich regenerieren, manchmal sogar, wenn das Rückenmark vollständig durchtrennt wurde. »Es kann drei Monate dauern«, sagt Alexxia. »Oder auch fünf Jahre. Aber es kann heilen.« Inzwischen scheint Fire Chief seine Hinterbeine zumindest wieder ein wenig bewegen zu können.
In der freien Natur könnte er so nicht überleben – jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt seiner Genesung. Aber Alexxia und Natasha haben schon gesehen, dass schlimmere Verletzungen vollständig verheilten. Im selben Jahr wie Fire Chief kam eine weitere große männliche Schnappschildkröte zu den beiden, von oben im Norden aus North Andover, an der Küste. Das Tier verbrachte den Sommer in einem Mühlenteich, der von belebten Straßen und Wohnkomplexen umgeben war. Vielleicht war es auf dem Rückweg von seinem Winterquartier oder auf der Suche nach einem Weibchen, als es von einer Stützmauer stürzte und auf hartem Asphalt aufschlug. Bis zu seiner Rettung hatte es mit eingerissenem Panzer und einem gebrochenen Schultergürtel so lange dagelegen, dass Fliegen in seinem Maul Eier gelegt hatten, aus denen schon Maden geschlüpft waren.
Alexxia und Natasha reinigten und versorgten das Maul der Schnappschildkröte, klebten ihren Panzer und richteten ihren Schultergürtel. Noch im selben Herbst ließen sie sie wieder frei.
Und dann war da noch Gill, benannt nach der Stadt in Massachusetts, aus der er stammte. Alexxia und Natasha trafen sich mit den Leuten, die die Schildkröte am Straßenrand gefunden hatten, in einem Cumberland Farms Convenience Store, wohin sie das riesige Schnappschildkrötenmännchen in ihrem Truck gebracht hatten. Alexxia schätzte, dass es an die 18 bis 22 Kilo wog. »Aber als ich ihn aufhob, war es, als würde ich einen großen Stein aufheben, der in Wirklichkeit aus Styropor bestand. Er wog nur sechs Kilo! Unter seinem Panzer war er nur noch Haut und Knochen.« Gill hatte eine verheilte Wunde am Panzer, aber seine Haut schälte sich stellenweise, und er roch, als wäre er tot. Seine Hinterbeine und sein Schwanz bewegten sich nicht.
Gill war in einem so schlechten Zustand, dass Alexxia und Natasha glaubten, es würde ihre bisherigen Kenntnisse übersteigen, ihn zu retten. Sie brachten ihn in die renommierte Tufts Wildlife Clinic, die zur Cummings School for Veterinary Medicine gehört. Dort empfahl man ihnen, das Tier einschläfern zu lassen. Doch die beiden Frauen beschlossen, Gill noch eine Chance zu geben.
Was war mit dieser Schnappschildkröte los? Warum häutete sie sich? Anhand der Narben an ihrem verheilenden Panzer reimte sich Alexxia ihre Geschichte zusammen: »Im Jahr zuvor«, erzählt sie, »war Gill von einem Auto angefahren worden. Er kroch über die Straße, fand einen Flecken Gras und blieb dort sitzen. Ein ganzes Jahr lang. Ohne Essen, ohne Wasser, ohne alles. Er schaffte es, den Winter zu überleben. Wenn eine Schildkröte hungert, bildet der Körper ihre Zellen nicht neu, sondern konserviert alles. Als Gill dann endlich Nahrung bekam, konnte sein Körper zwar wieder neue Zellen bilden« – daher wurde die abgestorbene Haut abgestoßen –, »aber bis dahin«, fährt Alexxia fort, »war seine Darmflora so durcheinander, dass er nicht viel Nahrung aufnehmen konnte. Also haben wir ihn mit natürlicher Kost gefüttert, mit ganzen Fischen zum Beispiel.«
Nach und nach konnte Gill seine Hinterbeine wieder bewegen, nahm zu, häutete sich nicht mehr und roch nicht mehr so übel. Zwei Jahre später rief Alexxia ihre Kollegen in Tufts an: »Könnt ihr euch noch an diese Schildkröte erinnern, die so gut wie tot war? Die lasse ich morgen frei.«
Es besteht also Hoffnung für Fire Chief, und es besteht auch Hoffnung für die beiden jungen, namenlosen Tropfenschildkröten, die letztes Jahr hergebracht wurden. Es sind wunderschöne kleine Tiere mit tiefschwarzen Panzern, die mit kleinen gelben Punkten übersät sind. Einst waren sie im gesamten Nordosten der USA verbreitet, doch inzwischen stehen sie auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten, da die Hälfte ihrer Population innerhalb einer einzigen Schildkröten-Lebensspanne verschwunden ist. Eines der beiden Weibchen hat einen Riss im Panzer und ein Problem mit einem Hinterbein; das andere ist »kognitiv blind«. Die Augen sehen ganz normal aus, aber als sie letztes Jahr nach einer mehrwöchigen Reha-Maßnahme freigelassen werden sollte, stellte sich heraus, dass das nicht möglich war. Natasha erzählt: »Wir saßen mit der Schildkröte am Ufer des Feuchtgebiets, und sie starrte vor sich hin, aber ohne etwas von ihrer Umgebung wahrzunehmen. Also stapften wir wieder zurück durch den Wald und fuhren nach Hause. Aber das«, so betont sie, »muss nicht heißen, dass sie nicht doch irgendwann wieder ausgewildert werden kann.«
Nova ist ebenfalls blind. Sie sitzt im flachen Wasser ihres Aquariums und macht einen trägen Eindruck. Sie ist hier geschlüpft, aus den Eiern einer Mutter, die in einem verschmutzten Teich lebte. Zusätzlich zur Blindheit, die auf einen Hirnschaden zurückzuführen ist, beträgt ihr Tag-Nacht-Zyklus laut Natasha und Alexxia mittlerweile eine Woche. Ihre Schlafenszeit verbringt sie auf dem Rücken liegend in ihrer trockenen Krankenkiste. Heute tritt sie wieder ihre einwöchige Schlafphase an. Alexxia holt sie aus dem Wasser. Die Schildkröte zappelt; ihre Hinterbeine rudern durch die Luft, und mit den Vorderfüßen fährt sie in Richtung ihrer Augen. Doch dann dreht Alexxia sie geschickt auf den Rücken, legt sie in ihre warme, trockene Krankenkiste und platziert ein Plüschschildkröten-Stofftier auf ihre flache Bauchschale, den Plastron. Zu unserem Erstaunen entspannt sich die Schildkröte augenblicklich. Sie lebt nun schon seit sieben Jahren hier. Es sieht nicht danach aus, dass sie sich irgendwann erholen wird. Aber selbst wenn nicht, kann sie hier für den Rest ihrer Tage geschützt und angenehm leben.
»In diesem Frühjahr wollen wir versuchen, Fire Chief mit Physiotherapie zu mobilisieren«, erzählt Natasha. Seitlich neben dem Haus befindet sich ein großer, eingezäunter Schildkrötengarten, wo er unter Aufsicht seine Hinterbeine trainieren kann.
Aber zunächst einmal wartet er ab – was Schildkröten gut können. Die wild lebenden Schildkröten in Neuengland verbringen den Winter, indem sie sich im Schlamm der Teiche vergraben oder sich in Löchern verstecken, ihr Herz und ihre Atmung verlangsamen und auf das Frühlingserwachen warten.
Auch bei der Turtle Rescue League geht es im Winter bei der Arbeit mit diesen langsamen Reptilien ruhiger zu. Alexxia und Natasha lassen die Schildkröten in ihrer Obhut nicht in Winterstarre fallen; sie möchten, dass ihre Schützlinge wach bleiben, damit sie sie im Auge behalten können. Dennoch scheinen die Schildkröten im Winter langsamer zu werden. Dabei kommen immer wieder neue Schildkröten hinzu: Schildkröten, die während ihrer Winterruhe gestört wurden, Schildkröten, die von ihren Besitzer:innen abgegeben werden, und Schildkröten, deren Probleme die Fähigkeiten anderer Wildtierretter:innen übersteigen. Die erste Schildkröte des Jahres 2020 wurde am 8. Januar aufgenommen – genau an dem Tag, an dem Alexxia an einer Kreuzung in Worcester einen Auffahrunfall hatte. Eine Nachbarin, die den Unfall beobachtet hatte, sah von ihrem Fenster aus das Logo von Alexxias Wagen und kam herausgerannt, um ihre unerwünschte asiatische Sumpfschildkröte abzugeben. Die Frauen tauften sie kurzerhand auf den Namen Crash.
»Im Mai geht es hier richtig los«, erzählt Alexxia. »Und dann rackern wir uns zwei Monate lang von früh bis spät ab. Es kann passieren, dass jemand morgens auf dem Weg zur Arbeit eine Schildkröte findet, nachdem ich die ganze Nacht damit verbracht habe, Maden aus der Körperhöhle einer andern zu pulen. Der Juni ist der reinste Hexenkessel; rund um die Uhr flickt man Schildkröten zusammen …«
Das klingt, als könnten sie im Frühling unsere Hilfe gebrauchen. Wir können es kaum erwarten!
3.Die Schildkröten-Krise
Eine McCords-Schlangenhalsschildkröte
Die vielen Wochen bis zum Beginn unseres Freiwilligeneinsatzes bei der Rescue League im Frühjahr liegen scheinbar endlos lange und bedrückend schildkrötenlos vor uns – abgesehen von der Zeit, die wir bei Matt mit Eddie und Polly sowie Iwan, einer Russischen, und Jimmy, einer Griechischen Landschildkröte verbringen. Aber Matt hatte eine Idee: Um meine Schildkrötenkenntnisse aufzubessern und mir zu zeigen, wie vielfältig, erstaunlich und bedroht diese Lebewesen sind, organisierte er einen Besuch bei seinen Freunden im Turtle Survival Center etwas außerhalb von Charleston, South Carolina.
Das Turtle Survival Center ist eine der größten und wichtigsten Brutkolonien für die am stärksten bedrohten Schildkröten der Welt – einige Arten, so erklärte Matt, gibt es in freier Wildbahn nicht mehr. Er hatte das Zentrum 2017 im Rahmen seiner allerersten Schildkrötenkonferenz besucht. »Es ist der Wahnsinn«, sagte Matt. »Du wirst Schildkröten sehen, die du nirgendwo sonst auf der Welt findest.«
Wir flogen im März mit einem ungewöhnlich sauberen und leeren Flugzeug los. In den Nachrichten war von der Ausbreitung einer neuen Atemwegserkrankung aus China berichtet worden; nur einen Tag vor unserem Flug wurde ein Kreuzfahrtschiff vor der Küste Kaliforniens am Einlaufen in den Hafen gehindert, weil bei einundzwanzig von sechsundvierzig getesteten Personen das Virus festgestellt worden war. Aber wir waren nicht sehr beunruhigt. Matt war unversehrt aus Madagaskar zurückgekehrt, nachdem er jeden Abend Eintöpfe aus madenverseuchtem Fleisch gegessen hatte, und ich hatte auf meinen Recherchereisen in den Tropen zahlreiche Infektionen überlebt, darunter das Dengue-Fieber. Wie schlimm konnte diese neue Krankheit schon sein? Wesentlich mehr Kopfzerbrechen bereitete mir, wie wir Matts Freund Cris Hagen, den Zentrumsleiter für Tiermanagement, am Flughafen finden sollten.
Aber Cris war leicht zu erkennen: ein gelassen wirkender, hochgewachsener Mann von siebenundvierzig Jahren, das graue Haar in der Mitte gescheitelt, in einem orangefarbenen T-Shirt der Turtle Survival Alliance und grauen Cargo-Shorts. Mein Blick wurde sofort auf seine linke Wade gelenkt: Sie ist mit sechs großen Tattoos bedeckt, die im Profil die Köpfe von vom Aussterben bedrohten süd- und südostasiatischen Flussschildkröten der Gattung Batagur zeigen. Jedes Tattoo, so erzählte Cris uns stolz, wurde nach dem Foto eines Individuums designt, dem er persönlich begegnet war. Am ganzen Körper trägt er über fünfzig Tattoos, darunter Star-Wars-Figuren (manche nennen ihn den Yoda der Schildkröten), Droiden und ein großes Strahlensymbol (er hat früher in einem Labor für Radioökologie gearbeitet). Lichtschwerter schmücken die Innenseiten seiner beiden Zeigefinger, und ein ausgestorbenes Meerestier, ein Trilobit, ziert einen Bizeps. Er erwähnte, dass er sogar eine Tätowierung, nämlich den Namen seiner Lieblingsrockband Slayer, im Mund hat.
»Und wer soll das bewundern?«, fragte ich. »Dein Zahnarzt?«
»Die Tattoos sind für mich«, antwortete er freundlich. Alle Tattoos haben eine Bedeutung für ihn – deshalb lässt er sich nach und nach alle vierzehn heute noch lebenden Schildkrötenfamilien tätowieren. Schildkröten sind ein integraler Bestandteil von Cris’ Persönlichkeit.