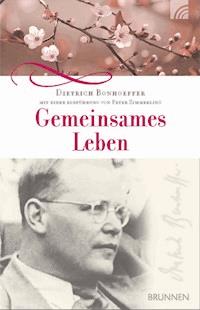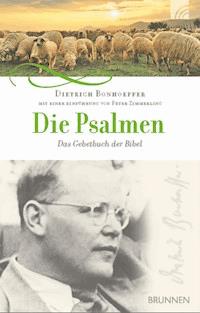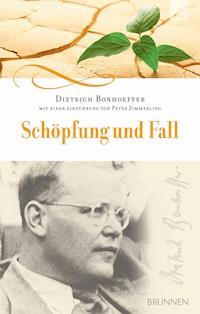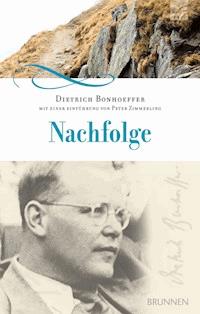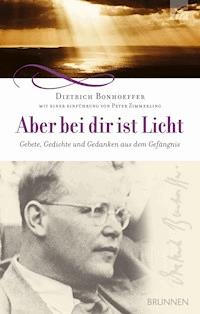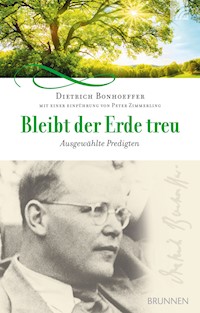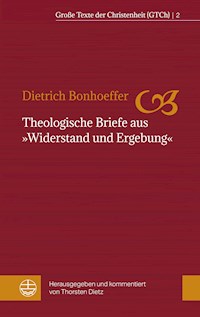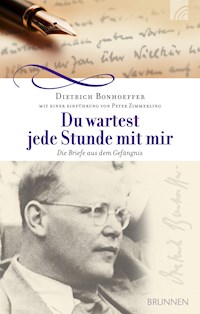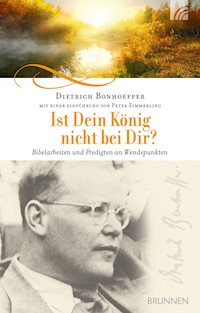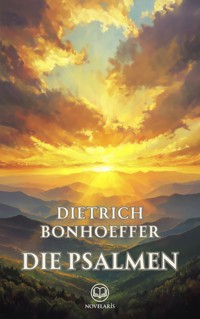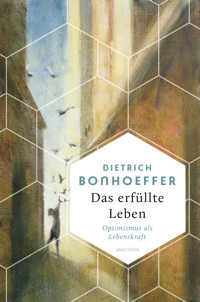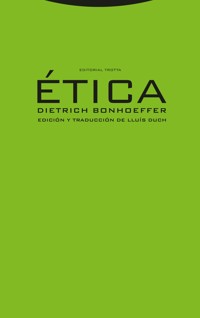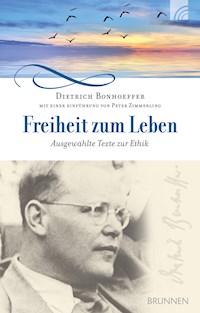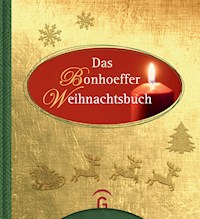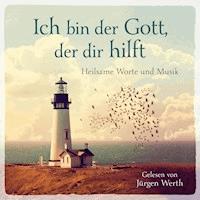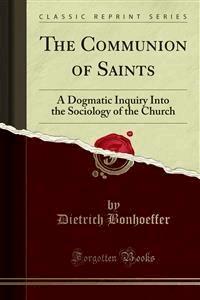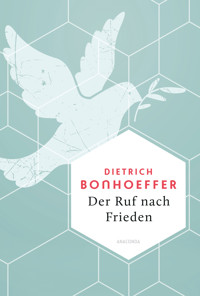
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Weisheit der Welt
- Sprache: Deutsch
»Selig sind, die Frieden stiften«: Dem Theologen Dietrich Bonhoeffer galten diese Worte der Bergpredigt als bindendes Gebot. Im Angesicht des drohenden Zweiten Weltkriegs wollte er die Kirche von einem kompromisslosen Pazifismus überzeugen. Das erschien damals – und erscheint gerade auch heute – vielen als geradezu naiv. Doch Bonhoeffer folgte dem Weg des Friedens, manchmal stolpernd, bis zu seiner Ermordung im KZ. Der vorliegende Band gibt mit Texten von und über Dietrich Bonhoeffer einen Einblick in dessen unermüdlichen und mutigen Einsatz für Frieden in einer Zeit der Gewalt und des Hasses.
- Sammlung von Texten über und vom »einzigen Heiligen des Protestantismus« Ralf Frisch im Deutschlandfunk, 14.09.2022
- »Dietrich Bonhoeffer gilt heute als einer der bekanntesten und einflussreichsten deutschen Theologen. Er war Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozialismus. Für seine Überzeugung hat er mit dem Leben bezahlt.« Tagesschau
- Bonhoeffer steht für Zivilcourage und Widerstand, sein Gedicht »Von guten Mächten« ist weltberühmt
- Berührende Weisheit eines großen Vorbilds: Bonhoeffer ermutigt und inspiriert
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dietrich Bonhoeffer
Der Ruf nach Frieden
Herausgegeben und mit einleitenden Texten von Mareike von Landsberg
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt undenthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugteNutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzungdurch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitungoder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere inelektronischer Form, ist untersagt und kann straf- undzivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlichgeschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- undData-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
(Vorstehende Angaben sind zugleichPflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: Katja Holst, Frankfurt am Main
Umschlagmotiv: Adobe Stock, © Ramona Kaulitzki (Taube)
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-33440-6V001
Inhalt
Zu diesem Buch
Zu den verwendeten Texten
»Das Wutgeheul der Weltmächte« –
»Aber der Weg muss durchgegangen werden« –
»Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden« –
Zeittafel
Literaturhinweise
»Es gibt doch nun einmal Dinge, für die es sichlohnt, kompromisslos einzustehen. Und mirscheint, der Friede und soziale Gerechtigkeit,oder eigentlich Christus, sei so etwas.«
Dietrich Bonhoeffer
Zu diesem Buch
Im April 1982 veranstaltet das Internationale Bonhoeffer Komitee Sektion Bundesrepublik Deutschland in Kaiserswerth eine Tagung zum Thema »Die gegenwärtige Friedensproblematik und die Bedeutung Dietrich Bonhoeffers für ihre Beurteilung.« Heinz Eduard Tödt, evangelischer Theologe, Sozialethiker und Mitherausgeber der wissenschaftlichen Bonhoeffer-Werkausgabe beginnt seinen Vortrag auf dieser Tagung mit den folgenden Sätzen:
Wir leben in einer Zeit und einer Region, in der ein mit Massenvernichtungsmitteln geführter Krieg uns in einen schaurigen Untergang menschlichen Lebens hineinreißen würde. Diese Auffassung ist nicht strittig. Strittig aber sind die Mittel und Wege, mit denen ein solcher Krieg verhindert werden kann. Ist das Streben nach Sicherheit durch Rüstung und Abschreckung geboten, oder führt dieses gerade herbei, was es verhindern soll? Können wir eine neue internationale politische Kultur entwickeln, in welcher Kooperation in wechselseitigem Interesse den Ausbruch von Kriegen ausschließt und wenigstens äußeren Frieden gewährleistet?1
1Heinz Eduard Tödt, Dietrich Bonhoeffers ökumenische Friedensethik. Vortrag am 24. April 1982. In: Hans Pfeiffer (Hrsg.), Frieden – das unumgängliche Wagnis. Die Gegenwartsbedeutung der Friedensethik Dietrich Bonhoeffers. München 1982, S. 85
Tödts Vortrag steht im Zeichen der Friedensbewegung der frühen Achtzigerjahre und seine Einleitung zielt vor allem auf die politischen Spannungen ab, die sich aus der damaligen Spaltung der Weltmächte durch den sogenannten Eisernen Vorhang ergeben; auf das Wettrüsten und Säbelrasseln der Kontrahenten; auf die allgegenwärtige Sorge, dass aus dem Kalten Krieg zwischen Ost und West ein »heißer« werden könnte.
Seitdem ist viel passiert: Eiserner Vorhang und Berliner Mauer sind gefallen – ohne Krieg und Blutvergießen. Doch wenn wir nicht wüssten, dass Tödt diese Worte vor über vierzig Jahren vortrug, könnten wir sie ohne Weiteres in unserer Gegenwart verorten, und eine Tagung des Bonhoeffer Komitees zur »Friedensproblematik« wäre heute genauso angemessen wie damals. Denn neue, nicht nur kalte Kriege sind entfacht, neue Mauern wachsen; manche sprechen von »Zeitenwende« und meinen damit: Wir müssen aufrüsten, um den Frieden zu sichern. Deshalb sind die Fragen, die Tödt aufwirft, heute nicht weniger aktuell als damals. Und heute wie damals suchen wir nach einer Antwort auf die Frage: »Wie wird Friede?«.
In seinem Vortrag meint Tödt: »Bei unserer Suche nach begründeter Orientierung gegenüber den Fragen von Rüstung, Krieg und Frieden wenden wir uns an Dietrich Bonhoeffer. Nicht in der Meinung, dass wir ein Konzept, das rund fünfzig Jahre zurückliegt, einfach übernehmen können; wohl aber in der Erwartung, dass Bonhoeffers Antwortversuche und seine Erfahrungen mit ihnen für uns aufschlussreich und wichtig sind.«2 In diese »Antwortversuche« – und damit in Bonhoeffers Friedensethik, »die nicht ein bloßer Zusatz, sondern ein zentrales Stück seines theologischen Denkens und seiner politischen Orientierung«3 darstellt – möchte das vorliegende Buch einen Einblick geben. Vielleicht kann uns Dietrich Bonhoeffers mutiger Aufruf zum Pazifismus auch heute daran gemahnen, dass wir trotz aller Feindseligkeit, trotz allen Starrsinns und mangelnder Gesprächsbereitschaft aufseiten der Aggressoren, den gewaltfreien Dialog als erste Option – als Weg zum Frieden – niemals aufgeben sollten.
2Tödt (1982), S. 85
3ebd., S. 87
Der vorliegende Band versammelt zum einen Texte Dietrich Bonhoeffers, die zentral sind für seine in den 1930er-Jahren entwickelte Friedensethik; zum anderen aber auch Briefe und andere Dokumente, die belegen, wie sehr er immer wieder mit sich selbst und der Kirche hadert: Lässt sich innerhalb der Kirche eine ausreichende Zahl Menschen versammeln, die bereit sind, ihm auf seinem Weg des gewaltlosen Widerstandes zu folgen? Und wenn nicht, ist Emigration die richtige Option?
Des Weiteren finden sich im letzten Teil des Buches Texte, die kurz vor und während Bonhoeffers Haft entstehen. Hier steht das Friedensthema nicht mehr im Vordergrund – der Krieg ist in vollem Gange und Bonhoeffer erlebt die Bombardierung Berlins am eigenen Leib. Aber diese Texte zeigen in eindrucksvoller Weise, dass Bonhoeffer seinen Weg, der ihn vom aktiven, aber gewaltlosen Widerstand schließlich doch in eine militärische Konspiration gegen Hitler und deshalb ins Gefängnis führt, nicht bereut. Man spürt, dass hier zwar kein Held und Märtyrer schreibt; keiner, der seinen Feinden und der drohenden Hinrichtung angstfrei entgegentritt – aber es schreibt ein Mensch, der im Reinen mit sich ist. Weil er weiß, dass er, im Vertrauen auf Gott, sein Möglichstes getan hat, um Frieden zu stiften und dem Hass Einhalt zu gebieten. Hier schreibt ein Mensch, der »über seine christliche Kirche hinausgegangen ist, über sie hinausgeglaubt und -gedacht hat, über sie hinauswirken wollte, als die Kirche selbst mit dem Bösen in Deutschland paktierte […].«4
4Volker Weidermann: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Wie der Theologe Dietrich Bonhoeffer ein Gedicht für die Ewigkeit schuf – und doch 80 Jahre nach seiner Ermordung von den Falschen vereinnahmt wird, in: DIEZEIT, Nr. 13, 27. März 2025, S. 51
Zu den verwendeten Texten
Die Texte des vorliegenden Bands wurden folgenden Werken entnommen:
Dietrich Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Band II: Kirchenkampf und Finkenwalde. München 1959 (im Folgenden abgekürzt: GSII)
Ders., Werke 4:Nachfolge. Hrsg. von Martin Kuske und Ilse Tödt; Christian Kaiser Verlag, München 1989 (im Folgenden abgekürzt: DBW 4)
Ders., Werke 6: Ethik. Hrsg. von Ilse Tödt, Heinz Eduard Tödt, Ernst Feil und Clifford Green; Christian Kaiser Verlag, München 1992 (im Folgenden abgekürzt: DBW 6)
Ders., Werke 8: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg. von Christian Gremmels, Eberhard Bethge und Renate Bethge in Zusammenarbeit mit Ilse Tödt; Christian Kaiser Verlag, München 1998 (im Folgenden abgekürzt: DBW 8)
Ders., Werke 11: Ökumene, Universität, Pfarramt: 1931 – 1932. Hrsg. von Eberhard Amelung und Christoph Strohm, München 1994 (im Folgenden abgekürzt DBW 11)
Ders., Werke 12: Berlin 1932 – 1933. Hrsg. von Carsten Nicolaisen und Ernst-Albert Scharffenroth; Christian Kaiser Verlag, München 1997 (im Folgenden abgekürzt DBW 12)
Ders., Werke 13: London 1933 – 1935. Hrsg. von Hans Goedeking, Martin Heimbucher und Hans-Walter Schleicher; Christian Kaiser Verlag, München 1994 (im Folgenden abgekürzt DBW 13)
Ders., Werke 14: Illegale Theologenausbildung. Finkenwalde 1935 – 1937. Hrsg. von Otto Dudzus und Jürgen Henkys in Zusammenarbeit mit Sabine Bobert-Stützel, Dirk Schulz und Ilse Tödt; Christian Kaiser Verlag, München 1996 (im Folgenden abgekürzt: DBW 14)
Ders., Werke 15: Illegale Theologenausbildung. Sammelvikariate 1937 – 1940. Hrsg. von Dirk Schulz; Christian Kaiser Verlag, München 1998 (im Folgenden abgekürzt: DBW 15)
Ders., Werke 16: Konspiration und Haft 1940 – 1945. Hrsg. von Jørgen Glenthøj, Ulrich Kabitz und Wolf Krötke; Christian Kaiser Verlag, München 1996 (im Folgenden abgekürzt DBW 16)
Ders., Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg. von Eberhard Bethge; Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1951 (im Folgenden abgekürzt: WE)
Maria von Wedemeyer u. Dietrich Bonhoeffer, Brautbriefe Zelle 92. 1943 – 1945. Hrsg. von Ruth-Alice von Bismarck und Ulrich Kabitz; C. H. Beck, München 1992 (im Folgenden abgekürzt: Brautbriefe)
Bibelstellen, die von der Herausgeberin zitiert werden, stammen aus folgender Bibelausgabe:
Die Bibel. Nach Martin Luthers Übersetzung. Revidiert 2017. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2017
»Das Wutgeheul der Weltmächte« –
Kann die Kirche Frieden stiften?
»Für Dietrich Bonhoeffer«, schreibt Volker Weidermann in einem Artikel zum 80. Todestag des Theologen, »war christliche Religion überhaupt nur dann von Belang, wenn sie hinaustrat aus den Kirchen und wirksam wurde in der Welt.«5»Wirksam« zu sein, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für sich selbst, sondern für das, was im eigenen sozialen Umfeld und darüber hinaus geschieht, wird für Dietrich Bonhoeffer schon früh bedeutsam. Im Alter von dreizehn Jahren beschließt er, Theologie zu studieren und beginnt, philosophische, sozialwissenschaftliche und theologische Literatur zu lesen. In einem Werk des evangelischen Theologen und liberalen Politikers Friedrich Naumann stößt Bonhoeffer als Primaner auf einen Widerspruch des christlichen Lebens: »Viele sind praktisch mit der rechten Hand Kaufleute und mit der linken Hand Wohltäter der Armen. […] Alle Stimmungen des Evangeliums schweben nur wie ferne, weiße Sehnsuchtswolken über allem wirklichen Tun unserer Zeit.«6 So ein Theologe will Dietrich Bonhoeffer nicht sein. Und so soll auch seine geliebte Kirche, der gemeinsame Ort der Christen, nicht sein. Sie soll sich einmischen und die Botschaft Christi – für Bonhoeffer bedeutet das vor allem: die Bergpredigt – »wirksam« werden lassen in der Welt.
5Weidermann (2025), S. 51
6Friedrich Naumann: Briefe über die Religion. Berlin 1917, S. 61
Wie sieht diese Welt aus, in die Bonhoeffer hinausgeht, als er 1930 – mit 24 Jahren und bereits habilitiert – sein Studium beendet?
Es sind unruhige Zeiten. Politische, soziale und wirtschaftliche Instabilität prägen die Stimmung im Deutschland der Weimarer Republik. Die 1929 von den USA ausgehende Weltwirtschaftskrise hat auch hier schwerwiegende Folgen; so erreicht etwa 1932 die Arbeitslosigkeit mit über sechs Millionen Menschen einen traurigen Höhepunkt. Bei den Reichstagswahlen im September 1930 verbucht die NSDAP mit 18,3 % der Stimmen erhebliche Zugewinne – die Unzufriedenheit der Menschen wächst gleichzeitig mit dem Einfluss nationalistischer und antisemitischer Bewegungen.
Den Beginn der radikalen und fatalen Umgestaltung der deutschen Politik und Gesellschaft markiert der Amtseintritt Hitlers als Reichskanzler am 30. Januar 1933. Bereits in den ersten Monaten der nationalsozialistischen Regierung werden mit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 die demokratischen Rechte erheblich eingeschränkt und die Grundlage für eine Diktatur gelegt. Noch im gleichen Jahr tritt Deutschland aus dem Völkerbund aus, ein alarmierendes Zeichen für zunehmende politische Isolation und militärische Aufrüstung. Die revisionistische und offen auf Expansion abzielende Politik der NSDAP schürt Ängste und Spannungen in Europa; das aggressive nationale Gedankengut, das die Nazis in ihren Parteiprogrammen und Hitler in seinen Reden offenbart, lässt bereits zu Beginn der Dreißigerjahre die Gefahr eines neuen Krieges greifbar werden.
Bonhoeffers Texte aus der Zeit zwischen 1931 und 1934 spiegeln deutlich, wie sehr er sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt des heraufziehenden Unheils – vor allem auch der Gefahr eines neuen Krieges – bewusst ist. In diesen Jahren leistet er aktive Friedensarbeit, indem er die Kirche davon zu überzeugen versucht, sich politisch einzumischen und, ab 1933, gewaltlosen Widerstand zu leisten gegen das Unrechtsregime der Nationalsozialisten.
So appelliert er 1932 in seiner Funktion als Jugendsekretär des »Weltbunds für internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen«7 an seine Zuhörer: »Die Ordnung des internationalen Friedens ist heute Gottes Gebot für uns.« Zwei Jahre später wird er diesen Aufruf in seiner berühmt gewordenen Friedensrede, die er auf der ökumenischen Jugendkonferenz des »Weltbunds« hält, noch leidenschaftlicher und eindringlicher wiederholen. Bonhoeffer beschwört hier einen Pazifismus, einen Weltfrieden, der seiner Meinung nach nicht durch »ein System von politischen Verträgen« erreicht werden könne; denn, so insistiert er, es »gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit.« Für ihn ist der Weg des Friedens in dieser Zeit der stetig zunehmenden politischen Gewalt8 der einzig gangbare für alle, die Christus nachfolgen.
7Der »Weltbund für internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen« (World Alliance for International Friendship Through the Churches) war eine Organisation, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für ein offenes Bekenntnis der Kirchen zum Frieden bemühte. Hier liegen die Wurzeln der christlichen Friedensbewegung und der ökumenischen Bewegung.
8In den Monaten vor der Fanø-Konferenz spitzen sich die politischen Ereignisse in Deutschland und Österreich dramatisch zu: Vom 30. Juni bis 2. Juli 1934 lässt Hitler unter dem Vorwand des sogenannten Röhm-Putsches über hundert politische Gegner liquidieren. Am 25. Juli kommt es in Österreich zu einem nationalsozialistischen Putsch, bei dem Bundeskanzler Dollfuß ermordet wird; als Reaktion darauf lässt Mussolini italienische Truppen am Brenner aufmarschieren. Anfang August stirbt Reichspräsident Paul von Hindenburg und das Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches wird erlassen: Hitler vereint nun in seiner Person die Ämter des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten; er wird zum »Führer und Reichskanzler«.
Doch Bonhoeffer setzt sich nicht nur auf Kirchenkonferenzen für den Weltfrieden ein; ihm geht es auch um den inneren Frieden in seiner Heimat Deutschland und darum, sich als Christ eindeutig gegen Hass und Ausgrenzung zu positionieren. So hält er unmittelbar nach Erlassung des sogenannten »Nichtariergesetzes«9 im April 1933 vor einem Kreis von Pfarrern den Vortrag »Die Kirche vor der Judenfrage«. Hier wird ganz klar, wie wichtig ihm eine eindeutige Haltung der Kirche gegen die menschenverachtende antisemitische Politik der Nazis ist. Er verweist auf die »Opfer des Staatshandelns«, denen die Kirche »in unbedingter Weise verpflichtet [ist], auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören.« In diesem Text fällt auch jener Satz, der sowohl für Bonhoeffers aktive Friedensarbeit als auch seinen späteren Weg in den Widerstand bezeichnend ist: »Die dritte Möglichkeit [kirchlichen Handelns dem Staat gegenüber] besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen.«
9Dieses am 7. April 1933 erlassene menschenverachtende Gesetz trug offiziell den beschönigenden Namen »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«, kurz »Berufsbeamtengesetz« (BBG). Hierin wurde verfügt, dass sogenannte »Nichtarier«, also Menschen jüdischer oder teilweise jüdischer Herkunft, in Deutschland nicht mehr als Beamte arbeiten durften und somit aus dem Staatsdienst entfernt wurden.
Doch die meisten Christen in Deutschland denken ganz anders: Innerhalb der evangelischen Kirchen bildet sich das Lager der sogenannten »Deutschen Christen«, die, nationalistisch gesinnt, treu hinter dem Naziregime stehen und das »Nichtariergesetz« befürworten. Bei kurzfristig anberaumten Kirchenwahlen im Juli 1933 gewinnen die »Deutschen Christen« mit großer Mehrheit. Aus der Opposition gegen die nationalsozialistischen Protestanten entsteht die Organisation der »Bekennenden Kirche«, in die Bonhoeffer nun seine ganze Hoffnung setzt. Aber er erkennt schnell, dass diese Bewegung nicht stark genug ist, um wirklich etwas zu bewegen und Hitler die Stirn zu bieten. Bonhoeffer, der im Oktober 1933 eine Stelle als Vikarsassistent in der Deutschen Evangelischen Gemeinde in London10