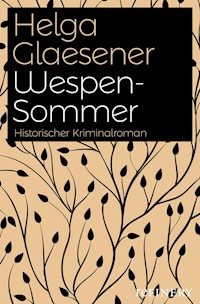7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine epische Saga, die die Grenzen zwischen Historie und Fantasie verschwimmen lässt: »Der Sänger des Königs« von Helga Glaesener jetzt als eBook bei dotbooks. Deutschland im 13. Jahrhundert: Der Minnesänger Mack Thannhäuser wird von König Heinrich in seinen Hofstaat aufgenommen. Der nicht besonders mutige, dafür umso gewitztere junge Edelmann soll zum Ritter erzogen werden, doch seine Begabungen liegen weniger im Schwertkampf, als im Umgang mit der Laute und seiner Stimme – von der manche sagen, dass sie die Menschen geradezu verzaubern könnte. Als Thannhäuser ein sagenumwobener Edelstein in die Hände fällt, wird er in eine Welt aus Intrigen, Hass und Gewalt gestoßen – und gerät unter Verdacht, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Um seinen Namen reinzuwaschen und um seine große Liebe zu retten, muss Thannhäuser beweisen, dass auch er es wagt für etwas zu kämpfen – und womöglich dafür zu sterben … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die ebenso fesselnde wie fantastische Saga »Der Sänger des Königs« von Helga Glaesener enthält die drei Romane »Der indische Baum«, »Der Stein des Luzifer« und »Der falsche Schwur«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1252
Ähnliche
Über dieses Buch:
Deutschland im 13. Jahrhundert: Der Minnesänger Mack Thannhäuser wird von König Heinrich in seinen Hofstaat aufgenommen. Der nicht besonders mutige, dafür umso gewitztere junge Edelmann soll zum Ritter erzogen werden, doch seine Begabungen liegen weniger im Schwertkampf, als im Umgang mit der Laute und seiner Stimme – von der manche sagen, dass sie die Menschen geradezu verzaubern könnte. Als Thannhäuser ein sagenumwobener Edelstein in die Hände fällt, wird er in eine Welt aus Intrigen, Hass und Gewalt gestoßen – und gerät unter Verdacht, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Um seinen Namen reinzuwaschen und um seine große Liebe zu retten, muss Thannhäuser beweisen, dass auch er es wagt für etwas zu kämpfen – und womöglich dafür zu sterben …
Über die Autorin:
Helga Glaesener, 1955 in eine Großfamilie hineingeboren, studierte Mathematik in Hannover. Mit ihrem Roman »Die Safranhändlerin« landete sie 1996 einen Bestsellererfolg. Seitdem hat sie zahlreiche historische Romane sowie mehrere Fantasy- und Kriminalromane veröffentlicht. Heute lebt sie in Niedersachsen und unterrichtet Kreatives Schreiben, wenn sie nicht gerade an einem neuen Werk arbeitet.
Helga Glaesener veröffentlichte bei dotbooks bereits den Fantasy-Roman »Der schwarze Skarabäus«.
Die Website der Autorin: www.helga-glaesener.de
***
Sammelband -Neuausgabe Januar 2020
Dieser Band enthält die drei Romane »Der indische Baum«, »Der Stein des Luzifer« und »Der falsche Schwur« der Autorin Helga Glaesener, die gemeinsam die »Thannhäuser-Trilogie« bilden.
Copyright © der Originalausgabe von »Der indische Baum« 2000 Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Originalausgabe von »Der Stein des Luzifer« 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG
Copyright © der Originalausgabe von »Der falsche Schwur« 2005 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgaben 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Marzolino, Picksell, Tamara Klikova
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-902-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Sänger des Königs« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Helga Glaesener
Der Sänger des Königs
Die große Saga
dotbooks.
Der indische Baum
Die Thannhäuser-Trilogie: Band 1
In magnis et voluisse sat est.
Für Nils, mit Liebe
Ein boum stet in Indian,groz, den will si von mir han.Minen willen tuot si gar,seht, ob ich irz alles her gewinne.Ich muoz bringen ihr den gral,des da pflac her Parzival,und den apfel, den Parisgap durch minneVenus der gütinne.
Thannhäuser
Prolog
Nell hielt das Frettchen und hoffte sehnlichst, das Feuer im Kamin würde erlöschen. Die Flammen selbst konnte sie nicht sehen, denn sie kauerte unter einem Tisch in der Ecke des Zimmers und vor ihr stand eines der stämmigen Tischbeine, aber die hellen Schatten tanzten und zitterten an der gegenüberliegenden Zimmerwand.
Nell schluckte an ihren Tränen. Sie saß auf ihren Füßen und ihre Beine waren eingeschlafen. Ihr war kalt und sie konnte sich kaum besinnen, wie lange sie schon unter dem Tisch hockte, aber es kam ihr vor wie … fast wie eine ganze Nacht. Und es gab keine Hoffnung auf ein Ende.
Das Frettchen zuckte im Schlaf mit den Schnurrbarthaaren und gab ein behagliches Geräusch von sich. Ja, dem Frettchen ging es gut. Dabei war es schuld an dem Unglück. Der Diener hatte die Schragen für das Abendbrot in den Saal getragen, Amma war fortgegangen, um den Hirsebrei für den kleinen Eberhard zu besorgen, und weil niemand sich um Nell gekümmert hatte, hatte sie begonnen mit dem Tier zu spielen. Zuerst hatte es sich streicheln lassen, aber dann war es plötzlich die Treppe hochgejagt und durch die Tür ins Zimmer der Tante und in die Ecke neben der Truhe geschlüpft. Und als Nell, die hinter ihm hergerannt war, es hatte aufheben wollen, war die dürre Mathilde mit einem Wasserbottich hereingekommen, und Nell hatte sich wie der Blitz unter dem Tisch verkrochen.
Die Schlafkammer war nicht verboten, aber Nell mochte die Tante nicht. Sie wurde schnell wütend und wenn sie schlug, benutzte sie dazu einen biegsamen Zweig, der nicht nur ziepte, sondern richtig weh tat. Also hatte Nell sich so nah wie möglich an die Wand verkrochen und gehofft unentdeckt zu bleiben, bis Mathilde wieder gegangen war.
Sie war aber nicht gegangen, sondern sie hatte die spinatgrünen Vorhänge zurückgezogen, die das Bett der Herrin wie ein Zelt umgaben. Dann war aus den Kissen ein Fiepen wie beim Ferkelschlachten gedrungen, und anschließend Schreie, die das kleine Mädchen zutiefst entsetzt hatten. Es hatte sich an das Frettchen geklammert und jeden Gedanken an Flucht vergessen.
Irgendwann hatte die Tante aufgehört zu schreien.
Neil gähnte und überlegte, dass sie geschlafen haben musste, denn neben dem Bett stand jetzt eine Wiege, die aus dem gleichen dunklen Holz war wie die Beine des Tischs und sie konnte sich nicht entsinnen, wann man sie dorthingetragen hatte. Sie fror entsetzlich. Die Bodendielen waren eiskalt und nur das weiche Fell des Frettchens auf ihren Oberschenkeln wärmte sie ein wenig.
Wo war Mathilde? Nell vernahm kein Geräusch. Vielleicht war die alte Frau auf einem Stuhl eingeschlafen oder fortgegangen. Nell sehnte sich danach, aus der Kammer zu schlüpfen und hinauf in ihr Zimmerchen zu laufen, wo der kleine Eberhard wahrscheinlich längst bei Amma auf der Strohmatratze schlief. Ein Teil von ihr empörte sich, weil offenbar niemand sie vermisste – und sie war wirklich noch sehr klein. Drei oder zehn Jahre, ganz genau wusste sie es nicht. Aber die Amma hätte sich um sie sorgen müssen.
Vorsichtig versuchte Nell am Tischbein vorbeizuschielen, ohne das Frettchen zu wecken. Sie sah, dass die Bettvorhänge noch immer zurückgeschlagen waren. Die Tante lag in den Kissen und starrte mit ihren kalten Augen zur Decke. Verwundert betrachtete Nell ihr bleiches Gesicht. Ihr wurde beklommen zumute, denn sie kannte die Tante nur mit herrischen Befehlen. Außerdem musste sie an ihre Mutter denken, die ebenso weiß im Bett gelegen hatte, und auch dort hatte eine Wiege gestanden. Nell hatte die stille Mutter küssen müssen, dann hatte Amma mit viel Geheule ihre Kleider und die Bauchwehkräuter in eine Truhe gepackt und sie waren auf einem Wagen fortgeholpert, in ihr neues Zuhause. In einem Körbchen, das Amma in den dicken Armen gehalten hatte, hatte der kleine Eberhard gelegen, der wie durch ein Wunder in ihr Leben getreten war.
Nell spürte einen nassen Tropfen über ihre Wange rollen. Wenn nicht die Angst vor der Gerte gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich angefangen lauthals nach Amma zu schreien. Doch der Gedanke an Schläge und der Anblick der Wiege, die Böses verhieß, ließen sie die Tränen hinunterschlucken.
Sie schlief erneut ein und als sie das nächste Mal erwachte, war es von einem Wutschrei.
Das Frettchen zuckte zusammen und flitzte von ihrem Schoß in eine andere finstere Ecke. Ängstlich stopfte sich Nell die Finger in den Mund.
Mathilde war zurückgekehrt. Sie trug ihren filzigen, wadenlangen Mantel, beugte sich über die Herrin und zeigte ihr etwas, das in ein graues Wolltuch gehüllt war. Nell verbiss sich den Schmerz der eingeschlafenen Füße und richtete sich ein wenig auf.
Die Tante war zornig. Als Nell den Ausdruck in ihrem weißen Gesicht sah, zog sie rasch den Kopf ein und wollte sich in der Ecke verkriechen, aber die Neugier siegte über ihre Angst.
»Es ist hässlich«, keuchte die Frau in den Kissen mit fahlen Lippen und betrachtete voller Ekel, was Mathilde ihr zeigte. »Es … sieht fast aus wie tot. Du hast mir … Dreck besorgt.«
»Ich habe geholt, was es gab«, antwortete Mathilde gleichmütig. Sie fürchtete sich nicht.
»Es ist dunkel. Es … es ist Dreck.«
»Es hat, was das Herz des Herrn höher schlagen lässt.« Mathilde schlug den Wolllappen auseinander und gemeinsam starrten sie auf die Beule im Tuch.
»Wo ist es her?«
»Das wollt Ihr nicht wissen, Herrin.«
»Die Mutter?«
»Die wirds nicht suchen.«
»Sieh dir die Augen an. Sie sind … dahinter leuchtet was.«
Mathilde schlug den Lappen wieder zusammen und legte oder vielmehr warf das Bündel achtlos ans Fußende des Bettes.
»Ich hab nie einen Säugling mit solchen Augen gesehen. Grün wie die Linsen in den Waldtümpeln. Das ist nicht geheuer, Mathilde. Was hast du mir da angeschleppt?«
Nell sah ein winziges Kind aus der Wolle rollen. Es war nackt, braun, mit Schleim und Blut beschmiert und hatte einen hässlichen Stumpf am Bauch. Es weinte nicht, was Nell sonderbar vorkam, denn Mathilde hatte es so grob geworfen, dass es mit dem Kopf an die Bettkante geschlagen war. Seine Augen waren weit geöffnet und es begann ihr Leid zu tun, weil es in der Kälte fror und weil die Herrin es so heftig verabscheute.
»Es hat, was der Herr haben will«, wiederholte Mathilde. Sie ging um das Bett herum und beugte sich über die Wiege.
Die Tante hatte die Füße eingezogen und ihre Knie bildeten unter der Decke einen Berg – eine Barriere, als wolle sie mit dem hässlichen Kind nicht in Berührung kommen. »Du warst nicht im Dorf. Du hattest gar keine Zeit für den Weg hin und zurück.«
»Fragt nicht. Was ich gefunden hab, taugt ebenso viel und mehr, weils nicht vermisst wird.« Mathilde hatte plötzlich ein neues Kind auf dem Arm. Im ersten Moment dachte Nell, es wäre Eberhard, aber der Säugling war viel kleiner und auf seinem Kopf wuchs helles, fast silbernes Haar. Die Magd legte das Kind mitsamt seiner Decke in die Armbeuge der Tante und das Gesicht der Frau im Bett wurde weich. Sie küsste es mit einer Zärtlichkeit, die Nell staunen ließ.
Dann nahm sie eines der bestickten weißen Kissen und drückte es dem Kind aufs Gesicht.
Kapitel 1
Sie kehrten zurück.
Nell sprang von dem gemauerten Sitzplatz in der Fensternische auf und ließ das Hemd, an dem sie gerade einen dieser unangenehm ausgefransten Risse gestopft hatte, zu Boden fallen. Die Kammer, die sie bewohnte, befand sich in einem der oberen Stockwerke der Burg und so hatte sie freien Ausblick auf das Dorf, die honiggelben Felder und den dahinter liegenden schwarzen Wald.
Vier Reiter kamen aus dem Wald, Männer in bunten Kleidern, die in der Sommersonne leuchteten. Sie schienen gesund und wohlbehalten zu sein, denn sie saßen alle tadellos im Sattel. Ihre Schwerter reflektierten das Licht. Dem vordersten wippte eine Feder am Hut. Sie sahen aus wie eine Jagdgesellschaft. Auf dieses Bild hatte Nell drei Jahre lang gewartet und ihr Herz schlug im Galopp.
Und doch – als sie die Männer jetzt sah, schien etwas nicht zu stimmen.
Nell runzelte die Stirn. Sie brauchte einen Moment, um zu erkennen, was sie störte. Es war der Staub. Die Männer kehrten nach unendlich langer Zeit in der Fremde heim und ließen ihre Pferde so langsam gehen, dass kein Körnchen Staub vom ausgedörrten Boden aufgewirbelt wurde. Sie zuckelten dahin, als wäre ihnen nichts gleichgültiger als ihre Heimkehr.
Nervös klemmte Nell eine Haarsträhne unter das Gebände zurück. Sie versuchte die einzelnen Personen zu unterscheiden, aber auf die Entfernung war das unmöglich. Alle trugen bunte, überwiegend rote Röcke, das schwarze Kreuz auf den flatternden Umhängen, die Decken und das andere Gepäck hinter den hohen Zwieseln.
Damals, als der Kaiser zum Kreuzzug aufgerufen hatte, war ihr Onkel mit mehr Pracht losgezogen. Vierzehn Mann hatten ihn begleitet. Ihre Pferde hatten Überwürfe aus grünem Samt getragen, die mit dem schwarzgoldenen Thannhäuser Wappen bestickt waren. Das Gesinde hatte wilde Nelken und Klatschmohnblüten geworfen, die Glocken der Burgkapelle hatten geläutet und der Kaplan war mit dem eisernen Kreuz, das er eigens zu diesem Zweck vom Altar genommen hatte, dem Zug vorangeschritten. Der Onkel war im Heiligen Land einer Darmkrankheit erlegen und nun kehrte der Rest seiner Truppe heim – ganze vier Mann. Und sie quälten sich durch die Felder, als wäre es die Wüste von Aleppo. Nell kniff die Augen zusammen. Einer der Männer musste ihr Cousin sein, aber sie konnte an keinem etwas Herrschaftliches entdecken. Niemand sah aus wie der künftige Gebieter von Thannhausen.
Sie fragte sich, wie die Leute im Dorf die armselige Ankunft ihres Herrn wohl aufnehmen würden. Doch passte diese Rückkehr nicht zu dem wunderlichsten aller Kreuzzüge, in dem die Heilige Stadt, wie es hieß, durch Feilschen befreit worden war, als hätte ein Krämer die Heere geführt? Keine Schlacht war geschlagen, kein Ruhm gewonnen worden. Der Kaiser hatte mit den Ungläubigen Gelage gefeiert, ihre Botschafter zu Rittern erhoben und ihre Frauen geschwängert. Und auf ihm und all seinen Mitstreitern lag nun der Zorn des Heiligen Vaters.
Im Dorf war man mittlerweile auf die Reiter aufmerksam geworden. Die Männer und Frauen, die mit ihren Sicheln auf den Feldern am Fluss Gerste schnitten, drehten auf einen Zuruf die Köpfe und ihre Kinder rannten los und scheuchten die Hühner auseinander. Nell sah, wie die Bauern die Röcke aus den Gürteln zogen und hinter der kreischenden Schar dreinliefen. Die Ankunft des Thannhäuser Herrn wurde dadurch zwar nicht glanzvoller, aber zumindest kamen die Willkommensrufe von Herzen. Seit Macks Vater ins Heilige Land gezogen war, hatte es zwei Hungerwinter mit vielen Toten gegeben und nun freuten sich die Leute, weil sein Sohn heimkehrte und hoffentlich alles wieder in Ordnung brachte. Der alte Thannhäuser war hart gewesen, aber er hatte sie am Leben gehalten.
»Komm in den Hof.«
»Was?« Nell drehte sich um. Ralph, ihr Vater, stand in der Tür. In den Falten und Dellen seines feisten Gesichts glitzerte der Schweiß. Ralph schwitzte immer, aber an einem heißen Tag wie diesem dunstete er das Wasser aus wie eine Schwarte ihr Fett in der Pfanne.
»Dein Bruder und dein Cousin. Sie sind zurück. Ich will, dass sie gebührend empfangen werden.«
Nell merkte, dass Ralph sich ärgerte, weil sie ihn anstarrte. Verlegen senkte sie den Blick. Ihr Vater hatte einen dicken, festen Leib, aber spindeldürre Arme und Beine und hervorquellende Augen. Wenn er auftauchte, musste sie unwillkürlich an die blauschillernden Fliegen denken, die auf dem Fleisch in der Küche saßen. Er war jedoch cholerisch und es empfahl sich nicht, ihn zu verärgern.
»Ich weiß nicht, welche Kammer ich vorbereiten soll«, sagte sie.
Außer der Küche und dem Herrenraum gab es nur ein einziges Zimmer in der Burg, das beheizbar war, und dort stand auch das einzige komfortable Bett mit Baldachin und Vorhängen. Seit dem Tod der Tante vor zwei Jahren, dem Tag, an dem Nell in die Thannhäuser Burg zurückgekehrt war, schlief dort ihr Vater. Er genoss den Luxus, für den er selbst immer zu arm gewesen war, und zweifellos traf ihn die Heimkehr seines Neffen hart. So viele waren im Heiligen Land gestorben, da hätte es gern auch Mack treffen können.
Ralph trat zu Nell in den Sonnenstreifen, den das Mittagslicht durchs Fenster warf. Sie dachte, er wolle ihr Anweisungen geben. Stattdessen schlug er ihr unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht.
Hilflos sah sie ihm nach, als er den Raum verließ. Er sagte kein Wort. Er sagte nie etwas, wenn er sich über sie ärgerte, und auch sonst sprach er kaum mit ihr, obwohl er sich mit Gästen und sogar mit dem Gesinde gern und über jedes Thema ausgiebig unterhielt. Sie spürte, wie ihre Lippe anschwoll. Das und die Tränen, die ihr in die Augen stiegen, würden sie wie eine Hexe aussehen lassen, wenn Mack in der Burg ankam. Nicht, dass es viel verderben würde. Sie war sowieso keine Schönheit. Nicht mit den buschigen Augenbrauen und dem ausgeprägten Kinn.
Sie würde, während die Männer aßen, das Zimmerchen hinter dem Saal ausfegen und mit Stroh bestreuen. Es war ein zugiges Durchgangszimmer, in dem die Katze ihre Jungen großzog, aber zumindest lag es schattig. Sie würde eine Strohmatratze und Decken auslegen und damit musste es gut sein.
Und wenn Mack sich wehrt?, dachte Nell, während sie langsam die Wendeltreppe in die unteren Räume hinabstieg. Ein atemberaubender Gedanke. Was, wenn er die lästige Verwandtschaft, die sich in seinem Haus eingenistet hatte, einfach davonjagte? Wenn er als Mann heimkehrte, gestählt durch die Abenteuer, die auch dieser sonderbare Kreuzzug zweifellos bereitgehalten hatte?
Sie versuchte sich den linkischen sechzehnjährigen Jungen, der die Burg vor drei Jahren verlassen hatte, als selbstbewussten, kraftstrotzenden Riesen vorzustellen. Doch es gelang ihr nicht. Mack glich den Schmetterlingen, die über die Wiesen taumeln, verspielt, von jeder Blüte bezaubert und von jedem Sonnenstrahl geküsst. Er war ein Träumer. Einer, der sich nicht merken konnte, dass man für versäumte Pflichten Prügel bezog. Er hat so viel Prügel erhalten, dachte Nell, dass sein Hintern wie gegerbtes Leder aussehen muss. Sie verzog die Lippen zu einem Lächeln, ließ es aber gleich wieder sein, weil ihr Mund schmerzte.
Mack machte sich nichts aus Strafen. Er schüttelte sich, sagte etwas, das zum Lachen reizte, und verschwand im Wald oder in einer der Hütten im Dorf, die ihm eigentlich verboten waren. Sogar vor der eigenen Schwertleite war er davongelaufen. Direkt aus dem Turnier, in dem er seine Fähigkeiten hätte unter Beweis stellen sollen. Keine Erklärung, keine Entschuldigung – einfach auf und davon. Erst zwei Tage später war er wie ein begossener Pudel heimgekehrt.
Über diese Erinnerung konnte Nell jedoch nicht lächeln. Die Prügel, die Mack für diese Büberei kassiert hatte, hatten die Wände beben lassen und danach war er eine Woche lang für niemanden zu sprechen gewesen. Nell argwöhnte, dass sein Vater ihm den Arm gebrochen hatte, denn Mack hatte ihn anschließend längere Zeit unter dem Rock getragen. Die Wut des Vaters konnte Nell verstehen. Schaudern machte sie dagegen das Lachen seiner Mutter, das die Schmerzensschreie während der Züchtigung begleitet hatte. Das war eine von Nells grausigsten Erinnerungen. Dieses Lachen, das bei jedem Schrei neu hochperlte und in dem nicht ein Hauch von Kummer lag.
Doch die Tante war tot, der Onkel ebenfalls und Mack war erwachsen. Sollte er sehen, wie er zurechtkam.
Unten, im Innenhof der Burg, hatte sich, von Ralph angetrieben, das Gesinde versammelt, eine armselige Meute in schäbigen Kleidern. Scheu drückte sie sich an die Wände. Die beiden Hungerjahre hatten auch unter den Knechten und Dienstmägden ihren Tribut gefordert. Viele waren an Krankheiten gestorben, andere davongelaufen. Ihr Vater hatte sich erst gar nicht bemüht sie wieder einzufangen. Nell argwöhnte, dass es ihm sogar gefiel, wie die Burg sich von den alten Bewohnern leerte. Ralphs Turm mit den wenigen Wirtschaftshäusern war kaum mehr als eine Ruine gewesen, und der Tod seiner Schwester … nun ja, übermäßig betrauert hatte er sie nicht. Er hatte eine neue Heimstatt bekommen, und mit Neil hatte er jemanden, der sie sauber hielt.
»Er ist also zurückgekehrt, der Bastard.« Die dahingezischten Worte kamen von der alten Mathilde, der Amme der verstorbenen Burgherrin. Sie stand abseits in einer Nische, als wäre sie aussätzig, und der Blick ihrer fast erblindeten Augen war undeutbar. Die meisten hatten die Bemerkung gar nicht beachtet, aber Nell zuckte schmerzlich zusammen. Sie hatte jedoch keine Zeit zu reagieren. Die Hufe der Pferde klapperten bereits auf der Holzbrücke und im nächsten Moment waren die Männer im Hof.
Nells Vater setzte seinen Fliegenleib in Bewegung. »Eberhard! Du bist gesund, du bist heim, mein Sohn, welch eine Freude. Und Mack … Was für ein Tag des Stolzes. Matthäus, Alwin, die Pferde – Teufel, helft ihnen aus dem Sattel! Sollen die Eroberer des Heiligen Landes auf ihren Pferden verfaulen? Ein Tag der Freude, wahrhaftig!«
Und Summ und Sirr und alles Heuchelei, dachte Neil verächtlich, während sie zusah, wie Eberhard umständlich vom Pferd stieg und sich von seinem Vater umarmen ließ. Das schlechte Gewissen packte sie, als ihr einfiel, dass sie ihrem jüngeren Bruder bisher noch keinen einzigen Gedanken gewidmet hatte. Dabei flog ihm auf der Stelle ihr Herz zu, als sie ihn mit seinen zwinkernden, kurzsichtigen Augen die Umgebung mustern sah. Sein Gesicht leuchtete. Der Brunnen mit der hölzernen Überdachung, das Backhaus in der Ecke des Hofes, der hölzerne Verbindungsgang zwischen Turm und Wohnhaus … er bestaunte alles, als wäre es aus Gold gegossen, als ginge ihm erst jetzt auf, dass seine Reise zu Ende war.
Ralph winkte das Küchenmädchen zu sich und nahm ihm einen Becher ab. Er ließ seinen Sohn trinken und legte ihm dabei den Arm um die Schulter. Als kröche eine Spinne mit ihren Fadenbeinen über die nächste Mahlzeit, dachte Nell. Doch da tat sie Ralph Unrecht. Wenn er auch niemanden liebte – an seinem Erben und einzigen Sohn hing er.
Der Herr der Burg saß derweil immer noch im Sattel. Widerstrebend, mit klopfendem Herzen nahm Nell ihn in Augenschein. Mack war … nicht mehr der Junge von früher, aber er hatte sich nicht zum Guten verändert. Seine weichen, brauen Locken waren ungepflegt, die Schultern hingen nach vorn. Er hatte sein Lächeln verloren und hielt den Kopf sonderbar schief, wie ein Vogel, der einen Wurm beäugt und sich nicht entschließen kann die Flügel auszubreiten.
Ein … Versager, dachte Nell. Indem er auf seinem Pferd blieb, während alle durcheinander liefen, sonderte er sich ab. Er erhob nicht den leisesten Anspruch auf sein Recht. Und das bedeutete, dass er immer noch derselbe dumme Junge wie früher war, der nicht begriff, was vor seinen Augen ablief. Nell glaubte nicht, dass Ralph Eberhard aus Versehen zuerst den Becher gereicht hatte. Und sie ärgerte sich, dass Mack es wie ein Tropf hinnahm.
Brüsk drehte sie sich um und stieg in die Küche hinab, wo der kleine Jörg, der das Kochen übernommen hatte, nachdem die Köchin sich einen Kessel Brühe über die Beine gegossen hatte, einen Spieß mit Hasen drehte.
»Fertig?«
»Fast.«Jörg nickte fahrig. Seine Kochkünste waren bescheiden. Und die Zeiten, in denen eine spendable Hausherrin für Pfeffer und andere Gewürze gesorgt hatte, die den Geschmack fauligen oder verbrannten Fleisches überdeckten, vorbei.
»Sind die Ritter gesund und munter, Herrin?«
»Was? Oh – ja, ich denke schon. Etwas Rosmarin in die Suppe! Besseres als dieses knorpelige Zeug hatten wir nicht? Nein, reib die Blätter klein. So … zwischen den Fingern.«
Mack war also heimgekehrt. Sein Körper war sehniger geworden, sein Haar länger, sein Gesicht magerer – mehr hatte die Kreuzfahrt nicht bewirkt. Die Jahre würden ihm Falten bescheren, aber er würde als Kind sterben.
Nell nahm den Besen, ging in den kleinen Raum, den sie als Schlafzimmer für Mack vorgesehen hatte, und bearbeitete wütend den Bretterboden. Sie hörte, wie ihr Vater mit den Heimkehrern sprach. Gelegentlich antwortete einer der beiden Bewaffneten, die Mack und Eberhard begleitet hatten. Sie lachten miteinander. Eberhard machte eine holprige Bemerkung. Von Mack hörte man gar nichts.
Nell schob den Schmutz die Stufen hinab, holte ein Bündel Stroh aus dem Stall und warf es in die Ecke zwischen den beiden Türen. Zum Zudecken mochte Mack seinen Mantel benutzen, und wenn ihm nach Blumen zumute war, konnte er sich in den Wald verkriechen wie früher. Immer noch wütend kehrte Nell in ihre Kammer oben im Turm zurück. Sie setzte sich auf ihre Strohmatratze und brach in Tränen aus.
»Nell?«
Die Stimme drängte sich in ihren Traum.
»Nellie? Bist du wach?«
Sie regte sich und versuchte sich zu besinnen, wo sie war, denn in ihrem Traum hatte sie Körbe voller Erbsen gepult, in denen blaue Maden krochen. Ihre Tür stand offen und ein eisiger Schreck packte sie. Doch dann sah sie, dass es nur Mack war, der ratlos mit einem Kienspan unter dem Türbalken stand und wartete.
»Bin ich, ja. Und alles andere wäre ein Wunder, so wie du rumbrüllst. Verschwinde, Mack! Du hast hier nichts zu suchen.« Nell richtete sich auf, wobei sie ihre nackten Brüste bis zum Hals mit dem Laken bedeckte.
»Ich dachte … ich hatte noch gar keine Gelegenheit dich zu begrüßen.«
»Und du meinst, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt?«
»Na ja …« Er trat näher, steckte den Kienspan in die Wandhalterung und wollte zum Bett gehen. Blitzschnell griff Nell unter ihr Laken und riss einen Knüppel hervor.
»Du bist der Herr dieser Burg, das ja. Aber mehr nicht. Wenn dir die Hose juckt, Mack Thannhäuser, sieh dich woanders um.«
Er starrte sie an. »Du schläfst … mit einem Stock im Bett?«
»Es gibt Merkwürdigeres.«
»Tja …«, meinte er hilflos.
»Was willst du?«
»Ich … nichts. Eine freundliche Seele sehen. Ehrlich, Nell.«
»Eine freundliche Seele ohne Kleider und Haube. Du bist ein Schmutzfink. Scher dich davon.«
Er nickte und kehrte sich gehorsam wieder zur Tür.
»Du solltest dich schämen!« Sie sah, wie er nach dem Kienspan griff. »Warte.«
»Was denn nun? Davonscheren oder warten?« Er lächelte sie über die Schulter an. Es war sein erstes Lächeln, seit er heimgekommen war, und nur ein Schatten seiner früheren Fröhlichkeit, aber Nells Herz machte einen Hüpfer. Betont ruppig schob sie ihren Knüppel unter die Decke zurück.
»Erzähl, hat Ralph dich mit Respekt behandelt?«
»Mit dem ehrlichen Respekt eines Fuchses für das Hühnchen. Er hat mir Pfeffer vorgesetzt, den er mit etwas Saubraten würzte, bis mir das Feuer aus dem Mund schlug.«
»Es gibt keinen Pfeffer in der Küche.«
»Für das Hühnchen schon.« Das Lächeln wurde breiter. »So geht es unter Füchsen zu, Nell. Erst Pfeffer und dann Wein. Und der Wein kam auch nicht aus der Küche.«
Sie starrte ihn mit offenem Mund an.
»Das hat aber nichts geschadet«, fuhr Mack fort, »weil ich einen Krug Wasser aus der Küche geholt habe. Nur bin ich heute Abend … Ich bin müde.«
»Aber warum …?«
»Ganz scheußlich müde sogar. Ich bin so müde, dass mich mit Sicherheit nichts aufwecken würde, wenn ich erst einmal die Augen zu habe. Und das macht mir Sorgen und darum bin ich raufgekommen … weil ich dachte …«
Ja, er hatte einen daumenbreiten, schwarzen Rand um die Augen, der sich von seinem Gesicht wie eine Eulenmarkierung abhob. Nell starrte immer noch und Mack wurde plötzlich verlegen.
»Jedenfalls freue ich mich, dass ich dir gute Nacht sagen konnte.« Er zog den Kienspan aus dem Eisenring.
»Du kannst dich da in die Ecke legen«, platzte Nell heraus. Sie griff hinter sich und zog eines der mit zahllosen Flicken besetzten Kissen vor, auf denen sie schlief. Mack fing es mit der freien Hand auf, bedankte sich und drückte die Fackel am Stein aus. Er musste wirklich müde wie der Tod sein, denn nur einen Moment nachdem er sich ausgestreckt hatte, hörte sie seinen gleichmäßigen Atem.
Als Nells Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah sie sein weißes Gesicht unter dem Fenster. Er schlief mit dem Arm im Nacken, die braunen, viel zu langen Locken flossen ihm über den Ellbogen. Sein Mund war so sorgfältig geschlossen, als müsse er sich selbst im Traum in Acht nehmen.
Er tat ihr Leid, wie er ihr schon immer Leid getan hatte.
Kapitel 2
Die Königin stand in der Mitte der sonnigen Kemenate vor einem Tisch, auf dem Stickereien und um Holzstäbchen gewickelte Garne ausgebreitet waren. Ihr Zimmer war bescheiden eingerichtet: ein Bett, zwei wuchtige Reisetruhen mit dunkel angelaufenen Beschlägen, Stühle, die ordentlich um den Tisch gruppiert waren, und, als einziger Luxus, ein großer Wandteppich mit fremdländischen Bauten in strahlenden Blau- und Silbertönen, der die Wand neben dem Bett bedeckte. Die stupsnasige blonde Frau, mit der sie sich unterhalten und die gerade eine Bemerkung zu einem der Stickbilder gemacht hatte, knickste und zog sich diskret in eine Fensternische zurück, als der Waffenmeister den Raum betrat.
Gunther bückte sich unter dem Querbalken der Tür hindurch. Er war für die meisten Türen einige Zoll zu groß und zog aus Gewohnheit den Kopf ein, genau wie er aus Gewohnheit versuchte sich mit dem ersten Blick einen Eindruck des Raums zu verschaffen, den er betrat. Als er niemanden außer den beiden Frauen entdecken konnte, hielt er entgeistert in der Bewegung inne. Er schaute sich um, als könne ein gründlicherer Blick zutage fördern, was er mit Sicherheit hier vermutet hatte. Warum befand sich kein Mann im Raum? Der König, den er eigentlich erwartet hatte, oder wenigstens einer der Grafen oder Ritter – irgendjemand, dessen Kreise sich mit denen eines Waffenmeisters berührten.
Die Königin winkte ihn heran und bat den Diener, die Tür zu schließen. Sie schien also tatsächlich mit ihm sprechen zu wollen, und zwar allein. Gunther trat näher und verneigte sich steif. Er wusste, wie er auf Frauen wirkte. Hölzern wie ein Besen und einschüchternd, was in diesem besonderen Falle allerdings nur seine eigene Verwirrung vermehrte.
Spröde bedeutete Margarete ihm sich zu erheben und murmelte in die Luft zwischen Fenster und Vorhang: »Ich danke Euch, dass Ihr gekommen seid, Waffenmeister. Ich … sicher habt Ihr viele wichtige Pflichten.«
Was kann es Wichtigeres geben als meiner Königin zu dienen – so oder ähnlich hätte ein galanter Ritter geantwortet, aber Gunther brachte diese Worte nicht über die Lippen. Der König und die Königin waren der Grund, warum er die Waffenkammer pflegte wie die Schätze Salomos und warum er seine Knappen bei Wind und Wetter auf den Turnierplatz jagte, um das Letzte aus ihnen herauszuholen. Sein König – und natürlich auch seine Königin – waren sein Heiligtum, das Zentrum seines Lebens und seiner Sorge. Aber er ahnte, dass diese oder eine ähnliche Erklärung in Margaretes Ohren wahrscheinlich wie Hohn klängen. Sie war etwas jünger als er selbst, aber sieben bedauerliche Jahre älter als ihr Gemahl. Und dass sie vom König nicht geliebt wurde, war kein Geheimnis. Heinrich ging ihr soweit als möglich aus dem Weg und bei den unausweichlichen gemeinsamen Pflichten strafte er sie mit Verachtung – nein, schlimmer, mit Missachtung. Der gesamte Hof machte sich darüber lustig.
Margaretes ängstlicher Blick schien zu bedeuten, dass sie von ihm Ähnliches erwartete oder es zumindest nicht ausschloss. Sie wirkte noch verkrampfter als er selbst, und so antwortete er rasch: »Ihr seid meine Königin. Ich komme, wann immer Ihr mich ruft.«
Mit einem Nicken tippelte Margarete zum Fenster, aber nach wenigen Schritten drehte sie sich wieder zu ihm um. Ein Vöglein, misstrauisch, verängstigt, bereit, beim ersten Anzeichen von Gefahr aufzufliegen. Ihr Haar war streng zurückgekämmt und unter einer Haube verschwunden. Sie war mit einer niedrigen Stirn und einem fliehenden Kinn geschlagen und hatte das spitze Gesicht eines Igels. Keine Frau, die das Herz eines jungen Mannes bezaubern konnte. Sie tat ihm Leid – oder sie hätte ihm Leid getan, wenn sie ihn nicht mit dieser ungewöhnlichen Audienz behelligt hätte, deren Sinn er sich bei aller Liebe nicht vorstellen konnte.
»Ihr wundert Euch, warum ich Euch von Euren Aufgaben abhalte.«
Gunther murmelte etwas, während Margarete auf ihre Hände blickte. Sie sah aus, als hätte sie etwas auf dem Herzen, von dem sie nicht wusste, wie sie es herausbringen sollte. Ein Geheimnis? Gunther seufzte still. Er verabscheute Heimlichtuerei.
»Der Herzog von Bayern hasst meinen Gatten.«
»Nun ja«, erwiderte er verblüfft. »Ludwig hat sich einen Welfen auf dem Thron gewünscht. Aber glücklicherweise ist er mit seinen Intrigen gescheitert. Der König hat ihn besiegt und zur Loyalität gezwungen und jetzt ist die Sache ausgestanden.«
»Das hoffen wir alle, ja.«
Und was wollte sie nun? Bei Hof nannte man Margarete einen Klippfisch, aber Gunther bildete sich ein, in ihren hellen Augen eine seltsame Leidenschaft flackern zu sehen. Als ihm bewusst wurde, dass er sie anstarrte und sie damit in Verlegenheit brachte, wandte er den Blick zum Fenster. Das Mädchen, das der Königin Gesellschaft leistete, nähte einen Flicken auf ein Leinenunterhemd, somit schien zumindest das Gerücht, dass die Königin äußerst sparsam lebte, auf Wahrheit zu beruhen. Vielleicht hätte ihr ein bisschen Leichtsinn gut getan. Auf einen jungen Mann von neunzehn Jahren übte Sparsamkeit nicht gerade Reiz aus.
»Es gibt eine Kapelle hier in der Nähe«, unterbrach Margarete sein Grübeln. »Ein Gotteshaus aus Lehm, das die Bauern zum Dank für … für irgendetwas errichtet haben, für des Herrn Gnade. In der Nähe eines Sees. Vielleicht habt Ihr davon gehört. Es heißt, dass der König dorthin manchmal reitet, um seine Gebete zu verrichten.«
Sie sah ihn, um Zustimmung heischend, an, aber Gunther hatte keine Ahnung, was der König tat, wenn er ausritt. Er schulte die Knappen und gelegentlich die Ritter, wenn sie irgendwelche Kniffe bei ihm lernen wollten und einsichtsvoll genug waren, seine Meisterschaft in der Waffenführung anzuerkennen. Aber er gehörte nicht zum engen Kreis des Königs.
»Heinrich glaubt, dass in der Demut eines ärmlichen Kirchleins der reine Geist des Glaubens stärker zum Tragen kommt als in den Kathedralen, daher liebt er diese Kirche.«
Gunther nickte. Er wünschte, die Königin würde endlich damit herausrücken, was sie von ihm wollte.
»Nun ist mir zugetragen worden …« Margaretes Gesicht lief in einem Kreis, der genau den Saum ihrer Haube nachzog, rot an.
»Herrin?«
»Ich glaube, dass man meinen Gatten ermorden will.« Der rote Kreis breitete sich aus, bis das Gesicht der Königin leuchtete wie eine Tomate. »In dieser Kirche. Man hat mir berichtet, dass es möglicherweise Pläne gibt, Heinrich dort …«
»Wer will das?«
»Ich weiß nicht. Ein gedungener Mörder. Ich nehme an, ein Mann des Baiernkönigs. Ich … kenne nur Gerüchte. Aber da es um die Person des Königs geht …«
»Habt Ihr ihm davon berichtet?« Die Frage war dumm. Wenn Margarete ihren Gatten informiert hätte, dann hätte sie kaum seinen Waffenmeister zu sich rufen lassen.
»Das kann ich nicht. Der König ist sehr beschäftigt. Und er glaubt auch nicht … Ich meine, er hält es für unmöglich …«
Er ist leichtsinnig. Das wollte die Königin sagen. Und er hörte ihr nicht zu, weil er sie langweilig und anstrengend fand. Obwohl sie steif wie ein Stock dastand, hatte Gunther das Gefühl, dass Margarete sich innerlich krümmte.
»Warum erzählt Ihr mir davon und nicht … Anselm … Robert von Bolanden … Er hat zahllose Ritter um sich, die Einfluss auf ihn haben.«
»Weil ich niemanden sonst kenne, der den König ohne Vorbehalt liebt.«
Das Mädchen im Fenster ließ bei diesen schlichten Worten das Leinenhemd sinken und sah zu ihnen hinüber.
»Jeder hier am Hof …«
»… geht seinen eigenen Interessen nach«, erklärte die Königin ruhig.
»Und Ihr wollt …«
»Ich will, dass Ihr meinen Gatten beschützt, ja.«
Margarete hatte noch ein zweites Geheimnis – und sie litt Höllenqualen, weil es plötzlich so offen im Raum lag, als hätte man es in der Mitte des sonnenbeschienenen Tisches zur allgemeinen Begutachtung ausgelegt. Die Königin liebte ihren Gatten. Sie liebte den Mann, der ihr so schnöde die kalte Schulter wies, als hätte sie ihn mit der vom Heiligen Vater eingefädelten Heirat persönlich kränken wollen, und der sie mit der Unüberlegtheit der Jugend ohne Unterlass demütigte. »Ich gehe davon aus, dass Ihr niemanden über das Gesprochene ins Vertrauen zieht.« Das Sticktuch rutschte ihr aus den Fingern und blieb an der Tischkante hängen.
»Aber wie soll ich ihn dann schützen, Herrin?«
Es schien, als hätte die Kraft, die die Königin erfüllte, sie mit dem Tüchlein verlassen. Sie tastete nach einem Stuhl, sank darauf nieder und wirkte plötzlich doppelt so alt. Ja, genau das war die Frage: Wie schützte man einen Vogel, der am Himmel segelte?
»Wie soll ich ihn schützen, Herrin?«, wiederholte Gunther seine Frage.
»Ich … ich weiß es nicht. Gebt einfach auf ihn … Acht.«
Einfach Acht geben, dachte Gunther und schlug gereizt nach einer Bremse, die ihn mit der Penetranz ihrer Gattung attackierte. Der Tag war heiß und die Luft so schwül wie im Badehaus. Nach seiner Ansicht war es Unfug, um die Mittagszeit eine Beizjagd anzusetzen. Aber der König wollte hinaus und Gunther fühlte sich in der Pflicht, wenn er auch nicht genau wusste, in welcher. Margarete hatte ihm einen Auftrag gegeben, der nicht zu erfüllen war: Er sollte zu jedermann schweigen und gleichzeitig den König vor einer Gefahr schützen, die so greifbar wie der Nebel an einem Herbstmorgen war. Sie verlangte Unmögliches und wäre sie nicht die Königin gewesen, ihm wäre mehr als ein Fluch entfahren.
Die Sonne knallte in den Hof der Nürnberger Kaiserpfalz. Es war Hochsommer. Schwärme von Fliegen und Bremsen belagerten den Misthaufen, den die Stallknechte neben dem Stalltor aufgehäuft hatten, und stürzten sich angriffslustig auf die Reiter. Beruhigend tätschelte Gunther seinem Rappen den Hals. Es war kein Problem gewesen, vom König eingeladen zu werden. Da Heinrich die Jagd – und besonders die Falkenjagd – über alles liebte, lebte er in dem Glauben, dass jeder danach lechzen müsse ihn zu begleiten. Gut gelaunt hatte er Gunthers Bitte entsprochen. Nun schwang er sich in den Sattel seines weißen Hengstes, lachte und philosophierte über die Jagdkunst.
»… Es ist der Triumph des Geistes, keine Gewalt. Die Macht einer starken Seele über eine ebenso starke Seele. Begreift Ihr, was ich meine, Gunther? Beizjagd bedeutet, die Natur des Vogels zu ändern, sein Wesen. Ich lehre ihn zu tun, was er niemals von sich aus getan hätte. Darin liegt die Herausforderung. Und das Glück. Der Triumph. Himmel, was seid Ihr für ein Stein, Mann! Habt Ihr kein Herz in der Brust? Warum freut Ihr Euch nicht?«
Heinrich war ein hervorragender Reiter. Sein Hengst trabte an, als könne er die Gedanken seines Herrn lesen. Wenn mein König so viel Feingefühl für Tiere aufbringt, wird er auch lernen Menschen einzuschätzen. Das wird ihn vorsichtig machen und ihn schützen, dachte Gunther, während er dem ungestümen jungen Mann zum Tor folgte, wo der Rest der Jagdgesellschaft bereits wartete. Einen Moment erwog er, Heinrich von seiner Unterredung mit der Königin zu berichten. Doch der König vibrierte vor Ungeduld und ein Blick in die übermütigen Gesichter der anderen Männer verschloss Gunther den Mund. Seine Hingabe galt dem König, aber er würde auch die Königin keinem Spott ausliefern.
Heinrich ließ sich vom Falkner seinen Lieblingsvogel reichen, einen jungen, ausgehungerten Sakerfalken, ein Geschenk seines Vaters, des sizilianischen Kaisers. Er schnürte sich die Fessel um die Faust und trabte an. Sein malvenroter Mantel flatterte im Wind, seine rotblonden Locken, das Erbe des Vaters, leuchteten in der Sonne, während er sich vorbeugte und den Burgpfad herabdonnerte und anschließend zwischen den Zelten mit den bunten Dächern und Fahnen hindurchjagte, in denen der niedere Teil seines Gefolges wohnte, um das offene Gelände zu erreichen.
Die meisten der Ritter, die ihm nachsetzten, waren jung. Robert von Bolanden, Emmerich von Thann, Heinrich von Sayn, der Graf von Döhrenbach – keiner von ihnen war mehr als ein paar Jahre älter als der König. Nur Anselm von Justingen trug an der Last der Jahre. Und der Nürnberger Burggraf, der seinen König pflichtgetreu auf jeden Ausritt begleitete, obwohl ihm die Gicht zu schaffen machte und er wahrscheinlich den Tag herbeisehnte, an dem Heinrich zu seiner nächsten Pfalz aufbrechen würde. Zwei Knappen gehörten ebenfalls zur Jagdtruppe, Noah und Prosper. Zusammen bildeten sie einen Trupp von knapp zwanzig Mann – genug, den König zu schützen, wenn man sie nicht gerade mit einer Armee überfiel.
Die Zeltstadt und die Wiesen lagen schon bald hinter ihnen. Sie erreichten einen Wald, wo sie ihr Tempo zügelten und kurze Zeit den Schatten unter dem Laubhimmel genossen. Dann lichteten sich die Bäume wieder und vor ihnen lag, inmitten der Felder, ein Leibeigenendorf hinter einem Zaun aus krummen Ästen. Gunther hörte den König einen Jubelschrei ausstoßen, während er seinem Hengst die Hacken in die Weichen stieß und mit ihm über einen Bach setzte. Er beugte sich so elegant über den Kamm des Pferdes, dass Noah, der das Federspiel trug und ihm auf den Fersen war, wie ein besonders plumper Affe wirkte.
Noah ist ein guter Kämpfer, aber im Sattel taugt er nicht viel, dachte Gunther, während er den Knappen beobachtete, der den Vorsprung des Königs wieder aufholen wollte. Ihm fehlte das Gleichgewichtsgefühl. Sein Körper befand sich niemals völlig mit den Bewegungen des Pferdes im Einklang und das machte das Tier nervös. Schade, denn Noah war kräftig und ein guter Kämpfer, vor allem mit der Axt und der Lanze, und es war Zeit, ihn für den Ritterschlag zu empfehlen.
Der König zügelte das Pferd. Er hatte einen mit Schilf und Sumpfschachtelhalmen bewachsenen See erreicht, über dem ein Purpurreiher schwebte – ein seltener Anblick in dieser Gegend. Vielleicht ein diskretes Geschenk des Burggrafen, mutmaßte Gunther. Das Tier auf Heinrichs Faust schien zu spüren, dass die Jagd beginnen sollte. Es schlug mit den Flügeln, als Heinrich nach der Haube griff. Die Glöckchen am Geschüh seiner Fessel klingelten.
»Er ist ein König – wenigstens so sehr, wie ich einer bin«, rief Heinrich begeistert aus, als sein Falke in die Luft stieß und in einem majestätischen Bogen an Höhe gewann.
»Und mit dem gleichen tödlichen Schnabelhieb«, stimmte der Burggraf in plumper Lobhudelei zu. Sein graues Haar klebte im Nacken und seine Lippen zitterten. Er konnte kaum verbergen, welche Anstrengung es ihn kostete, das Tempo der jungen Männer mitzuhalten. Gunther sah, wie er unauffällig im Sattel rutschte und sein Gewicht verlagerte.
Der Falke ließ sich Zeit. Sein Opfer kreiste weit unter ihm. Das blaugraue Gefieder des Reihers und sein überlanger, schlanker, rotvioletter Hals schimmerten im Sonnenlicht – die Verheißung eines Glücks, das den Falken gierig, nein, halb verrückt machen musste, das er aber trotz seines Hungers noch hinauszögerte. Der Falke bewegte kaum die Flügel. Es war ein wundervoller Anblick.
Nur dass Gunther ihn nicht genießen konnte. In einem ehrenvollen Kampf war es möglich, den König zu schützen. Was aber, wenn der bayrische Herzog sich eines Meuchelmörders bediente, der ebenso lautlos kreiste und zustieß wie der Falke? Unauffällig begann Gunther das Gebüsch und den Waldrand jenseits des Sees abzusuchen. Er trug seinen Bogen bei sich, genau wie Robert von Bolanden und einige der anderen jungen Leute. Pfeile waren eine gute Abwehrwaffe, aber auch das ideale Gerät für einen Mordversuch aus dem Hinterhalt.
»Jetzt. Er stößt herab.« Der König sprach leise, in ungespielter Verzückung. So wie er mit seinem Pferd verbunden war, schien er auch zu spüren, was in dem Falken vor sich ging.
Der See, über dem der Vogel kreiste, hatte eine flache, nasenförmige Ausbuchtung, die vom Schilf überwuchert war. Hinter dem Schilf standen Mandelweiden und hüfthohes Unkraut. Gab es dort eine Bewegung? Einen Moment lang meinte Gunther, etwas Braunes durch die Blätter schleichen zu sehen. Ein Reh? Zwei Blässhühner flogen auf und brachten sich auf dem ,Wasser in Sicherheit. Etwas strich dort entlang, das sie als Gefahr …
Der König brüllte auf und Gunther blieb das Herz stehen. Aber es war nur ein Jubelschrei – ein Begeisterungsruf, dem ein dutzendfaches Echo folgte. Der Reiher schien in der Zeit, als Gunther abgelenkt gewesen war, einen Fisch aufgespießt zu haben, denn der Falke trug zwei zappelnde Beutetiere über die gekräuselte Wasserfläche.
»Robert?«
Der Graf von Bolanden klebte mit seinem Blick am Himmel. »Hm?«
»Ich reite um den See.« Gunther fasste ihn am Ellbogen. »Bei den Weiden dahinten rührt sich was. Ich will nachsehen, was es ist.«
»Warum?« Robert lächelte über den jungen König, den der bizarre doppelte Jagderfolg in einen Taumel versetzt hatte.
»Weil es nötig ist. Tu mir den Gefallen und behalte das Ufer im Auge. Und achte auf den König.«
Es war die Warnung der Königin, die Gunther von der Jagdgesellschaft forttrieb, nichts sonst, wie er sich eingestand, und wahrscheinlich hielt Robert ihn für einen übervorsichtigen Pedanten. Aber das Wesen in den Büschen war zu groß gewesen für eine Ralle oder ein Teichhuhn und Rot- und Schwarzwild würde den sumpfigen Grund meiden. Wenn es sich jedoch wirklich um einen Menschen handelte – welchen Grund hätte er, sich im Schilf nasse Füße zu holen?
Das Gelächter der Jagdgesellschaft begleitete Gunther um den See. Er galoppierte und kam schnell voran, aber einen Steinwurf vor der Stelle, an der er das verdächtige Wesen gesehen zu haben meinte, musste er absteigen. Ein Wall aus Unkraut und Dornensträuchern türmte sich vor ihm auf. Sein Misstrauen verstärkte sich. Es gab hier weder einen Trampelpfad noch eine andere Möglichkeit sich an den Dornen vorbeizuschlängeln. Das war kein Platz, an dem man sich gemütlich die Zeit vertrieb. Er nahm sein Messer und machte sich auf ins Dickicht, wobei er still über jeden Dorn fluchte, der den Stoff seines Rocks zerriss. Je näher er dem Ufer kam, desto verfilzter wurde das Dickicht. Leider konnte er nicht feststellen, wo sich das verdächtige Wesen aufhielt, denn er scheuchte selbst sämtliches Getier auf.
Am Ende hatte er aber auch keinen Hinweis mehr nötig – er fiel über das, was er suchte. Die Überlegung, dass ein Mörder, der dem König auflauerte, ihn auf jeden Fall vom Seeufer ausspähen musste, hatte ihn bis zu den Waden ins Wasser getrieben. Und dort, zwischen Pfeifengras, Teichrosen und im Trüben verborgenen Wurzeln stieß er gegen ein Bein. Er wäre darüber gestolpert und bäuchlings im Schlamm gelandet, hätte er sich nicht im letzten Moment mit einer Hand im Geäst einer Weide fangen können.
Die Beine lagen still und die Füße waren gegeneinander verdreht, der eine über dem anderen. Kein Mensch würde freiwillig solch eine unnatürliche Stellung einnehmen, so viel stand fest. Trotzdem war Gunther vorsichtig. Er schloss die Hand fester um das Messer und bog vorsichtig die Zweige auseinander.
Sein erster Gedanke war, dass der Mann, der im brackigen Wasser lag, Glück gehabt hatte. Er war bewusstlos und der größte Teil seines Körpers befand sich im Nassen, aber sein Kopf war bei dem Unfall oder was immer ihn niedergestreckt hatte auf sich gabelnden Weidenzweigen gelandet. Ein Dorn hatte ihm das Kinn bis zum Ohr aufgerissen und seine Haut war zerkratzt, aber der Busch hatte ihn vor dem Ertrinken bewahrt.
Gunther schob sein Messer in den Gürtel zurück. Er packte den Ohnmächtigen einen jungen Burschen, nicht älter als die Knappen, die er ausbildete – unter den Achseln. Es war eine mühsame Rackerei, ihn aus dem Morast zu schleifen, besonders weil der junge Mann weibisch lange Haare hatte, die sich in jeder Ranke verhedderten. Gunther riss sich einen langen Schlitz in den Rock, bekam Schlamm in die Stiefel und war froh, als er wieder offenes Gelände erreichte und den Jungen ins Gras fallen lassen konnte.
Nicht nur die Haare des Verletzten wirkten weibisch, auch sein Gesicht, wie er mit Widerwillen feststellte. Seine Nase war schmal, mit zarten Flügeln, die beim Atmen bebten. Die Lippen schwangen sich in einem Bogen über das Dreieck des Kinns, das viel zu fein war, um Willenskraft auszudrücken, die Haut war kleinporig und samtig und die Wimpern glichen schwarzen Seidenfäden. Zwei weiße, makellose Zähne bohrten sich in seine Unterlippe, als er sich bewegte und noch völlig benommen nach seinem Kopf zu tasten begann.
Er hatte eine Platzwunde zwischen Schläfe und Ohr. Sie war dick angeschwollen und erklärte seine Ohnmacht. Als er in diesen Brei aus Schmutz und Blut fasste, öffnete er endlich auch die Augen. Katzenaugen in seltsamen Grüntönen von unterschiedlicher Färbung, die in Schlieren ineinander liefen. Gunther mochte sie ebenso wenig wie den Rest seines Äußeren und er besann sich wieder auf das wichtige Faktum: Er hatte den Verletzten an einer verdächtigen Stelle gefunden – in einem Morast, dem Ufer gegenüber, an dem sein König jagte.
»Bist du wach?«
Der Junge antwortete nicht. Er setzte sich auf und es zeigte sich, dass seine Schmerzen offenbar nicht nur mit der Beule zusammenhingen, denn er tastete nach seinem Hals und dann nach seiner Schulter.
»Wo ist deine Waffe?«
»Was?« Er hielt sich den Oberarm und zuckte zusammen.
»Deine Waffe«, wiederholte Gunther.
»Ich habe keine.«
»Oh! Du bist ein Bauer?« Das war er offensichtlich nicht, es sei denn, die Kleider, die er trug, waren gestohlen. Sie waren nicht luxuriös, aber besser als alles, was sich ein Bauer leisten konnte. Ein blaubeerfarbener Rock, ausgewaschen, aber von ordentlicher Qualität, mit grünem Besatz an Halsausschnitt und Ärmeln. Der Rock reichte ihm bis zu den Knöcheln – die Saumlänge eines Edelmanns.
Der Junge fasste sich wieder an den Arm und diesmal entfuhr ihm ein derber Fluch, während gleichzeitig die Farbe aus seinem Gesicht wich. Er ließ den Arm los und drückte die Stirn gegen die Knie. Die Locken verdeckten sein Gesicht, aber Gunther nahm an, dass er weinte. Angewidert verzog er das Gesicht.
Er stand auf und zerrte ohne viel Rücksicht den Rock des Jungen über die Schulter, bis die Haut frei lag. Eine Handbreit unter der Schulter klaffte eine Wunde, die von Blut troff und aus der das abgebrochene Ende eines Pfeils ragte. Das Blut hatte den Dreck fortgespült, aber der Pfeil war in einem ungünstigen Winkel eingedrungen. Als Gunther den Arm drehte, sah er die Metallspitze schwarz unter der zarten Haut der Achselhöhle schimmern. Das hintere Ende des Pfeils war gesplittert und wahrscheinlich beim Sturz abgebrochen. Ob die Pfeilspitze einen Widerhaken besaß, ließ sich nicht feststellen. Aber das gesplitterte Ende war lang genug, um sie vollständig durch das Fleisch zu treiben und zu entfernen.
»Stillhalten!«, befahl Gunther. Er zog sein Messer und glättete das zersplitterte Holz. Dann stieß er den Pfeil mit einem kräftigen Ruck durchs Fleisch. Es war eine blutige Schweinerei, die ihm die Hose verdarb und ihn ärgerte, weil sie ihn zwang, von seinem König fortzubleiben. Er mochte den Jungen nicht: wegen seiner Erscheinung und weil er sich verdächtig verhalten und noch immer keine Erklärung dafür geliefert hatte.
»Kann ich sehen?« Der Junge war nicht mehr blass, sondern weiß wie ein Blumenkohl. Seine Hand, die er ausstreckte, zitterte.
Gunther fiel erst jetzt auf, dass die Stimmen der Jäger, die sie bisher wie das Murmeln eines entfernten Bachs begleitet hatten, lauter geworden waren. Der König schien sich auf die Suche nach seinem Waffenmeister gemacht zu haben.
»Bitte.« Der Junge hielt noch immer die Hand offen.
»Es ist eine Pfeilspitze. Ein Stück von deiner Haut hängt dran. Sei froh, dass es dich nicht umgebracht hat, und damit gut. Warum hast du dich am Ufer rumgetrieben?«
»Ich würde sie mir gern ansehen.«
»Und ich würde gern wissen … mein König? Hier, ich bin hinter den Büschen.« Gunther trat ein paar Schritt zur Seite, damit die anderen ihn sehen konnten. Er winkte und kehrte zu dem Verletzten zurück. »Also los – was hast du in dem verdammten Sumpf gewollt?«
Der Junge hatte sein Gesicht wieder auf die Knie gelegt. Sein Haar fiel nach vorn, so dass ein Teil seines Halses frei lag. Dort zog sich eine blutige Schürfwunde entlang. Der Scheitel klebte ebenfalls von Blut. Gunther bezweifelte, dass dies bei einem Sturz geschehen war. Man hatte den Jungen niedergeschlagen.
»Ich danke dir, dass du mir geholfen hast«, hörte er ihn murmeln.
»Was mich glücklich macht. Und noch glücklicher wäre ich …«
»Ich sagte, ich danke dir.«
»Interessiert mich nicht. Verstanden? Was wolltest du am See?«
»Ich danke dir.« Der Junge sah auf. Seine hübschen Lippen waren schmal geworden. »Aber fass mich im Leben nicht mehr an. Du bist schlimmer als ein Sauschlächter.«
Der König war so nah, dass Gunther seine Stimme von denen der anderen unterscheiden konnte. Im nächsten Moment bog er mit seinen Rittern um die Büsche. Der Junge sah auf. Wie eine Katze, dachte Gunther erneut. Ein Katzenvieh, das sich eingekreist fühlt und die Nackenhaare sträubt. Er stand auf, etwas zu hastig nach der Prügel, die er eingesteckt haben musste, und offenbar war ihm schwindlig, was er mit tiefen Atemzügen zu bekämpfen suchte.
»Gunther! Seht her!« Der König wies lachend auf die Beute, die an seinem Sattel baumelte. »Einen Reiher und einen Weißfisch. Mein Liebling ist nicht nur ein exzellenter Jäger, er ist durchtrieben wie der Leibhaftige. Ihr habt Euch um einen großartigen Augenblick gebracht, vielleicht um den besten dieses Sommers. Was ist? Was macht dieser Mann hier?«
Der Verletzte trat – nein, er taumelte – einen Schritt zurück. Er lächelte, was Gunther ebenfalls missfiel, denn wenn es einem dreckig ging, gab es keinen Grund das zu verbergen. »Vergebt Herr, gar nichts. Ich war … ich hab einem Eurer Pfeile im Weg gestanden. Es ist nichts …«
»Knie nieder, Bengel. Du stehst vor deinem König«, fuhr Gunther ihn an.
»Nein, lass. Ist er verwundet?« Heinrich musterte den Fremden neugierig. »Wie heißt du?«
»Ich … Mack. Markward.«
»Und weiter? Du wirst doch ein Zuhause haben. Wo kommst du her?«
»Von Thannhausen, Herr. Ich würde knien, aber ich fürchte …«
»Was ist das? Eine Burg?«
»Ich kenne den Kerl«, schnitt der Burggraf dem Jungen das Wort ab. »Seinem Vater gehört eine Burg südlich von hier. Ein paar Dörfer, Wälder und Ländereien. Nichts Besonderes. Oder vielmehr – seinem Vater gehörte die Burg. Er soll im Heiligen Land ums Leben gekommen sein. Ist er doch, oder?« Der Graf blickte den Jungen an, sprach aber weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. »Mack ist der Erbe. Er ist älter geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe – aber er ist es ohne Zweifel.« Er machte keinen Hehl aus seiner Abneigung und Gunther fühlte sich in seinem Argwohn bestätigt.
»Warst du auch im Heiligen Land? Beim Kreuzzug?« Bisher hatte Heinrich mit müdem Interesse gefragt, aber als der Junge nickte, richtete er sich plötzlich kerzengerade im Sattel auf. »Und? Hast du den Kaiser gesehen?«
»Ja, ein paar Mal.« Mack lächelte erneut. Es war kein ehrliches Lächeln. Vielleicht weil er Schmerzen hatte. Gunther wollte gerecht sein. Mit Schmerzen sah jedes Lächeln wie eine Grimasse aus.
»Warst du bei seiner Krönung in der Kirche zu Jerusalem dabei?«
»Ich glaube nicht, mein König, dass dieser … Nichtsnutz der Mann wäre, dem unser Kaiser die Gnade seiner Gegenwart gewährt hätte«, bemerkte der Burggraf abfällig.
»Warst du?«
»Nicht wirklich.«
»Ja oder nein?«
»Mein Vater …«, sagte der Junge und man merkte, wie er überlegte und zögerte, »… hatte dem Kaiser einen Dienst erwiesen. Dabei ist er umgekommen und deshalb hat der Kaiser mir und meinem Vetter erlaubt …« Er stockte. Seine Hand wanderte zur Schulter, aber als er es merkte, ließ er sie wieder sinken. »Wir haben hinten gestanden. In einer Ecke der Kapelle der Beschimpfungen. Man konnte fast nichts sehen.«
»Dein Vater ist für das Kreuz gestorben?«
»Nein, er … Der Kaiser brauchte jemanden und mein Vater stand bereit.«
Gunthers Misstrauen stieg. Niemand machte seine Verdienste – oder die seiner Leute – klein, wenn es nicht etwas zu verbergen gab. Er war überzeugt, dass der Junge log. Wahrscheinlich hatte er die Kirche von Jerusalem nicht einmal von außen gesehen.
Heinrich beugte sich vor. »Zeig mir den Pfeil, der dich getroffen hat.«
»Hier ist er. Ich habe ihn.« Gunther gab ihn seinem Herrn und beide, der Junge wie der König, betrachteten das blutverschmierte Metall mit dem Holzende.
»Aus deinem Köcher, Emmerich?«
Der Ritter nickte, nachdem er das Objekt des Interesses ebenfalls begutachtet hatte.
»Unser Falke hat auf dem Flug zurück zum Federspiel ein Dutzend weitere Reiher aufgeschreckt. Wir haben danach geschossen und ein paar Pfeile sind hinter dem See niedergegangen. Du hattest Pech … Mack.« Der König überlegte. »Du hattest Pech, aber es war nicht deine Schuld. Wenn mein Vater deinen Vater belohnte, weil er sein Blut vergoss, dann sollte ich, der ich deines vergossen habe, wenn auch unabsichtlich, nicht knauseriger sein. Was wünschst du dir, Mack?«
Der Junge wich einen weiteren Schritt zurück – wie die Katze, bevor man sie am Schlafittchen packt, dachte Gunther – und schüttelte den Kopf. Sein Lächeln war unechter denn je. »Nein, Herr, was … brauche ich schon? In Jerusalem hat mich die Sonne verbrannt – hier habe ich ein Dach, das mich schützt. Ich habe Essen und Trinken, ich habe meine Laute …« Er redete dummes Zeug, weil er nicht wusste, was er sagen sollte. »Ich bin völlig zufrieden …«
»Willst du an meinen Hof kommen?«
Es war eine romantische Laune. Jeder wusste, wie hart es den jungen deutschen König getroffen hatte, dass er seinen Vater nicht ins Heilige Land begleiten durfte. Scheinbar wollte er sich jetzt mit dem Jungen ein Stück Jerusalem in seinen Palas holen.
»Verzeiht, mein König«, begann Anselm. »Wir wissen fast nichts …«
»Was hast du hier am Ufer zu tun gehabt?«, fiel Gunther dem Grafen unhöflich ins Wort. Denn auf diese Frage hatte er noch immer keine Antwort erhalten.
Heinrichs Stirn umwölkte sich, worauf Gunther erklärte, während er seine Stimme zu zähmen versuchte: »Der Bengel hat sich äußerst verdächtig benommen, Herr. Ich habe ihn an einer Stelle des Sees erwischt, wo man bis zu den Waden im Schlamm steht und nicht einmal fischen kann. Er war nicht auf der Jagd, denn er hatte keine Waffe bei sich. Außerdem dürfte er hier gar nicht jagen. Ich denke also, er sollte damit herausrücken, was zum Teufel …«
»Was wolltest du hier?«, fragte Heinrich.
»Nichts anderes als … in einen Pfeil springen, um mich in die Gunst meines Königs zu schleichen, wie jeder hier vermutet. Ich habe kein Unrecht getan, Herr. Ich wollte gar nicht dorthin, wo ich war. Ich habe mich verlaufen. Das Pech sitzt mir im Nacken, wie Ihr selbst gesagt habt. Und es tut mir leid …«
»Wenn du eine Laute zu deinen Schätzen zählst, dann bist du ein Sänger?«
Es wäre ein Fehler, Heinrich abzuraten, dachte Gunther. Der König besaß die Tugenden seiner Geburt – Tapferkeit, Edelmut und Großzügigkeit –, aber auch die Fehler seiner Jugend. Starrsinn war einer davon.
»Oh … nein, nein. Früher. Aber meine Stimme ist unter Jerusalems Sonne so kratzig geworden wie ein Igelpelz.«
»Kannst du lesen? Liednotationen, meine ich.«
»Wenig.«
»Er ein Taugenichts. Vergebt, Herr, aber das muss gesagt werden.« Die Stirn des Burggrafen umwölkte sich. Er war ein rechtschaffener Mann und außerdem einer, der die Tücken seines Amts kannte. Sicher raubte ihm die Vorstellung, dem König könne während des Aufenthalts auf seiner Pfalz ein Unglück geschehen, seit Wochen den Schlaf. »Ich habe die jungen Männer hier aus der Gegend, die das Kreuz nehmen sollten, auf meine Burg geladen, um sie zum Ritter zu schlagen. Die Zeit eilte … Ihr wisst, der Ruf kam überraschend. Sie brauchten keinen Nachweis ihrer Fähigkeiten abzulegen, außer einem Kräftemessen in einem Tjost. Ein bisschen Lanzenscheppern, sonst nichts. Aber dieser Mack war ein Feigling und ist davongelaufen.«
»Du bist davongelaufen?«
Alle sahen den Jungen an.
»Wie der Herr sagt.« Es ging Gunther auf die Nerven, dass der Junge immer noch lächelte. Zumindest jetzt hätte er beschämt den Kopf senken sollen. »Ich mag das nicht – blanke Schwerter und Pferde, die gegeneinander jagen. Es erschreckt mich …«
»Du bist also ein Nichtsnutz und Feigling.«
»Ihr wiederholt die Worte meiner Mutter, Herr. Ja, das bin ich.«
Und jetzt, dachte Gunther, gib dem Wicht einen Tritt und jag ihn zum Teufel. Ihm fiel auf, dass es dunkler geworden war. Und kühler. Am Himmel waren Wolken aufgezogen und die Luft drückte wie in einem Backofen. Es würde ein Gewitter geben. Auch der Burggraf warf einen besorgten Blick gen Himmel. Wahrscheinlich stellte er sich vor, was der Kaiser mit ihm anstellen würde, wenn sein Thronerbe, einer seiner beiden leiblichen Söhne, in Nürnberg von einem Blitz erschlagen würde.
»Holt sein Pferd und bringt ihn zu mir auf die Burg, Gunther.«
»Bitte, Herr?«
Der König grinste den Waffenmeister mutwillig an. »Ich habe entschieden. Dieser Junge hat Hände, die in der Lage sind, ein Schwert zu tragen. Er hat einen gesunden Körper. Und auf den Mund gefallen ist er auch nicht. Ich will, dass Ihr aus ihm einen Ritter macht.«
»Vergebung, Herr.« Anselm ließ sich von den gerunzelten Brauen des Königs nicht einschüchtern. »Selbst der beste Schmied formt aus einem Klumpen Mist keine Klinge.«
»Ich gebe ihm ein Jahr«, beharrte Heinrich. »Und dann soll er gegen Euch antreten. Ein alter Mann mit Erfahrung gegen einen jungen, dem Gunther bis dahin hoffentlich genügend beigebracht hat, dass er mir keine Schande bereitet.«
»Ich soll gegen einen Streuner …«
»Niemand verlangt, dass Ihr ihn schont.« Heinrichs Pferd stieg mit Vergnügen auf die Hinterhufe, als er es aufstachelte, und Ross und Reiter jagten dem Gewitter entgegen.
Missvergnügt sah Gunther sich nach dem Pferd des Jungen um.
Kapitel 3
Mack starrte an die Decke. Durch die Schlitze, die im oberen Teil des Raumes angebracht waren, drang silbergraues Licht. Möglicherweise war es Abend, aber es konnte ebenso gut Nachmittag sein. Der Himmel wurde durch das Gewitter, das inzwischen mit aller Macht tobte, verfinstert. Blitze erhellten die Fenster, im nächsten Moment sanken sie ins Dunkel zurück. Irgendwann im Laufe dieses grauenhaften Tages war ihm das Zeitgefühl abhanden gekommen. Er verkroch sich tiefer unter seiner Decke und lauschte dem Donnergrollen.