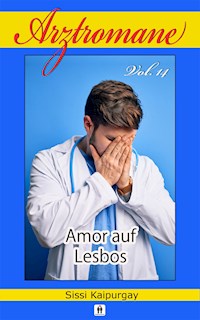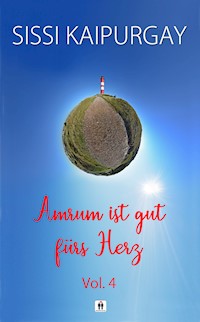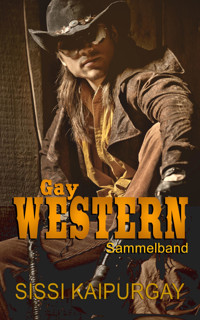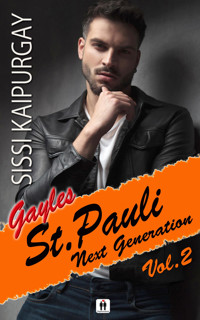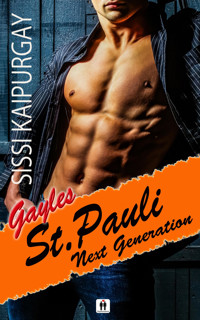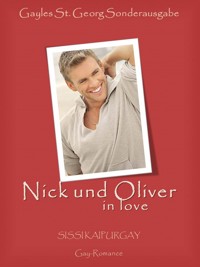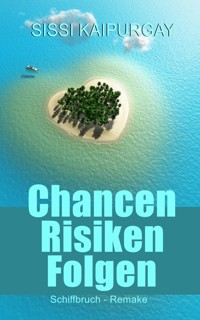3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luis leidet unter Schuldgefühlen. Sein Partner Joshua ist nämlich während eines Streitgesprächs, in dem er ihre Trennung verlangt, ins Koma gefallen. Ein Kollege erzählt ihm von einem Schamanen, der vor langer Zeit einen Patienten mit ähnlicher Diagnose geheilt hat. Die Idee, diesen Mann in den USA aufzusuchen und um Hilfe zu bitten, setzt sich bei ihm fest. Dabei schuldet er Joshua gar nichts, aber er kann eben nicht aus seiner Haut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Schamane Yakari
Arztromane Vol. 21
Sämtliche Personen, Orte und Begebenheiten sind frei erfunden, Ähnlichkeiten rein zufällig. Der Inhalt dieses Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Covermodels aus. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin.
Texte: Sissi Kaipurgay/Kaiserlos
Korrekturen: Aschure, Dankeschön!
Fotos/Bilder: Depositphotos, shutterstock
Cover: Lars Rogmann
Kontakt:
https://www.sissikaipurgay.de/
Sissi Kaiserlos/Kaipurgay
c/o Autorenservice Karin Rogmann
Kohlmeisenstieg 19
22399 Hamburg
Der Schamane Yakari
Luis leidet unter Schuldgefühlen. Sein Partner Joshua ist nämlich während eines Streitgesprächs, in dem er ihre Trennung verlangt, ins Koma gefallen. Ein Kollege erzählt ihm von einem Schamanen, der vor langer Zeit einen Patienten mit ähnlicher Diagnose geheilt hat. Die Idee, diesen Mann in den USA aufzusuchen und um Hilfe zu bitten, setzt sich bei ihm fest. Dabei schuldet er Joshua gar nichts, aber er kann eben nicht aus seiner Haut.
Prolog
Endlich vernahm Luis Geräusche an der Haustür. Auf diesen Moment wartete er seit Stunden.
Mittags hatte ihm ein Kollege erzählt, Joshua in einem Club beim Fremdknutschen gesehen zu haben. Abel war Krankenpfleger und arbeitete auf derselben Station wie er. Als er kürzlich rausgefunden hatte, dass Abel in die gleichen Etablissements wie Joshua ging, hatte Luis ihm ein Foto seines Partners gezeigt und gebeten, die Augen offenzuhalten. Es war nicht okay, seinen Liebsten zu bespitzeln, aber ... nein, kein aber, es war wirklich nicht in Ordnung.
Joshua spähte ins Wohnzimmer. „Hi. Bestellen wir heute was zu essen?“
„Ich muss mit dir reden.“ Am liebsten würde er Joshua eine reinhauen, doch das wäre unzivilisiert. Um nicht in Versuchung zu geraten, blieb er auf der Couch sitzen. Auf diese Weise stellte der Tisch eine effektive Barriere dar.
„Was gibt’s denn?“, wollte Joshua wissen.
„Du hast mir versprochen, zukünftig treu zu sein.“
Joshuas Miene drückte pure Unschuld aus. „Bin ich doch auch.“
„Fremdgehen fängt beim Küssen an.“
Joshuas aalglatte Maske bekam einen Riss. „Ich küsse niemanden, außer dich.“
„Muss ich dir Beweisfotos präsentieren?“
„Lässt du mich etwa beschatten?“, erkundigte sich Joshua in anklagendem Tonfall.
„Jemand hat zufällig gesehen, wie du im Goldenen Hirsch rumgeknutscht hast.“
„Na und? Darf ich jetzt noch nicht mal mehr guten Freunden ein Küsschen geben?“, brauste Joshua auf.
Luis‘ Puls befand sich am Anschlag, hatte er jedenfalls gedacht. Nun stieg er noch weiter in die Höhe. Er ballte die Hände zu Fäusten. „Was nützen mir deine Versprechen, wenn du dich nicht daran hältst?“
„Ich hab doch gesagt ...“
„Hör auf, mich zu verarschen!“, unterbrach er Joshua und sprang auf. „Steh wenigstens dazu, wenn du Scheiße gebaut hast!“
„Na gut, ich hab den Typen geküsst und hinterher genagelt. Was soll ich denn sonst tun, wenn du ständig keine Lust hast?“
Nun schob das Arschloch auch noch ihm den Schwarzen Peter zu! „Ich hab die Nase voll! Pack deinen Kram und verschwinde!“
Als wäre ein Schalter umgedreht, wandelte sich Joshuas Miene von aufsässig zu schuldbewusst. „Ich wollte das gar nicht. Ich wäre viel lieber mit dir in die Kiste gesprungen.“
Luis winkte ab. „Spar dir das.“
„Bitte! Du musst mir glauben! Ich hab mir die ganze Zeit vorgestellt, dass du anstelle des Typen bist.“
Es war zum Kotzen! Joshua beherrschte die gesamte Klaviatur der Manipulation. Über fünf Jahre ließ er sich das nun schon gefallen. Er musste endlich einen Schlussstrich ziehen, sonst ging er an ihrer Beziehung kaputt. „Es ist aus. Ich gebe dir eine halbe Stunde, dann bist du weg.“
„Nein!“ Flehentlich streckte Joshua ihm beide Hände entgegen. „Ich will dich nicht verlieren!“
Stumm schüttelte Luis den Kopf.
Einige Momente guckte Joshua ihn Welpenblick an, verdrehte dann die Augen und fiel plötzlich – wie vom Blitz getroffen – um. War das ein neuer Trick? Allerdings einer, der wehtat, denn Joshua hatte keinerlei Anstalten gemacht, den Sturz abzufangen.
Misstrauisch beäugte Luis die reglose Gestalt. Schließlich ging er um den Couchtisch herum und neben Joshua auf die Knie. „Lass die Schmierenkomödie. Steh auf.“
Keine Reaktion.
Als Joshuas Zustand auch einige Minuten später unverändert war, alarmierte er den Notarzt, weil er einen Schlaganfall befürchtete. Ein Rettungswagen brachte Joshua in die Notaufnahme.
1.
Er hätte gegenüber Joshuas Mutter den Streit verschweigen sollen. Jedes Mal, wenn Luis der Frau an Joshuas Bett begegnete, erdolchte sie ihn mit Blicken. Na gut, er gab sich auch die Schuld daran, dass ihr Sohn umgefallen war. Schließlich war es infolge ihres Wortwechsels geschehen. Wenn er Joshua noch eine Chance eingeräumt hätte, wäre es vielleicht nicht passiert.
Was die Ursache war, konnte keiner der Kollegen diagnostizieren. Joshua war von allen möglichen Spezialisten untersucht worden – ohne ein greifbares Ergebnis. Doktor Grafenstein, Facharzt für Neurologie, mutmaßte, dass Joshua an einer neuen Variante des Kleine-Levin-Syndroms, auch Dornröschenschlaf genannt, litt. Normalerweise wachten solche Patienten aber zwischendurch auf. Joshua weigerte sich jedoch beharrlich. Außerdem fiel man dann nicht von jetzt auf gleich ins Koma.
Seinen Eltern tat die Entwicklung leid. Sie mochten Joshua sehr. Seine Schwester Natalie hingegen meinte, dass Joshua seine gerechte Strafe bekommen hatte. Sie wusste, im Gegensatz zu ihren Eltern, von der ständigen Fremdgeherei.
Angesichts der reglosen Gestalt, die einst ein aktiver und fröhlicher Mann war, konnte er ihr nicht zustimmen. Es tat weh, völlig hilflos zu sein. So oft es ihm möglich war, übernahm er es, Joshuas Zähne zu putzen, ihn zu kämmen und einzucremen. Da Joshua in der Klinik lag, in der er arbeitete, konnte er das so gut wie jeden Tag tun.
Der Zustand dauerte inzwischen schon zehn Wochen. Luis merkte, dass er allmählich an seine Grenzen geriet. Neben dem Schichtdient stundenlang an Joshuas Bett zu sitzen und von Schuldgefühlen zerfressen zu werden, würde ihn bald in die Knie zwingen.
Am Anfang der elften Woche verordnete er sich, kürzerzutreten. Joshuas Pflege überließ er den Kollegen und beschränkte seine Anwesenheit im Krankenzimmer auf dreißig Minuten. Mehr, als Joshuas Hand halten und ihn stumm anglotzen, konnte er ja eh nicht.
Seine Mutter hatte seinen Kühlschrank mit vorgekochten Gerichten gefüllt. Pflichtschuldig wärmte er sich eines davon auf. In letzter Zeit war bei ihm die Nahrungsaufnahme zu kurz gekommen. Sie hatte ja recht, wenn sie sagte, dass er viel zu mager wurde.
Entgegen seiner festen Überzeugung, dass man nicht vor der Glotze essen sollte, ließ er sich mit seinem Abendessen auf der Couch nieder. Während er die Portion verspeiste, guckte er eine Quizshow. Inhaltlich rauschte sie an ihm vorüber, weil er gedanklich mit Joshuas Schicksal beschäftigt war.
Nachdem er den Teller leergegessen hatte, schallte er durch die Kanäle und blieb bei einer Doku hängen. Es ging um Reservate in den USA. Wer glaubte, dass dort bunte Tipis standen und die Bewohner fröhlich ihrer Stammesrituale frönten – weit gefehlt. Es schockierte ihn zu sehen, in welch ärmlichen Verhältnissen die Menschen lebten. Zwar hatte er schon vorher gewusst, dass Amerikas Ureinwohner ein kärgliches Dasein fristeten; es zu sehen, war jedoch ein anderes Kaliber. Am schlimmsten war jedoch die Hoffnungslosigkeit in den Gesichtern.
Der Bericht handelte von Leuten, die versuchten, das Leben der Reservatsbewohner zu verbessern. Bessere Bildung, bessere Bedingungen für Häftlinge, mehr Farbe im Alltag durch Veranstaltungen. Eine Schweizerin, die einen der Bewohner geheiratet hatte, war mit ihren inzwischen erwachsenen Kindern aktiv an solchen Aktionen beteiligt. Ihre Energie und Zuversicht fand Luis bewundernswert.
Es hatte gutgetan, sich mal auf etwas anderes als Joshua zu konzentrieren. Sobald die Glotze aus war, holte ihn die Realität jedoch wieder ein.
Am nächsten Tag hatte er Frühdienst. Nachdem er den Patienten, der in der Nacht eingeliefert worden war, untersucht hatte, begab er sich in sein Büro, um den bürokratischen Mist zu erledigen. Kaum saß er am Schreibtisch, stand er wieder auf, um sich Kaffee aus der Teeküche holen.
Sein Kollege Roger Campbell traf kurz nach ihm ein. Roger war Onkologe und stammte aus den USA.
„Lass mir was über“, bat sein Kollege, den Blick begehrlich auf die schwarze Brühe in der Glaskanne gerichtet.
„Suchtie.“ Luis schenkte Kaffee in seinen Becher.
„Selber“, gab Roger zurück und nahm ihm die Kanne aus der Hand. „Gibt’s was Neues über Berger?“
Er schüttelte den Kopf. „Zustand unverändert, keine neuen Erkenntnisse.“
Roger stellte die Glaskanne zurück in den Kaffeeautomaten. „Vielleicht sollten wir einen anderen Ansatz als die Schulmedizin nehmen.“
„Wie meinst du das?“ Luis lehnte sich gegen die Arbeitsfläche und nippte an seinem Kaffee.
„Ich hab mal ein Praktikum in einem Hospital in Albuquerque gemacht. Dort gab es einen ähnlichen Fall. Weil sich die Ärzte nicht mehr zu helfen wusste, und auch weil es sich um ein Stammesmitglied der Apachen handelte, haben sie den Medizinmann des entsprechenden Reservats dazu geholt.“
„Und?“
„Der Mann behauptete, dass der Patient von bösen Geistern besessen sei. Er hat einen Exorzismus durchgeführt und den Patienten damit geheilt.“
„Glaubst du an sowas?“
„Ich war live dabei. Also, nicht bei dem Exorzismus, aber vorher und nachher.“
„Und es ist ausgeschlossen, dass Patient und Medizinmann zusammengearbeitet haben?“
„Du meinst, ob sie uns bloß reingelegt haben? Ausgeschlossen.“ Roger öffnete den Kühlschrank und inspizierte dessen Inhalt. „Fuck! No milk!“
„Milch vergiftet deinen Verdauungstrakt.“
Die Antwort bestand in einem mürrischen Brummeln. Roger knallte die Kühlschranktür zu. „Jedenfalls solltest du dich mal nach alternativen Behandlungsmethoden umsehen.“
„Danke für den Tipp.“ Er schenkte Roger ein Lächeln und ging zurück in sein Büro.
Erst abends kam er dazu, über ihr Gespräch nachzudenken. Er war ja gern bereit, jeden Strohhalm zu ergreifen, aber wo sollte er in Deutschland einen Medizinmann auftreiben? Ein Kleriker kam für ihn nicht infrage. Diese Klientel hatte er gründlich gefressen und noch gründlicher, seit die ganzen Missbrauchsvorwürfe laut geworden waren.
Das Vibrieren seines Smartphones riss ihn aus seinen Grübeleien. Das Konterfei seiner Schwester erschien auf dem Display.
„Hi Schwesterchen“, begrüßte er sie.
„Wollte mal hören, wie’s bei dir so ist.“
„Keine Veränderung.“
Natalie seufzte. „Hast du endlich seinen Kram eingepackt und zu seiner Mutter gebracht?“
„Nein.“
Sie seufzte abermals. „Soll ich das für dich erledigen?“
„Nein!“
„Du kannst doch nicht ewig in der Zeitschleife festhängen. Ihr habt euch getrennt. Nun zieh es auch durch.“
„Ich kann Joshuas Zustand nicht ausnutzen.“ Kaum waren die Worte raus, wusste er, dass er damit eine Standpauke herausgefordert hatte.
Zum x-ten Mal musste er sich anhören, dass Joshua ihn jahrelang ausgenutzt hatte; dass Joshua ein Schmarotzer und Arschloch war. In gewisser Weise stimmte das. Als er Joshua kennenlernte, hatte der noch bei seiner Mutter gewohnt. Langzeitstudent, dann in Teilzeit Bibiliotheksmitarbeiter. Da reichte das Geld eben nicht, um sich eine Wohnung zu leisten.
Neben dem Schwur, sich beruflich neu zu orientieren, hatte Joshua ihm nach jedem Fehltritt – wobei wohl nicht jeder ans Tageslicht gekommen war – geschworen, fortan treu zu sein. Es war eben schwierig einen Partner zu haben, der im Schichtdienst arbeitete und deswegen zeitlich eingeschränkt und häufig müde war. Luis sah ein, dass ein Leben mit ihm eine Herausforderung darstellte. Deshalb hatte er Joshua etliche Male verziehen.
„Ich bin heilfroh, dass du ihn nicht geheiratet hast. Dann müsstest du bis ans Ende deines Lebens für seine Pflege aufkommen“, beendete Natalie ihren Monolog.
„Er wird wieder gesund.“ Woran er allerdings von Tag zu Tag weniger glaubte.
Sie schnaubte verächtlich. „Wäre ja auch schade, wenn ein so aktiver Bezirksbefruchter dauerhaft ausfallen würde.“
„Und was macht dein Liebesleben?“, versuchte er ein Ablenkungsmanöver.
„Derzeit sieht es mau aus. Du solltest in Urlaub fahren.“
Natalie erinnerte ihn an einen Rottweiler. Hatte sie sich einmal in ein Thema verbissen, ließ sie nicht mehr los.
„Ich denke mal darüber nach.“ Wie viele der engagierten Kollegen schob er seine Urlaubstage seit einiger Zeit vor sich her. Bei ihm hatte sich einiges angesammelt.
Das war auch ein Streitpunkt gewesen. Joshua wollte mit ihm in den Urlaub fahren und zwar möglichst zu Fernzielen. Bahamas, Südafrika, Australien. Die Finanzierung hätte er übernehmen müssen, genau wie er die Raten fürs Haus allein bezahlte. Zweimal hatte sich Luis darauf eingelassen, doch dann verlangt, dass sich Joshua beteiligte. Daraus war nichts geworden, weil dessen ganzes Geld für Clubbesuche und was auch immer draufging.
„Bitte denk intensiv darüber nach“, mahnte Natalie. „Und nun hab ich dich genug vollgelabert. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann.“
„Mache ich“, versprach er.
Nachdem er aufgelegt hatte, widmete er sich erneut der Frage, wo er einen alternativen Heiler herbekommen sollte. Scharlatane trieben sich haufenweise in Deutschland rum. Wenn er überhaupt an übersinnliche Kräfte glaubte, dann am ehestens an die der Urvölker.
Er holte sein Notebook aus dem Arbeitszimmer, stellte es auf den Couchtisch und tippte Albuquerque als Suchbegriff ein. Als Schüler hatte er ein Jahr in den USA verbracht. Einen groben Überblick über die Bundesstaaten besaß er, doch das Land war einfach zu groß, um sich all die größeren Städte und deren Lage zu merken.
Albuquerque lag in New Mexico. Im Umkreis befanden sich einige Reservate. Er nahm sich vor, Roger am nächsten Tag zu fragen, aus welchem der besagte Medizinmann stammte. Vielleicht konnte der Kollege ihm auch den Namen des Mannes nennen.
Mit dem Notebook wechselte er auf die Terrasse. Der Garten bräuchte mal wieder ein bisschen Pflege. Gras und Unkraut wucherten. Es handelte sich nur um eine kleine Fläche. Joshua hatte immer gespottet, dass man das handtuchgroße Grundstück kaum als Garten bezeichnen konnte. Warum fielen ihm eigentlich ständig die unangenehmen Dinge ein? Sollte man von einem kranken Menschen nicht nur positiv denken, genau wie über einen Toten?
Er besann sich der schönen Zeiten, die sie geteilt hatten. Der Sex mit Joshua war super. Die Urlaube hatte er auch in guter Erinnerung. Faule Stunden am Strand. Romantische Abende mit Sonnenuntergang und exotischem Essen. Heiße Liebe unterm Moskitonetz.
Ihr verflixtes Jahr hatte nicht im siebten, sondern im dritten begonnen. Joshua war, wenn Luis Nachtdienst hatte, immer öfter allein losgezogen. Ersten Verdachtsmomenten folgte die Gewissheit, dass sein Partner woanders rumvögelte. Joshua hatte es zugegeben und Besserung geschworen. Seitdem waren sie in einer Endlosschleife gefangen.
Um nicht wieder in den negativen Bereich abzudriften, konzentrierte er sich auf seine Recherche. Regelmäßig suchte er im Internet nach Berichten über Leute, die trotz langem Koma vollständig genesen waren. Es gab einige Wunderheilungen, doch keiner dieser Menschen war ohne Beeinträchtigung geblieben. Das menschliche Gehirn erlitt während einer langwährenden Komaphase nun mal irreparable Schäden.
Außerdem suchte er eine Diagnose für Joshuas Zustand. Seine Kollegen waren hervorragende Fachleute, trotzdem ... Es gab Krankheiten, die so wenige Menschen betrafen, dass kaum jemand etwas davon wusste. Bevor Corona seinen Siegeszug rund um den Globus angetreten hatte, war das Virus – jedenfalls in seiner damaligen Form - ja auch unbekannt gewesen.
Er eignete sich einen Haufen unnützes Wissen an. Beispielsweise, dass Gaumenspalten, landläufig Hasenscharte genannt, vermehrt im asiatischen Raum auftraten. Regelmäßig reisten Ehrenamtliche dorthin, um die Betroffenen zu operieren. Das war interessant, doch es beantwortete seine Fragen nicht.
2.
„Das Reservat heißt ... irgendwas mit M.“ Roger zückte sein Smartphone und wischte auf dem Display herum. „Mescalero. Ich erinnere mich nur an den Nachnamen des Medizinmannes: Black Elk. Er war schon ziemlich alt und das Ganze ist ein Vierteljahrhundert her. Wahrscheinlich lebt er nicht mehr.“
„Wird das Wissen nicht von Generation zu Generation weitergegeben?“
Roger zuckte mit den Schultern. „Das Wissen – ja. Die Kräfte – keine Ahnung.“
„Hast du noch Kontakt zu dem Hospital?“
„Ab und zu schreibe ich mit einem der Ärzte hin und her. Warum fragst du?“
„Ich spiele mit dem Gedanken, hinzufliegen und mit Black Elk, oder dessen Nachfolger, zu reden.“
„Wenn meine Frau anstelle deines Mannes auf der Intensiv wäre, würde ich es auch tun.“ Roger klopfte ihm auf die Schulter. „Falls du fliegst, sag bitte Bescheid, damit ich dir etwas für meinen Bekannten mitgeben kann.“
Später, als er an Joshuas Bett saß und dessen schmale Hand hielt, wuchs in ihm Entschlossenheit. Er würde den weiten Weg auf sich nehmen. Falls es umsonst war, hatte er es zumindest probiert.
In den folgenden Tagen kümmerte er sich um die Formalitäten. Ein Visum musste her. Der Flug war irre teuer, doch das war ihm Joshuas Genesung wert. Die Klinikleitung genehmigte seinen Antrag auf drei Wochen Urlaub, wenn auch zähneknirschend. Früher oder später hätten sie ihm eh freigeben müssen.
Seine Eltern fanden seine Entscheidung richtig. Wie bereits erwähnt, wussten sie nichts von Joshuas Verfehlungen. Das durfte auch gerne so bleiben. Natalie hielt dicht, das hatte sie ihm versprochen. Sie war zwar dagegen, dass er wegen Joshua derartigen Aufwand betrieb, hieß seine Reisepläne aber gut.
Dank Rogers Hilfe gelang es ihm, binnen einer Woche ein Visum zu erhalten. Allein hätte er es niemals geschafft, den ESTA-Antrag zu stellen. Wegen des Rechtsrucks in den USA musste man bei den Fragen nämlich höllisch aufpassen, in keine Falle zu laufen. Hätte er beispielsweise seine Homosexualität erwähnt, wäre er bestimmt nie in Besitz des Visums gekommen. Bekanntermaßen waren der neue Präsident und seine Schergen ja allesamt homophob und Rassisten noch dazu.
Zwei Wochen nachdem er entschieden hatte, die Reise anzutreten, verabschiedete er sich von Joshua. „Du musst jetzt eine Weile ohne mich auskommen. Ich versuche, Hilfe zu holen.“
Keine Reaktion. Nicht mal ein Wimpernzucken.
„Ich habe meine Eltern gebeten, regelmäßig bei dir vorbeizuschauen“, redete er weiter. „Und deine Mutter ist ja auch noch da.“
Er beugte sich übers Bett, hauchte Joshua einen Kuss auf die Wange und verließ das Zimmer.
Ihm graute vor dem endlosen Flug. Fast siebzehn Stunden würde er unterwegs sein. Wegen des Zeitunterschiedes flog er morgens los und kam am späten Nachmittag an; sofern alles glatt lief. Hoffentlich hielt man ihn in Denver nicht auf. Roger hatte ihm zwar versichert, dass sein Visum in Ordnung war, aber wer wusste schon, was sich der Irre im Weißen Haus als nächstes ausdachte?
Er hatte Glück und erreichte zur geplanten Zeit sein Ziel. Ein Hotel hatte er vorab gebucht, damit er nicht erst eines suchen musste. Das Comfort Inn Albuquerque Airport war preiswert und zu Fuß von den Terminals gut zu erreichen. Nach dem ewigen Sitzen war Luis dankbar, seine Beine endlich wieder bewegen zu können.
Das Jahr als Austauschschüler hatte er in Rochester, das lag am Ontario See, verbracht. Die Landschaft dort glich der gewohnten seiner Heimat. New Mexico war ein anderes Kaliber. Es gab kaum Baumbestand. Gelbes, hohes Gras wuchs auf jeder unbebauten Fläche. Vom Hotel aus konnte man, so flach war das Land, bis zum Horizont gucken. Allgegenwärtig: Hochspannungsleitungen, die zumeist an der Straße entlangführten.
Das Hotelzimmer war sauber und mit einem breiten Bett ausgestattet. Er duschte, schickte seinen Eltern eine Nachricht, dass er gut angekommen war und legte sich schlafen. Allerdings kam er nicht zur Ruhe. Joshuas blasses Gesicht geisterte durch seinen Kopf. Was sollte er tun, wenn er keine Hilfe fand? Er konnte sich doch nicht von einem Komapatienten trennen. Das war moralisch unvertretbar.
Schließlich stand er wieder auf, zog sich an und begab sich ins Erdgeschoss. Eine Bar existierte nicht, lediglich ein Snack- und Getränkeautomat. Im vorderen Gebäudeteil, an der Straße, war jedoch ein Lokal, das mit Craft-Beer, Cocktails und Grill warb.
Neben einem jungen Pärchen war er der einzige Gast. Er bestellte ein Bier, dazu einen Burger.
Während er auf sein Essen wartete, guckte er aus dem Fenster. Ein Sattelzug fuhr vorbei, dann ein Pickup. Ohne fahrbaren Untersatz war man in den USA verloren. Vergeblich hatte er nach einer Verbindung nach Mescalero Ausschau gehalten. Was machten Amerikaner, die sich kein Auto leisten konnten? Per Anhalter reisen? Wahrscheinlich.
Der Burger schmeckte erstaunlich gut. Zwischen den Brötchenhälften klebte sogar ein Salatblatt. Ob der Fleischanteil wirklich Fleisch enthielt, wollte er aber lieber nicht wissen. Mit einem zweiten Bier spülte er sein Abendessen hinunter und ging zurück ins Hotel.
Gegen neun lieh er am nächsten Tag einen Wagen und fuhr zu der Adresse, die Roger ihm genannt hatte. Ein einstöckiges Haus mit gelber Fassade, das von einer hohen Mauer umgeben war. Er läutete am Tor, woraufhin es nach innen aufschwang. Entweder war Doktor Adrian Smith ein unvorsichtiger Mensch oder es gab eine Kamera.
Rogers Bekannter war ein kleiner, glatzköpfiger Mann mit sympathischem Gesicht und festem Händedruck. „Willkommen in meinem bescheidenen Heim.“
„Ich wollte eigentlich nur etwas abgeben.“ Er hielt Smith das Päckchen, das Roger ihm mitgegeben hatte, hin.
„Für einen Tee werden Sie doch bestimmt Zeit haben“, erwiderte der Doktor, ignorierte das Paket und bedeutete ihm mit einem Wink, das Haus zu betreten.
Von einem winzigen Vorraum ging es direkt in den Wohn- Essbereich. Man merkte sofort, dass hier ein belesener Mann lebte. Eine Wand bestand aus Regalen, die mit Büchern vollgestopft waren. Davor: ein Ohrensessel mit Fußbank.
„Setzen Sie sich“, bat Smith und wies auf eine gemütliche Sitzecke, bestehend aus einem Zweiersofa und einem dazu passenden Sessel. „Schwarz? Oder lieber Kräuter?“
„Wenn Sie Pfefferminztee haben, hätte ich gerne den“, erwiderte Luis, ließ sich auf dem Sofa nieder und stellte das Päckchen neben sich ab. Was sich darin befand, entzog sich seiner Kenntnis.
Der Doktor rumorte hinter dem Küchentresen. Das verschaffte ihm Gelegenheit, seine Umgebung näher zu betrachten. Bei den Büchern handelte es sich um eine bunte Mischung aus Trivial- und Fachliteratur. Auf der Fensterbank vegetierten ein paar Topfpflanzen vor sich hin. Selbst der Kaktus, der sich darunter befand, machte einen schlappen Eindruck, als ob er zu wenig Wasser bekam. Auf dem gefliesten Boden lagen bunte Teppiche. Genauso bunte Wolldecken bedeckten den Fußhocker und hingen über die Lehne des Sofas.
Die Wände, an denen keine Regale standen, waren mit Bildern gepflastert. Etliche Fotografien, dazwischen Diplome. Eines der Fotos zog Luis magisch an. Er stand auf und beäugte es aus der Nähe. Das Bild zeigte eine Gruppe Männer in weißen Kitteln. Doktor Smith erkannte er auf Anhieb, obwohl die Aufnahme älteren Datums sein musste, denn ein junger Roger befand sich ebenfalls darauf. Sein Kollege hatte sich kaum verändert. Das gleiche breite Grinsen, die gleiche Adlernase.
Am Rand der Gruppe stand ein Mann, der sich durch den ernsten Gesichtsausdruck von den anderen abhob. Er trug eine braune Hose, vielleicht aus Wildleder, dazu ein weißes Hemd, an dem nur wenige Knöpfe geschlossen waren. Ein Amulett hing an einem Band um seinen Hals. Zumindest glaubte Luis, dass es eines war. Das Bild war zu klein, um es im Detail zu erkennen.
„Das ist Black Elk“, erklang direkt hinter ihm Smiths Stimme, was ihn zusammenzucken ließ, denn er hatte gar keine Schritte gehört. „Roger hat geschrieben, dass Sie sich für ihn interessieren.“
Er drehte sich zu Smith um. „Ist die Geschichte, die Roger mir über die Wunderheilung erzählt hat, wahr?“
Der Doktor nickte. „Ich war dabei.“
„Und was denken Sie, was die Heilung ausgelöst hat?“
„Vielleicht war der Patient wirklich vom bösen Geist besessen. Vielleicht war einfach der Zeitpunkt gekommen, dass er aufwachen sollte. Wer weiß das schon? Letztendlich zählt das Ergebnis, nicht wahr?“ Smith schenkte ihm ein Lächeln und begab sich wieder zur Küchenzeile.
Luis wandte sich erneut dem Foto zu. „Wissen Sie, ob Black Elk noch lebt?“
„Ich habe ihn vor ungefähr acht Jahren zuletzt gesehen. Er wirkte zwar gesund, war zu dem Zeitpunkt aber bestimmt schon achtzig.“
„Wissen Sie, ob er Kinder hat?“
„Nein. Ich bin ihm nur in der Klinik begegnet.“
Luis kehrte zum Sofa zurück und betrachtete das Päckchen. Was mochte darin sein? Roger hatte geheimnisvoll gelächelt, als er danach fragte.
Doktor Smith trug ein Tablett zur Sitzgruppe, stellte es auf den Couchtisch und ließ sich im Sessel nieder. „Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nie im Reservat war. Wahrscheinlich geht es mir wie vielen meiner Landsleute: Ich möchte nicht mit den Sünden meiner Vergangenheit konfrontiert werden.“
Luis bezweifelte, dass es vielen Amerikanern so ging. Nach seiner Meinung betrachtete sich der überwiegende Teil als rechtmäßiger Eigentümer des Kontinents und die Eingeborenen als lästiges Übel. Vielleicht irrte er sich, aber sowohl die Art, wie man die Natives behandelte, als auch, wie man über sie sprach, ließ ihn darauf schließen.
„Verraten Sie mir, wieso Sie an Black Elk interessiert sind?“, erkundigte sich Smith mit einem charmanten Lächeln.
„Ein Freund liegt seit einigen Wochen im Koma. Niemand weiß warum. Sämtliche Behandlungen waren ohne Erfolg. Black Elk ist gewissermaßen meine letzte Hoffnung.“
Der Doktor beugte sich vor und goss Tee in die beiden Tassen, die auf dem Tablett standen.
„Ein Kollege vermutet, dass es sich um eine Abart des Kleine-Levin-Syndroms handelt. Ich bin von seiner These nicht überzeugt“, fuhr Luis fort.
„Damals wurde der besagte Patient mit Verdacht auf Schlaganfall eingeliefert. Das Hospital in Mescalero ist dafür nicht ausgestattet. Die Erstdiagnose hat sich nicht bestätigt. Wir konnten auch nicht rausfinden, was den Mann ins Koma versetzt hat und darin festhielt.“ Smith reichte ihm eine der Tassen und nahm sich die andere.
Sie fachsimpelten ein bisschen, dann fiel Luis das Päckchen wieder ein. Um es dem Doktor zu überreichen, stellte er seinen Tee ab.
„Ich glaube, ich weiß, was da drin ist.“ Auf Smiths Miene erschien ein freudiges Strahlen. „Meine persönliche Droge.“
Hatte er etwa illegale Substanzen ins Land geschmuggelt? Beunruhigt guckte er zu, wie der Doktor das Paket öffnete. Es kam jedoch kein weißes Pulver oder ähnliches zum Vorschein, sondern in Frischhaltefolie verpackte Franzbrötchen. Zehn Stück stapelte Smith auf dem Tisch und holte als letztes einen gefalteten Zettel hervor.
„Lass es dir schmecken – Liebe Grüße, Roger.“ Schmunzelnd legte der Doktor den Brief beiseite. „Es kann sein, dass ich in meiner letzten E-Mail erwähnt habe, wie sehr ich die leckeren Zimtschnecken aus Idaho vermisse. Die deutsche Bäckerei, bei der ich sie in jedem meiner Urlaube gekauft habe, hat leider geschlossen.“
„Das ist eine unverzeihliche Sünde.“ Luis nippte an seinem Tee.
„Ganz meiner Meinung. Ich sollte den Bäcker verklagen.“ Eines nach dem anderen legte Smith die Franzbrötchen zurück in das Päckchen.
Da der Doktor in den Anblick der Backwaren versunken war, kam er sich überflüssig vor. Er hatte sich eh schon länger als geplant aufgehalten. „Ich muss leider aufbrechen. Vor mir liegt eine lange Fahrt.“
Smith schaute hoch. „Es würde mich freuen, wenn Sie mich auf dem Laufenden halten würden.“
„Sehr gern. Wenn Sie mir Ihre Mobilnummer geben, können wir in Kontakt bleiben.“
Nachdem sie ihre Nummern ausgetauscht hatten, begleitete Smith ihn zur Tür und wünschte ihm eine gute Fahrt.
3.
Nachdem Luis den Rio Grande überquert hatte, führte die Strecke meist durch Ödland. Ab und zu standen ein paar Häuser, von einer Mauer abgeschirmt, an der Straße. Ansonsten gab es Sand, gelbes Gras, ein paar Hügel, Büsche und kleinwüchsige Bäume.
Rund anderthalb Stunden später führte erneut eine Brücke über den Rio Grande. Dahinter wurde die Landschaft etwas hügeliger. Ansonsten gab es keine Abwechslung. Schade, dass er nicht in einem Bus saß und seine Gedanken schweifen lassen konnte. Trotzdem ihm nur wenige Fahrzeuge entgegenkamen, musste er stets aufpassen. An manchen Stellen wies der Asphalt nämlich Beschädigungen auf.
Weitere sechzig Minuten später hatte er den Eindruck, dass die Straße anstieg. Außerdem wurden aus den Hügeln Berge und die Umgebung wies mehr Grün auf. Dann passierte er endlich ein Schild, das die Grenze des Reservats markierte.
An der nächsten Abzweigung bog er von der Hauptstraße ab und fuhr langsam weiter. Links und rechts des Weges standen Bäume, hier und da, teils halb verdeckt von Buschwerk, Häuser. Allesamt waren die Gebäude eingeschossig und erinnerten ihn an Ferienbungalows beziehungsweise Hütten eines Kleingartenvereins. Bedrückend fand er, dass die Grundstücke durchweg verwahrlost aussahen. Vielleicht musste er seine innere Einstellung justieren und es als Natur wahrnehmen. Kaputte Zäune gehörten allerdings nicht in diese Kategorie, genau wie herumliegender Müll.
Er hatte sich natürlich über sein Ziel informiert. In Mescalero lebten eintausendvierhundert Menschen, im gesamten Reservat viertausend. Es gab fünf kirchliche Einrichtungen, ein Hospital und Gesundheitszentrum, eine Leihbücherei, Fisch und Holz verarbeitendes Gewerbe und zwei Lokale. Die Mescalero Apachen betrieben ein Casino und ein Skiresort, das sich großer Beliebtheit erfreute. Was vor Ort gänzlich fehlte, war eine Unterkunft für Reisende.
Luis kurvte ein bisschen herum, bis er das Hospital gefunden hatte. Hoffentlich konnte man ihm hier sagen, wo Black Elk wohnte.
Das Gebäude war zweigeschossig und bestand aus rotbraunen Steinen. Es machte einen relativ neuen Eindruck. Drinnen bestätigte sich das, denn alles wirkte modern und hygienisch. Hinterm Empfangstresen saß eine Frau, die ihn freundlich anlächelte.
Er erwiderte ihr Lächeln. „Ich bin auf der Suche nach Black Elk. Können Sie mir einen Tipp geben, wo ich ihn finde?“
Ihr Blick wurde misstrauisch. „Sind Sie von der Behörde?“
„Entschuldigung. Ich hätte mich erst vorstellen sollen. Mein Name ist Doktor Luis Kornbach. Ich bin den weiten Weg von Deutschland hergereist, um von Black Elk einen Rat einzuholen.“
Das freundliche Lächeln kehrte zurück, sogar eine Spur strahlender. „Was für eine Ehre. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich versuche, ihn zu erreichen.“
Luis ließ sich in einem der Sessel, die an der Fensterfront standen, nieder. Was für ein Unterschied zu der Klinik, in der er arbeitete und in der ständig Hektik herrschte. Diese Einrichtung wirkte eher wie ein Sanatorium als ein Krankenhaus.
Hinterm Empfangstresen telefonierte die Dame in einer fremden Sprache. Luis hatte nicht verstanden, welchen Dialekt man in Mescalero sprach. Die Angaben dazu fand er verwirrend. Davon mal abgesehen traute er sich eh nicht zu, auf die schnelle ein paar Worte zu lernen.
„Black Elk ist im ELA“, informierte ihn die Dame, die inzwischen aufgelegt hatte. „Soll ich Ihnen den Weg erklären?“
„Ja, bitte.“ Er sprang auf und trat an den Tresen.
Binnen weniger Minuten erreichte er sein Ziel. ELA entpuppte sich als Lokal. Ein Flachdachgebäude, vor dem einige Bierzeltgarnituren aufgebaut waren. Der Geruch von Frittierfett hing in der Luft. Luis‘ Magen, der seit dem Frühstück nichts zu tun bekommen hatte, knurrte.
Unter denen, die draußen an den Tischen saßen, entdeckte er keinen Mann, der dem auf dem Foto ähnelte. Er begab sich in das Restaurant, in dem sich nur wenige Gäste aufhielten. Auch darunter befand sich niemand, den er als Black Elk identifizierte. Hatte die Empfangsdame ihn etwa in die Irre geführt?
Einer der Männer, die am Tresen saßen, erhob sich und kam auf ihn zu. Bronzefarbene Haut, dunkle Augen, schwarzes, langes Haar und ein scharfgeschnittenes Gesicht.
„Du suchst Black Elk?“, sprach der Mann ihn an.
Luis nickte.
„Dann hast du ihn gefunden.“
Wollte der Typ ihn verarschen? Oder gab es mehrere Black Elks?
Anscheinend sah man ihm seine Verwirrung an, denn der Mann redete weiter: „Du hast meinen Vater erwartet. Er ist vor vielen Monaten gestorben.“
„Bist du sein Nachfolger?“ Klang das dämlich? Irgendwie schon. „Hast du seine Fähigkeiten geerbt?“
„Er hat mich alles gelehrt, was ihm sein Vater beigebracht hat.“
Diesen Moment suchte sich sein Magen aus, um erneut zu knurren. Wie peinlich! Es klang, als hätte er einen hungrigen Bären verschluckt. „Entschuldigung. Ich bin seit heute Morgen unterwegs und hatte keine Verpflegung an Bord.“
„Dann lass uns gemeinsam essen“, schlug Black Elk vor.
„Darf ich dich einladen?“
„Nein. Du bist mein Gast.“ Black Elk schritt zur Theke und redete mit dem Mann, der dahinter stand.
Er war dankbar, dass Black Elk die Auswahl übernahm. Die Namen der Gerichte, die mit Kreide auf eine Tafel geschrieben waren, sagten ihm nämlich nichts.
Black Elk kehrte zu ihm zurück und wies mit dem Kinn in Richtung Ausgang. Luis folgte ihm nach draußen. Sie setzten sich an einen Tisch, der abseits der anderen in Schatten stand. War dieser Platz den VIPs vorbehalten oder wieso war er noch frei? Alle anderen waren nämlich besetzt. Und warum machte er sich um solche Kinkerlitzchen Gedanken?
„Wie ist dein Name?“, fragte Black Elk.
Beschämt, weil er seine Manieren anscheinend vor dem Reservat abgelegt hatte, antwortete er: „Luis Kornbach. Ich bin Internist in einer Klinik in Deutschland.“
Der Mann, mit dem Black Elk gesprochen hatte, tauchte auf, stellte gefüllte Gläser vor ihnen ab und legte Besteck dazu. Dann ging der Mann wieder davon.
Luis beäugte den Glasinhalt, der wie Orangenlimonade aussah. Er schmeckte auch so, allerdings ohne den gewohnten Zuckerschock.
„Kenai macht die Limonade selbst.“ Black Elk prostete ihm zu und trank ebenfalls einen Schluck.
Er schätzte sein Gegenüber auf dreißig bis vierzig. Black Elk hatte die Haare im Nacken zusammengebunden, trug Jeans und ein graues, vielleicht ehemals weißes, T-Shirt. Um den Hals hing die Kette, die Luis auf dem Foto gesehen hatte. Aus der Nähe erkannte er das Bild eines Adlers auf dem runden Amulett.
„Du hast eine große Strapaze auf dich genommen, um meinen Vater zu treffen.“
Luis‘ Blick huschte von dem Adler hoch zu den braunen Augen. Wäre es unhöflich, mit der Tür ins Haus zu fallen? Andererseits wusste er sonst keine plausible Erwiderung. „Ich habe von seinen Fähigkeiten gehört und wollte um seine Hilfe bitten.“
Stumm guckte Black Elk ihn an.
„Dein Vater hat einen Komapatienten geheilt. Einer meiner Kollegen war dabei und hat mir davon erzählt.“
Weiterhin ruhte der Blick der dunklen Augen auf ihm, ohne dass eine Reaktion erfolgte.