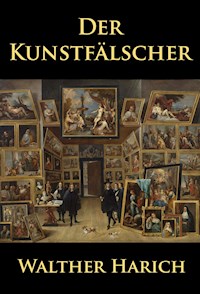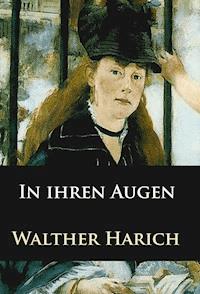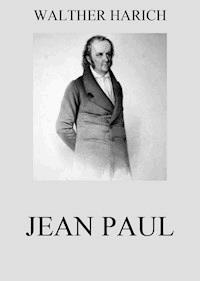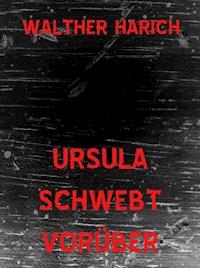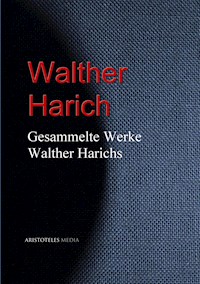Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Kennen Sie van Holten,« fragte Margis, »den Rechtsanwalt? Ich glaube, van Holten hat mir von Ihnen gesprochen.« »So!« antwortete Glasberg kurz und wendete sich ab. Frau Fenn wollte sich ins Gespräch mischen, aber dem Maler fuhr es bereits heraus: »Natürlich! Jetzt weiß ich's: van Holten hat Ihr Bild auf seinem Schreibtisch stehen!« Er bemerkte nicht, daß Glasbergs Miene eisig wurde und die Damen sich verstörte Blicke zuwarfen. Die Musik setzte mit einem Charleston ein. Renate sprang wie erlöst auf und winkte dem Maler zu: »Tanzen Sie Charleston?« »Das nicht,« bekannte er. »Aber wir können steppen.« Während des Tanzes sprach sie wieder kein Wort. Als ob sie eine Pflicht erfüllte, schwebte sie in seinen Armen, ein wohlfunktionierender Mechanismus, dem leisesten Druck gehorchend, aber ohne Seele, steinhart das Gesicht, die Augen niedergeschlagen. Auf einmal sagte sie, ohne daß ihre Miene sich geändert hätte: »Sprechen Sie nie wieder jenen Namen aus!« »Welchen Namen?« fragte er erstaunt. »Van Holten!« ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walther Harich
Der Schatten der Susette
idb
ISBN 9783961509331
1
Seit sechs Wochen lebte Franz Margis, der Maler, jetzt in dem kleinen Badeort Sankt Lüne. Er genoß das Alleinsein, fern von seiner Frau und den Kindern. Es war herrlich, so losgelöst zu sein, in aller Stille morgens mit einigem Raffinement die Nerven auf die Arbeit einzustellen, dem Bogen nachzugeben, wie er sich gerade spannte: für vier, für sechs Stunden, für den ganzen Tag bis zur Dämmerung.
Dann aber wieder waren die Abende da, mit denen er nichts anfangen konnte. Hin und wieder konnte man spazierengehen, möglichst dem Sonnenuntergang aus dem Wege, den alle Menschen pflichtgemäß bewundern gingen. Ein wenig durch das Gehölz streifen. Aber nicht zu oft, denn diese Mischung von wildem Krüppelholz und sauberer Promenade, diese aufgeputzte Dürftigkeit fiel auf die Nerven. Gleich hinter St. Lüne wurde es anders. Da begann die Steilküste mit den dunklen Wäldern, die auf einmal jäh abrissen und mit weißem Dünenhang zum Meer hinunterstürzten. Aber gerade in St. Lüne konnte er hoffen, diese wundersame Meerstimmung zu fassen und künstlerisch zu bewältigen. Diese großartige Öde von Strandhafer, im Wind frierenden Kiefernstämmen, ohne pathetische Linien, ohne steile Hänge, ohne den Hintergrund dunkelblauer Forsten und fetter Felder mit roten Dörfern darin – gerade das reizte ihn. Gerade deshalb hatte er beschlossen, einmal einen ganzen Sommer lang, ohne Familie, hierherzugehen. Und jetzt war er seit sechs Wochen da und rang mit dieser spröden Landschaft.
Nach dem Abendessen blieb er gewöhnlich in der Hoteldiele an seinem Tisch sitzen, bestellte eine Flasche Mosel, hörte zu, wie die Musiker ihre Instrumente stimmten. Und saß noch immer da, wenn die Tanzerei in vollem Gange war. Eigentlich konnte er auch nichts anderes tun als dasitzen. Oben auf seinem Zimmer hörte er doch jeden Ton: den Baß des getrommelten Klaviers, das Klirren des Schlagzeugs, die winselnden Saxophone und den Schleifschritt der Tanzenden. Es blieb ihm geradezu nichts anderes übrig, als hier bis nach Mitternacht zu sitzen, obwohl er in seiner Isoliertheit an dem kleinen Tisch offenbar eine lächerliche und auffallende Erscheinung war: mit der Weinflasche und später der Mokkatasse, immer das aufgeschlagene Buch vor sich, als wenn man bei dem Lärm hätte lesen können. Das einfachste wäre gewesen, das Hotel zu verlassen und sich irgendein Zimmer zu mieten. Man hätte sogar viel billiger leben können. Aber es war, als ob die Jazzband ihn mit ihren Schlagern faszinierte wie die Schlange das gebannte Opfer. Jeden Tag konnte er sich vornehmen, eine Änderung eintreten zu lassen. Am Abend saß er dann doch wieder an seinem Platz, trank, las und sah auf die tanzenden Paare.
Eigentlich hatte er einen besonderen Anlaß gehabt, gerade nach St. Lüne zu gehen. Zunächst war es der künstlerische Grund gewesen: die eigenartig spröde Landschaft. Aber wieviel Landschaften hatte er schon gesehen, die ihn reizten, und dennoch war er nie für Monate, für ein halbes Jahr dorthin gegangen. Es war etwas anderes gewesen: ein Blick, eine flüchtige Begegnung, kaum eine Begegnung, was ihm im vorigen Frühjahr, als er mit seiner Frau sich ganz zufällig einige Tage hier aufhielt, sofort den Gedanken eingab, für längere Zeit hierherzukommen. Sie waren abends auf dem Wege zum Strandhotel durch die Kusseln gegangen. Ein schmaler Steig führte zwischen den Kiefern hin, so schmal, daß zwei Menschen kaum aneinander vorbeikonnten.
Da war ihnen jene Frau begegnet, die er seither nicht wieder ganz hatte vergessen können. Keine sehr junge Frau mehr, vielleicht fünfunddreißig Jahre oder älter. Schwarzes Scheitelhaar über schmalem Gesicht, Knoten im Nacken. Ein weißes Kleid, und ein schwarzer Schal über die Schultern gelegt. Als sie an ihm vorbeiging, konnte er deutlich sehen, daß sie blaue Augen hatte, die in seltsamem Gegensatz zu ihrem dunklen Haar und dem weißen Gesicht standen. Da sie sich dicht und langsam aneinander vorüberdrücken mußten, hatte er die Gestalt genau ins Auge gefaßt.
Aber es war nicht diese Frau allein. Hinter ihr ging ein Mädchen, ein halbes Kind noch, offenbar ihre Tochter. Und das merkwürdige war, daß sie in allem der Gegensatz zu der voranschreitenden Frau schien. Hellblonder Bubikopf, der wiederum mit schmalen, ganz dunklen Augen kontrastierte. Eine kurze, fast aufgewippte Nase, darunter ein ausdrucksvoller Mund, wie der einer reifen Frau. Und in eigenartiger Weise war der Gang der Tochter voll gespannter Beherrschung gewesen, der der Mutter wie eines halbflüggen Backfisches von berückender Unfertigkeit. Zwei Frauengenerationen gingen da vorüber, von denen die ältere, zwischen den Zeiten stehend, nicht ganz fertig mit sich geworden war, und eine jüngere, die, fast vollendet, mit zwei kräftigen Beinen mitten ins Leben hineinsprang und da war.
Diese beiden Gestalten waren für Franz Margis fast eine einzige gewesen. Er konnte die eine nicht ohne die andere denken, nicht das weiße Kleid der Mutter ohne das dunkelblaue der Tochter. Nicht den schwarzen Haarknoten ohne die blonde Tolle. So war eine Deutung in Richtung auf Verliebtheit nicht gut möglich, und doch fühlte er sich von den beiden auf eine merkwürdige und ganz tiefe Art ergriffen, ohne daß er seiner Frau, die gleich ihm beiseitegetreten war, mit einer Silbe von diesem Erlebnis Mitteilung machen konnte. Luisa hatte von den beiden nicht mehr bemerkt als: eine Dame und ihre Tochter; und ganz unnötig war seine Besorgnis gewesen, sie würde sich der Begegnung erinnern und seinem Plan, nach Sankt Lüne zu gehen, mit Mißtrauen entgegenstehen.
Natürlich war das Ganze nicht mehr als eine Spielerei seiner Phantasie gewesen, ein kleines Raffinement, sich die Landschaft, die er malen wollte, reizvoll zu machen und vor sich selbst die Wiederkehr in diesen Ort energischer zu betreiben. Auch hatte er der beiden Erscheinungen, seit er wirklich wieder in St. Lüne war, kaum mehr gedacht, und nur manchmal beobachtete er sich, wenn er Abend für Abend in der Tanzdiele des Hotels saß, daß er in den Gesichtern nach Ähnlichkeiten suchte und sich sogar für ein Wiedersehen mit den beiden wappnete, wenn er zwischen den Kusseln umherstrich. Gerade sechs Wochen war er in Sankt Lüne, als eines Abends Mutter und Tochter in Gesellschaft eines Herrn in die Hoteldiele eintraten und am Nebentisch Platz nahmen.
Die kleine Gesellschaft war – das hatte er bemerkt – mit einem Auto gekommen. Zuerst war der Herr eingetreten, eine auffallende Erscheinung übrigens, und war geradeswegs auf den zufällig leeren Nebentisch losgegangen. Hinter ihm ging das junge Mädchen, erwachsener als im vorigen Jahr, aber kaum verändert, und dann kam die Frau im weißen Kleid, den schwarzen Spitzenschal über den Schultern. Ihre Mäntel und Hüte hatten sie wohl in dem Auto draußen gelassen. Die Art, wie sie Platz nahmen, war keineswegs geräuschvoll und dennoch auffallend. Nicht so sehr durch das selbstbewußte Auftreten des Herrn und die ruhige Sicherheit des jungen Mädchens als gerade durch die unruhige und ein wenig unsichere Art der Frau, die sich zwischen den Stühlen nicht zurechtfand, erst den einen Platz, dann einen anderen versuchte, aus Verlegenheit mitten in einem Piano der Musik den Kellner heranrief und nach Eis fragte.
Franz Margis wartete, bis die Fremden bestellt hatten. Sekt, und für die Damen überdies Eisbecher. Dann ging er in sein Zimmer hinauf, um sich umzuziehen. Er wollte sich nicht etwa besonders fein machen, aber in Breeches und Sporthemd dazusitzen, erschien ihm nicht mehr ganz passend. Als er nach zehn Minuten herunterkam, fragte er den Hotelier hinter dem Büfett nach der Gesellschaft am Nebentisch. Den Herrn kannte man nicht; die Dame aber war Frau Maria Fenn, Besitzerin des Restgutes Klein-Klank, und das junge Mädchen ihre Tochter Renate. Jedermann weit und breit sollte Maria Fenn und ihre Tochter Renate kennen. Der Wirt schmunzelte sogar ein wenig während seines Berichts.
Maria Fenn! dachte Margis, als er sich an seinen Platz setzte. Maria und Renate Fenn!
Der Herr, etwa dreißig Jahre alt, trug einen Ehering. Er sagte »Gnädige Frau« und »Fräulein Renate«, wie Franz Margis deutlich hören konnte. Ihn redeten die Damen mit »Herr Doktor« an. Eigentlich war der Doktor der interessanteste von den dreien. Eine hohe, trainierte Gestalt, amerikanisch bartloses Gesicht, das braune Haar glatt nach hinten gekämmt. »Klug, energisch und sehr reich!« konstatierte der Maler. »Sportsmann oder Industrieller!«
Das Gespräch ging zwischen dem Doktor und der Tochter, aber Margis spürte, daß die Beziehungen zur Mutter vornan standen. Als ein Blues gespielt wurde, forderte der Herr Maria Fenn auf, zögerte aber einen Augenblick, da die Tochter dann am Tisch allein geblieben wäre. Die Augen der Mutter sahen sich verlegen lächelnd im Saale um.
Franz Margis bewunderte sich selbst, da er sich erhob, zu dem jungen Mädchen trat und sich mit kurzer Verbeugung vorstellte. Der Herr und Frau Fenn tanzten schon, ehe der Maler recht zur Besinnung kam. Das Mädchen stand auf und nahm seinen Arm, aber ihre Miene verbot ihm, ein Wort zu sagen. Wozu auch? dachte er. Renate tanzte genau, wie er es sich gedacht hatte. Obwohl sie kunstgemäß seiner Führung folgte, sich jedem Einfall anpaßte – Margis war Eigentänzer, wie er es nannte – schien sie dennoch weitab. Eigentlich bist du eine dumme Gans, dachte er, daß du dich gar nicht darum bekümmerst, mit wem du tanzt. Mit einem, der einen Namen hat, Beste! Dessen Bilder in allen großen Galerien hängen. Es ist keine besondere Herablassung, wenn du mit mir tanzt, kleines Mädchen!
Renates Augen suchten die Mutter. Manchmal lächelten beide Frauen sich beim Tanzen zu. Margis kam es vor, als machten sie sich über ihn lustig und als ginge Frage und Antwort zwischen den beiden hin und her. Eigentlich war er froh, als der Tanz zu Ende war und er Renate an ihren Platz führte. Dennoch, jetzt merkte er, wie diese Begegnung ihn erregte. Durch sie bekam sein Aufenthalt erst einen Sinn. Bisher war alles unbefriedigend gewesen. Jetzt schürzte sich ein Erlebnis. Eigentlich wollte er kein Erlebnis, wollte nur die beiden Frauen zusammen sehen, was ihn auch jetzt wieder seltsam und ganz tief berührte. Der schwarze Scheitel der Mutter, der blonde Schopf Renates! Wenn er von seinem Buch aufsah, konnte er allen dreien ins Gesicht blicken, weil sie im Halbkreis um den runden Tisch saßen. Aber der interessanteste war der Mann.
Es war kaum anders möglich, als daß dieser »Doktor« Abenteuer in Hülle und Fülle erlebt hatte. Dabei war das Gesicht aber wie das eines Kindes geblieben. Vielleicht Forschungsreisender? dachte Margis. Einer jedenfalls, bei dem Abenteuer mit Löwen, wilden Völkern und Frauen keine problematische Zerrissenheit zurücklassen, der sie wieder abschütteln und von neuem anfangen kann. Ein bildschöner Kerl!
Ab jetzt ein Boston kam, warf der Herr einen Blick zu dem Maler herüber, und erst, als Franz Margis sich aufzustehen anschickte, forderte er das junge Mädchen auf. Margis stand vor Maria Fenn.
»Es ist nett von Ihnen, daß Sie unsern Kreis ergänzen,« sagte sie. »Eigentlich wollten Sie lesen?«
Er wollte aber nicht lesen, erklärte ihr, daß sein Zimmer über der Diele läge. Kein Gedanke daran, daß man einschlafen könne, solange die Musik spiele.
Sie fand es sonderbar, daß er allein in St. Lüne lebe.
Er arbeite, male. Die Landschaft interessiere ihn.
Ob er ein berühmter Maler sei? Sie hätte seinen Namen nicht verstanden. Er wiederholte ihn, aber sie hatte noch nie von ihm gehört.
Sie standen noch immer zwischen den Tischen. Auf einmal erklärte Maria Fenn, nicht tanzen zu wollen. »Nehmen Sie es mir sehr übel? O bitte, nein!« Sie hielt ihn zurück. »Leisten Sie mir Gesellschaft! Oder wollen Sie allein sein?«
Er fand sie nervös. Während sie sprach, folgten ihre Augen der Tochter, die mit dem Doktor tanzte. O mein Gott, dachte er, hier haben sich Mutter und Tochter in den gleichen Mann verliebt! – Man konnte keine rühmliche Rolle dabei spielen. Trotzdem setzte er sich an den Tisch, ärgerte sich zugleich, daß er nun mit dem Rücken gegen den Saal sitzen mußte, und überhaupt –. Der Wirt schien erfreut, daß sein Gast Gesellschaft gefunden hatte; er kam selbst vom Büfett herbei und trug ihm Flasche und Glas nach. Dabei lächelte er wieder wie vorher bei seiner Auskunft. Was hatte man über Maria Fenn zu lächeln? War sie vielleicht eine ortsbekannte Kokette?
»Wohl bekomm's!« sagte der Wirt. Er hatte ihm eingeschenkt und entfernte sich. Die Dame fragte ihn, ohne zuzuhören, nach Herkunft und Familie. Er ärgerte sich, daß man ihm die Flasche nachgebracht hatte. Eigentlich wollte er hier nur sitzen, solange die beiden andern tanzten. Es war sogar unschicklich von ihm, sich hier niederzulassen. Er hätte die Flasche zurückschicken sollen. Nun stand sie großspurig auf dem Tisch, eine einfache grüne Flasche, neben den Eisbechern und den drei Sektgläsern. War Frau Fenn erstaunt gewesen, daß er sich so plötzlich an ihrem Tisch anbaute?
»Um Gottes willen, gnädige Frau! Ich habe es gar nicht gesehen. Der Wirt –. Ich will durchaus nicht stören.« Sie schien ihn nicht ganz zu verstehen. In diesem Augenblick war der Tanz zu Ende. Der Doktor und Renate kamen an den Tisch, ein wenig verwundert, den Fremden vorzufinden. Renate schien über das Ungeschick ihrer Mutter zu lächeln. Margis erhob sich. Maria Fenn stellte vor, nannte Herrn Margis, ihre Tochter Renate und Herrn Dr. Mario Glasberg.
»Glasberg?« fragte Margis erstaunt und dachte an die berühmte Industriedynastie. In welche Gesellschaft war er geraten!
Der Doktor zeigte sein sympathisches Lachen. »Es ist jedesmal dasselbe,« sagte er fröhlich. »Jawohl, von den Glasbergs aus Leynhausen! Kohlen, Stahl, Eisen, Truste, Banken, was Sie wollen. Aber nur ein simpler dritter Sohn, ganz bescheidener Doktor der Chemie.«
Mario Glasberg! Wo habe ich den Namen schon gehört? durchfuhr es den Maler. – Glasberg fragte ihn nach seinem Beruf, ließ sich den Namen noch einmal nennen. Im Augenblick waren sie im Gespräch. Er kannte Margis' Pietà in der Hamburger Kunsthalle, dieses kolossal angelegte Werk, das seinen Ruf begründet hatte. Die drei Eifellandschaften, die in Frankfurt hingen.
Ein reizender Kerl, dieser Industriellensohn! Ein wenig zu liebenswürdig vielleicht! empfand Margis. Seltsam, noch vor einer halben Stunde war ihm Sankt Lüne gleichgültig gewesen, und jetzt saß er hier auf einmal mit den Damen Fenn und einem wirklichen Glasberg zusammen. Wo habe ich von Mario Glasberg schon einmal gehört? Nur konnte er nicht daraus klug werden, ob er das Trio störte oder wirklich willkommen war.
Die beiden Frauen sprachen kaum mehr, um so lebhafter der Doktor. Er schien alle Welt zu kennen, Margis und er hatten im Handumdrehen eine Reihe gemeinsamer Bekannter. Ein Zufall, daß sie sich nicht längst begegnet waren.
»Kennen Sie van Holten,« fragte Margis, »den Rechtsanwalt? Ich glaube, van Holten hat mir von Ihnen gesprochen.«
»So!« antwortete Glasberg kurz und wendete sich ab. Frau Fenn wollte sich ins Gespräch mischen, aber dem Maler fuhr es bereits heraus: »Natürlich! Jetzt weiß ich's: van Holten hat Ihr Bild auf seinem Schreibtisch stehen!«
Er bemerkte nicht, daß Glasbergs Miene eisig wurde und die Damen sich verstörte Blicke zuwarfen. Die Musik setzte mit einem Charleston ein. Renate sprang wie erlöst auf und winkte dem Maler zu: »Tanzen Sie Charleston?«
»Das nicht,« bekannte er. »Aber wir können steppen.«
Während des Tanzes sprach sie wieder kein Wort. Als ob sie eine Pflicht erfüllte, schwebte sie in seinen Armen, ein wohlfunktionierender Mechanismus, dem leisesten Druck gehorchend, aber ohne Seele, steinhart das Gesicht, die Augen niedergeschlagen. Auf einmal sagte sie, ohne daß ihre Miene sich geändert hätte: »Sprechen Sie nie wieder jenen Namen aus!«
»Welchen Namen?« fragte er erstaunt.
»Van Holten!«
»Ich verstehe nicht.«
Sie sagte nichts mehr. Die Musik hörte auf, er führte Renate zum Tisch zurück. Im Augenblick merkte er die verwandelte Stimmung. Maria Fenn sah verlegen vor sich nieder. Glasberg war bereits im Begriff zu zahlen und ganz mit dem Kellner beschäftigt. Der Chauffeur stand in der Tür. »Wir kommen!« winkte der Doktor ihm zu.
Warum dieser plötzliche Aufbruch? dachte Margis. Natürlich täuschte er sich, aber es wollte ihm vorkommen, als ob die Erwähnung jenes Namens eine kleine Panik zur Folge gehabt hätte. Glasberg reichte ihm die Hand, die Damen nickten ihm wie in Verlegenheit zu. Nicht einmal »Auf Wiedersehen!« wurde getauscht. Die drei gingen hinaus, wie sie gekommen waren, nicht geräuschvoll, aber doch auffallend. Voran Mario Glasberg, dann Renate und Maria Fenn als letzte. Wie ein Traum war das alles gewesen.
Franz Margis faßte sich an die Stirn. Nun saß er allein an dem großen Tisch. Hatte er eine Taktlosigkeit begangen? War es vielleicht, weil er sich überhaupt zu fremden Menschen an den Tisch gesetzt hatte? Aber Frau Fenn hatte ihn dazu aufgefordert! Das konnte es unmöglich sein. Glasberg war sogar entschieden froh gewesen, seine Gesellschaft zu finden. Bis jener Name fiel.
Van Holten, Rechtsanwalt van Holten! Weshalb durfte man diesen Namen nicht aussprechen? Oder war der plötzliche Aufbruch nur ein Zufall gewesen? Van Holten war ein durchaus einwandfreier Mann, der sich durch einige große Prozesse einen Namen gemacht hatte. Und Margis hatte wirklich die Photographie Glasbergs auf van Holtens Schreibtisch gesehen. Jetzt besann er sich sogar ganz genau darauf. Eine in die Brüche gegangene Freundschaft? »Sprechen Sie nie wieder diesen Namen aus!« hatte das junge Mädchen gesagt.
Auf einmal fiel es ihm ein: Dr. Mario Glasberg, Sohn des berühmten Leynhausener Trustkönigs! Richtig, da war diese Geschichte gewesen, eine ganz rätselhafte Geschichte, die durch die Blätter gegangen war und über die man vor einigen Jahren viel geredet hatte. Wie war es doch gewesen? Hatte dieser Mario Glasberg nicht eine Frau gehabt? Oder war es eine Geliebte gewesen?
Plötzlich fiel dem Maler sogar der Name ein, brach aus ferner, dunkler Erinnerung hervor: Susi Streicher, die süße Susette Streicher, aus der berühmten Schauspielerfamilie! So war es gewesen: Heirat gegen den Willen der Eltern, abenteuerliche Entführungsgeschichte, ein Jahr lang Leben in Saus und Braus, und dann, urplötzlich, hatte sich die junge Frau, die süße Susette, das Leben genommen, aller Welt zur Überraschung.
Was war damals alles geredet worden? Einfluß des allgewaltigen Trustmagnaten! Sogar von der Liebe eines Prinzen hatte man gesprochen, vor der die süße Susette sich schließlich in den Tod flüchten mußte. Mein Gott, war das damals eine Aufregung an den Künstler- und Schauspielerstammtischen gewesen! Alle kannten Susi Streicher von der Bühne her. Sie hatte ein Jahr lang in Berlin gespielt. Dann war sie an irgendeine Hofbühne im Reich gegangen, irgendwo in der Nähe von dem Industriereich der Glasbergs. Weimar, Meiningen oder Koburg? Oder war es Leynhausen selber? Es konnte Leynhausen gewesen sein. Irgendein Herzog oder regierender Graf saß dort in der Nähe. Ein emeritierter Fürst, der natürlich nichts neben den Glasbergs bedeutete. In dieser Atmosphäre hatte sich das Drama angesponnen. Natürlich: Dr. Mario Glasberg!
Franz Margis war in sein Zimmer hinaufgegangen und stand am Fenster. Jenseits der flachen Dünen lag das Meer und sandte sein immerwährendes Donnern herüber. Wie konnte man nach solcher Tragödie dieses Knabengesicht behalten? dachte er. Er sah die klaren, energischen Züge des Chemikers zum Greifen deutlich vor sich. Das also war der Mann der vergötterten Susette Streicher gewesen! Ein ganz junger Mann, der anscheinend erst zu leben anfing, der die furchtbaren Erinnerungen längst wie ein Knabenerlebnis abgeschüttelt hatte. Und dieser Mann fuhr jetzt im Auto mit Maria Fenn und ihrer Tochter durch die Nacht.
»Eifersüchtig?« fragte Margis sich selber. Wie konnte er eifersüchtig sein! Dieser Mario Glasberg war einer der Halbgötter der Erde. Was konnte er, der ringende Maler, der in Berlin eine Frau und drei Kinder hatte, neben Mario Glasberg für Frauen bedeuten? Aber seltsam war dieses Zusammentreffen!
Mit einem Seufzer legte er sich ins Bett, obwohl die Klänge der Jazzband von unten heraufdrangen.
2
Am nächsten Tage begann der Maler einen Brief an den Rechtsanwalt van Holten in Berlin. Ihm war, als müsse er diesem die Begegnung mit Mario Glasberg und die seltsame Wirkung, die die Erwähnung seines Namens hervorgerufen, mitteilen. Aber auch zwei, drei Tage später war der Brief nicht über die ersten Sätze hinausgekommen. Schließlich kannte er den Rechtsanwalt nicht genauer, als einige gemeinsame Abende im Bühnenklub und einige Besuche mit sehr vielen Menschen zusammen es mit sich brachten. Und was ging es ihn eigentlich an, was zwischen van Holten und Glasberg vorgefallen sein mochte! Sie waren Freunde gewesen und hatten sich getrennt, nichts weiter. Oder van Holten hatte vielleicht einen Prozeß gegen die Leynhausener Glasbergs geführt und gewonnen. Es war nichts Besonderes daran, und es wäre direkt taktlos gewesen, bei van Holten daran zu rühren.
Dennoch standen gleich im Anfang des Briefes einige Sätze, die dem Maler so unbedingt das Richtige auszudrücken schienen, daß er den Bogen nicht fortwarf. »Ich habe natürlich keine Ahnung, lieber van Holten, weshalb ich Ihnen davon schreibe. Aber eine innere Stimme sagt mir, daß es richtig ist. Verzeihen Sie, wenn ich dadurch vielleicht schmerzliche Saiten bei Ihnen zum Klingen bringe, aber –.« So weit hatte er geschrieben, als er den Brief abbrach.
Seit jenem Abend blieb er nicht mehr in der Hoteldiele sitzen, bis die Musik begann. Er stand frühzeitig von seinem Tisch auf und legte sich in die nahen Dünen. Aber immer so, daß er ein heranfahrendes Auto bemerken mußte. Oder strich durch das kleine Badedorf, ging den Weg zum Wäldchen, dann in dieses hinein. Aber wiederum immer so, daß er die Autostraße im Auge behielt und gleichzeitig jenen Pfad überblickte, auf dem Mutter und Tochter im vorigen Jahr ihm begegnet waren. Es war, wie er in Erfahrung gebracht hatte, der Fußweg von St. Lüne nach Klein-Klank. Für sein Leben gern wäre er hier weitergegangen, um den Gutshof liegen zu sehen. Aber er fürchtete eine Begegnung mit Glasberg oder den Frauen, wobei es sich herausstellen konnte, daß er ihnen nachspionierte. Im übrigen arbeitete er fleißig an seinem letzten Bilde weiter. In den Kusseln am Strand, rechts von der allgemeinen Badestelle, hatte er sich eine richtige kleine Räuberhöhle angelegt. Nicht eine Hütte gerade, aber so etwas wie einen Vorratsschrank. Ein Loch im Sandboden, mit kleinen Hölzern abgesteckt, um seine Staffelei, die Palette, Pinsel und Farben unterzubringen. Es war ihm gesagt worden, daß man in dieser Gegend nicht stehle. So bedurfte es nur eines Verschlusses gegen den Regen.
Jeden Morgen, wenn es einigermaßen gutes Wetter war, stellte er in den Dünen die Staffelei auf, zog den Malerkittel über den bloßen Körper und arbeitete, badete, las. Eigentlich hätte er es den ganzen Tag bis zum Abend so treiben können, aber gegen Mittag bekam er doch Hunger, und die Hitze wurde zu stark. Selbst im Schatten stand die Glut zwischen den Bäumen. Dann ging er in sein Hotel zurück, aß und legte sich eine Stunde aufs Bett. Nach dem Kaffee ging er gewöhnlich wieder an seine Bade- und Malstelle. Aber es war dann nicht mehr das Richtige. Gewöhnlich zog er sich bald an, verstaute die Sachen und machte Spaziergänge. Über diesen Nachmittagsstunden lag eine Unlust, die bis zum Schlafengehen anhielt und erst am nächsten Morgen fortgeblasen war. »Vielleicht bin ich doch zu einsam!« sagte er sich.
An einem der nächsten Vormittage tauchte Mario Glasberg überraschend zwischen den Dünen auf. Da nie ein Mensch hierher kam, man aber allgemein im Hotel und Dorf seine Arbeitsstätte kannte, war es kaum anders möglich, als daß Glasberg ihn absichtlich aufsuchte.
»Holla!« rief Glasberg von weitem. »Holla, Meister Margis! Darf man sich dem geweihten Bannkreis nahen?« Sie setzten sich auf die Sandhügel; Margis reichte Zigaretten. Glasberg war gekommen, um sich für den plötzlichen Aufbruch neulich zu entschuldigen. »Sie werden diese Eile natürlich auf sich bezogen haben, Meister. In Wirklichkeit wollten wir nur einmal in diesen Tempel Terpsichores hineinschauen, einige Runden machen und wieder verschwinden. Wir hatten es uns gar nicht überlegt, daß, wenn zwei tanzen, der Dritte genasführt dabeisitzen muß. Gott sei Dank sprangen Sie ein.«
»Bitte!« unterbrach Margis. »Es war aber unverkennbar, daß Sie und die Damen sich zurückzogen, als ich den Namen Holtens genannt hatte.«
Damit hätte er allerdings einen Namen genannt, der ihm ziemlich verhaßt wäre. Und wie der Zufall spiele: Gerade an diesem Nachmittag hätte er den Damen Fenn von seinem feindlichen Zusammenstoß mit dem Rechtsanwalt erzählt. Holten hätte sich ihm gegenüber wirklich toll benommen. Aber das wären alte, begrabene Geschichten. Glasberg lächelte dazu und entblößte seine prächtigen Zähne. »Sind Sie übrigens mit Holten befreundet?«
Diese Frage rief bei Margis ein ihm selber unerklärliches Mißtrauen hervor. Er verstand sofort, daß diese Frage der eigentliche Grund war, weshalb Glasberg ihn aufsuchte. Vielleicht war es Mario Glasberg unbequem, wenn van Holten durch ihn etwas von seinem hiesigen Aufenthalt erfuhr? Vielleicht wollte er sich vergewissern, ob der Maler nicht schon an Holten geschrieben hatte oder schreiben wollte? Er zögerte mit der Antwort, wußte nicht recht, was da zu sagen war.
»Verzeihen Sie meine Frage!« fuhr Mario Glasberg fort. »Natürlich, ich bin indiskret; aber es handelt sich um folgendes: Wenn Sie mit Holten befreundet sind, ist natürlich jeder Verkehr zwischen Ihnen und mir ausgeschlossen. Denn Holten ist einfach mein Feind. Im andern Fall hätte ich gern meinen Aufenthalt hier mit Ihrer Gesellschaft ein wenig gewürzt. Man könnte nette Abende miteinander verbringen, zusammen Auto fahren, jagen, bei den Damen Fenn tanzen und tausend Sachen mehr.«
»Wohnen Sie in Klein-Klank?« fragte Margis dagegen.
»Oh, keine Spur! Ich wohne auf dem Rittergut Serbenitz, bei meinem Freund Teuffel.«
Margis fuhr zusammen. Der Name erschreckte ihn in diesem Augenblick. »Teufel?«
»Teuffel! Baron von Teuffel! Eine in Deutschland nicht unbekannte Familie. Ich bin seit Jahren in jedem Sommer dort. Wenn Sie so wollen, sehe ich dort nach dem Rechten, wenn Baron Teuffel verreist ist. Ende Juli kommt er wieder; wir verbringen dann noch eine gemeinsame Woche, und ich rutsche wieder an die Arbeit. Also: Sind Sie mit Holten befreundet?«
Das alles war mit vollendeter Liebenswürdigkeit herausgesprudelt, von einem Lächeln und dem Blitzen der prachtvollen Zähne begleitet. Margis mußte wieder daran denken, daß keine Frau diesem Manne widerstehen konnte.
»Nein!« sagte er. »Ich kenne Holten nur oberflächlich. Aber noch in diesem April sah ich Ihr Bild auf seinem Schreibtisch. Hinterher, als Sie fort waren, fiel mir das alles ein.«
»Was heißt alles?« fragte Glasberg scharf zurück und bohrte seine Augen in das Gesicht des Malers. Margis erwiderte den Blick ruhig.
»Alles, was man seinerzeit über Sie redete. Aber das sind unangenehme Erinnerungen für Sie.« Er sah nicht ein, weshalb er Glasberg gegenüber ein Blatt vor den Mund nehmen sollte.
Mario Glasberg stand auf und ging einige Schritte weiter. Plötzlich drehte er sich wieder um. Seine Augen waren niedergeschlagen. Er hatte das Gesicht eines gescholtenen Knaben.
»Man hat diese Geschichte also noch nicht vergessen?« sagte er langsam. »Ich dachte, daß jetzt Gras darüber gewachsen sei. Aber es ist noch immer so: Wenn einer den Namen Mario Glasberg hört, dann denkt er sofort an die furchtbare Geschichte mit Susette Streicher, nicht wahr?«
»Ich entsinne mich keiner Einzelheiten, Herr Doktor, und es ist auch nur wie eine ganz ferne Erinnerung.«
Mario Glasberg schlug die Augen auf. »Bitte, Meister Margis, was wissen Sie noch davon? Verzeihen Sie! Aber es interessiert mich natürlich brennend, wie man heute, nach mehr als zwei Jahren, über diese Geschichte denkt. Bitte, was wissen Sie noch davon?«
Margis rekapitulierte mit kurzen Stichworten, was er über Susette Streichers Ende in der Erinnerung hatte: ihre Flucht mit Mario vor dem elterlichen Widerspruch, die kurze Ehe und dann den überraschenden Selbstmord. Er dachte, daß Glasberg nur unter Qualen diese Geschichte anhören könnte. Als er aber aufsah, bemerkte er statt eines verstörten Gesichts, wie der Chemiker mit Interesse, ja, mit einer gar nicht verhehlten Befriedigung, mit einem fast glücklichen Leuchten in seinen Augen zuhörte.
Was ist das für ein Mensch! dachte er entsetzt. Im nächsten Augenblick aber korrigierte er diesen Eindruck. Natürlich war es nur der Gedanke an die Geliebte, an das Jahr ihres unbeschreiblichen Glücks, das diese beseligende Wirkung bei ihm auslöste.
»So!« sagte Glasberg nach einer Weile. »Und weshalb, glauben Sie, hat sich meine Frau das Leben genommen? Haben Sie darüber etwas gehört?«
»Dumme Gerüchte! Man sprach damals sogar davon, daß Ihr Herr Vater die unbequeme Schwiegertochter aus dem Wege geräumt habe. Es hieß auch, daß die allzu zudringliche Liebe eines Prinzen – ich weiß nicht, welches – Susi Streicher in den Tod getrieben habe. Das ist aber wohl alles Unsinn?«
Glasbergs Gesicht war wieder eisig geworden. »Ich weiß nichts!« sagte er nach einer Weile. »Mir ist die Tat heute noch ebenso unergründlich wie damals. Seit jenem Morgen, als ich Susette tot in ihrem Bett fand, habe ich keinen der Meinen und keinen der Ihren mehr wiedergesehen. Auch nicht den Prinzen Georg. Vielleicht habe ich Vermutungen, aber Sie verzeihen, daß ich darüber nicht spreche!«
Im Augenblick fiel dem Maler der Name van Holtens ein. War ein Zusammenhang zwischen dieser Geschichte und der Feindschaft der beiden Männer? Aber war es denn überhaupt eine Feindschaft? Der Rechtsanwalt hatte doch das Bild Mario Glasbergs auf seinem Schreibtisch stehen!
Wie sonderbar war das alles! Aus wie vielen Situationen und Eindrücken war dieser Augenblick zusammengeweht! Da sah er im vorigen Jahre Mutter und Tochter auf einem Fußweg an sich vorübergehen, da sah er im Winter die Photographie eines Mannes auf dem Schreibtisch eines Bekannten, da hatte er von Mario Glasberg erzählen hören – und jetzt auf einmal ballten sich die zerstreuten Eindrücke zu dieser seltsamen Situation zusammen: Er mit Glasberg im Gespräch über das Ende der schönen Susette. Und noch eben war ein Abend gewesen, da hatte ihm die kleine Renate Fenn verboten, den Namen van Holtens auszusprechen.
Wie merkwürdig war das Leben! Einen Augenblick mußte er denken, daß etwas ganz anderes als nur eine spröde Landschaft ihn hierhergerufen hatte, daß ihn hier irgend etwas erwartete. Ganz folgerichtig war das alles so gekommen: erst die inhaltleeren sechs Wochen wie ein Auftakt, und jetzt überstürzten sich die Begegnungen.
»Verzeihen Sie,« sagte Glasberg, jetzt wieder leichthin. »Ich falle Ihnen mit diesen Dingen lästig. Im übrigen führt mich ein bestimmter Auftrag hierher. Frau Fenn läßt Sie bitten, heute nachmittag bei ihr Tee zu trinken. Haben Sie Lust? Mein Wagen kann Sie abholen.«
Margis fand nicht sofort die bejahende Antwort. Das richtige wäre gewesen, die Einladung abzulehnen, seine Sachen zusammenzupacken und abzureisen. Ganz deutlich hatte er die Empfindung, daß dies das allein Richtige war. Was sollte er mit diesen Menschen? Er witterte irgendeine Absicht hinter der Einladung.
Daneben hörte er sich die Zusage geben: »Selbstverständlich, ich komme sehr gern!« Hatte er das wirklich gesagt? Aber weshalb sollte er nicht? Seine Bedenken waren natürlich lächerlich. Die Damen Fenn interessierten ihn, er hatte durch einen Zufall ihre Bekanntschaft gemacht, sie luden ihn ein. Es war selbstverständlich, daß er hinging. Man konnte überhaupt einige nette Wochen in diesem weltabgelegenen Winkel verbringen. Wie hatte Glasberg gesagt? »Ein wenig Auto fahren, jagen, bei den Damen Fenn tanzen und tausend Sachen mehr.« Natürlich konnte man das. Weshalb nicht? Ihm wollte jetzt sogar scheinen, als wenn Glasberg die Damen Fenn nicht übermäßig ernst nahm. Vielleicht hatte der verwöhnte Industrieprinz für sie dasselbe Lächeln wie der Hotelier. »Mit den Damen Fenn tanzen und tausend Sachen mehr.« Das klang ein wenig, als wenn er Maria Fenn für eine Kokette nahm, gut genug für einige Sommerwochen, und vielleicht war er der Gesellschaft der beiden längst überdrüssig und suchte im Verkehr mit Margis Abwechslung. Jedenfalls konnte man das alles ganz harmlos und leicht nehmen.
»Dann wird mein Wagen Sie um fünf Uhr abholen, Meister Margis. Ich werde übrigens heute nicht in Klein-Klank sein. Ich muß arbeiten, ich mache gerade einen interessanten Versuch: Arsenreaktionen. Ich habe mir in Serbenitz ein kleines Laboratorium eingerichtet.« Sie gingen durch den Sand zum Hotel zurück, wo Glasberg das Auto gelassen hatte.
3
Gleich hinter St. Lüne stiegen dunkle Wälder mit üppigem Untergehölz hoch. Eine Försterei lag zwischen fetten Wiesen. Man sah Kühe weiden und Pferde auf Koppeln springen. Nichts erinnerte an die Nähe von Meer und armseligen Fischerdörfern. Nur hier und da hatte ein Riesenkamm die Wälder gescheitelt, und im Dreieck eines Durchblicks zeigte sich zwischen dunklen Wipfeln die stahlblaue See mit ihren weißen Schaumpunkten. Kirchdörfer tauchten landeinwärts auf, Hügelrücken schoben sich daher.
Wenn ich hier wohnte, dachte Franz Margis, wäre ich andrer Stimmung. Aber es blieb dennoch jene öde Sandbucht, die ihn zum Malen reizte, nicht diese fette Landschaft, die wohltätig auf seine Nerven einwirkte.
Auf dem Fußweg mußte man, quer durch das Wiesental eines Baches, in einer knappen Stunde von St. Lüne nach Klein-Klank gelangen. Die Chaussee machte einen weiten Bogen, folgte dem Vorsprung der Küste, die hier mit scharfer Spitze weit ins Meer hineinstieß. Aber auch so sah man in einer knappen halben Stunde den Gutshof liegen, überwachsen von den mächtigen Kastanien des Parks. Eine Birkenallee bog von der Chaussee ab. Hier mußte das Auto langsamer fahren. Vom letzten Regen standen noch Wasserlachen quer über dem Weg. Links begann hinter einem einfachen Drahtzaun der Park. Man sah zwischen den Bäumen auf verschlungene Pfade, und von hinten schimmerte eine helle Rasenfläche mit Farbentupfen von bunten Blumenbeeten hindurch. Vor dem Wirtschaftshof bog man zum Herrenhaus durch ein offen stehendes Gittertor. Kiesbedeckt schwang sich die Anfahrt um ein Rondell aus Rosen. Man hielt vor der breiten Veranda. Ein Mädchen mit weißer Schürze und weißer Krause im Haar stand auf den Stufen und lächelte.
Der Maler wollte dem Chauffeur ein Trinkgeld geben. »Danke!« sagte der ablehnend. »Ich werde von meinem Herrn bezahlt.«
Margis sah ihn erstaunt an. Es war ein hochmütig verschlossenes Gesicht mit merkwürdig brennenden grünbraunen Augen darin. In einer Diele legte Margis Hut und Stock ab. Das Mädchen zeigte auf die Treppe. Er war erstaunt, hatte gedacht, daß auf Gutshöfen die Wohnräume unten lägen und oben nur noch Schlaf- und Fremdenzimmer. Maria Fenn hatte es anders eingerichtet.
So ging er die braune, geschnitzte Treppe hoch. Oben gab es eine Art Wohnflur mit Tischen und Sesseln, allerhand Graphik an den Wänden und eine Reihe von weißen Türen, eine große Flügeltür gerade vor der Treppe. An diese Tür klopfte das Mädchen und zog sich zurück.
Renate öffnete. Sie hatte ein rotes Seidenkleid an und eine ganz dünne Perlenschnur um den kindlichen Hals. »Herr Margis!« sagte sie seltsam abwesend und gab ihm die Hand. Er trat in einen kleinen Empiresaal in Weiß und Gold. Drei Fenster gingen bis zum Fußboden hinunter. Man schien zwischen Baumkronen zu schweben.
Das erste, was er sah, war der weite Ausblick über die Rasenflächen und Blumenbeete des Parks und hinten das blaue Meer, eingefangen zwischen dem Ausschnitt der grünen Wipfel. Rechts am Fenster stand ein Sekretär. Es gab gemütliche Ecken um geschweifte Tischchen, einen kleinen Stutzflügel, mit schillernder Brokatdecke überzogen. An einer Wand einen breiten Diwan mit einem prachtvollen Eisbärfell darüber, Aschenbecher auf kleinen Hockern, einige Landschaften in matten Farben und silbrigen Rahmen. Ah! dachte der Maler. So muß Maria Fenn wohnen!
Zwischen Flügel und Fenster wartete auf einem goldlackierten Tischchen die brodelnde Teemaschine mit drei Gedecken. »Mutter läßt sich entschuldigen,« sagte Renate. »Sie mußte mit dem Verwalter noch einmal aufs Feld reiten. Sie wird in einer halben Stunde zurück sein.«
Renate bereitete den Tee, reichte ihm Weißbrot, Butter und eingemachte Früchte zu. Er folgte ihren Bewegungen mit offensichtlicher Bewunderung.
Vielleicht ist es nur ein kultivierter Haushalt, dachte er, aber es könnte ebensogut Yoshiwara, das japanische Liebesparadies, sein. Sicher ist auch der Verwalter ein hübscher, schlanker Kerl und der Herrin mit Leib und Leben ergeben, und vielleicht erwartet man von allen Männern, die hierher kommen, wunderbare Liebesfeste.
Er mußte lächeln, als diese Gedanken ihm kamen. Natürlich war alles ganz anders. Maria Fenn hatte nur die Kultur der Großstadt in diesen stillen Winkel mitgenommen. Oder Herr Fenn, an den er noch gar nicht gedacht hatte, war einst ein Mann von künstlerischen Neigungen gewesen. Es sollte auf diesen ostpreußischen Gutshöfen Originale von allen Schattierungen geben.
»Gehört noch viel Land zu Ihnen? Ich glaubte, Klein-Klank sei Restgut?« fragte er.
»Ach Gott, einige hundert Morgen. Es ist nicht viel.«
»Sie sind oft auf Reisen?«
»Wir reisen nie.« Nach einer Weile fügte sie hinzu: »Wir haben kein Geld.«
»Nanu?« lachte er und zeigte auf die Einrichtung. Achtete zugleich unwillkürlich darauf, ob nicht leise Spuren des Verfalls zu bemerken waren. Er konnte aber nichts entdecken, was nach Vernachlässigung aussah. Im Gegenteil, der Eindruck der Gepflegtheit, der aus allem, aus der Haube des Dienstmädchens, aus den Blumenrabatten, den Bildern und Teppichen sprach, war unverkennbar.
»Ach, das!« sagte Renate wegwerfend. Sie schien die seltene Gelegenheit eines Besuches auszunützen, um ihre Meinung zur Geltung zu bringen. »Ja, das ist alles ganz nett. Aber ich würde lieber hier sparen und dafür reisen. Mama will hübsch wohnen. Das ist ihr alles.«
Ob sie viel Besuch hätten? Renate sagte, daß es selten vorkäme. Sie mochten mit den Grundbesitzern der Umgegend nicht verkehren. Allein Teuffels wären ganz nett. »Die übrigen sind alle, wissen Sie, so primitiv, ohne Interessen und Formen. Sie wundern sich über unsre Bilder und Bücher. Ich könnte keinen von denen heiraten. Mama auch nicht.« Es amüsierte ihn, wie das junge Mädchen über eine mögliche Heirat ihrer Mutter nachdachte.
»Verzeihen Sie! Ist Ihr Herr Vater schon lange tot?«
Aber Herr Fenn war von seiner Frau geschieden und lebte in Kalifornien. »Vater war vielleicht etwas sonderbar. Er mochte Deutschland nicht. Meine Mama ist vom Rhein. Wir erbten dieses Gut vor fünf Jahren von einem Onkel und zogen hierher. Mir gefällt es hier nicht.«
Es stellte sich heraus, daß sie lieber tanzte und Bücher las als spazierenritt. Sie lachte dazu. »Sehen Sie, kleine Hunde gehen noch an, aber Pferde sind so furchtbar groß! Ich mag das nicht! Dann muß es schon ein Auto sein. Aber wir haben auch kein Auto!«
Hier trat Maria Fenn ein, wie immer im weißen Kleid, nur der schwarze Spitzenschal fehlte. Statt dessen schmückte eine wunderbare Perlenkette ihren Hals. Eine dreifach geschlungene Kette von solch großen Stücken, daß man erst hinsehen mußte, um sie für echt zu halten. »Wir haben ja kein Geld!« hatte Renate gesagt. Vielleicht hatten sie wirklich für die Verhältnisse verwöhnter rheinländischer Patrizierfamilien wenig, und Franz Margis konnte sich denken, daß Maria Fenn zum Reisen, was sie unter Reisen verstand, wahrscheinlich sehr viel Geld gebraucht hätte.
Aber es gefiel ihm von ihr, daß sie einen kleinen Rahmen lieber mit Luxus ausfüllte, als sich in einem größeren Rahmen zu beschränken. Es gefiel ihm ebenso, wie ihm das Verlangen der Tochter nach der weiten Welt gefiel. Noch immer war es so: Diese beiden Frauen waren für ihn untrennbar. Sie beide zusammen erst hatten diesen unwiderstehlichen Reiz, der sie ihm nun über ein ganzes Jahr hindurch – und was für ein Jahr Berliner Lebens! – unvergessen gemacht hatte. Und zu beiden paßte der verwöhnte Sohn des Trustkönigs mit seinem romantischen Schicksal.
»Nun, hat Ihnen Renate schon ihr Leid geklagt?« Das waren Marias erste Worte. Sie kannte die Art ihrer Tochter.
»Über die verwunschene Einsamkeit und den Drang in die Welt und den Mangel eines Autos,« sagte Margis. »Um so wundervoller ist es für den arglosen Wanderer, wenn er das Dornengestrüpp beiseitebiegt und solche Wunderblumen entdeckt.«
Maria Fenn sah ihn mit ihren blauen Stahlaugen an. »Sie sagen das im Scherz,« sagte sie lächelnd, »aber ich hoffe, es ist Ihr Ernst.« Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt und ließ sich von Renate bedienen. Wie fein, dachte Margis, daß sie nicht im Reitkleid hereingekommen ist! Keine andere Frau hätte sich das entgehen lassen.
Sie nahm gleich das Gespräch in die Hand, fragte, ob Mario Glasberg ihm die Entschuldigungen für den plötzlichen Aufbruch übermittelt hätte. Betonte, vielleicht ein wenig zu ängstlich, daß man Herrn Doktor Glasberg viel zu selten zu sehen bekomme. »Jedes Jahr ist er auf Serbenitz. Wer hat ihn dort entdeckt? Natürlich Renate! Sie brachte ihn vor zwei Jahren auf einmal an.« Renate wäre ja damals vollkommen Kind gewesen, während sie jetzt nur noch ein Kindskopf sei. Aber Herr Glasberg wäre mit seiner ganzen Liebenswürdigkeit auf ihre dummen Gedanken eingegangen, und so wäre er plötzlich, mit dem Mädel an der Hand, hier aufgetaucht. »Aber er ist uns ein lieber Freund geworden.«
»Siehst du,« sagte Renate schnippisch, »das habe ich eben sofort herausgefühlt. Und ich brachte ihn ja auch nicht für mich mit.«
»Sondern für mich, nicht wahr?« lachte Maria Fenn. »Dabei möchte sie mir, ihrer alten Mutter, die Augen auskratzen, wenn Glasberg zu mir ein Wort mehr als zu ihr spricht.«
Das junge Mädchen wurde bei diesen Worten ihrer Mutter purpurrot. Margis bemühte sich, es nicht zu sehen. Frau Fenn lächelte kaum merklich darüber.
Hol' mich der Teufel, dachte er, wenn die nicht eben mit Glasberg zusammengewesen ist! Das Auto hat ihn am Waldrand abgesetzt, mich dann aus St. Lüne geholt und ihn wieder am Waldrand aufgenommen. Selbstverständlich!
»Dabei ist Mario Glasberg ein alter Ehemann!« setzte Maria Fenn fort.
»So?« fragte Margis. »Ist Herr Doktor Glasberg wieder verheiratet?«
»Und wie verheiratet!« brach Renate los. Sie konnte sich kaum lassen vor Heiterkeit. »Denken Sie sich eine biedere Haushälterin mit einem Madonnenwasserscheitel, und hinken tut sie auch!« Die maßlose Gehässigkeit einer hoffnungslosen Mädchenschwärmerei trat mit unbekümmerter Roheit zutage.
»Pfui, Renate!« rief die Mutter dazwischen. »Das ist furchtbar häßlich, so zu sprechen! Dr. Glasberg hat sicher eine sehr nette Frau. Wir kennen sie leider nicht.«
»Ich habe ihr Bild gesehen!« schmollte Renate.
Margis fragte, ob sie die Geschichte seiner ersten Ehe kennten. Die Damen nickten schweigend.
»Übrigens hängt es mit dieser Geschichte natürlich zusammen,« sagte Frau Fenn nach einer Weile, »daß Glasbergs jetzige Frau wirklich andere Vorzüge als große Schönheit aufzuweisen haben soll. Er hat die furchtbaren Gefahren der Schönheit kennengelernt. Die Schönheit ist ihm und Susi Streicher zum entsetzlichen Verhängnis geworden. Kein Wunder, daß er darauf eine durchaus unscheinbare Frau wählte. Er hatte genug an der einen Tragödie.«
»Und doch wird er von der Schönheit niemals loskommen!« warf Renate dazwischen. Sie war aufgestanden, um Tee einzuschenken. Während sie diese Worte aussprach, reckte sie sich unwillkürlich – oder war es Absicht? – hoch. Es war eigentlich von atembeklemmender Peinlichkeit, daß sie diese Worte sprach. Den Maler durchfuhr es wie ein eisiger Schrecken. Warf das kaum flügge Ding mit diesen Worten und dieser Geste nicht einer fernen, schutzlosen Frau in ungehemmter Brutalität den Fehdehandschuh hin, in ihrem eigenen oder, noch schlimmer, ihrer Mutter Namen? Kaum ihre siebzehnjährige Jugend konnte dafür als Entschuldigung gelten. Maria Fenn erbleichte geradezu. Sie sah ängstlich zu Margis hinüber.
»Du bist noch sehr jung!« sagte sie dann streng. Renate setzte sich wieder auf ihren Platz, als wenn nichts geschehen wäre.
»Ja,« sagte der Maler, »Schönheit kann ein Verhängnis sein. Wenn sie mit Dummheit gepaart ist, ist sie meistens ein Glück und eine Macht. Wenn sie aber mit Klugheit und Kultur gepaart ist, ist sie ein Verhängnis. Außer denen, die es an sich selbst erfahren, weiß das am besten der Künstler.« Er wunderte sich über sich selbst, daß er diese Worte ernstlich und mit Betonung aussprach und Maria Fenn dabei fest ansah.
Sie nickte ihm zu.
4
Während Margis auf Klein-Klank mit den Damen Fenn Tee trank, raste Mario Glasberg auf seinem Auto nach Königsberg. In einer Stunde hatte er eine besondere Gelegenheit, nach Berlin zu fliegen, außerhalb des regelmäßigen Passagierdienstes. Gegen neun Uhr abends konnte er mit der leichten Taube, die nur zwei Personen faßte, bereits dort sein.
Der Wagen sauste über die Samlandhügel; ferner drehte sich der Horizont mit Wäldern, die wie Geschwader von Lanzenreitern vorüberhuschten. Dörfer tanzten vorbei, kleine Brücken donnerten, gepreßte Luft zischte gegen die Siedlungshäuser von Tannenwalde, das schlechte Vorstadtpflaster rüttelte an den Achsen, bis man auf den Asphalt wie in eine besänftigende Flüssigkeit hineinglitt. Vorbei an den kleinen Bahnhöfen, durch Hinterstraßen, zwischen langen, dunklen Kasernen und alten Festungsmauern. Dann wieder Chaussee bis zum Flugplatz.
Die Taube war startbereit. Der ehemalige Fliegerhauptmann, der sie lenken sollte, grüßte fast militärisch.
»Wie lange?« fragte Glasberg.
»Bis Tempelhof? Knappe drei Stunden bei dem Wetter!« antwortete der und fuhr mit der Hand an die Kappe. Dieser junge Mann, den er so plötzlich nach Berlin befördern sollte, mußte etwas Besonderes sein.
Sie stiegen auf, drehten sich hoch. Hinter den Türmen der Stadt sah man die bleigraue Fläche des Haffs mit ihrem Waldkranz und den leuchtenden Dünen aufsteigen, dahinter das Meer, dem sie zustrebten. Die Sonne brannte von schräg unten zu ihnen herauf. Die Stadt rutschte hinter den Horizont, die ganze Landschaft unter ihnen glitt wie auf einem Rollband nach hinten.