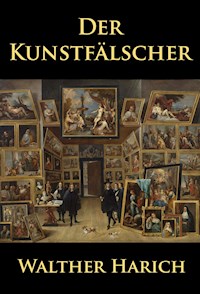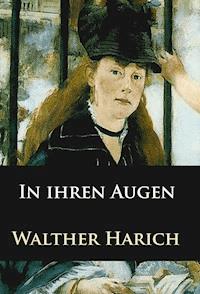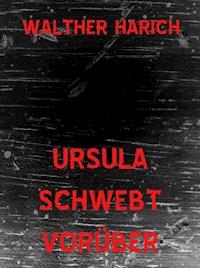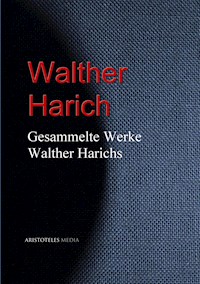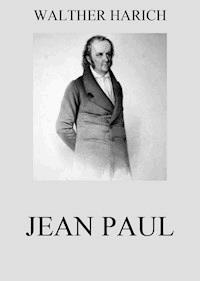
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Harichs extensive Biografie des deutschen Schriftstellers Jean Paul gehört heute zu den literaturhistorisch bedeutsamen Werken seiner Zeit. Auf vielen hundert Seiten beleuchtet Harich das Leben und Werk des 1825 in Bayreuth verstorbenen Jean Paul.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1139
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Paul
Walther Harich
Inhalt:
Jean Paul
Vorrede
Kindheit und erste Jugend
Gymnasiast und Student
Der Satirenschreiber
Durchbruch
Die unsichtbare Loge
Idyllen
Hesperus
Siebenkäs
Weimar
Abschied von Hof
Wanderjahre
Titan
Vorschule der Ästhetik – Levana
Flegeljahre
Politische Schriften
Idyllen und Humoresken
Der Komet
Letzte Jahre
Jean Paul, W. Harich
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849643225
www.jazzybee-verlag.de
Jean Paul
Vorrede
Nach unfaßbaren Gesetzen tauchen von Zeit zu Zeit die Großen der Geschichte aus Dunkel und Vergessenheit wieder ans Licht. Das vorliegende Buch steht unter dem gleichen Gesetz, das Jean Paul jetzt, hundert Jahre nach seinem Tode, wieder in unser Gesichtsfeld rückt. Hundert Jahre würde es dauern, prophezeite der glühende Börne, bis »sein schleichend Volk« ihm nachgekommen ist. Heut ist es so weit. Die Erschütterungen des Weltkriegs und der Nachkriegsjahre haben den Boden gelockert. Wir sind bereit, Jean Paul zu empfangen.
Nachträglich ist es leicht erklärt, wie dieser große Dichter uns so lange entschwinden konnte. Von der größten Epoche deutscher Dichtung – viel größer als heute unsre Zünftigen ahnen – nahmen wir bisher nur auf, was durch Fleiß oder Intellekt überliefert werden kann. Untersank alles, zu dessen Aufnahme es eines aufgelockerten Menschentums bedarf. Untersank die seit Klopstock, in Hamann, Herder, Jean Paul nach einer deutschen Form suchende Bewegung. Das Feld beherrscht Goethe als Repräsentant einer im Persönlichkeitskultus hängenden Gesellschaftsschicht, und Kant, der den Mythos tötete. Persönlichkeit als Repräsentant formaler Bildung, Wissenschaft als logische Durchdringung der Welt. Der Zusammenbruch offenbarte, was uns fehlt: nicht Tüchtigkeit und Wissen, sondern Totalität und Herz. Jean Paul ist nur nachzuleben, nicht auf eine Formel zu bringen. So mußte er, wie die Träger des Mythos jener Zeiten, uns entschwinden. Die Formel vererbte sich auf Kind und Kindeskinder, das Wesen entzog sich uns. Es ist nicht lehr- und lernbar, durch keine Tüchtigkeit, nur durch umfassendes Menschentum zu umgreifen.
Jean Paul ist eine Welt. Wer ihr Zentrum nicht erfaßt, dem muß er überladen, zerstreut, barock erscheinen. Wer ihn begriffen hat, für den hat er den Formenreichtum der Gotik und das Allumfassende der Liebe. Er dient nicht seinem Werk, sondern seiner Sendung. Deshalb ist es schwerer, ihn zu lesen als einen Dichter, der nichts als sein Werk will. Er aber drückt sich selbst und sein Wesen, und damit das Wesen aller Dinge, im Werk aus. Es ist nur der Mittler zu seiner Welt voller Liebe und Geist. Aus unberührtem Neuland aufsteigend, durchdringt er die verschiedenen Schichten alten und neuen Bildungsgutes, die über Europa lagern. Wie ein Schwimmer stößt er ruckweise vorwärts, durch den Rationalismus, den Pietismus, durch Goethe und Schiller und die junge Romantik hindurch, um an allen diesen Stationen sich selbst zu verwirklichen. In ihm antwortet gewissermaßen die ewige Natur auf alle Fragen und Probleme des Geistes, und antwortet in unübersehbaren Bänden. Er ist nicht irgendein großer Dichter, sondern wie eine Naturkraft, und er hat die Weite einer Welt. Was uns heute aus der Exotik kommt und uns müde und überladene Europäer wie eine Offenbarung erschüttert, auch das liegt schon alles in ihm. Wie die Erde scheint er durch die Weisheit Laotses und die Stärke der Inder hindurchgegangen zu sein. Der Waldzauber Wolfram von Eschenbachs, seines Landsmanns, schwingt in ihm fort, und er lebt wie einer der Jünglinge der neuesten Jugendbewegung. Er hat die Kuriosa des Menschengeschlechts aus allen nur möglichen verschollenen Büchern und Urkunden aufgelesen; das Schrifttum aller Zeiten und Völker ist ihm vertraut, am vertrautesten aber die Urtatsachen des Lebens, Geburt und Tod, Liebe und Freundschaft. Er malt die Erschütterungen des ungeheuren Schmerzes und die Entzückungen sich umklammernder Seelen. Er führt die Beladenen und Verstoßenen an die auch für sie gedeckten Tafeln der kleinen Freuden. Er löst die Landschaft in kosmische Gewalten auf, und sieht die Menschheit wie einen Salpeter, der an verschimmelte Wände anschießt. Der Blickwinkel eines Käfers und die Weltschau eines Gottes sind ihm gleich vertraut.
Wie stellt sich das Werk Jean Pauls dar? Wenn man die Elemente dieses Werks auseinanderlegte, müßte man glauben, die Rudimente eines großen Lyrikers vor sich zu haben. Von solcher Intensität ist seine Sprache, von solcher Losgelöstheit sind seine Bilder, so gedrängt, »gedichtet« das Leben. Und doch entlädt er seine Gesichte in sechs gigantischen Romanen und ihrem Bände erfüllenden Beiwerk. In zwei theoretischen Werken, über Dichtkunst und Erziehung, die beiden Leitpunkte seines Daseins. Und in unüberschaubaren Schriften satirischen, philosophischen, politischen Inhalts. Aber dies alles ist nur der empirische Leib seiner metaphysischen Schau, wie der Kandidat und spätere Legationsrat Richter nur die empirische Gestalt des metaphysischen Menschen Jean Paul ist. Dahinter steht die Welt und das Wesen, zur reinsten Form geläutert, unbelastet von bloßem Stoff und Ungeformtem. Eine Welt wie die empirische, aber notwendig und Geist geworden, verwandelt durch ein Herz, das durch Liebe und Kraft schöpferisch ward. Und doch wieder in den Leib der Sprache und der Gestalten eingegangen, daß man den metaphysischen Jean Paul nur begreift, wenn man den empirischen erfaßt hat.
Unaufhaltsam wälzt sich der Strom seines Schaffens vorwärts, aber schließlich doch zu Einzelwerken gerinnend. Nicht ganz kann alles von den großen Abschnitten, als die seine einzelnen Werke sich darstellen, erfaßt werden. Unendliches Beiwerk säumt die Ufer. Aber das Werk ist die Form der dichterischen und geistigen Manifestation. Die einzelnen großen Werke werden deshalb im Vordergrund unsrer Darstellung stehen, und sie dürfen es, wenn wir wissen, daß sie das Letzte und Größte bei ihm, aber nicht alles sind.
Ein unendlich mühsamer Prozeß ging voraus, ehe die Welt Jean Pauls sich zu ihrer Form, zum Werk, verdichtete. Den gleichen Weg muß die nachschaffende Darstellung zurückverfolgen. Es wäre leichter, wenn man allgemeine Kenntnis des Materials wenigstens in den Grundzügen voraussetzen dürfte. Wer aber weiß heute etwas von Jean Paul? Wer hat auch nur seine Hauptwerke gelesen, ja kennt auch nur ihre Titel? Sind doch sogar die meisten seiner Schriften nicht einmal im Buchhandel zu haben. Wir durften also nichts voraussetzen und müssen, unsre Darstellung belastend, Stoff sogar als Selbstzweck herantragen. Schon einmal, bei E. T. A. Hoffmann, leistete ich diese Kärrnerarbeit. Eine undankbare Aufgabe!
Und allem widerstrebend, was unsre hoch entwickelte literarästhetische Methode endlich erobert hat. Fort von der Empirie zur Deutung des metaphysischen Phänomens! Aber die empirische Gestalt muß vorliegen, wenn man über sie hinaus will. Hier aber ist erst die Gestalt zu erobern, noch lange nicht »Literaturgeschichte als Problemgeschichte« zu schreiben. Der diese Forderung erhob, beschenkte uns mit dem ersten bedeutenden und tiefen Werk über Hamann, aber mit dem Ergebnis, daß Hamann heute genau so wenig im Bewußtsein der Zeit vorhanden ist wie vordem. Gundolf, Unger, Walzel, Korff und andere haben eine Höhe der reinen Anschauung erklommen, die sie den schöpferischen Geistern nähert. Sie sind in die Tiefe der Persönlichkeiten und der Dinge gedrungen und haben letzte Erkenntnis des Schöpferischen gegeben. Aber eines scheint dabei in Gefahr: das einmalige und ganz persönliche Erlebnis der einzelnen Dichter, ihre Gestalt. Das Schöpferische wird ins Typische projiziert, die bestimmten Umrisse verdämmern.
Diltheys Typenlehre und Wölfflins Prinzipien stehen an den Toren der neuen Literaturgeschichtsschreibung. Nach der langweiligen Empirie der Scherer-Schmidtschen Schule eine ungeheure Bereicherung, Vordringen zum gesetzmäßig notwendigen Ablauf des Geschehens. Aber die unerhörte Einmaligkeit der Gestalt darf darüber nicht vergessen werden. Mag noch so Feines über den Wechsel der Stile, die Kategorien des Ästhetischen ermittelt werden, der Mensch bleibt dennoch Träger aller Stile und allen Erlebens. Nicht der empirische Mensch, aber doch der, dessen empirische Erscheinung Sinnbild metaphysischen Geschehens ist. Jedenfalls, wo Neuland angepflügt wird, mag die Gestalt in die erste Linie gerückt werden, die Gestalt des Menschen und seines Werkes.
Aber Mensch und Werk stehen nicht für sich, sondern in einer Umwelt, die ihrer Erscheinung erst Sinn gibt. Die Methode der neueren Literaturgeschichtsschreibung ist von der Philosophie und der bildenden Kunst her beeinflußt worden. So wird der Dichter vorzugsweise in Stil- und Geistzusammenhänge hineingehoben. Das hat nicht nur Berechtigung, sondern auch Notwendigkeit, aber man scheint mir damit noch immer nicht seine Einmaligkeit erfassen zu können, sondern auch hier dem Typischen zuzudrängen. Stammeszugehörigkeit, Blut und Geschichte erst ordnen die einzelne Erscheinung in einen überpersönlichen Zusammenhang ein. Es ist Josef Nadler, der zuerst auf diese Dinge hinwies. Auf dieser Ebene, von Blut, Landschaft, Lage, geistiger und politischer Situation bestimmt, entfaltet sich erst die Persönlichkeit in ihrer Begrenzung und Weite. Die geschichtlichen Zusammenhänge, nicht die ästhetischen Kategorien geben der Gestalt Relief. Dichtung ist Kunst: Erst vom übergeordneten Begriff her empfängt jedes Ding seine Wertung. Kunst von Leben, Leben von Gott. Wir haben daher Jean Paul in seine historische, ja politische Situation hineingestellt, aber nur, weil jede empirische Situation Ausdruck einer metaphysischen ist.
Es ist also mehr der »Roman« Jean Pauls, dem ich zudränge, als einer Auflösung seines Wesens in Stilgeschichte und Typenlehre. Er soll leben, mit seiner magern Blondheit durch seine ersten Bücher stürmen, in Hemdärmeln vor der Tasse Kaffee als kleiner Schulmeister am bekramten Tisch sitzen, behäbig geworden und beruhigt seines Innern Widersprüche in Valt und Wult (»Flegeljahre«) nachzeichnen. Und er soll es unbeschadet tun, weil wir in ihm immer das Walten eines drängenden Geistes spüren, das Ringen der Sehnsucht, die am Ausgang des 18. Jahrhunderts die Welt in Revolutionen und Kriegen durcheinanderwirbelte.
Man weiß nichts von Jean Paul, oder die wenigen, die etwas von ihm wissen, könnten bequem mit Namen genannt werden. Und dennoch gibt es über ihn eine beträchtliche Literatur. An der Hand seiner Tagebücher könnte Tag für Tag seines Lebens verfolgt werden. Von seinem Neffen Richard Otto Spazier stammt eine Biographie, die in ihrer Art ein Meisterstück ist, und bis ans Ende des 19. Jahrhunderts sind immer wieder Jean Paul-Biographien geschrieben worden, die es allerdings weniger sind. Niemand hat sich um diese Literatur bekümmert. Heute würde Spaziers Darstellung vielleicht manchen interessierten Leser finden. Aber naturgemäß enthält sie Unrichtigkeiten und unüberwindliche Längen, von der mangelhaften Wertung der Werke ganz zu schweigen. Dennoch kommt man um diese Biographie nicht herum, sie liegt auch unsrer Darstellung zugrunde wie allen späteren Arbeiten über den Dichter. In neuerer Zeit hat sich Eduard Berend mit Jean Paul beschäftigt, und in seinen Arbeiten wächst nun in der Tat ein Standardwerk heran, wie es fast allen Dichtern sonst längst beschieden ist. Von den vier dicken Bänden seiner »Briefe Jean Pauls« sind zwei erschienen, der dritte war mir durch die Liebenswürdigkeit des Verlages Georg Müller wenigstens in den Druckfahnen zugänglich. Diese Ausgabe der Briefe, mit aufschlußreichen Anmerkungen versehen, soll den Grundstock einer Gesamtausgabe der Werke bilden. Weder die erste Reimersche Ausgabe noch die zweite enthält sämtliche Schriften, geschweige denn die verschiedenen Fassungen und Lesarten. Nur der mit Jean Paul Vertraute vermag die Schwierigkeit eines Unternehmens zu ahnen, an das Berend herangegangen ist. Eduard Berend besorgte auch die erste größere Auswahl von den Werken Jean Pauls. Lange nicht alles Wichtige ist in ihr enthalten, aber wenigstens so viel, daß man sich auch von seiner Vielseitigkeit wieder ein Bild machen kann. Diese Berendsche Ausgabe muß heute in die Hand nehmen, wer sich mit Jean Paul zu beschäftigen gedenkt. Die stille Hoffnung, mit der ich meine Darstellung in die Welt sende, ist die, daß sich das Interesse an Jean Paul so steigert, daß sich endlich ein Verleger findet, der dem hervorragenden Forscher Berend bei seinem Plan einer Gesamtausgabe mit allen Mitteln hilft. Zur Ergänzung der Berendschen Auswahl wird man am besten die von Richard Benz unter dem Titel »Blumen-, Frucht- und Dornenstücke« in erlesener Auswahl herausgegebenen kleinen Dichtungen Jean Pauls heranziehen. Eine ausführliche Bibliographie befindet sich am Schluß meiner Darstellung.
Neben der Biographie Spaziers waren es in erster Linie die Hinweise Berends, die mich nennenswert unterstützten. In meiner Wertung Jean Pauls glaube ich durchaus eigne Wege gegangen zu sein. Ich bin mir bewußt, daß die vorliegende Arbeit nur einen ersten Versuch darstellt. Jean Paul bedarf einer nicht minder großen Literatur als Goethe. Eine unendliche Fülle von Problemen muß noch durchgearbeitet werden, ehe er endgültig bezwungen ist. Aber es ist ja nicht einmal so wichtig, daß die Philologen Arbeit bekommen, als daß das deutsche Volk endlich einen seiner ganz großen Dichter in sich aufnimmt. Zur Lektüre Jean Pauls hinzuleiten, durch die Fülle seines Schaffens einige Richtwege festzulegen, ist mein Hauptbestreben gewesen.
Königsberg in Preußen, im Januar 1925
Dr. Walther Harich. ###
###
Kindheit und erste Jugend
Am 15. Februar 1763 schloß der Hubertusburger Frieden den Siebenjährigen Krieg ab. Preußen, der Träger des aufgeklärten Absolutismus, behauptete sich in seinem Bestand. Ein neues Buch deutscher Geschichte, die ersten stürmischen Kapitel hinter sich, nahm seinen Fortgang. Das seit dem Dreißigjährigen Kriege zerrissene Reich, wüster Tummelplatz verantwortungsloser Dynastien, engherzigen und habgierigen Adels, schutzlose Beute äußerer Feinde, mußte den neuen Ausgangspunkt staatlicher Ordnung anerkennen. Quer durch das deutsche Chaos zog und festigte sich das neue Rückgrat Preußen, ein erstes organisches Gebilde, das seit dem auseinandergleitenden Mittelalter auf deutschem Boden sich zeigte. Mochten die Reste des alten Reiches gegen Preußen im Felde gelegen haben, über ganz Deutschland hin fühlte man doch, daß die im Norden befestigte staatliche Ordnung ein erster Ansatzpunkt war, den Schutt der alten Zeit zu beseitigen, und gab, wie Goethe, seiner »fritzischen« Gesinnung Ausdruck.
Nach sieben Kriegsjahren stand fest, daß von Norden ein neuer Odem durch Deutschland wehte. Wenn man die Bilanz zog, war zwar auch hier mancher Verlust zu buchen, der unmittelbar sich bemerkbar machte. Der preußisch-baltische Kreis blieb zerrissen. Die von Friedrich I. versäumte Gelegenheit, die baltischen Provinzen sich untertan zu machen, war auch jetzt nicht einzuholen gewesen. Im Gegenteil: russische Truppen hatten Jahre hindurch Königsberg besetzt. Wenn auch die geistigen Fäden herüber- und hinüberspielten, Hamann, Herder, Hippel nach altem Brauch ihre Lehr- und Wanderjahre in den Ostseeprovinzen absolvierten – so verhinderte doch die politische Zerrissenheit des deutschen Ostens sie, mit Kant an der Spitze einen preußisch-baltischen Kulturkreis als Gegengewicht gegen die Berliner und sächsische Aufklärung zu bilden, und sie standen einsam und vereinzelt in der geistigen Entwicklung da, zu deren Träger mehr und mehr das Berlin Friedrichs des Großen wurde. Berlin als Träger aber bedeutete die Aufklärung.
Man ist heute gewohnt, von der Folgezeit her auf den deutschen Rationalismus als auf eine erstarrte und schwunglose Epoche zurückzublicken. Damit verkennt man den befreienden Zug, den die Aufklärung in das deutsche Leben, Geistes- wie politisches Leben, brachte. Nachdem jahrhundertelang ein Macht- und Raubkampf sinnlos hin und her getobt hatte, bei dem der Deutsche, mindestens das deutsche Volk, schutzloses Opfertier brutaler Vergewaltigung gewesen war, trat die Aufklärung, verkörpert durch einen siegreichen Staat, als Idee eines von Optimismus getragenen Fortschritts der Menschheit auf. Die gottgewollten Gewalten, unter deren Schutz bisher jeder Egoismus der Großen und Herren sich hatte ergehen können, verloren ihre zwingende Kraft. Vernunft trat an die Stelle des historisch Überlieferten. Geburt und Macht bedeuteten nunmehr nicht nur Vorrechte, sondern auch Verpflichtungen. Der Mensch als freies Vernunftwesen fühlte sich als Träger der den staatlichen und sozialen Ordnungen zugrunde liegenden Verträge. Ein ungeheurer Fortschritt in dem sozialen Bewußtsein, ein erster Schritt, das Reich der Vernunft über die Erde auszubreiten, Wohlstand und Zivilisation zu steigern, die Völker zu bilden, mit Vorurteilen aufzuräumen, unter deren Gewalt Städte und Dörfer in Brand gesteckt, Felder verwüstet worden waren. Eine Neuordnung der Welt schien nahe bevorzustehen und mindestens erreichbar. War Vernunft nicht selbst die Waffe und zugleich die Entscheidung, von der nur an sie selbst zu appellieren war? Konnte anderes als Böswilligkeit sich ihrem Siegeszuge über die Erde entgegenstellen?
Ein Hauch von sieghaftem Diesseitsoptimismus ging mit dieser Bewegung durch die Lande, verbunden mit selbstsicherer Kampffreudigkeit, einer Lust am Disputieren, die an die Zeiten der Reformation erinnerte. Der Ausspruch Ulrich von Huttens: »Es ist eine Lust zu leben!« hätte der Wahlspruch manch eines der rationalistischen Führer in Preußen, Sachsen oder Frankreich sein können.
Diese Stimmung und geistige Einstellung fand in der von den Mächten anerkannten Behauptung des aufgeklärten preußischen Staatswesens durch den Hubertusburger Frieden ihre Bekräftigung. Gegenüber dem Deutschland des Friedens von Osnabrück, diesem Deutschland der Territorialdynastien, des »cujus regio, ejus religio«, hatte sich ein Neues durchsetzen können: ein Königreich der Gewissensfreiheit und mustergültigen Verwaltung. Ein Zentralpunkt der Volksbildung, der rationell durchorganisierten Wirtschaft. Eine Stätte, die die Geister anzog und Mittelpunkt einer neuen Kultur zu sein verhieß; ein zweites Athen, das von den Alten nicht ohne Geschick den klassischen Faltenwurf absah und seinen Parnaß zu bevölkern verstand.
Zwar, noch ehe die Sonne der Aufklärung wenigstens ganz Deutschland überstrahlte, kündigten sich bereits neue Spannungen zwischen der diesseitsfreudigen Gegenwart und einer nahen Zukunft an. Schon 1759 waren Hamanns, des nordischen Magus, »Sokratische Denkwürdigkeiten« erschienen. Kant, der ein Jahr vor Ausbruch des Krieges, gewissermaßen die naturwissenschaftliche Grundlegung der Aufklärung, seine »Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels«, herausgegeben hatte, arbeitete jetzt an seinen »Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen« und näherte sich schon hier in langsamem aber bewußtem Anmarsch dem Kampfplatz, auf dem er der Allherrschaft der Vernunft die vernichtende Niederlage beibringen sollte. In Frankfurt rang ein vierzehnjähriger Knabe mit dem Gretchenerlebnis. In langen Gesprächen ließ der junge Herder von Hamann sich unterweisen. Die ganze vernünftige Weltordnung erschütternd aber war bereits Rousseau am Horizont aufgetaucht und rief sein »Zurück zur Natur!« in die abendländische Zivilisation. Ein Kampfruf, der selbst in Kant eine Revolution hervorrief und dem er gerade in seiner Schrift über das »Gefühl des Erhabenen und Schönen« ein Echo gab.
So lagen schon Spannungen in der Luft, ehe die Aufklärung sich mit Nicolais »Allgemeiner deutscher Bibliothek« 1765 in Berlin zu langem Bleiben einrichtete. Aber noch nirgends, außer von Hamann, wurden diese Gegensätze als feindliche empfunden, eher als Erweiterung und Bereicherung. Unaufhaltsam schien der Siegeszug der Vernunft und griff schon auf jenes preußenfeindliche oder dem neuen Geist abgekehrte Deutschland über, das seine länger als jahrhundertalten Formen in stumpfer Stetigkeit bewahrte. Hier war allerdings nur langsam und in zähem Ringen Boden zu gewinnen.
Kaum ein größerer Gegensatz als das straff auf Leistung und rationelle Ausnutzung organisierte Preußen und die ganz anders gestimmte Welt etwa der österreichischen Erblande, an deren zäher Beharrlichkeit einige Jahrzehnte später selbst Josephs II. Reformpläne scheitern sollten. Als die Welt der kleinen Duodezfürstentümer mit ihren landständischen Grafen und Herren, die über ihre Bauern wie über Sklaven verfügten, Untertanen noch immer als Kanonenfutter verkauften und nach Willkür Pfarrer, Gerichtshalter und Lehrer vozierten. Wenn in Preußen Pfarrer und Lehrer sich als Träger des Staatswillens und Pioniere der allgemeinen Bildung fühlen konnten, hier waren sie die Ärmsten der Armen, jeder Willkür preisgegeben, einem Schicksal des Hungers und der Demütigungen bestimmt. Wenig wurde die soziale Stellung durch die Zugehörigkeit zu einer der verschiedenen Konfessionen beeinflußt. Das Herrenrecht stand bei Protestanten wie Katholiken an erster Stelle in allen den kleinen Staaten und Fürstentümern, die noch im Schatten des Osnabrücker Friedens lebten. Wohl aber mußte die Konfession dem bloßen Dasein eine verschiedene Färbung geben.
Die katholischen Länder waren immerhin durch ihre Kirche in einen größeren Zusammenhang hineingestellt, die protestantischen aber hatten als Schicksal nur, was ihnen der Umkreis ihres Ländchens davon bot, und das war wenig mehr als bloßes vegetatives Dasein. Je weniger sie in Probleme geistiger und politischer Entwicklung verflochten waren, je weniger sie sich an Fortschrittsideen und sozialen Idealen entzünden konnten, desto näher standen ihnen die Urprobleme des Lebens. Keine Begeisterung oder innere Inanspruchnahme vermochte sie über das Erlebnis des Hungers und der Not, der Liebe oder des Gewissens hinwegzuschnellen. Sie standen in keiner andern Entwicklung als der allgemein menschlichen von der Wiege bis zum Grabe. Geburt und Tod, das waren die Pole ihres äußern und innern Daseins. Sie lebten das Leben der ausgelieferten Kreatur, hingegeben dem Wechsel der Jahreszeiten, des Mißwachses oder der gerüttelten Ernte, des Glücks und des Unglücks, wie es ihnen aus einer Laune der Erde, des Himmels oder ihrer Oberen zukam. Seit Jahrhunderten, genauer: seit die religiösen und konfessionellen Fragen aufgehört hatten, ins Innerste des Menschen zu greifen, war hier ein Reservoir menschlichen Daseins aufgespeichert, von Urerlebnissen erfüllt, von einer jungfräulichen Unberührtheit des Geistes, von den Kräften einer jungen und unverbrauchten Rasse, die sich bei der ersten Berührung mit den geistigen Mächten der Zeit wie eine Springflut ins Land ergießen mußte.
Ganz anders mußte sie sich geben als etwa Goethe, der Erbe einer jahrhundertalten rheinischen Kultur, der das Dasein nur als Form und Gesellschaft kannte, in eine bewußte, vergeistigte Atmosphäre erhoben. Aus diesen von Geschichte und geistiger Entwicklung abseits gelassenen Bezirken mußte ein Strom des Daseins selber in die alte Kultur einbrechen, stärker an Urerlebnissen, an Vertrautheit mit der Schwere und Eigenart der Dinge, dem mühseligen Alltag, dem fluchbeladenen Menschen. Was durch die Einwirkung einer Epoche von umwälzenden naturwissenschaftlichen Entdeckungen und einer an der Scholastik geschulten rationalistischen Philosophie bereits spezialisiert und differenziert war, was sich durch Einfluß und Vorbild des französischen Hofes bereits verfeinert und vergeistigt hatte, das mußte nun aus einer neuen Schicht den Ansturm einer Ganzheit und Ungebrochenheit des Lebens aufnehmen.
Wir kennen aus eigner Anschauung einen solchen Zusammenprall alter Bildungsmächte mit jungem unverbrauchtem Volkstum aus der russischen Literatur. Wie dort die Zivilisation des Westens mit der aufgespeicherten Kraft der russischen Erde sich berührte und unter dieser Berührung die langen Romanreihen Dostojewskis und Tolstois erwuchsen, so erhob sich jetzt aus den bis dahin brachliegenden Schichten gerade der protestantischen Länder des alten Reichs, ohne Tradition, eine Reihe von schöpferischen Geistern, die in das ihnen dargebotene Erbe hineinwuchsen und zugleich ein Neues hineintrugen: das Gefühl von der zusammenhängenden Totalität des Lebens, das ihnen noch nicht in Teilgebiete und Einzelprobleme zerfallen war. Aus dem Herzen Deutschlands, aus Schichten, die der seit alters auf die deutsche Kultur einwirkenden Latinität des Südens und Westens entrückter waren, mehr unmittelbar und geradezu aus dem Boden stieg die neue Generation und zugleich in gewissem Sinne sogar neue Rasse der Hölderlin, Hegel, Schelling, auf denen noch ungeteilt die Schwere einer ganzen Welt lastete, die von ihnen neu zu gliedern und neu zu verteilen war. Von ihnen konnte keiner, nicht einmal theoretisch, die Kultur der Alten als unübertreffliches Vorbild und Muster hinnehmen. Und wo es, wie bei Hölderlin, der Fall schien, da war Griechentum nur Maske für das eigne Volk, um dessen Form und Sinn sie rangen. Sie, die aus ungeformten Schichten stiegen, waren weniger als Goethe geneigt, vorhandene Bildungen und Formen anzuerkennen, vielmehr getrieben, ihr Wesen auszusprechen und in Form nur das Vehikel ihrer Gedanken zu sehen. So schufen sie neue Formen der lyrischen oder philosophischen Weltschau, dem Rhythmus der Dinge nachgehend.
Es lag an dem deutschen Schicksal, daß die deutsche Kultur dualistisch gerichtet war, Sein und Sollen darin auseinanderklafften, Diesseits und Jenseits feindlich gegeneinanderstanden. Aus der Berührung der jungen germanischen Stämme mit der spätrömischen Zivilisation war die deutsche Kultur erwachsen. Zwei Zeitalter, zwei Weltanschauungen waren hier ineinandergeschoben. Über das Volksempfinden legte sich eine Bildungsschicht, die ihre Wurzeln im romanischen Süden hatte, nicht in der heimischen Erde. In Recht und Religion, in Bildung und Sitte machte diese Zweiheit sich bemerkbar. Auch die Aufklärung war von Zivilisationsbewußtsein getragen, ja, in ihr wirkte sich der Geist der spätrömischen Zivilisation vielleicht erst ganz aus. Alle Erscheinungen vor das Forum der Vernunft, derratio, zu ziehen, war in hohem Maße romanisches, nicht deutsches Bedürfnis, war wiederum Angelegenheit einer in Rom wurzelnden Bildungsschicht, die wie in Winckelmann, und nach ihm in Goethe, auf griechische Kultur zurückzugehen glaubte, während sie dem Geist der römischen Kaiserzeit erlag. Nicht nur als katholische Kirche wirkte Rom in Deutschland fort, nicht weniger bedeutend waren die Nachwirkungen der spätrömischen Zivilisation, in der die jungen germanischen Stämme sich verfangen hatten und die dann auf dem Umweg über die fränkischen Könige auf die Bildung des deutschen Lebens einwirkte. Wenn Luther das Joch Roms abzuschütteln bemüht war, so brach in ihm eine volkhafte Bewegung aus deutschem Boden hervor; aber als Vorläufer der Aufklärung wiederum ersetzte er nur das Rom der Päpste durch das Rom seiner Kaiser und bereitete in Deutschland die Herrschaft der Vernunft, der mythoslosenratioeiner überalterten Zivilisation vor. Katholische Kirche und rationalistische Zivilisation, beide umklammerten als romanisch-lateinisches Erbe das deutsche Wesen, wenn nach einem fast tausendjährigen Überbauen durch romanische Begriffe von Kultur, Kirche, Staat, Recht überhaupt noch von einem deutschen Wesen die Rede sein konnte.
Aber trotz allem war es da. Freilich nicht repräsentiert durch die Dynastien der kleinen Territorien, die nach dem Pariser Vorbild sich richteten, und nicht einmal durch die Führer der geistigen Oberschicht, die in den Anschauungen einer rationalistischen Zivilisation befangen waren und die Sache der Aufklärung zur ihrigen machten. Es war da in den von der Latinität und ihren Auswirkungen noch unberührten Schichten, in dem gemeinen Volk, und darin vor allem in jenen Ländern, die noch im Bann der lutherischen Befreiungstat standen. Was aus diesen Schichten im zusammenstürzenden Mittelalter als Ruf nach einem deutschen Kaisertum immer wieder hervorbrach, nach einem starken Kaisertum gegen die Gewalt und Willkür der Territorialherren, das war die Sehnsucht nach deutscher Einheit und Auswirkung deutscher Wesenheit, das Verlangen nach einer deutschen Kultur, die die fremden Bildungs- und Begriffsschichten abwarf und aus der deutschen Erde und deutschen Eigenart emporwuchs.
Aus den von der Latinität unberührten Schichten allein also konnte das Ringen um die deutsche Form kommen. Entsprechend der geistigen Lagerung setzte im fernen Preußen diese Bewegung ein. Kant, von allen am meisten mit dem Rationalismus verwachsen, wurde dennoch sein Zermalmer. Hamann, durch die Erschütterung seines Londoner Aufenthalts aufgerüttelt aus dem zivilisatorischen Handelsgeist, der ihn in Riga umfangen hatte, stellte der Aufklärung die Innerlichkeit und Intensität seines religiösen Gefühls entgegen. Herder stieg zu den Quellen der Geschichte nieder und zeigte die historischen Formen als nicht aus der Vernunft, sondern aus der Seele der Völker erwachsen auf. In diesen Vertretern des Ostens fand die aus dem Herzen Deutschlands und aus bisher unberührten Schichten aufsteigende neue Generation ihre Wegbahner. Um nur Württemberg zu nennen: Schiller, zur ehernen Dichterposaune der kantischen Philosophie berufen, ging als erster voran. Hegel, Hölderlin (beide 1770 geboren) und Schelling (1775) folgten ihm. Unter der Berührung mit den geistigen Mächten der Zeit wuchsen die Söhne der von der römischen Kirche wie von der Aufklärung abseits liegenden protestantischen Länder in den deutschen Geist ein, nachdem Gestalten wie Schubart oder, in Sachsen, Günther den Boden gelockert hatten. Die einzige Tradition, deren sie teilhaftig waren, war Luthers Ringen um die deutsche Form gewesen, und dieses Ringen fand nun in der folgenden Periode des deutschen Idealismus und der deutschen Romantik seine Fortsetzung. Hierin wuchsen die ostpreußischen Denker mit den aus dem mittel- und süddeutschen Protestantismus stammenden Denkern und Dichtern zusammen, wie sehr im Verlauf der Entwicklung auch jeder seine eigne Individualität auswirken sollte.
Von den verschiedensten Seiten strömte neues Leben in die deutsche Dichtung ein. Die höchste Vollendung konnte sie in Goethe, dem Sohn der freien Reichsstadt am Main und Erben der germanisch-romanischen Verschmelzung, erreichen. Hier aber war in der vollkommenen Blüte der Sinn einer Entwicklung geschlossen. Das Ringen um die Formwerdung eines neuen Reiches, an oder vor dessen Anfängen wir immer noch stehen, entstieg andern Bezirken. Die großen Ostpreußen gingen voraus und bahnten den kommenden Weg. Die katholischen Länder des Südens blieben abseits. Als aber die über Europa hingehende Welle der Aufklärung die bisher vom Zeitgeist unberührten Schichten der protestantischen Länder Süd- und Mitteldeutschlands erreichte, da strömten aus unverbrauchtem Volkstum die Begabungen in das deutsche Geistesleben ein und bildeten mit einer Fülle überquellender Werke die neue Front. An Schiller und Hölderlin, Hegel und Schelling sahen wir, wie Württemberg in die deutsche Geistesentwicklung einschwenkte. Es war nicht die einzige Landschaft, die zu geistigem Selbstbewußtsein erwachte. Wenige Wochen nach dem Abschluß des Hubertusburger Friedens wurde in Wunsiedel im Fürstentum Baireuth Jean Paul geboren und in ihm der Dichter, der die Probleme seiner Zeit und eines aus unberührter Tiefe aufsteigenden neuen Volkstums am treuesten austragen sollte.
Wir zogen die russische Literatur als Vergleich heran. Wie unter der Berührung der westlichen Kultur mit der russischen Erde die langen Romanreihen Dostojewskis und Tolstois längs des breiten Saums dieser Berührung aufrauschten, so begleiten Jean Pauls fast unübersehbare Werke sein Hineinwachsen in die geistigen Strömungen der Zeit. Aus bisher unberührten Schichten aufsteigend, einzig von der Tradition der lutherischen Befreiungstat getragen, riß er das deutsche Leben an entscheidender Wende in sich hinein und stellte es als Gestalt wieder heraus. Die Aufklärung, die großen Ostpreußen, das Genietum, Goethe, Schiller, Fichte und die Romantik, mit allen hat er sich auseinandergesetzt und aus der Berührung mit ihnen die Verwirklichung des deutschen Menschen gewonnen. Den Kulturoptimismus der Aufklärung vermochte er als der einzige unter den Großen der Zeit mit dem Nationalbewußtsein der Romantik, den seelischen Überschwang der Genieperiode mit der Hingebung an die Wirklichkeit zu versöhnen. Weil er in die wechselnden Ströme des Geistes immer sein Dasein hineintrug, das Haften an den Urtatsachen des Lebens.
»Wer mich rein und recht beurteilen will,« schrieb Jean Paul in den Vorarbeiten zu seiner Selbstbiographie, »muß mich in meinem Ganzen nehmen.« Und rührte damit an die Hauptschwierigkeit, die sich seiner Würdigung in einem Zeitalter des Spezialistentums entgegenstellen mußte. Das 19. Jahrhundert hat nur die Schätze der Vergangenheit zu bergen verstanden, die einer Teiluntersuchung sich erschlossen, die durch den Buchstaben mitgeteilt werden konnten. Es sah die intellektuellen Probleme, aber die Totalität eines Lebens und das bloße Dasein entzog sich seinem Zugriff. Weder erkannte es die Verschmelzung von Jean Pauls titanischer Hingerissenheit mit den wirklichen Lebensströmen der Zeit, noch, daß er seine Idyllen als den Schacht des unversiegbaren Lebens in ein umfassendes Weltbild hineinstellte. Man glaubte ihn als formlosen Stürmer und Dränger abtun zu können oder ihn zum Idylliker beschneiden zu müssen. Beides war er nicht, weil er beides war.
Wir haben die geistige Konstellation bei seiner Geburt, wenige Wochen nach dem Hubertusburger Frieden, zu skizzieren versucht: Der Norden Deutschlands war von der europäischen Aufklärungswelle durchflutet. Im Osten bereitete sich schon die geschichtlich-heroische Weltauffassung des deutschen Idealismus vor. Die abseits liegenden Länder des süd- und mitteldeutschen Protestantismus, bis dahin vom Osnabrücker Frieden beschattet, unter dem Druck kleiner Despoten seufzend, hoben sich, berührt von der Aufklärung in die deutsche Entwicklung und das deutsche Geistesleben hinein. Unter dieser Konstellation wurde Johann Paul Friedrich Richter zu Wunsiedel im Fichtelgebirge als Sohn des Tertius (dritter Lehrer) und Organisten Johann Christian Richter an dem verheißungsvollen Datum des 21. März 1763 geboren.
###
Jean Pauls Heimat ist einer der düstersten und entlegensten Landstriche Deutschlands. Ein kärglicher Boden ernährt mühsam seine spärlichen Bewohner. Hochgelegen, am Fuß scharf abfallender Berge, heftigen Winden ausgesetzt, treten die Winter hier mit verheerender Strenge auf. Frühlings- und Sommersehnsucht zieht sich durch Jean Pauls Werk hindurch. Von seinen in bunter Fülle schwellenden Landschaften bot ihm seine Heimat den Zauber der Farben und die phantastischen Linien. Wenn die dunklen Fichtenwälder auf den Säumen des Gebirges im Sonnenuntergang erglühten, die Nebelmeere über den sumpfigen Tälern standen, dann durfte er in der Tat die mythische Landschaft erschauen, in der seine Gestalten leben. Immer spielen seine Romane am Fuß der Gebirge, die seine Kindheit und Jugend umstanden, und wenn er sie in ferne Gegenden verlegt, so allenfalls an den Saum der Alpen, weil Gottes Schöpferhand ihm im Zug der Berge am sinnfälligsten sich darstellte und er in Gottes Schöpfung seine Gestalten eingebettet wissen wollte.
Politisch gehörte Wunsiedel – Jean Paul nennt das Städtchen in richtigerer Fassung Wonsiedel – zum Fürstentum Baireuth, das wenige Jahre nach seiner Geburt mit Ansbach vereinigt wurde. 1791 kamen beide an Preußen, 1810 an Bayern. Dieser mehrfache Wechsel ist auf Jean Pauls Werk nicht ohne Einfluß geblieben. Die Eifersucht erbberechtigter Dynastien bildet ein ständiges Thema seiner Romane. In der rücksichtslosen Ländergier, die selbst vor Verbrechen in bürgerlichem Sinne nicht zurückschreckt, faßte er die ihm verhaßten Territorialdynastien bei ihrem angreifbarsten Punkte. Mit der Mehrzahl seiner Landsleute atmete er auf, als das Land an Preußen fiel und der Willkür seiner Fürsten entzogen wurde, wenn auch die Mätressenwirtschaft Friedrich Wilhelms II. zunächst wenig verlockende Aussichten bot.
Man kann sagen, daß Jean Paul aus dem Herzen Deutschlands stammt. Denn das Fichtelgebirge ist die Grenzscheide von Nord- und Süddeutschland. Nach allen Richtungen hin entsendet es deutsche Ströme. Aber Jean Pauls Heimat ist auch Grenzland, berührt sich mit slawischem Volkstum und weist wendischen Einschlag auf. So gehört auch das Fürstentum Baireuth zu dem deutsch-slawischen Ostraum, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine so überraschende Anzahl genialer Köpfe hervorbrachte. Sei es, daß ein Tropfen wendischen oder slawischen Blutes die schlummernden Kräfte aufweckte oder in blutfremder Nachbarschaft gerade das eigne Volkstum sich rein und stark bewahrte, jedenfalls hat sich auch in Jean Paul eine Grenzscheide der Rassen als fruchtbar erwiesen. Sein Festhalten an der Sippe, am kleinen, von seinem Wesen ausgefüllten Raum, sein Hang zum »Nestmachen«, wie er es selber nennt, scheint wendische oder slawische Blutmischung bei ihm durchscheinen zu lassen. Aber wiederum konnte ihn das germanische Schweifen in die Ferne erfassen. Vielleicht war es überhaupt eine neue Rassenmischung, die in ihm und vielen seiner großen Zeitgenossen auftauchte und schon in Erscheinungen wie Günther, Bürger oder Schubart zutage trat. Eine Vermischung germanischer Erobererstämme mit irgendwelchen älteren autochthonen Bewohnern des Landes, die im Gegensatz zu der rein germanischen Oberschicht, etwa durch Goethe repräsentiert, nun aus der Tiefe sich hob und in die bisherige Herren- und Bildungsschicht eindrang. So wenig beweisbar im exakt wissenschaftlichen Sinne solche Vermutungen sind, so stützen sie sich doch auf augenscheinliche Tatsachen und Gegensätze des Wesens, die kaum anders als durch Rassengegensätze erklärt werden können.
Jean Pauls Familie war seit Generationen im Fichtelgebirge ansässig. Sein Großvater Johann Richter lebte als Rektor, Kantor und Organist in Neustadt am Kulm. »An dieser gewöhnlichen baireuthischen Hungerquelle für Schulleute stand der Mann (der zuvor Kantor in Rehau gewesen war) fünfunddreißig Jahre lang und schöpfte.« Mit einem Strich wird hier das Elend der armen Theologen umrissen, die in der oft vergeblichen Hoffnung auf eine Pfarrstelle als Schullehrer, Kantoren, Organisten ihr Leben für ein Jammergehalt fristeten, einen bewunderungswürdigen Heroismus des Entbehrens an den Tag legten und in furchtbarster Armut Kinder zeugten, denen wieder das gleiche Los bevorstand. Als der Großvater im Sterben lag, brachten die Eltern den fünf Monate alten Jean Paul in beschwerlicher Fußwanderung zu dem Großvater, daß er ihn segne. »Ich wurde in das Sterbebett hineingereicht, und er legte die Hand auf meinen Kopf.«
In solchem tagtäglichen Elend, in strenger Einteilung jedes Bissens Brot, wuchs Jean Paul heran. Die Überzeugung, wie jämmerlich die Kreatur Mensch in die Hand des Höchsten gegeben ist, mußte sich ihm in die Brust schneiden. Wie Vertriebene irrten diese Menschen durch das Leben, an ewiges Unglück gewöhnt. Und wenn ein stiller Augenblick des Glücks oder der Weihe sich über sie ausgoß, mußten sie ihn nicht mit Tränen in den Augen empfangen? Mußte nicht selbst jede Erhöhung schmerzhaft die wundgestoßene Seele berühren? Jean Paul läßt seine Gestalten ungewöhnlich viel weinen. Im Glück und Unglück entstürzen Tränenströme ihren Augen. Es war nicht allein sentimentales Übermaß der Epoche, es war die durch Hungern und Entbehren überreizte Außenfläche, die jede Berührung bis zur schmerzhaften Erschütterung empfand.
Bewegter als des Großvaters war das Leben des Vaters. Am 16. Dezember 1727 in Neustadt am Kulm geboren, besuchte er das Lyzeum in Wunsiedel als sogenannter Alumnus oder »armer Schüler« und darauf dasGymnasium poeticumin Regensburg. Hier wurde seine starke musikalische Begabung entdeckt. »In der Kapelle des damaligen Fürsten von Thurn und Taxis, des bekannten Kenner und Gönner der Musik, konnte er der Heiligen, zu deren Anbetung er geboren war, dienen.« Später brachte es Johann Christoph Richter sogar zum beliebten Kirchenkomponisten des Fürstentums. Jean Paul erzählt, wie sein Vater im Lärm der Stube ohne Zuhilfenahme eines Instruments an den Winterabenden seine Partituren schrieb. Dennoch wagte der junge Künstler nicht den extravaganten Schritt, sein Leben der geliebten Kunst anzuvertrauen, sondern studierte in Jena und auf der baireuther Landesuniversität Erlangen Theologie, plagte sich bis zu seinem 32. Lebensjahr in St. Georgen bei Baireuth als Hauslehrer ab und erhielt 1760 den Posten eines Organisten und Tertius in Wunsiedel, die Frucht eines fast zehnjährigen Wartens auf Anstellung. Ein verhältnismäßig immer noch günstiges Geschick.
»Er lebte auf Flügeln«, sagt Jean Paul von seinem Vater und bezeichnet damit das Hinreißende und Hingerissene seines Wesens. Ein Meister geselligen Scherzes, wurde er schon in Baireuth Liebling adliger Familien, und erregte durch seine außergewöhnliche Kanzelberedsamkeit Aufsehen. Ein Umstand, dem er wahrscheinlich nicht nur seine verhältnismäßig frühe Anstellung sondern auch seine Frau zu verdanken hat. In Hof im Vogtland verliebte er sich in Sophie Rosine Kuhn, die Tochter des wohlhabenden Tuchmachers Johann Paul Kuhn, und führte die Geliebte am 13. Oktober 1761 in sein Schulhäuschen in Wunsiedel als Gattin heim. Daß es ohne größeren Widerstand seitens ihrer Verwandten abging, war wohl der eindrucksvollen und bedeutenden Erscheinung des jungen Schulmeisters zu verdanken. Denn im allgemeinen hätte ein junger Theologe vergeblich bei einem wohlhabenden Tuchmacher angeklopft.
Man wird sich indessen das Vermögen der mütterlichen Familie nicht als zu groß vorstellen dürfen. Nach der Erbteilung blieb für Sophie Rosine herzlich wenig übrig. Und auch die gesellschaftliche Stellung kann nicht bedeutend gewesen sein. Auf den Jahrmärkten hielt Johann Paul Kuhn selbst in seinem Verkaufsstand seine Waren feil, und seiner Tochter fehlte es an jeder Bildung. Dennoch hat sich die Familie Kuhn sicherlich in engem Krämerstolz über den studierten Hungerleider erhaben gefühlt.
Eine ältere Schwester ist bald nach der Geburt gestorben, so daß Johann Paul Friedrich Richter als Erstgeborner galt. »Gern bin ich in dir geboren, Städtchen am langen hohen Gebirge, dessen Gipfel wie Adlerhäupter zu uns niedersehen!« schreibt er von Wunsiedel. Zeit seines Lebens hat er an Wunsiedel mit treuer Liebe gehangen und die Stadt seiner ersten Kinderjahre mit bunten Phantasiefarben ausgeschmückt. Noch bei seinem ersten Hervortreten als Schriftsteller übersandte er ein Exemplar der »Grönländischen Prozesse« der Ratsbibliothek der Stadt. Aufgesucht hat er sie allerdings erst wieder im Alter, seinem Grundsatz gemäß, sich poetische Erinnerungen nicht durch eine vielleicht nüchterne Gegenwart zu gefährden.
Nur durch wenige Tatsachen ist Wunsiedel bekannt geworden. Im Jahr 1462 verteidigte es sich mit Erfolg gegen ein Heer von 10000 Hussiten. Jean Paul erwähnt diesen Beweis der Tapferkeit seiner Mitbürger voller Stolz. 1795 wurde der Ermorder Kotzebues, Karl Sand, »der schwärmerischste deutsche Jüngling neuester Zeit«, wie Jean Pauls erster Biograph Richard Otto Spazier schreibt, in Wunsiedel geboren. Wenn auch Jean Paul sich von der mörderischen Gewalttat abgewendet hat, die Kampfeinstellung Sands für die deutsche Freiheit und Einheit teilte er. In ihr trafen die beiden berühmt gewordenen Söhne der Stadt zusammen.
Einen Tag nach seiner Geburt wurde der kleine Fritz, wie er genannt wurde, vom Senior (ältesten Pfarrer) Apel getauft. Seine Taufpaten waren der mütterliche Großvater Johann Paul Kuhn und der Buchbinder Johann Friedrich Thieme, »der damals nicht wußte, welchem Mäzen seines Handwerks er seinen Namen verlieh.« Daß der Tag seiner Geburt der Anfang des Frühlings war, konnte auf einen Dichter nicht ohne Eindruck bleiben. »In dem Monate,« schreibt Jean Paul über sein Geburtsdatum, »wo mit ihm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rotkehlchen, der Kranich, der Rohrammer und mehrere Schnepfen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März; – und zwar an dem Monattage, wo, falls man Blüten auf seine Wiege zu streuen hatte, gerade dazu das Scharbock- oder Löffelkraut und die Zitterpappel in Blüte traten, desgleichen der Ackerährenpreis oder Hühnerbißdarm, nämlich am 21. März; – und zwar in der frühesten frischesten Tagzeit, nämlich am Morgen um eineinhalb Uhr; was aber alles krönt, war, daß der Anfang seines Lebens zugleich der des damaligen Lenzes war.« Der 21. März blieb für den Dichter zeitlebens ein Tag symbolischer Bedeutung, ihm nahte er geheiligt und gereinigt und schrieb ihm eine schicksalwendende Kraft zu. Eine mit dunklen Bedeutungen spielende Mystik, der er sich gern ergab, knüpfte er mit Vorliebe an den Lenzanfang. Man kann sagen, daß sein ganzes Werk eine Apotheose des Frühlings ist, wie fast alle seine Helden im Frühling des Lebens stehen und der Sommerseligkeit zureifen. »So viel ist gewiß,« schrieb er noch im März 1822, »die Tag- und Nachtgleiche, in der ich geboren bin, ist Bild, wenn nicht Grund einer geistigen in mir – Phantasie und Reflexion sind sich ziemlich gleich zugewogen, so vielleicht moralisch gut und böse und zuletzt wohl Schicksale.« Und: »Das einzig Wunderbare, was sich bei meiner Geburt zutrug, war, daß der Tag und die Nacht gleich waren, als Vorspiel meines Doppelstils« (des humoristischen und des heroischen).
So war Jean Paul mit der Natur und einer phantastischen Ausdeutung des Frühlingsanfangs verwachsen. Schon die scherzhaften Sätze über die Flora und Fauna seines Geburtstages zeigen die tiefe Vertrautheit mit allem, was da kreucht und fleucht, und ebenso magisch gebunden wie an das Datum seiner Geburt blieb er an die Stätte seiner ersten Tage. Bevor er zum Selbstbewußtsein erwachte, siedelte die Familie nach Joditz über, wohin der Vater von der Freifrau von Plotho in Zedtwitz, geborne Bodenhausen, als Pfarrer voziert war.
Joditz, ein kleines Dorf an der Saale, zwei Meilen von Hof entfernt, nahm nun den allmählich zum Bewußtsein Erwachenden auf, um ihn bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr zu beherbergen. »Die Saale, gleich mir am Fichtelgebirge entsprungen, war mir bis dahin nachgelaufen . . . Der Fluß ist das Schönste, wenigstens das Längste von Joditz, und läuft um dasselbe an einer Berghöhe vorüber, das Örtchen selber aber durchschneidet ein kleiner Bach mit seinem Stege kreuzweise. Ein gewöhnliches Schloß und Pfarrhaus möchten das Bedeutendste von Gebäuden da sein. Die Umgegend ist nicht über zweimal größer als das Dörfchen, wenn man nicht steigt.« Mit diesen wenigen Strichen zeichnet Jean Paul den Ort, der ihm eine Welt umschloß und in dem sein Leben wie sein Schaffen bis an sein Ende wurzeln sollte. Kaum eines seiner Werke, das nicht die Joditzer Kindheit zum Ausgangspunkt hätte. Unauslöschlich bleiben die Dorferinnerungen in seinem Gemüt haften. Weder Leipzig noch Berlin noch sonst ein Ort der großen Welt hat ihm geben können, was das einsame Dorf im Fichtelgebirge ihm gab.
»Lasse sich doch kein Dichter in einer Hauptstadt gebären und erziehen,« schreibt er in seiner Selbstbiographie, »sondern wo möglich, in einem Dorfe, höchstens in einem Städtchen.« Nachdem er von den kalten Zonen ungekannter und ungeliebter Menschen in der Stadt gesprochen, fährt er fort: »Aber im Dorfe liebt man das ganze Dorf und kein Säugling wird da begraben, ohne daß jeder dessen Namen und Krankheit und Trauer weiß; die Joditzer haben sich alle ineinander hineingewohnt und hineingewöhnt; – und dieses herrliche Teilnehmen an jedem, der wie ein Mensch aussieht, . . . brütet eine verdichtete Menschenliebe aus, und die rechte Schlagkraft des Herzens. – Und dann, wenn der Dichter aus seinem Dorfe wandert, bringt er jedem, der ihm begegnet, ein Stückchen Herz mit, und er muß weit reisen, eh' er endlich damit auf den Straßen und Gassen das ganze Herz ausgegeben hat.« Die verdichtete Menschenliebe hat das Dorf ihm in der Tat mitgegeben, und er selber ist der Dichter, der aus seinem Dorfe wanderte und jedem ein Stückchen Herz mitbrachte. Nicht allein denen, die ihm begegneten, sondern allen seinen Tausenden von Lesern, denen er sich in bewußter und seliger Offenbarung, in einer Art edelster Schamlosigkeit hingab.
In seiner Selbstbiographie hat Jean Paul die Schwere seiner Kindheit, wahrscheinlich aus Ehrfurcht vor der geheiligten Gestalt seines Vaters, gemildert und durchsonnt. Nur im Werk kann man hier und dort durch die Dichtung die Wahrheit hindurchahnen, und viel von der Bitterkeit, mit der Vult in den »Flegeljahren« von seinen Eltern spricht, wird sich in seiner eignen Seele geregt haben. Dem Vater waren wohl schon in Joditz, zum mindesten in den letzten Jahren, die Schwingen zerbrochen, und an die Stelle des liebenswürdigen Gesellschafters war mehr und mehr der»strenge Gesetzprediger«, der harte und uneinsichtige Erzieher getreten.
Gegenüber dem Pfarrhaus lag die Wohnung des Schulmeisters, in der Fritz mit seinem Bruder Adam den ersten Unterricht genoß. Mit dem Abcbuch in der Hand betrat er die hohe Schule »in einer grüntafftenen Haube, aber schon in Höschen (die Schulmeisterin ersetzte öffentlich dabei meine schwachen Händchen).« Mit dem freundlichen Lehrer – alle diese Gestalten wird er später nicht müde liebevoll auszumalen – teilte er die Spannung des Vogelfangs mit dem zum Fenster hinausgehaltenen Finkenkloben oder dem Zuggarn auf dem Vogelherde draußen. Besonders erinnerte er sich »der langen ausgestopften Zapfen aus Leinwand, welche in kleinen durch die Holzwand gebohrten Luftlöchern steckten und die man nur herauszuziehen brauchte, um in den offenen Mund die herrlichsten Erfrischungen von Luft aus dem Froste draußen einzunehmen.« Auch hier wieder diese Vertrautheit mit den Elementen, die kleinen Erlebnisse, die in ihrer Gebundenheit an das dürftige aber naturhafte Material Welten in sich schließen, wie das Atemholen an den Luftlöchern der Holzwand.
Aber die ihn beglückende Schulzeit fand ein jähes Ende, weil »ein langer Bauernsohn . . . mich mit dem Einlegmesser ein wenig auf die Fingerknöchel geschlagen.« Infolgedessen nahm der ängstliche Vater die Söhne aus der Schule, um sie nun allein zu unterrichten. »Mir gegenüber mußt' ich jeden Winter die Schulkinder in einen Hafen einlaufen sehen, der mir versperrt war.« Der Unterricht des Vaters bestand darin, daß er den Söhnen vier Stunden vor-, und drei Stunden nachmittags aus dem Katechismus, der Bibel, Wörterbüchern und Langens Grammatik zum Auswendiglernen aufgab und sie außerdem während des Winters vollständig ans Haus fesselte. Ganze Jahre lang hat Jean Paul, solange der Winter dauerte, den engen geschlossenen Raum überhaupt nicht verlassen dürfen, oder doch nur gelegenheitsweise, wenn es im Dorf etwas Besseres zu tun gab. Im Sommer ging es nur wenig besser. Es war gar nichts Leichtes, »an einem blauen Juniustag, wo der Alleinherrscher Vater nicht zu Hause war, sich selber in einen Winkel festzusetzen und gefangenzunehmen und zwei oder drei Seiten von Vokabeln desselben Buchstabens oder ähnlichen Klanges in den Kopf einzuprägen und einzubauen.« »Man muß sich nicht wundern, wenn mein Bruder Adam deshalb immer Schläge von solchen Tagen davontrug.« Von sich kann er berichten, daß er niemals geschlagen wurde, denn »er wußte immer das Seinige.« Schon hier trat die staunenswerte Begabung des Knaben hervor. Für Fritz gab es keine Aufgabe, die er nicht mit Feuereifer aufgriff. Er lernte mit einem unersättlichen Heißhunger, auch wenn es sich nur um das Auswendiglernen eines Vokabelbuchs oder grammatischer Regeln handelte. Wo er auch hinkam, überall erregte sein Wissen begreifliches Aufsehen. Was ihm auch vorgehalten wurde, es war für ihn ein Zipfelchen der großen Welt der Gelehrsamkeit, und er ruhte nicht, bis er wenigstens alles ihm Erreichbare völlig in sich eingeschlungen hatte. Seine Aufnahmefähigkeit war grenzenlos, sein Gedächtnis umfassend wie das eines Halbwilden. In ihm schlummerte nicht nur der große Dichter, sondern auch eine der ganz großen intellektuellen Begabungen, wie gerade jene Zeit ihrer in Hegel, Schelling, Wilhelm von Humboldt hervorgebracht hat.
Dennoch litt er unter den Erziehungsgrundsätzen seines Vaters. Aber vielleicht war diese Erziehung seiner Natur gemäß. Er lernte nach Glück hungern und jede freie Stunde unter dem Sonnenhimmel als köstliches Geschenk aufnehmen. Und wenn er Monate hindurch in ein Zimmer gebannt war, so verwuchs er mit allen Adern wenigstens in den kleinen Ausschnitt der Welt, der ihm geboten war. Und dieser kleine Ausschnitt war ja auch nicht ein beliebiges Zimmer, nach einer Willkür des Überflusses und zufällig ornamentalen Gesichtspunkten ausgestattet, sondern es war ein von Fülle berstender Lebensumkreis, unter dem Gesetz der Notwendigkeit stehend. Wir sehen die Familie in dem einen Wohnzimmer versammelt, wenn draußen der Januarwind von den Höhen niedertobt. Der Vater sitzt wie gewöhnlich in der Fensternische und lernt an der Sonntagspredigt. (Übergroße Gewissenhaftigkeit verbot ihm, sich auf seine Improvisationsgabe zu verlassen.) Die drei Söhne »Fritz (das bin ich selbst) und Adam und Gottlieb (denn Heinrich kam erst gegen das Ende des Joditzer Idyllenlebens dazu) trugen abwechselnd die volle Kaffeetasse zu ihm, um noch froher die leere zurückzuholen, weil der Träger aus ihr die ungeschmolzenen Reste des gegen Husten genossenen Kandiszucker frei aus ihr nehmen durfte. Draußen deckte zwar der Himmel alles mit Stille zu, den Bach, durch Eis, das Dorf mit Schnee; aber in der Wohnstube war Leben, unter dem Ofen ein Taubenschlag, an den Fenstern Zeisige- und Stieglitzenhäuser, auf dem Boden die unbändige Bullenbeißerin, unsere Bonne, der Nachtwächter des Pfarrhofs, und ein Spitzhund, und der artige Scharmantel, ein Geschenk der Frau von Plotho, – und darneben die Gesindestube mit zwei Mägden; und weiter gegen das andre Ende des Pfarrhauses der Stall mit allem möglichen Rind-, Schwein- und Federvieh und dessen Geschrei; unsere auch vom Pfarrhofe umschlossene Drescher könnt' ich mit ihren Flegeln auch rechnen. So von lauter Gesellschaft umgeben, brachte nun leicht der ganze männliche Teil der Wohnstube den Vormittag mit Auswendiglernen zu, nahe neben dem weiblichen Kochen.«
Ein sinnvoller Lebenskreis rundet sich hier um den jungen Betrachter, dem die Vertrautheit mit dem Alltag, seinem Gerät und seinen Gewohnheiten eine unschätzbare Mitgift des elterlichen Pfarrhauses war.
Wenn die Dämmerung sank, schloß sich der Kreis noch enger zusammen. Der Vater ging auf und ab, »und die Kinder trabten unter seinem Schlafrock nach Vermögen an seinen Händen.« Unter dem Gebetläuten wurde ein Lied gesungen. »Die Abendglocke ist gleichsam der Dämpfer der überlauten Herzen und ruft, als der Kuhreigen der Ebene, die Menschen von ihren Läufen und Mühen in das Land der Stille und des Traums.« Die Fensterläden wurden geschlossen und von der Gesindestube her kam der erwartete »Mondaufgang« des Talglichts. Während der Vater an seinen Partituren arbeitete, saßen die Kinder spielend am langen Schreib- und Eßtisch, ja sogar auch unter ihm. »Unter die Freuden, welche auf immer der schönen Kinderzeit nachsinken, gehört auch die, daß zuweilen ein so grimmiges Frostwetter eintrat, daß der lange Tisch der Wärme wegen an die Ofenbank geschoben wurde; und wir lauerten den ganzen Winter über auf dies frohe Ereignis.« Von Zeit zu Zeit kam die alte Botenfrau, mit Schnee behangen, mit ihrem Frucht- und Fleisch- und Warenkorbe in die Gesindestube, und vor den kleinen Augen breitete sich im Auszug einiger Butterwecken aller Reichtum und Glanz der fernen Stadt. Oder die Viehmagd erzählte am Spinnrocken in der Gesindestube beim Licht des Kienspans Märchen und Schauergeschichten, die auf den reizbaren Knaben tiefen Eindruck machten, so daß er klappernd vor Frost und Angst im Bett lag, bis der Vater, mit dem er das Bett teilte, zur Ruhe ging. Oder auch in der Kirche, wenn er dem Vater die Bibel in die Sakristei nachtrug, lag die nachstürzende Geisterwelt auf seinem Nacken, und in grausigen Fluchtsprüngen suchte er die Tür der schützenden Sakristei zu erreichen.
Diese enge Nachbarschaft alles Lebendigen, dieses Versammeltsein von Hunden und Vögeln in der menschlichen Stube, dieses Schlafen im gleichen Bett, will uns heute unappetitlich und unhygienisch erscheinen. Aber um die bessere Hygiene tauschten wir doch das Glück der warmen Hautberührung und die kreatürliche Zusammengehörigkeit, die damals Gemeinbesitz war. Seit ein jedes Familienmitglied Anspruch auf sein gesondertes Arbeitszimmer erhebt, ist einer der tiefsten Schachte menschlichen Glücks ausgelaufen. Wer noch, aus unteren Schichten emporsteigend, daran Teil hatte wie Jean Paul, nahm seelische Kräfte in sein Leben mit, über die der aus Herren- und Bildungsschichten Stammende nicht mehr verfügt. Darum starb Goethe in verlorener Einsamkeit, Jean Paul aber im Arm der Seinen. Und die Armut, die ihn auch später mit Mutter und Brüdern in ein Zimmer pferchte, ließ ihn doch nie bis zur Verzweiflung unglücklich werden, weil er den Reichtum menschlicher Nähe auszukosten verstand. –
Wie eine Befreiung wirkte nach der winterlichen Abgeschlossenheit der anbrechende Frühling. »Was das heißt, auf einmal nicht nur aus Stadtmauern, welche viel Feld umschließen, sondern aus Hofmauern, und zwar sogar über das ganze Dorf, hinwegzukommen in mauerfreie Bezirke hinaus und in das Dorf von oben zu sehen, in das man nicht von unten gesehen!« schreibt er. Ackern, Säen, Pflanzen, Mähen, Heumachen, Kornschneiden, Ernten – ein Reigen von Frühlings- und Sommerfesten tanzt vorüber. »Die Morgen glänzen mir noch mit unvertrocknetem Tau«, an denen er dem Vater den Kaffee in den Pfarrgarten trug, der außerhalb des Dorfes lag. Das Auswendiglernen wurde jetzt im Grase liegend betrieben. Abends begleiten die Kinder die Mutter zu den Salatbeeten und den Beerensträuchern, und das Herrlichste: man konnte zur Nacht essen, ohne Licht anzuzünden! Die kleinen Freuden des unsterblichen Quintus Fixlein und des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz, sie haben an den Sommertagen des Knaben ihre Fackeln entzündet.
Die Zeit der ersten Liebe nahte. Es war ein kleines gleichaltriges Bauernmädchen mit eirundem pockennarbigen Gesicht, das sein Herz gefangen nahm, Augustina Römer geheißen. Zu einer Liebeserklärung kam es zwar nicht, aber in der Kirche sah er sie von seinem Pfarrstuhl aus in ihrem Weiberstühlchen sitzen und konnte ihren Anblick nicht satt bekommen. Wenn sie Abends die Weidekühe nach Hause trieb, die er am Geläut kannte, so kletterte er auf die Hofmauer, um sie zu sehen und heranzuwinken, und lief dann wieder hinab an den Torweg, um ihr etwas Eßbares, Zuckermandeln oder sonst etwas Köstliches, zuzustecken. »Leider trieb er's in manchem Sommer nicht dreimal zu solchem Glück«, und in all den Jahren kam er nicht einmal dazu, ihr die Hand zu drücken, geschweige denn sie zu küssen. Aber noch als die Familie nach Schwarzenbach gezogen war, übersandte er der heimlich und glühend Geliebten durch einen Boten selbstverfertigte Potentatenbilder, die er mit Fett und Ruß nach ihrem gemalten Leben gezeichnet und mit dem Farbenkästchen täuschend illuminiert hatte.
Besondere Oasen bildeten die Sonntage. Schon am taufrischen Morgen holte Fritz Rosen aus dem Pfarrgarten, um die Kanzel des Vaters zu schmücken. Nach der Kirche durfte er den Fronbauern, die wochüber in der pfarrherrlichen Landwirtschaft tätig gewesen, das reichlich ausfallende Halbpfundbrot überbringen und Freude austeilen. Die festlichste Abwechslung aber brachte der Besuch der Pfarrleute Hagen aus dem nahe gelegenen Köditz, die unter der Predigt erschienen. Spätabends, nach einem Tag voller Freuden und Spiele, begleitete das Joditzer Pfarrhaus das Köditzer bis weit über das Dorf hinaus, und eine solche Seligkeit erfüllte den Knaben dabei, daß das verlängerte Abschiednehmen und Begleiten von Freunden in den Abend hinein ein immer wiederkehrendes Thema seiner späteren Romane wurde. Auch ward den Köditzern der Besuch erwidert, und das freie Spielen mit einem gleichaltrigen Kameraden im befreundeten Hause bedeutete lange nachwirkende Seligkeit. Hier errang er auch die ersten Lorbeeren, wenn er vor den Pfarrleuten pathetisch des Vaters letzte Sonntagspredigt wiederholen mußte und glänzend abschnitt.
Eine besondere Rolle spielte in dem kleinen Leben naturgemäß die Familie des Patronatsherrn Freiherrn von Plotho auf Zedtwitz. Plotho war preußischer Gesandter beim Regensburger Reichstag gewesen. Goethe erwähnt ihn in seiner Beschreibung der Krönung Josephs II. und bemerkt, daß sein Auftreten dem Bilde entsprach, das sich die Frankfurter von dem Vertreter des großen Preußenkönigs gemacht hatten. Jedesmal wenn der Vater »bei Hofe« gewesen, setzte er Frau und Kinder in ländliches Erstaunen über hohe Personen und deren Hofzeremoniell, über Speisen und Eisgruben und Schweizerkühe. Berichtete voller Stolz, wie er aus dem Domestikenzimmer sehr bald zur Tafel gezogen wurde, wenn auch daran die bedeutendsten Rittergutsbesitzer des Vogtlandes saßen und aßen. Jeden Gründonnerstag holte eine prächtige Kutsche den Pfarrer als Beichtvater zur Abendmahlfeier der Herrschaft ab, und die Kinder wurden, bis der Vater fertig war, darin mit ihren Entzückungen im Dorfe ein wenig herumgefahren. Einmal aber wurde Fritz mit nach Zedtwitz genommen, drückte der Freiherrin den zeremoniellen Kuß auf ihr Kleid und empfing in dem Schloßpark die ersten Eindrücke von vornehmen Gärten, in denen er später im Werk wie im Leben heimisch werden sollte.
Erlebnisreicher waren die Gänge nach dem großelterlichen Hof, weil sie mit den Wundern der Stadt verbunden waren. Den Quersack auf dem Rücken ging es zuerst durch gewöhnliche reizlose Gegenden, dann durch einen Wald und darin über einen brausenden Fluß voller Felsstücke, »bis endlich auf einer Felderhöhe die Stadt mit zwei Brudertürmen und mit der Saale in der Talebene den begnügsamen kleinen Boten übermäßig überschüttete und ausfüllte. Vor einem Höhleneingang nahe an der Vorstadt, in welchen der Sage nach sich die Höfer im Dreißigjährigen Kriege geflüchtet hatten, ging er mit dem kindlichen Schauer vor allen Kriegen und Marterzeiten vorüber; und die nahe Tuchwalkmühle erweiterte mit ihren fortdauernden Donnerstößen und den unbändigen Maschinenbalken seine Dorfseele weit und groß genug, um die Stadt geräumiger darein aufzunehmen.« Zum erstenmal auf diesen Fahrten packte ihn die Fülle der Welt und die grenzenlose Verlorenheit alles Lebendigen auf ihr. »Noch erinnert er sich eines Sommertages, wo ihn, da er auf der Rückkehr gegen zwei Uhr die sonnigen beglänzten Bergabhänge und die ziehenden Wogen auf den Ährenfeldern und die Laufschatten der Wolken überschaute, ein noch unerlebtes gegenstandsloses Sehnen überfiel, das aus mehr Pein und wenig Lust gemischt und ein Wünschen ohne Erinnern war. Ach es war der ganze Mensch, der sich nach den himmlischen Gütern des Lebens sehnte, die noch unbezeichnet und farbelos im tiefen weiten Dunkel des Herzens lagen und welche sich unter den einfallenden Sonnenstreifen flüchtig erleuchteten. Es gibt eine Zeit der Sehnsucht, wo ihr Gegenstand noch keinen Namen trägt und sie nur sich selber zu nennen vermag.«
Es war ein Augenblick des inneren Erwachens, wie es ihn wohl um dieselbe Zeit zum erstenmal erschüttert hatte. »Nie vergeß ich die noch keinem Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich bei der Geburt meines Selbstbewußtseins stand, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiß. An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustür und sah nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mich fuhr und seitdem leuchtend stehenblieb: da hatte mein Ich zum ersten Male sich selber gesehen und auf ewig.« Er war in das erschreckende und erhebende Bewußtsein der Individuation eingegangen. –
Diese Gänge nach der Stadt, die in Zeiten der Not einige Male auch im strengsten Winter zurückgelegt werden mußten, waren »wahre Subsidiengänge«. Die Mutter gab dem Knaben nur einige wenige Geldstücke für die Großeltern mit – »es sollte nicht alles hergeschenkt erscheinen!« –, wofür die Großmutter, »spendend gegen Tochter und Enkel, und nur kargend gegen die übrige Welt, den Quersack mit allem füllte, was etwan auf dem jedesmaligen Küchenzettel stand«. Wenn er dem ernsten langen Großvater hinter seinem Webestuhl die Hand geküßt und den offiziellen Mutterbrief überreicht hatte – »der Vater war zum Bitten zu stolz« –, so gab er das mitgebrachte Geld öffentlich ab und empfing heimlich hinter der Tür auf dem Gang von der Großmutter die reichlichen Gaben und konnte Nachmittags mit vollem Tornister und mit den Zuckermandeln für die geliebte Augustina, höchst erfreut über das elterliche Proviantschiff auf dem Rücken, nach Hause traben.
Den Höhepunkt der Stadtfreuden bildete aber der Höfer Jahrmarkt, zu dem die Großeltern jedesmal die zarte Tochter mit Fritz in einer Kutsche kommen ließen. »Wie Kaisern sonst Ehrentrünke geschickt wurden, so wurde die Mutter stets mit süßem Wein von ihren Eltern empfangen, und der Sohn ging mit etwas davon im Kopfe zum damaligen Haarkräusler Silberer. Dieser kühlte von außen den Kopf durch Brenneisen ab und durch An- und Umschrauben der Lockenwickel; aber desto frischer, neuer und weißer kam er dann mit Locken und Toupee aus dem Pudergestöber zum Mittagsmahle zurück, das nicht bedeutend sein konnte, weil der Großvater sehr bald auf das Rathaus hinter den Verkauftisch seiner Tücherballen eilen mußte . . . . Nun wurde der Nachmittag herrlich und aufsichtfrei und übertäubt und überglänzt unter dem bunten und lauten Getümmel der Menschen und Waren verbracht.« Für den von der Großmutter empfangenen Groschen konnte er »alles kaufen«, einiges Eingekaufte in das leere, unheimliche Haus tragen, in dem den Nachmittag über niemand anwesend war, und sich wieder in das bunte Gewühl mischen. Die vornehmsten und schönsten Damen hatte er umsonst an den Fenstern, zeichnete jedoch keine als Favoritin aus, sondern kaufte Zuckermandeln und Rosinen für die viehweidende Augustina in Joditz. Wenn die Lust und der Lärm unter den Abendstrahlen am lautesten wurde, mußte er freilich nach Hause, weil der Großvater nach dem Verkaufen um sieben Uhr aß und alles beisammen sein mußte. Nach dem Essen aber ging es noch einmal hinaus, wo die Janitscharenmusik durch die Straßen zog. Unvergeßlich blieb dem Dorfkind dieser erste Eindruck von Trommeln, Querpfeifen und Janitscharenbecken. »In mir, der ich unaufhörlich nach Tönen lechzte, entstand ordentlich ein Tonrausch . . . Am meisten griffen die Querpfeifen in mich ein durch melodischen Gang in der Höhe . . . So klang mir bei der russischen Feldmusik das hohe scharfe Dareinpfeifen der kleinen Pfeifchen fast fürchterlich, als eine zum Schlachten rufende Bothmäuspfeife, ja als ein grausames Früh-Tedeum für künftiges Blutlassen.« –