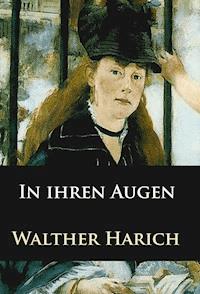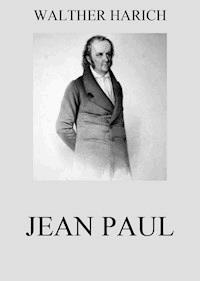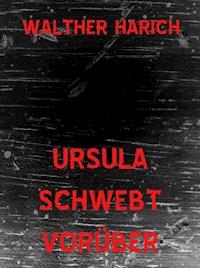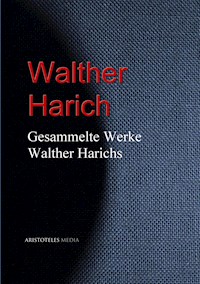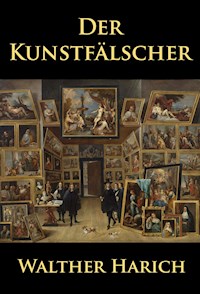
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Museumsassistent legte die Blätter der Mappe vor sich hin, ließ unter dem Glas Teilkreise aus dem Zusammenhang heraus groß vor das Auge treten, deckte Partien von Augen und Stirn vorsichtig zu, zirkelte den Winkel von Stirn und Nase ab, verglich auf den Blättern das Herauswachsen des Halses aus den schmalen Schultern, und konnte schließlich kopfschüttelnd zu keinem andern Ergebnis kommen, als daß ein einziges Modell diesen Arbeiten aus vollen drei Jahrhunderten zum Vorbild gedient haben mußte. Kurzum, daß es sich um Fälschungen handelte! Und dann ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walther Harich
Der Kunstfälscher
Roman
idb
ISBN 9783961509225
Berlin 1930
I
Es wurde nachher bald vergessen, wie die Geschichte ins Rollen kam. Aber es war so gewesen, daß irgendwo, in Detroit vielleicht, oder in Kopenhagen, in Buenos Aires, vielleicht auch in Paris oder Rom, ein junger Museumsassistent plötzlich überrascht die Lupe sinken ließ. Vor ihm lagen die Blätter, die jene seltsamen Kunstwerke aus dem »Fund von Cati« wiedergaben, soweit man sie hatte zusammenbringen können. Außerordentlich scharfe Photographien, die mehr als das Auge festhielten und die Oberfläche fast abzuschälen schienen.
Stücke von einem eigenartigen Reiz und meisterlicher Arbeit: Holzplastiken, Madonnenstatuen, eine heilige Katharina, der Engel eines Grabmals, Figuren von Brunnen und aus den Kreuzgängen spanischer Kathedralen. Dem vollen Umkreis altspanischer Gotik entstammend, dreizehntes bis fünfzehntes Jahrhundert. Man entsann sich nach Jahren der Sensation, die diese Stücke erregten, als sie im internationalen Kunsthandel auftauchten.
Ein Ursulinenkloster in dem altertümlichen Städtchen Cati (im Valencianischen) war abgebrannt. Aus einem Schuppen rettete man die vergessenen Sachen, die vielleicht Jahrhunderte dort verborgen gewesen waren. Arbeiten von unbekannten Meistern, deren Existenz man bisher nur aus geringen Abweichungen einzelner Werkstattarbeiten erschlossen hatte. Auf einmal tauchten nun von ihnen drei, vier Werke von einer unvergleichlichen Vollkommenheit auf. Andere daneben aus den folgenden Jahrhunderten, Parallelarbeiten zu den Schätzen der berühmten Kartause von Miraflores. Es gab da eine Sibylle aus dem fünfzehnten Jahrhundert von einer erstaunlichen Gewalt des Ausdrucks. Arbeiten von Gil de Siloe und Juan Guas. Die Holzfigur eines laufenden Mönches, die man als Gegenstück zu der berühmten Statue des Königs Ordono in der Kathedrale von Leon seit Jahrzehnten gesucht hatte. Und dann einen Engel, unverkennbar von dem in alle Winde zerstreuten Grabmal des Santiagoritters D. Alonso de Cardenas herstammend. Eine Figur von einem Liebreiz, der die Tränen in die Augen trieb.
Bei Betrachtung dieser Figur war es – und das ist das einzig Bezeugte von diesem Hergang –, daß den Assistenten, oder wer es gewesen sein mag, eine gewisse Ähnlichkeit der Gesichtszüge bei sämtlichen Werken dieses Fundes stutzig machte. Sie lag keineswegs auf der Hand. Es war nicht etwa so, daß immer das gleiche Antlitz dem Betrachter aus jedem Bilde entgegengesprungen wäre. Aber es war doch das gleiche Verhältnis eines weichen und runden Kinns zu einer schmalen und edlen Stirn, einer feingeflügelten Nase zu einem vollerblühten Mund, das in mannigfaltigen Abwandlungen immer wiederkehrte. Einmal brach der Ausdruck eines schwärmerischen Auges aus dem Maß dieser Formen leuchtend und verzehrend hervor, ein andres Mal wieder war es die Resignation eines müde heruntergelassenen Augenlids oder ein ruhiger Blick voll süßer Reife. Oder der hohe Ernst auf dieser ungewöhnlich wohlgebildeten Stirn, die wie ein Himmel voller Sterne und Wolken zugleich schien. Und immer derselbe Ansatz der Haare darüber mit der Andeutung eines dunklen Scheitels.
Der Museumsassistent legte die Blätter der Mappe vor sich hin, ließ unter dem Glas Teilkreise aus dem Zusammenhang heraus groß vor das Auge treten, deckte Partien von Augen und Stirn vorsichtig zu, zirkelte den Winkel von Stirn und Nase ab, verglich auf den Blättern das Herauswachsen des Halses aus den schmalen Schultern, und konnte schließlich kopfschüttelnd zu keinem andern Ergebnis kommen, als daß ein einziges Modell diesen Arbeiten aus vollen drei Jahrhunderten zum Vorbild gedient haben mußte. Kurzum, daß es sich um Fälschungen handelte!
Und dann wird er mit der großen Mappe zu seinem Professor oder Direktor gegangen sein, und sie werden beide über den Blättern gesessen und verglichen haben.
»Diese ganzen Arbeiten müssen von einer Hand herrühren!« sagte der Assistent.
»Es sind die geschicktesten Fälschungen, die mir je vorgekommen sind!« sagte der Direktor oder Professor und fügte gleich den Namen jenes Mannes hinzu, vor dessen Forum dieser Fall in erster Linie gehörte: des Geheimrats von Bock in Berlin.
Und dann begann der geheimnisvolle Apparat des internationalen Museenverbandes zu spielen. Ein kleiner Stab von Spezialisten saß tagelang zusammen, prüfte die Behandlung von Faltenwurf, Blattwerk, Beinstellung, Kopfhaltung, wog dreizehntes und fünfzehntes Jahrhundert gegeneinander aus, verglich die geometrische Aufteilung des Goldgrundes, den Blockcharakter der Figuren, ihre Haltung, die Neigung des Kopfes, die Seitendrehung. Keines der allgemeinen Merkmale einer Fälschung konnte festgestellt werden, nur gewisse Anzeichen dafür, daß diese Arbeiten, die den Charakter von drei verschiedenen Jahrhunderten trugen, von einer und derselben Hand herzustammen schienen und eine einzige Gestalt allen diesen verschiedenen Frauengestalten zugrunde lag. Merkwürdig!
Beißend scharfe Photos wurden hergestellt, die verdächtigen Partien in drei- und vierfacher Vergrößerung besonders aufgezogen, mit eingezeichneten Graden der Gesichtswinkel. Einzelne Teile der verschiedenen Arbeiten nebeneinander getypt, um ihre Übereinstimmung deutlicher zu machen. Chiffrierte Depeschen flogen um den Erdball mit vorläufigen Warnungen an die Mitglieder des Verbandes in den einzelnen Ländern und Städten, das bereits abgeschickte oder in Vorbereitung befindliche Material ankündigend.
In diesen Tagen wurde in London der große Monumentalbrunnen, den man Juan Guas zuschrieb, für zweihunderttausend Dollars von Mr. Smith aus Philadelphia ersteigert. Der junge Lord Fielding, der das Dezernat für Museen und staatliche Kunstsammlungen bearbeitete, war mit den Leitern des Britischen Museums und des »Victoria and Albert-Museums« anwesend. Unbeweglichen Gesichts sahen sie zu, wie der Amerikaner für das angezweifelte Werk seinen Scheck ausschrieb.
»Ein schönes Stück!« sagte der Leiter der Versteigerung zu dem Lord. Er wunderte sich, daß die Herren nicht für die staatlichen Sammlungen mitgeboten hatten.
»Indeed!« antwortete der Lord und wandte sich ab. Man hatte noch keine Beweise in der Hand und mußte schweigen. Aber er hatte die Susanne auf dem Brunnenrand mit den Photos andrer Werke aus dem Fund von Cati verglichen. Noch vor drei Tagen hätte er ohne die Warnung den Brunnen für die National Galery zu erwerben versucht. So schwiegen er und seine Herren, und keiner der Beteiligten ahnte etwas von den Alarmsignalen, die schon in allen Weltteilen die Museumsleiter erreicht hatten.
Es dauerte vier Tage, ehe das Belegmaterial bei Geheimrat von Bock in Berlin eintraf. Der Geheimrat wußte bereits, daß der Brunnen in London nach Amerika verkauft war, und sein Assistent, Dr. Günther Filscher, jener Filscher, der ein aufschlußreiches Buch über Holzplastiken des Barock verfaßt hatte, hatte herausbekommen, daß sich seit etwa zwei Jahren eine Madonnenplastik, die einem Schüler Pedro de Menas zugeschrieben wurde, im Berliner Kunsthandel befand. Niemand hatte sie in letzter Zeit gesehen. Eine andere Madonnenstatue war vor einem Vierteljahr in Dresden angeboten worden. Wo würde sie jetzt sein? Ebenfalls in Berlin natürlich! Was in Deutschland war, schob sich unwillkürlich in Berlin zusammen oder lief doch wenigstens einmal über Berlin. Man konnte mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, daß noch mehr Werke aus diesem merkwürdigen Fund von Cati in der Reichshauptstadt auftauchen würden. Nicht die größten vielleicht, weil die Kaufkraft der deutschen Sammler nicht hoch veranschlagt wurde, aber immerhin einige hochwertige Stücke. Man würde aufpassen müssen.
»Halten Sie die Fälschungen für erwiesen?« fragte der Geheimrat seinen Assistenten.
Der zuckte die Achseln. »Erfahrungsgemäß sind die meisten Stücke unecht.«
Wer war Geheimrat von Bock? Einer jener Gewaltigen, deren Namen die Öffentlichkeit kaum kennt. Der nur hier und dort, von der Masse überhört, etwa in den Etatsberatungen des Parlaments auftauchte. Einer, der hinter Kulissen thronte und den nur wenige Eingeweihte zu Gesicht bekamen. Aber der Geheimrat beherrschte ein ganzes Reich. Große Gebäudekomplexe wurden auf einen Wink seiner Hand geschlossen, veränderten ihre Fassade, wandelten ihren Charakter. Aus griechischen Sälen wurden assyrische oder ägyptische, alte Schlösser verwandelten sich in moderne Galerien. Wenn er der Zerfahrenheit der staatlichen Sammlungen müde war, erstanden irgendwo in Berlin Riesenpaläste, die eine seltsame Kreuzung von amerikanischen Hochhäusern und griechischen Tempeln darstellten. Unzählige Säle voll vorderasiatischer Kunst bauten sich auf sein Geheiß irgendwo auf. Früher wußte niemand, daß sie da waren. Das deutsche Mittelalter entfaltete seine Fülle. Die Renaissance schlug ihren Pfauenschweif durch ungeheure Hallen, zu denen goldgleißende Treppenhäuser emporführten. Geheimrat von Bock hatte seine Hände überall. Niemand wußte in seinem Reich Bescheid wie er. Wenn er heute aufstand und fortging, würde morgen auf Rohbauten die Arbeit einschlafen, würden ganze Speicher voller Kostbarkeiten vergessen werden, würden bereits genehmigte Pläne in einer entlegenen Schublade vermodern. Geheimrat von Bock hatte es in vierzig Jahren erreicht, daß Berlin im internationalen Museumswesen in vorderster Reihe stand. Trotzdem kannte ihn kaum jemand außerhalb des Kultusministeriums, und selbst den meisten Abgeordneten blieb sein Name unbekannt.
Am 2. Oktober traf das Material über den Fund von Cati bei der Museumsverwaltung ein. Es war das Geheimnis des Geheimrats, daß er stets die Post erhielt, die er erhalten wollte. Denn im Grunde war es nicht einzusehen, wie irgendein Paket, das unten in dem Treppenhaus des halbfertigen Rohbaus abgegeben wurde, den Weg zu ihm finden konnte und sich nicht in einem der zahlreichen Röhrensysteme verfing. Das Paket mußte an den verschiedenen Bauämtern vorüber, an dem Personalamt, an den einzelnen Museumsleitungen. Es war überhaupt schon ein Wunder, daß es nicht auf der Museumsinsel am Kupfergraben hängen blieb und wirklich nach dem Neubau im Westen hinausfand. Der Briefträger konnte wirklich nicht wissen, daß hinter den oberen Fenstern, mitten zwischen den Baugerüsten, das Gehirn der ganzen Museumswelt lag. Aber der Portier unten in dem Vestibül beschnupperte die Eingänge und beorderte sie durch den improvisierten Fahrstuhl, der zwischen gemauerten Wänden und rohen Eisenträgern dahinlief, nach oben. Dort nahm sie der Sekretär in Empfang, und er ging diesmal schweratmend durch den Saal mit den Gipsabgüssen nach der Antike, an der photographischen Abteilung vorüber, durch den Saal mit dem Oberlicht, der eigentlich für Kupferstiche vorgesehen war und in dem vorläufig die vier Stenotypistinnen saßen, nach dem Zimmer von Dr. Filscher. Dr. Filscher war der Referent für den Museenverband. Auf andern Fahrstühlen und über andre Treppensysteme ging es noch zu sechsunddreißig andern Assistenten. In seinem Arbeitsraum im Mittelpunkt aller Dinge saß der Geheimrat wie eine Spinne im Netz, und wie eine Spinne stieß er von Zeit zu Zeit nach den verschiedenen Ecken vor, und jedesmal begann das ganze System der feinen Verästelungen zu zittern und zu schwanken.
»Da ist es!« sagte Dr. Filscher, als er den atelierartigen Raum betrat. Er schlug die Mappe auseinander und breitete die Photos auf dem geräumigen Tisch aus.
Der Geheimrat warf von seinen Akten einen flüchtigen Blick darauf und griff nach dem Fernsprecher. »Herrn Professor Ambrus! Er möchte unter allen Umständen sofort zu mir kommen!« Dr. Filscher sah ihn verwundert an. Professor Ambrus, Ordinarius an der Berliner Universität, war nicht Mitglied des Museenverbandes. »Ambrus läßt gerade über spanische Gotik arbeiten«, erklärte der Geheimrat. »Wir unterhielten uns neulich über diese Dinge.«
»Darf ich solange das Material durchsehen?«
»Tun Sie das, Bester!« Die massige Gestalt des Geheimrats blieb unbewegt, und nur wenn er mit dem Riesenbleistift in den Akten herumkorrigierte, flog es wie von dunklen Schatten über seine Stirn, die wie gemauert war.
Und dann saß Dr. Filscher in seinem Zimmer vor den Bildern, verglich, las die begleitenden Erklärungen, sah Blatt für Blatt aufmerksam durch und trat schließlich an das Fenster. Vor ihm lag im Glast des sonnigen Oktobermittags Berlin. Hinter den Türmen der westlichen Vororte verlor sich das Gebrodel der Dächer im Dunst. Plätze mit dem bestaubten Blattgrün schwammen als kleine trübe Flecke herum. Straßen verliefen wie gekritzelte Striche inmitten verwischter Farben. Günther Filscher hatte dies Bild in allen Tagesbeleuchtungen, in allen Stimmungen in sich aufgenommen. Berlin! dachte er. Die Stadt war ihm ein Sinnbild des Lebens. So lag es vor ihm, ungestaltet und fassungslos fremd. Und jedesmal, wenn er durch sein Fenster blickte, empfand er von neuem die Verpflichtung, aus diesem Chaos eine Form zu gewinnen. Er ersehnte Aufgaben, die seine Kräfte anspannten, irgendeinen großen Fall, der die Aufmerksamkeit auf ihn lenkte. Bisher war er nur eine Nummer in dem Riesenbetrieb, die auf ein Klingelzeichen des Geheimrats hervorsprang und wieder verschwand.
Vielleicht lag hier der lang ersehnte »große Fall« vor ihm? Aber wie selten gelang es, einen großen Fälscher wirklich zu entlarven! Man kannte van der Veeken und einige andre, die es verstanden hatten, ein täuschendes Craquelé zu erzeugen, aber nicht einmal der Verfertiger jener berühmten Florabüste war entdeckt worden, der die größten Koryphäen getäuscht hatte.
Hinter dem Glas wurde das Rufzeichen des Geheimrats sichtbar. Dr. Filscher klappte die Mappe zusammen und begab sich in den Arbeitsraum des Vorgesetzten. Professor Ambrus war bereits anwesend. Die beiden Herren saßen auf dem Sofa, der große breite Geheimrat, der wie ein Bär erschien und doch die Behendigkeit eines Wiesels hatte, und die Faunsgestalt des Professors, auf dessen spindeldürren Körper ein richtiges Mephistogesicht gesetzt war. Die Blätter wurden ausgebreitet. Der Geheimrat mit seiner tiefen brüchigen Stimme erklärte.
»Ich kenne die Blätter,« sagte der Professor, »ich habe sie kürzlich für mein Seminar angeschafft. Interessante Stücke!« Aber den Gedanken an eine Fälschung lehnte er ab, solange geistesgeschichtliche Deutung als Erklärung übrigblieb. Die Ähnlichkeit der Gesichtszüge? Du mein lieber Gott, es hat sich da ein bestimmter Gesichtstypus herausgearbeitet. »Was für ein Typus?« dozierte er. »Mir scheint eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bamberger Reiter vorzuliegen. Man wird nicht so sehr ein einziges Vorbild für alle diese Arbeiten annehmen müssen als vielmehr Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Künstlern und Werken. Ferdinand der Heilige ist mit seiner Gattin Beatrix von Schwaben im Kreuzgang der Kathedrale von Burgos dargestellt. Welche Verbindungen gab es allein infolge dieser Heirat zwischen Oberdeutschland und Kastilien! Man kennt ganze deutsche Künstlerkolonien dort, die sich immer wieder aus der Heimat ergänzen. Reims mit seiner weltbedeutenden Schule vermittelte zwischen Schwaben, Franken und Kastilien. Es geht hinüber und herüber mit den Meistern und ihren Werkstätten. Hand in Hand damit ist das Auftreten eines schwäbischen oder fränkischen, jedenfalls oberdeutschen Typus innerhalb der spanischen Gotik zu konstatieren. Das Motiv dieses Gesichts pflanzt sich durch zwei, drei Jahrhunderte fort. Es ist nichts Erstaunliches daran!«
»Es gibt hier aber noch andre Kennzeichen, die darauf hindeuten, daß diese ganzen Arbeiten von einer einzigen Hand herstammen.«
»Kenne ich«, beeilte sich der Professor abzulehnen. »Ein Doktorand wollte mir neulich beweisen, daß der anonyme Schöpfer des Bamberger Reiters in der Dombauhütte von Burgos mitgearbeitet haben müsse. Der junge Mann hatte ganz triftige Gründe dafür. Dieselben ungefähr, die Sie hier anführen. Aber er konnte mich nicht überzeugen.«
Dr. Filscher merkte, wie dem Geheimrat das Blut in den Kopf stieg. Dann besann sich der Gewaltige aber und fing an zu lächeln. »Der Vergleich mit Ihrem Doktoranden ehrt mich. Im übrigen sind auch schon andre Leute auf den Gedanken gekommen, bei den bekannten zwei Figuren der Kirche von Burgos die Hand des Bamberger Meisters zu vermuten.«
Der Assistent stand hinter den Streitenden und schaute pflichtgemäß über ihre Köpfe auf die ausgebreiteten Photos. Im Innern aber ließ er die Berliner Händlertypen an sich vorüberziehen. Da waren die großen Firmen von Weltruf mit klarem und übersichtlichem Geschäftsgebaren. Im Augenblick hatte dort niemand Interesse an spanischer Gotik. Man war überdies vorsichtig geworden, besonders seit der Geschichte mit den nachgemachten Corots. Aber da waren noch die vielen kleineren Händler. Männer mit Habichtsaugen und Geierklauen darunter. Wer konnte in diese Menschen hineinsehen? Es gibt überall Hyänen des Kunsthandels, die die Qualität und das Anrüchige mit der Sicherheit professioneller Einbrecher wittern und sich die Objekte über Grenzen und Meere hinweg zuspielen.
»Mein verehrtester Herr Geheimrat,« fuhr Professor Ambrus gerade fort, »niemand kann dem Kampf Ihres Museenverbandes gegen die Fälscher dankbarer sein als ich. Aber Sie dürfen nun auch nicht gleich alles für unecht erklären, was sich nicht in Ihren staatlichen oder städtischen Museen befindet.«
»Es hat mich sehr gefreut, Herr Professor!« sagte der Geheimrat ein wenig zu rasch und erhob sich. Seine Würde konnte zuzeiten brüsk in Erscheinung treten.
»Ganz auf meiner Seite, Herr Geheimrat!«
Dr. Filscher begleitete den Professor auf einen Wink seines Vorgesetzten hinaus. Wie der ganze junge Nachwuchs in der Berliner Kunstverwaltung war er Ambrus' Schüler.
»Was meinen Sie, Herr Doktor, gibt es wirklich so viel Fälschungen?« fragte der Professor draußen, als er den Mantel anzog.
»Es gibt sehr wenig Echtes, Herr Professor.«
»Und der Londoner Brunnen? Und die Sibylle?«
»Ich halte sie nach dem vorliegenden Material ebenfalls für Fälschungen.«
Der Professor wandte sich achselzuckend der Treppe zu. Er sah ein, daß viel gefälscht wurde, aber er verstand nicht, wie man mit dieser Skepsis Kunstgeschichte treiben konnte.
Der Geheimrat rief seinen Assistenten nochmals herein. Er hatte sich eine Zigarre angesteckt und die Blätter vor sich ausgebreitet. »Fabelhafte Sachen!« sagte er. »Der Mann, der das gemacht hat, ist ein Genie. Man müßte diese Sachen für echt halten, wenn nicht immer wieder das gleiche Gesicht da wäre. Aber ist es nicht im Grunde gleichgültig, ob solche Sachen alt oder neu sind? Sehen Sie sich diese Brunnenfigur an!«
»Ich liebe am meisten den Engel von dem Grabmal des Alonso de Cardenas.«
»Eine fabelhafte Figur, Ihr Engel! Gil de Siloe soll das gemacht haben? Vielleicht konnte Gil das gar nicht so gut. Weshalb bewertet man eigentlich die alten Sachen höher als die nachgemachten?«
»Es ist vielleicht dieses Hineinschlüpfen in einen andern Stil!« sagte der Assistent. »Das Schöpferische besteht in dem Finden des eignen Stils, der eignen Form. Die Form eines andern nachzuahmen, ist eine rein virtuose Angelegenheit, die man letzten Endes nicht als künstlerische Leistung bewerten kann.«
Der Geheimrat zeigte lächelnd auf die Photos. »Ist das nur ein Hineinschlüpfen in einen fremden Stil? Das ist mehr!« sagte er. »Da hat ein Mensch sich selber auszudrücken versucht. Mit diesen wenigen hochbegabten Fälschern hat es eine eigene Bewandtnis. Es steckt eine Sehnsucht nach durchgeistigteren Zeiten dahinter, eine Angst vor dem Seelenvakuum der Gegenwart. Zwei solche Leute sind mir in meiner jahrzehntelangen Praxis begegnet, und dieser Dritte scheint mir der vorzüglichste zu sein. Vielleicht ist es eine Gemeinheit, die wir an diesem Menschen begehen. Er ahnt noch nicht, daß seine Werke erkannt sind, daß in jeder größeren Stadt die Museumsmänner auf der Lauer liegen, um ihn abzufassen. Wie soll er es auch ahnen? Innerhalb des Museenverbandes gibt es nur unverbrüchliches Schweigen, bis der Fall reif ist.«
»Dieser Fälscher ist jedenfalls ein hervorragender Könner. Vielleicht ist es ein berühmter Künstler, den wir alle kennen.«
»Ich hatte einmal einen solchen Fall«, sagte der Geheimrat. »Damals war der Fälscher ein sehr bekannter und hervorragender englischer Maler. Die Angelegenheit wurde unter der Hand erledigt. Es erfuhren nur wenige Menschen von den eigentlichen Zusammenhängen. Hier scheint die Sache ähnlich zu liegen.«
»Immerhin ist die Erwerbsgier eines solchermaßen begabten Künstlers ein unsympathischer Zug.«
»Erwerbsgier? Du mein lieber Gott, ein solcher Fälscher hat das Wenigste davon. Das große Geschäft wird von den Gaunern gemacht, in deren Händen sich der Mann befindet. Aber jeder Fall liegt anders. Man kann nichts Endgültiges darüber sagen. – Was machen wir nun?«
»Ich werde mich herumsehen, Herr Geheimrat, ob ich in Berlin etwas aus diesem Fund von Cati auftreiben kann.«
»Tun Sie das, mein Bester! Tun Sie das!« Geheimrat von Bock hatte schon die Akten über die Neuaufstellung des Pergamonaltars hervorgezogen. Dr. Filscher wußte, daß sein Vorgesetzter sich durch einen Hebeldruck umstellen konnte. In diesem Augenblick lebte er nur noch für den kleinasiatischen Hellenismus, und bei einem andern der sechsunddreißig Assistenten würde jetzt das Rufzeichen aufleuchten.
Er machte eine Verbeugung und ging hinaus. Schon auf dem Korridor begannen seine Gedanken zu arbeiten: In wessen Händen war damals die merkwürdige Madonnenplastik gewesen? Welcher Dresdner Händler hatte die heilige Katharina angeboten? Aber auch wenn man das herausbekam, hielt man noch immer nicht das Ende des Fadens in der Hand. Solche Spuren verloren sich. Immer tauchte der große Unbekannte auf, der nicht zu ermitteln war. Gegebene Ehrenworte begannen ihre Rolle zu spielen. Rücksichten auf Familien wurden vorgeschützt, die nicht bloßgestellt werden dürften. Es gab so herrliche Ausflüchte, wenn man sich nur in die Brust zu werfen verstand.
Die Welt war klein. Vielleicht saß man mit dem Fälscher täglich im Café zusammen oder wohnte mit ihm in derselben Etage. Vielleicht war es wirklich einer der großen Maler oder Bildhauer, oder irgendeiner aus dem namenlosen Meer der Unbekannten, von denen niemand etwas wußte. Nur einen Augenblick in das Innere aller Menschen blicken können, denen man begegnete, oder auch nur, mit denen man sprach! Es mußte toll sein, ein solches Geheimnis mit sich herumzutragen. Vielleicht wußten die nächsten Angehörigen nicht darum. Oder ein solcher Mensch hatte nicht einmal Angehörige!
Wieder stand Dr. Filscher an seinem Fenster und blickte über Berlin hin, wo die Oktobersonne die matten Pastellfarben auflockerte. Zwei, drei Menschen waren in diesem Häusermeer, die das Geheimnis des »Fundes von Cati« kannten. Wie sollte man die finden?
II
Hundert, zweihundert Professoren und Assistenten von Universitäten, Akademien, Kunstverwaltungen, Museen, Kupferstichkabinetten in Detroit, Kopenhagen, Berlin, Paris, London, Buenos Aires suchen in diesen Wochen nach einer Spur, die zu der geheimnisvollen Werkstatt führt.
Sie wissen, daß es einen gibt, der in lautloser Stille unerhörte Meisterwerke schafft, eines nach dem andern, in langer Kette, die nicht abreißen will. Die Arbeit eines ganzen Menschenlebens ist bereits auf den Markt geworfen, und immer noch taucht Neues auf. Oder lebt er nicht mehr? Vielleicht haben sich gewissenlose Menschen des Lebenswerks eines genialen Sonderlings nach seinem Tode bemächtigt. Vielleicht wurde er sogar von ruchloser Hand aus dem Wege geräumt. Vielleicht arbeitet er immer noch weiter, sitzt als harmloser Mensch in Restaurants und Cafés und ist in einsamen Nachtstunden von Dämonen besessen. Niemand kann wissen, wie so etwas vor sich geht.
Auch er weiß nicht, was in der Welt vor sich geht. Aus dem internationalen Museenverband dringt keine Stimme in den Kunsthandel hinein, und der Mann, der zu seiner Arbeit so absonderlicher und verbrecherischer Umwege benötigt, weiß nicht einmal viel von den Vorgängen im Kunsthandel. Er bekümmert sich nicht mehr darum, seit er mit einer dunklen Existenz vor drei oder vier Jahren das Abkommen schloß, das ihm ein gesichertes Arbeiten verbürgte. Er weiß nicht, wo seine Arbeiten hinkommen, er sieht sie nie wieder, hört nichts wieder von ihnen. Er arbeitet. Es ist eine Wut zur Arbeit in ihm. Manchmal kommt der Dunkle und breitet Photos vor ihm aus, den ganzen Tisch voll Bilder, das Ruhebett, den Fußboden voll Bilder. Eine ganze Welt aus Bildern! Einen Kranz von Statuen auf den Gesimsen verwitterter Dome, einen Wald von Säulen, die Wunderhöhlen dunkler Altarnischen, den Prunk goldener Gewänder, den stählernen Ernst von Harnischen aus geglättetem Stein, das Ungestüm vorjagender Rosse, Könige und Königinnen, und sie besprechen die Arbeit.
Ist der einsame Mann jemals auf den Gedanken gekommen, daß er Fälschungen ausführt? Damals, als er für das erste Werk das viele Geld erhielt, durchfuhr es ihn wie ein Blitz. Seitdem nimmt er es mit Gelassenheit hin, daß er ein Betrüger ist. Es ist die Form seines Daseins. Er stellt es sachlich fest und bleibt innerlich ruhig dabei, obwohl in ihm eine geheimnisvolle Kraft bedrohlich heranwächst. Manchmal schwillt es schon wie eine Wolke von dunkler Spannung in sein Bewußtsein hinein. Vielleicht wird er sich einmal an jemandem dafür rächen müssen, daß er ein Verbrecher geworden ist. Aber das liegt noch in weiter Ferne. Das hat mit dem Leben draußen zu tun. Sein eigenes Leben sind die nächtlichen Arbeitsstunden.
Er braucht keine Modelle. Er reißt ihre Form in sich hinein, diese Form, die einmal Zeit war und jetzt zeitlos geworden ist. Nie kann er von den Vorbildern etwas ganz gebrauchen. Das macht die Zeit, die immer noch daran haftet. Er braucht seine eigne Welt, er hebt die Behandlung des Faltenwurfs ins ewig Lebendige. Die Hintergründe werden bei ihm transparenter, das Blattwerk wirft er wie einen Teppich aus Stein über das Gemäuer. Die Figur des toten Königs auf seinem Sarkophag sinkt wie in den Mittelpunkt der Welt hinunter. Ein andermal schwebt der tote Bischof wie von Engeln getragen auf seinem Bett aus Marmor. Er dankt den Bildern des Dunklen, daß er so arbeiten kann. Daß er Stücke aus dieser vorhandenen Welt herausbrechen kann und in sein eigenes Leben überführen darf. Krone und Mitra und der von Speeren durchbohrte Heilige sind ihm näher als die Arbeiterheere der Leuna-Werke und ihr wogender drohender Rhythmus. Er braucht die Aura von Einsamkeit um seine Menschen, wie nur die alten Zeiten sie hatten.
Manchmal hält er mitten in seiner Arbeit inne, erschrocken von der tiefen Stille der Nacht, die über ihn gestürzt ist. Es gibt nichts Erschreckenderes als die Totenstille der großen Städte, die plötzlich wie eine Blase aus dem Grunde aufsteigt und über den Dächern platzt. Es ist wie ein jähes Knallen über seinem Haupt. Davon wacht er auf und merkt, daß seine Nerven zittern und seine Arme ihm weh tun. Dann setzt er sich auf den Marmor einer umgestürzten Figur und spricht in Gedanken mit dem einzigen Menschen, der manchmal zu ihm kommt und alles von ihm weiß.
III
Am Morgen wurde Dr. Hans Durlacher, der Juniorchef des Bankhauses Düsen & Durlacher, in seinem Kontor von dem Kunsthändler Zwingermann angerufen.
Nein, er wolle nichts Besonderes und möchte auch am Fernsprecher nichts sagen, aber er hätte etwas für ihn.
»Großes Objekt? Welche Zeit? Ich interessiere mich gegenwärtig für die Mingperiode.«
Nun, Dr. Durlacher würde sehen. Sie könnten sich am Nachmittag im Café Elsenheim am Kurfürstendamm treffen. Er würde Photos mitbringen.
Zwingermann war vorsichtig. Nie sagte er am Fernsprecher ein Wort zu viel. Er hatte keine Ahnung von einem »Fund von Cati«. Er wußte nicht, daß gewisse Abbildungen bei den Mitgliedern des Museenverbandes zirkulierten. Und wenn auch, er würde sich nichts daraus machen. Er hatte da lediglich einige Sachen, einige sehr wertvolle Sachen, von Erich Wein, und der hatte sie von Runge, und der hatte sie von Schabrack. Der große Monumentalbrunnen in London war von allen Autoritäten für echt gehalten worden. Schabrack sollte einen Züricher Privatdozenten an der Hand haben, der an einem Buch über den Fund von Cati arbeitete und die neuen Sachen kunstgeschichtlich einordnete. Aber Zwingermann würde trotzdem die Vorsicht nie außer acht lassen. Man konnte im Kunsthandel nie wissen. Die Geschichte mit den falschen Corots lag noch allen in den Gliedern, und man munkelte, daß der alte Schabrack auch da seine Hand im Spiel gehabt hätte. Das heißt: wer munkelt? Die Fernstehenden wissen von nichts, und die Eingeweihten werden sich hüten, ein Wort zu sagen. »Man munkelt« heißt im Kunsthandel, daß hier oder dort einer möchte, daß gemunkelt wird.
Hans Durlacher ärgerte sich jedesmal über Zwingermanns Art. Wenn ihm etwas angeboten wurde, wollte er wissen, wie und was. Sein Konto war jetzt immer angespannt. Er wollte sofort darangehen, einen Plan machen, eventuell irgendein Stück seiner Sammlung abstoßen. Wenn Zwingermann sagte: »Ein Pferdekopf aus der Mingzeit!«, dann konnte die Phantasie anfangen zu spielen. Jetzt schweiften seine Gedanken in allen Ländern und Zeiten herum. Es störte ihn bei der Arbeit. Er überraschte sich dabei, wie er seine Wohnung umräumte, ganze Wände neu ordnete, Ecken auseinanderriß. Und das alles, weil Zwingermann »etwas für ihn hatte«. Als sein Vater, der Seniorchef, bei ihm eintrat, fuhr er fast zusammen. Aber der alte Durlacher wollte nur etwas über ein Akzept wissen.
Vielleicht war Hans Durlachers ganze Sammlertätigkeit mit einem schlechten Gewissen verbunden. Noch keine drei Jahre war es her, daß er zu sammeln begonnen hatte. Er wußte nicht, wie es plötzlich über ihn gekommen war. Irgendwie hing es mit dem damaligen Besuch des früheren Kriegskameraden Edmund Stahl zusammen. Jedenfalls fiel ihm Edmund Stahl ein, sooft er an die Anfänge seiner Sammlungen dachte.
An und für sich war es mit Edmund Stahl nichts Besonderes gewesen. Man hatte mit ihm im Kriege irgendwo im Osten an derselben Front gelegen. Plötzlich schrieb er aus Hamburg eine Karte, da er zufällig von der Existenz des Hauses Durlacher vernommen oder gelesen hatte, und wenige Tage darauf tauchte er selber auf, bevor er sich nach Argentinien zurückbegab. Zuerst hatte Hans Durlacher geglaubt, daß ein Anleiheversuch dabei herauskommen würde, aber im Gegenteil, der frühere Gefreite d. L. Stahl dachte nicht daran, in Geldverlegenheit zu sein.
Noch immer hatte Stahl das ungezügelte und gewalttätige Gebaren, durch das er schon damals einen exotischen Hauch in das streng geregelte militärische Dasein gebracht hatte. Außer im Kriege war er wirklich unmöglich für Europa. Es gab einfach nichts, was er nicht unverblümt aussprach. Der gut erzogene junge Durlacher paßte zu dem ehemaligen Kameraden in keiner Weise, und dennoch imponierte ihm etwas an diesem Manne, der schon als einfacher Soldat getan hatte, was er wollte. Sie machten zusammen eine Tour durch die möglichen und unmöglichen Lokale der Stadt, sie hatten lange Gespräche in jener Stimmung, die der nüchterne Beobachter schon als Betrunkenheit bezeichnen wird, die die Beteiligten aber lediglich als Erhöhung des gewohnten Zustandes empfinden. Stahl sprach unaufhörlich und trank Unermeßliches. Sein Lieblingsthema war die Erotik der Eingeborenen, deren Künste er mit breiter Ausführlichkeit vortrug. Nicht der Stoff, aber die selbstverständliche Freiheit und Unbefangenheit, mit der Stahl sprach, bezauberten Durlacher. Es war, als wenn unter der sengenden Redeweise des Fremden etwas in ihm aufschmölze. Neue, ungeahnte Welten drangen auf ihn ein. Er begann etwas von der inneren Grenzenlosigkeit des Daseins zu spüren.
Am nächsten Morgen reiste Edmund Stahl nach Argentinien zurück, nicht ohne ihm einige indianische Waffen und Decken als Geschenk zu hinterlassen. Sicher ahnte er nichts von der Veränderung, die seine kurze Anwesenheit in Hans Durlacher bewirkte. Seit der Bankier an jenem Morgen nach Hause gekommen war, fügte er sich zwar wie bisher den Geboten der Pflicht, soweit sie seinen Beruf und seine Arbeit betrafen, lehnte sich aber offensichtlich gegen jene weitere Ausdehnung des Pflichtbegriffs auf, die auch das Verhältnis zur Familie, Sparsamkeit, geregeltes Leben und Überwindung unordentlicher Neigungen umfassen will. Er mietete sich eine eigene Wohnung, stattete ein Zimmer den indianischen Stücken gemäß aus und wies gelegentliche Einmischungen seines Vaters in sein Privatleben in einer höflichen, aber bestimmten Form ab.
Das Merkwürdige war, daß er sich innerhalb weniger Monate zu einem Kunstsammler entwickelte, den man auf allen Auktionen und in allen Antiquitätenläden antreffen konnte. Diese neue Neigung lag nun freilich von Edmund Stahls Wesen denkbar weit ab, und doch gab es auch hier direkte Verbindungslinien. Beschäftigung mit exotischen Dingen ist die Art des zivilisierten Mitteleuropäers, sich der Grenzenlosigkeit des Daseins zu bemächtigen. Ein höchst kultiviertes Hineintauchen in ferne Welten und entlegene Zeiten, ein Wunschtraum, den man herbeiführt, da die Ermattung der Instinkte nichts anderes mehr zuläßt. Vielleicht lag auch noch ein Rest barbarischen Erbes darin, sich mit kostbaren Stoffen zu umgeben, seltsame Formen aufzustapeln, ein Funkeln von Gold, Edelgestein und Emaille um sich spüren zu wollen.
Innerhalb dieser neuen Besessenheit aber vergeudete Hans Durlacher nichts. Auch wenn sein Bankguthaben von jetzt ab immer voll in Anspruch genommen war, tauschte, verkaufte und kaufte er mit einem ganz besonderen Geschick. Der Kaufmann in ihm bemächtigte sich auch dieses neuen Gebiets. Die gesammelten Stücke hatten für Hans Durlacher im Grunde keinen besonderen Geldwert. Wenn er seine Arbeit beendet hatte und sonst nichts Besonderes ihn abhielt, lebte er in seinen drei Zimmern ein eigenes Leben, bei dem er sich höchstens von seiner Schwester Hildegard beobachten ließ. Es war fast eine religiöse Verzückung, die ihn erfüllte. Er konnte still auf einem alten Tamburin dasitzen und seine Augen im Kreise gehen lassen. Die Moschee-Ampel strömte dickes gelbes Licht über ihn. Der zerschlissene Samt alter Barockstühle blickte ihn leichenhaft fahl an. Die verdunkelten Farben holländischer Bilder glühten bronzen. Über dem dunklen Gold eines schweren Altarschreins schimmerte das hellere in der Mitra eines Bischofs aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Reliquiare, gestickte Altarvorsätze, Kustodien, Ostensorien glommen von Ständern und Tischen, aus den Vitrinen glitzerten vorgeschichtliche Falbeln, Kameen, Fibeln.
An solchen Abenden trank er aus einem der venezianischen Gläser einen schweren bernsteingelben Wein von einer Blumigkeit, die den Atem beklommen machte. Es kam vor, daß er bis zur Bewußtlosigkeit trank. Er brauchte das, um die Geräusche der Großstadt zu überwinden, die durch die Fenster zu ihm drangen, oder um zu vergessen, daß er Hosenbeine mit tadellosen Bügelfalten trug und gräßliche Dinge, wie Kragenknöpfe und Sockenhalter, an sich hatte. Eine Zeitlang versuchte er es mit alten Kostümen, aber es befriedigte ihn nicht.
Er hielt, da er sich in seiner Neigung vor den Blicken eines Mannes fürchtete, keinen Diener, sondern zwei Mädchen, von denen die eine vollauf mit Staubwischen und Reinigen seiner Zimmer beschäftigt war. Übrigens machte es ihm nicht viel aus, wenn der Staub auf den in Blütenform gearbeiteten Kerzenträgern oder zwischen den verschlungenen Bändern eines schmiedeeisernen Altargitters aus der Renaissance millimeterdick lag. Seine Gesichtszüge selber sahen allmählich wie verstaubt aus. Er war in den letzten Jahren mager geworden, die Augen hatten den Glanz verloren und schienen tiefer in den Höhlen zu liegen. Ein halbes Jahr, nachdem Edmund Stahl wieder nach Argentinien gefahren war, begannen die Schläfen Hans Durlachers grau zu werden.
Er war sich über das Gefährliche seines Zustandes klar, aber er würde sich nicht mehr ändern. Nach den Erschütterungen des letzten Jahrzehnts würde die Bank, bei einigermaßen vorsichtiger Haltung, keine besonderen Krisen mehr durchmachen, wenn man auf größere Expansion verzichtete. Man war mit aussichtsreichen Industrien verbündet und nicht allzu hoch engagiert. Das mochte ausreichen. Auch durch die Liebe würden keine Krisen mehr kommen. Das Leben war zeitlos geworden. Alle Stile und Kulturepochen machten mit einem Schlage halt, wenn sie in dem Zimmer des Sammlers Aufstellung nahmen. Die Entwicklung lag unter Glas. Es war gleichgültig, ob man noch zehn oder zwanzig Jahre lebte. Sämtliche Stücke des berühmten Ganymedfundes würde man doch nicht mehr zusammenbekommen. – – –
Als Durlacher sich umgezogen hatte und gerade ausgehen wollte, um sich mit Zwingermann im Café Elsenheim zu treffen, besuchte ihn seine Schwester. Hildegard Durlacher war die einzige in der Familie, die ihm seine Zurückgezogenheit nicht verübelte.
»Ah, du gehst aus!« rief sie ihm in der Diele entgegen. »Ein seltenes Ereignis! Für mich bist du einer der wenigen Menschen, die überhaupt noch wohnen. Ich glaube, du hast sogar schon auf jedem deiner Stühle gesessen und sogar schon in die meisten deiner Bücher wenigstens hineingesehen. Du bist ein Unikum!«
Sie lachte, als sie vernahm, daß er mit Zwingermann verabredet war. »Also auf dem Kriegspfad! Von Zwingermann hast du übrigens deine besten Sachen!« fügte sie hinzu.
Er nickte. Sie ging in das Zimmer hinein und suchte vor der Seidenbespannung, die aus einem französischen Schloß stammte, nach der einen Statue, die sie an dieser Stelle zu finden gewohnt war.
»Ach, du hast deine heilige Katharina verkauft!« rief sie enttäuscht aus. »Es war dein schönstes Stück!«
»Liebst du es sehr?« fragte er lächelnd.
»Sehr!«
»So komm!«
Er führte sie in sein Schlafzimmer, wo die heilige Katharina dem Bett gegenüberstand. Hildegard trat schnell vor. Diese kleine Skulptur liebte sie über alles. Wie der fast geometrisch aufgeteilte Goldgrund den realistischen Ausdruck des Gesichts in einer strengen, fast archaischen Form zusammenhielt! Und dann dieses Gesicht selber! Den traurigen Blick der dunklen Augen, den verzückten Mund! Es war etwas Herzzerreißendes in diesem kleinen Heiligenantlitz, auf dessen runder schmaler Stirn ein Abglanz des goldenen Himmels zu liegen schien.
»Wie heißt der Künstler doch?« fragte sie. »Du hast es mir hundertmal gesagt, und immer vergesse ich es. Es ist mir auch gleichgültig, aber vor einem solchen Werk muß man doch den Namen seines Schöpfers in der Unterwelt beschwören. Ich glaube, daß er dann einen Augenblick aufhorcht.«
»Ich wollte, der Künstler hieße Pedro de Mena, aber es ist sicher nur ein Schüler von ihm oder ein Mitglied seiner Werkstatt. Man weiß nichts Genaues.«
»Würdest du die Katharina mir verkaufen?« fragte sie.
Er schüttelte den Kopf. »Komm, ich muß ins Café! Zwingermann wartet.«
Als sie die Treppe hinuntergingen, fiel ihr auf einmal ein, weswegen sie zu ihm gekommen war.