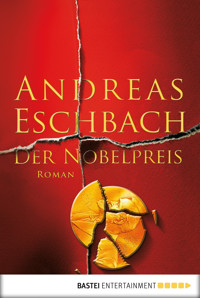9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jens Leunich besitzt nur so viel, wie in zwei Koffer passt - und außerdem genug Millionen auf dem Konto, um sein ganzes Leben in den Luxushotels der Welt zu verbringen. Abgesehen davon tut er - nichts. Gar nichts. Denn nichts zu tun, hat er erkannt, ist der beste Weg, die Welt zu retten. Bloß ist nichts zu tun nicht so einfach, wie die meisten denken. Diese und andere schlaue Einsichten will er nun niederschreiben - doch ganz gegen seine Gewohnheiten muss er sich damit beeilen, denn er hat nur noch zehn Tage zu leben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumVorwortNoch 10 TageNoch 9 TageNoch 8 TageNoch 7 TageNoch 6 TageNoch 5 TageNoch 4 TageNoch 3 TageNoch 2 TageNoch 1 TagMein letzter TagDanachÜber dieses Buch
Jens Leunich besitzt nur so viel, wie in zwei Koffer passt – und außerdem genug Millionen auf dem Konto, um sein ganzes Leben in den Luxushotels der Welt zu verbringen. Abgesehen davon tut er – nichts. Gar nichts. Denn nichts zu tun, hat er erkannt, ist der beste Weg, die Welt zu retten. Bloß ist nichts zu tun nicht so einfach, wie die meisten denken. Diese und andere schlaue Einsichten will er nun niederschreiben – doch ganz gegen seine Gewohnheiten muss er sich damit beeilen, denn er hat nur noch zehn Tage zu leben …
Über den Autor
Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 in Ulm, ist verheiratet, hat einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr.
Er studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Von 1993 bis 1996 war er geschäftsführender Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma.
Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hoch begabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman »Die Haarteppichknüpfer«, der 1995 erschien und für den er 1996 den »Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland« erhielt. Bekannt wurde er vor allem durch den Thriller »Das Jesus-Video« (1998), der im Jahr 1999 drei literarische Preise gewann und zum Taschenbuchbestseller wurde. ProSieben verfilmte den Roman, der erstmals im Dezember 2002 ausgestrahlt wurde und Rekordeinschaltquoten bescherte. Mit »Eine Billion Dollar«, »Der Nobelpreis« und zuletzt »Ausgebrannt« stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Thriller-Autoren auf.
Nach über 25 Jahren in Stuttgart lebt Andreas Eschbach mit seiner Familie jetzt seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne.
ROMAN
LÜBBE
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © 2023 by Andreas Eschbach
Diese Ausgabe 2023 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Svetlana – stock.adobe.com; mustapha – stock.adobe.com
Lektorat: Stefan Bauer
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4294-8
luebbe.de
lesejury.de
Eine der Frauen, die im Laufe meines Lebens das Bett mit mir geteilt haben, sagte einmal zu mir, ich sei wahrscheinlich der schlauste Mann der Welt. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob sie das wirklich als Kompliment gemeint hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es stimmt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich will im Folgenden über mein Leben berichten, und dann können Sie ja selbst urteilen.
Wo fange ich an? Egal. Ich kann hier und jetzt anfangen. Hier und jetzt sitze ich auf der Terrasse meiner Suite im Hotel Rosenpalais, von der aus man eine phantastische Aussicht über die Stadt hat. Das Wetter ist herrlich, ein mildes Lüftchen weht, nicht zu kalt und nicht zu warm. Von der phantastischen Aussicht mache ich im Moment allerdings keinen Gebrauch, weil ich einen Computer vor mir habe, in dessen Bildschirm ich mich spiegele, während ich schreibe.
Mir gegenüber ist der Etagenkellner damit beschäftigt, auf einem Tischchen einen Imbiss aufzubauen. Ich erspähe ein Stück Kuchen mit Schlagsahne, einen Korb mit frischen Brötchen, eine Schale mit Obst, goldgelben Orangensaft im Glas. Auf einem Teller liegen Lachs, ein paar Scheiben Avocado, Käse, Schinken, dazu Butter und Sahnemeerrettich in weißem Porzellan. Eine kleine Kanne Kaffee steht da und ein Glas Champagner.
Der Kellner gibt sich spürbar Mühe, alles so schön wie möglich für mich anzurichten. Ich hingegen gebe mir keinerlei Mühe für ihn, sondern sitze einfach nur hier in meinem Sessel und schreibe, um endlich einen Anfang zu haben. Würde uns jemand zusehen, würde er den Eindruck haben, dass ich den Kellner gar nicht beachte, doch das stimmt nicht. Ich beobachte ihn durchaus, aber unauffällig.
Er ist recht jung, noch keine dreißig, würde ich behaupten, wirkt tüchtig, gut ausgebildet und serviceorientiert im besten Sinne des Wortes. Ein nützliches Glied der Gesellschaft also. Ich hingegen bin faul, frei von Begabungen oder besonderen Fähigkeiten und kreise ganz und gar um mich und meine persönlichen Bedürfnisse. Ich bin, kurz gesagt, völlig unnütz. Aber ich werde es sein, der sich nachher an diesen Tisch dort setzen und all die Köstlichkeiten essen wird, während der tüchtige junge Mann das Hotel nach Dienstende hungrig verlassen wird, um nach Hause in eine bescheidene Unterkunft zu gehen, weil er sich, schlecht bezahlt, wie Hotelangestellte es nun einmal sind, Besseres nicht leisten kann.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass das etwas zu sagen hat, liegen Sie genau richtig. In gewisser Weise haben wir damit das Thema dieses Buches en miniature.
***
»Guten Appetit, Herr Leunich«, sagt er zum Abschluss, lächelt freundlich und so, als ob es ihm wirklich Spaß gemacht hätte. Vielleicht hat es das sogar. Heutzutage sind die Leute geizig, auch in Hotels dieser Klasse, sodass er womöglich nicht allzu oft Gelegenheit hat, einen so aufwendigen Tisch anzurichten.
Ich bin nicht geizig. Ich habe keinen Grund, es zu sein. Ich habe schon ewig kein selbst verdientes Geld mehr ausgegeben, wieso also sollte ich geizen? Auch diese Hotelrechnung wird am Ende jemand anderes bezahlen, anbei bemerkt.
Ich sage nur kurz: »Danke.« Bestimmt klingt es beiläufig, wahrscheinlich sogar herablassend. Ich habe mich im Verdacht, dass ich mir im Lauf der Jahre einen gönnerhaften Tonfall angewöhnt habe und es schon gar nicht mehr bemerke. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist es nicht passiert, weil ich mich für etwas Besseres halte als Menschen, die wirklich arbeiten – das ganz bestimmt nicht –, sondern weil diese Haltung und dieser Tonfall besser funktionieren. Schrecklich viele Menschen lechzen geradezu danach, jemandem zu dienen oder jemanden anhimmeln zu dürfen, von dem sie denken, er sei etwas Besseres als sie selbst. Auf dieser Grundlage funktioniert Aristokratie. Ich habe im Lauf meines Lebens viele Aristokraten kennengelernt, und die meisten waren strohdumme, faule Nichtstuer, deren einzige Fähigkeit darin bestand, bei den Menschen in ihrer Umgebung keinerlei Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass sie etwas Besseres seien.
Vermutlich ließe sich der Zustand der Welt insgesamt aus diesem eigenartigen Bedürfnis herleiten: ein interessanter Gedanke, dem ich gerne noch nachhängen würde. Aber, wie soll ich sagen? Ich werde nicht die Zeit haben, diese Überlegung weiter zu vertiefen, denn nach Stand der Dinge werde ich in zehn Tagen tot sein, und deswegen beschäftigen mich andere Fragen gerade weitaus mehr.
***
Der Etagenkellner ist gegangen, ich bin wieder für mich. Es ist ein schöner Moment. Man könnte mich jetzt fotografieren, wie ich in diesem Sessel sitze, den kleinen Computer auf den Knien, und bekäme ein für Werbezwecke ideal geeignetes Bild: ein gut gekleideter älterer Herr vor atemberaubendem Stadtpanorama, vor üppigen Blumen, einen verschwenderisch gedeckten Tisch neben sich.
Wenn ich von hier aus den Blick nach links wende, sehe ich durch das Geländer hinab auf einen weitläufigen, mit wunderschönen Mustern ausgelegten Platz. Menschen überqueren ihn zielstrebigen Schrittes, die einen von links nach rechts, die anderen in der entgegengesetzten Richtung.
Keiner von ihnen ahnt, dass ich hier oben sitze und sie beobachte. Keiner ahnt, dass ich in zehn Tagen sterben werde. Ich weiß noch nicht, wie, aber es könnte gut sein, dass ich dort unten ende, mitten auf dem weitläufigen, wunderschönen Platz, zerschmettert, als ekliger, blutiger Brei, den andere fleißige Menschen, andere nützliche Glieder der Gesellschaft, werden wegputzen müssen. Dann werde ich zum letzten Mal völlig nutzlos und allen eine Last gewesen sein.
Man wird sich fragen, wieso ich das getan habe. Sich keinen Reim darauf machen können. Darum schreibe ich diese Erinnerungen hier. Die werden zwar auch niemandem nützen, aber zumindest werden sie ein paar Antworten geben.
Noch 10 Tage
Es ist halb elf Uhr. Ich habe, wie immer, ausgiebig gefrühstückt und sitze nun in der Hotellobby, habe meinen Computer auf dem Schoß und merke, dass ich nicht recht weiß, wie ich anfangen soll. Ein paar erste Versuche habe ich wieder gelöscht, aber das werde ich nicht mehr machen; so viel Zeit bleibt mir nicht, als dass ich mir derlei erlauben dürfte.
Also: Wie beginne ich?
Keine Ahnung. Irgendwie eben. Am besten, ich schreibe einfach drauflos, dann wird sich schon alles finden. Das war immer so in meinem Leben.
Es ist ruhig um diese Zeit. Alle, die heute auschecken, sind bereits weg, und neue Gäste kommen in der Regel erst ab dem Nachmittag. Ohnehin verlieren sich aller Lärm und alle Hektik in dieser Halle, werden unbedeutend zwischen Marmorsäulen, goldenen Ornamenten, dicken Perserteppichen, ausladenden Polstergarnituren und üppigen Zimmerpflanzen. Ich pflege jeden Tag um diese Zeit in der Halle meines jeweiligen Hotels zu sitzen, eine Tasse Tee neben mir, die mir ein aufmerksamer Angestellter bringt, der meine Gewohnheiten kennt. Auch das Zimmermädchen kennt meine Gewohnheiten und nutzt diese Zeit, meine Suite wieder tipptopp in Ordnung zu bringen. In diesem Hotel hier war ich schon oft; man könnte sagen, es zählt zu meinen Lieblingshotels.
Ungewöhnlich ist heute nur, dass ich etwas tue. Normalerweise tue ich nämlich den Tag über nichts.
Sind Sie dazu imstande? Nichts zu tun?
Das glauben Sie vielleicht, aber meiner Erfahrung nach halten das die wenigsten Menschen lange aus. Fünf Minuten still auf einem Stuhl zu sitzen und nichts zu reden, nichts zu denken, nichts zu tun überfordert die meisten schon. Eine Stunde faul auf einem Liegestuhl liegen, ohne einen Drink zu schlürfen, dummes Zeug zu reden oder Frauen hinterherzublicken und sich vorzustellen, wie es wäre … das braucht richtig Übung.
Ich habe lange gebraucht, bis ich es konnte. Aber wenn man muss, kann man vieles.
Und ich musste ja.
Ah, das könnte ein guter Einstieg in die Geschichte meines Lebens sein. Ja, hier werde ich anfangen.
Also: Es gibt ein anderes Wort für Nichtstun – ein sehr schönes, Ehrfurcht einflößendes, gesellschaftlich ganz und gar akzeptiertes Wort: Meditation.
Verblüfft Sie das? Ich versichere Ihnen, es stimmt. Meditation ist nichts anderes, als dazusitzen und absolut nichts zu tun. Es ist die Kunst des Nichtstuns. Eine heilige Kunst, wie manche meinen.
Aber wie ich schon sagte, es ist tatsächlich schwierig, wirklich nichts zu tun. Furchtbar schwierig, und in diesem Fall ist das Wort furchtbar absolut angebracht. Die Gammler, die Faulpelze, die sogenannten »Sozialschmarotzer« oder wie immer man diejenigen nennt, die nur herumsitzen und nichts tun, tun in Wirklichkeit ja nicht nichts. Im Gegenteil, solche Leute tun eine Menge, und das die ganze Zeit. Sie quasseln. Sie rauchen. Sie spielen Karten. Sie pfeifen sich irgendwelche Drogen rein. Sie versuchen, jemanden ins Bett zu kriegen. Sie streifen umher auf der Suche nach Ablenkung, Beschäftigung, Unterhaltung, und das unablässig. Die Arbeitslosen und die Unterschicht sind die besten Kunden der Unterhaltungsindustrie; die willigsten Abnehmer für Flachbildfernseher, Fernsehshows und Computerspiele, wenn sie irgendwo das Geld dafür auftreiben. Tagediebe tun nicht nichts, sie tun nur nichts Produktives. Das ist es, was man ihnen übel nimmt.
Deshalb haben sich die Gurus und Weisheitslehrer aller Zeiten allerlei Methoden ausgedacht, die es leichter machen, wirklich nichts zu tun. Zum Beispiel, den Atem zu beobachten. Eine bestimmte Position einzunehmen. Ein Mantra zu wiederholen. Und so weiter.
Braucht man alles nicht, wenn man imstande ist, einfach nichts zu tun. Also: faul zu sein.
Und das bin ich. Ich setze mich hin und tue – nichts. Ich lese keine Tageszeitung. Ich halte nicht Ausschau nach irgendetwas oder irgendjemandem. Ich schmiede keine Pläne. Ich träume nicht von vergangenen Tagen, und ich versuche auch nicht, mir kommende auszumalen. Es ist mir gelungen, einen Grad an Faulheit zu entwickeln, der all das nicht mehr erforderlich macht.
Ich weiß, dass man Faulheit gemeinhin für etwas Unanständiges, Verächtliches hält, aber nach all den Jahrzehnten, die ich gebraucht habe, um es darin zur Meisterschaft zu bringen, kann ich kaum noch nachvollziehen, wieso.
Wieso denken alle, es sei etwas Gutes, tüchtig und produktiv zu sein?
Unfug. Es ist der Tüchtige, der all die schönen Bäume fällt, der Äcker in die Landschaft pflügt und der sich in die Tiefen der Erde wühlt auf der Suche nach Bodenschätzen, um Dinge daraus herzustellen. Die Allertüchtigsten erfinden Maschinen, um Bäume noch schneller zu fällen, unberührtes Land noch schneller in Äcker zu verwandeln, noch mehr Bodenschätze zu fördern und noch schneller noch mehr Dinge daraus zu machen. Dinge, die ihre Benutzer möglichst bald wieder auf den Müll werfen sollen, damit man ihnen neue Dinge verkaufen kann.
Es sind die Tüchtigen, die unseren schönen Planeten nach und nach in eine Müllhalde verwandeln.
Es sind die Fleißigen, die uns in den Untergang treiben.
Faulheit, habe ich erkannt, ist eine Tugend.
Der normale Bürger einer westlichen Industrienation, so sagt man, besitzt etwa zehntausend Dinge. Ich dagegen besitze nur, was in zwei handliche Koffer passt. Es handelt sich um lauter Gegenstände, die entweder von hervorragender Qualität sind oder die mir so viel bedeuten, dass ich sie um mich haben will. Der größte Teil ist Kleidung, der Rest ein paar Bücher, die mich so berührt haben, dass ich sie immer wieder lese, und ein paar Erinnerungsstücke.
Alles andere miete ich, könnte man sagen.
Das ist die Art und Weise, wie ich seit über dreißig Jahren lebe. Andere produzieren – ich konsumiere und bilde damit das notwendige Gegenstück. Andere sind fleißig – ich bin faul und schiebe so das Gleichgewicht der Welt wenigstens ein bisschen weiter in Richtung Balance. Andere arbeiten, so viel sie können – ich tue so wenig wie möglich, meistens nichts, und trage damit möglicherweise zu meinem Seelenheil bei, denn Meditation gilt ja als der Weg zur Erleuchtung.
Allerdings bin ich, ehrlich gesagt, auch zu faul, um mir Gedanken darüber zu machen, ob das wirklich so ist.
Man wird sehen. Und das bald. Ändern kann ich ohnehin nichts mehr.
***
Ich merke gerade, dass ich weiter ausholen muss. Mit Überlegungen wie diesen kann man nichts anfangen, ohne die Geschichte dahinter zu kennen.
Ich mache es auch kurz und schmerzlos, versprochen.
Geboren bin ich in Deutschland – wo und wann, tut nichts zur Sache. Stellen Sie sich eine Vorortsiedlung vor, mit mittelprächtigen Reihenhäusern, in denen Angestellte wohnen, kleine Beamte, hier und da ein Rentner-Ehepaar, das einen Kleinkrieg gegen lärmende Kinder führt. Stellen Sie sich Autos vor, die ihre Besitzer samstagvormittags unnötigerweise, aber stolz waschen und auf Hochglanz polieren, dazu Jägerzäune, dröhnende Rasenmäher zur Unzeit, Streit um zu laute Musik aus Teenagerzimmern, Grillabende, die zu lustig werden, dann haben Sie das Bild. Wir schreiben die Siebzigerjahre. Der Bundeskanzler heißt Helmut Schmidt, die Baader-Meinhof-Bande sprengt Bankchefs in die Luft – was man damals noch empörend fand –, und in den Oberstufen der Gymnasien sind marxistische Ideen groß in Mode, auch wenn sie nicht wirklich verstanden werden oder vielleicht gerade deshalb.
Und mitten darin ich: ein mittelmäßiger Schüler, der auf ein mittelmäßiges Abitur zusteuert und dumpf ahnt, dass ihm danach Bundeswehr, Studium, Beruf, Heirat und ein mittelmäßiges, bürgerliches Leben drohen, in dieser Reihenfolge. Keine Aussicht, die mich begeistert hätte, bloß wusste ich keine Alternative. Ich kannte auch niemanden, der eine wusste. Außerdem hätte ich das alles sowieso klaglos akzeptiert, wenn ich nur eine feste Freundin gehabt hätte. Hatte ich aber nicht, weil ich nichts Besonderes war. Weder war ich einer von den großen, coolen, sportlichen Typen, denen die Mädchen sowieso zu Füßen liegen, noch einer von den klugen Überfliegern, bei denen klar war, dass eine glänzende Karriere auf sie wartete, mit Doktortitel, Ferienhaus in den Bergen, einem Mercedes für die Gattin und einem Segelboot auf dem Bodensee für den Herrn des Hauses. Ich war nur ein magerer, unansehnlicher Jüngling mit Pickeln, und ich hatte nicht mal ein Mofa, nur ein altes Fahrrad.
Entsprechend begrenzt waren meine sexuellen Erfahrungen. Mein erstes Erlebnis in diesem Zusammenhang hatte ich mit einer Cousine, als ich in den Ferien bei Verwandten zu Besuch war: Beauftragt, mir die Umgebung zu zeigen, lockte sie mich in ein einsames Wäldchen, um mir dort ungeschickt, aber fest entschlossen einen von der Palme zu wedeln, und zwar, wie sie mir danach erklärte, um nachzuprüfen, ob es stimme, was ihr eine Freundin erzählt hatte. Ich schlug vor, dass wir das ruhig öfter machen könnten, aber sie meinte, so toll fände sie es nun auch wieder nicht.
Dann, kurz nach meinem sechzehnten Geburtstag, zog mich im Trubel einer aus den Fugen geratenen Silvesterfeier ein dürres betrunkenes Mädchen in ein dunkles Zimmer und über sich: ein aufregendes Erlebnis und nicht schlecht als »erstes Mal«, wie ich fand. Danach gingen wir ein paar Wochen miteinander und taten es noch weitere vier Mal, aber dann machte sie Schluss mit der Begründung, sie habe das an Silvester sowieso nicht so ernst gemeint. Mir war es nicht unrecht, denn ich fand sie, wenn ich ehrlich war, ziemlich hässlich, und war mir nur nicht schlüssig gewesen, ob der Sex mit ihr das ausglich.
Meine Anläufe, etwas mit Mädchen anzufangen, in die ich verliebt war, scheiterten hingegen allesamt kläglich. Dadurch hatte ich zwar genug Zeit, mich gründlich auf das Abitur vorzubereiten, doch es stellte sich heraus, dass meine mittelmäßigen Noten nichts mit mangelnder Zeit zu tun hatten.
Bei der Musterung hieß es, ich sei Tauglichkeitsstufe 3, also bewarb ich mich gar nicht erst um einen Studienplatz, sondern wartete den Brief vom Bund ab. Der kam ewig nicht, und als er schließlich doch kam, war es zu meiner Überraschung eine Zurückstellung. Ein Fehler in der Organisation, was ich jedoch nur vermuten kann, denn ich war damals zwar noch nicht sonderlich schlau, aber so doof nun auch wieder nicht, dass ich nachgefragt hätte, wieso man mich nicht wollte.
So kam es, dass ich auf einmal viel Zeit hatte.
Einem gewissen Karsten Baumann aus der Parallelklasse, mit dem ich zusammen Physik-AG gemacht hatte, war es ähnlich ergangen, und er hatte die Idee, nach Indien zu reisen. »So viel Zeit am Stück haben wir nie wieder im Leben«, erklärte er mir. »Das muss man ausnützen.«
Nach Indien zu reisen war damals angesagt; alle coolen Leute machten Trips nach Indien. Weswegen mir das nie in den Sinn gekommen war, denn die coolen Leute, das waren andere, nicht ich.
Karsten sah das deutlich entspannter. Er hatte eine ältere Schwester namens Silke, die schon in Indien gewesen war, und er meinte, was Silke könne, das könnten er und ich auch. Ich meldete Zweifel an, mir das leisten zu können, aber die ließ er nicht gelten. In Indien, erklärte er, lebe man total billig. Wenn man erst mal da sei, reichten ein paar Mark für Monate; so habe es seine Schwester auch gemacht.
Er bequatschte mich also, und kurz darauf flogen wir von Frankfurt nach Bombay. Wir reisten mit einer arabischen Fluglinie, deren Maschine viel Platz bot und hervorragendes Essen. Das islamische Alkoholverbot schien an Bord keine Rolle zu spielen, jedenfalls gab es zum Essen Wein und im Duty-free auch härtere Spirituosen – leider, denn so konnte Karsten eine Flasche Whisky erstehen. Mit dem Ergebnis, dass er bei unserer Ankunft in Bombay stockbesoffen war.
Es war der totale Kulturschock für mich. Der Flughafen stank wie eine öffentliche Toilette, mein Kumpel wie eine schottische Destillerie, und an mir blieb es hängen, uns irgendwie durch den Zoll und in den Bus nach Goa zu befördern. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich erinnere mich nur, dass vor dem Ausgang des Flughafens ein Gewühl herrschte, wie ich es noch nie gesehen hatte – buchstäblich Tausende von Menschen, die händefuchtelnd auf alle Neuankömmlinge einbrüllten, ihnen Taxis anboten oder Hotels oder Sex, und das alles um sieben Uhr morgens! Ich erinnere mich an eine Fahrt in einem Taxi, dessen Tür nicht schloss, sondern mit dünnem grünem Draht festgebunden werden musste, an Straßen voller Dreck und Bettler, an eine schier endlose Schlange vor einem Fahrkartenschalter, in dem ein gelangweilter Mann saß, der mich nicht verstand und den ich nicht verstand, an brütende Hitze und staubige Luft und an Horden von Fahrrädern, wild hupenden Rikschas und knatternden Mopeds.
Aber irgendwie schafften wir es an Bord eines Busses, der sogar tatsächlich nach Goa fuhr, und unser Gepäck hatten wir auch noch.
Die Fahrt dauerte ewig. Wir saßen eingepfercht zwischen dicken Hausfrauen, die unaufhörlich miteinander schnatterten in einer Sprache, aus der ich nicht einmal einzelne Worte heraushörte, Kindern, die uns stundenlang anstarrten, Männern, die unentwegt seltsames Zeug kauten, Hühnern in zerbeulten Drahtkäfigen, Körben voller gammeliger Früchte, die ich noch nie gesehen hatte, und unglaublich voluminösen Koffern. Mal wurde mir schlecht, mal Karsten, es ging über Schotterpisten, auf die sich in Deutschland nicht mal ein Traktor gewagt hätte, und es nahm und nahm kein Ende.
Bis es dann doch ein Ende nahm und wir da waren, in Goa, dem gelobten Land. Inzwischen war Karsten wieder nüchtern und schaffte es irgendwie, uns eine Hütte am Strand zu mieten. Vor dieser ließen wir uns atemlos erst einmal nieder und schauten lange einfach nur auf diesen weißen, unglaublichen Sand und diese unglaublichen Wellen und die unglaublichen Palmen – und die unglaublichen Frauen, die all das bevölkerten –, und konnten unser Glück kaum fassen.
Wie sich in solchen Fällen immer rasch herausstellt, war das Glück nicht so groß, wie es auf den ersten Blick den Anschein gehabt hatte. Die Frauen waren unglaublich, das stimmte – aber wir beide waren nicht cool genug, als dass sie sich mit uns abgegeben hätten, denn es gab jede Menge andere, viel coolere Männer, mit längeren Haaren, breiteren Schultern und lässigerem Auftreten. Nach ein paar Tagen hing mir das alles – das Baden im Meer, die allgegenwärtigen Moskitos und das Gefühl, unsichtbar zu sein – zum Hals heraus, und ich blieb einfach in unserer Hütte, pflegte meinen Sonnenbrand und tat mir leid.
Karsten dagegen zog herum und fand einen Dreh, doch noch cool zu werden: Er stieg nämlich in den Handel mit Marihuana ein oder, wie man es damals nannte, »Gras«. Wer Haschisch anzubieten hatte, der kriegte die Mädchen, auch ohne wie ein Surfer auszusehen. Von mir erwartete Karsten, in solchen Fällen die Hütte zu räumen und irgendwo zu warten, bis die beiden wieder herauskamen, das Mädchen mit einer Tüte in der Hand und er mit einem satten Grinsen auf dem Gesicht.
Gerade, als ich mal wieder an der Theke der Strandkneipe über einer Cola saß, die ich auszudehnen gedachte, bis Karsten seinen neuesten Deal abgeschlossen hatte, setzte sich eine Frau neben mich, die um die dreißig war, aus Sicht eines Achtzehnjährigen also steinalt. Sie hatte lange staubbraune Locken, Falten um die Augen und ein dünnes Batik-Kleid am Leib, und aus irgendeinem Grund ignorierte sie mich nicht wie alle anderen, sondern wollte wissen, woher ich käme und wie ich hieße.
Ich gab die gewünschten Auskünfte und erfuhr, dass sie Gertie hieß und aus Österreich kam, genauer gesagt aus Wien, und dass sie in Indien war, um über ihre Scheidung hinwegzukommen. Goa, erklärte sie, sei nur die erste Station, ihr eigentliches Ziel sei ein Ashram weiter im Norden.
»Aha«, sagte ich, »Sie wollen zu diesem Guru … wie heißt er? Bhagwan?«
»Bloß nicht«, winkte Gertie ab. Dort gehe jeder hin, das sei nichts für sie. Aber ob ich schon mal von Swami Navreen gehört hätte?
Nein, gestand ich, worauf sie mir in aller Ausführlichkeit erzählte, wie sie mit diesem Meister in Kontakt gekommen war (über eine Bekannte in Salzburg nämlich, die schon mehrmals zu Füßen des Swami gesessen hatte, von ihm gesegnet worden sei und der es seither richtig gut ginge) und wie wunderbar es sein würde, ihn zu sehen und sich seinen Lehren zu öffnen. Wie es sie spirituell weiterbringen würde. Wie die Weisheit der Veden ihr helfen würde, die Illusionen der Zivilisation zu durchschauen. Und so weiter.
Irgendwann muss ihr aufgefallen sein, dass ich schon lange nicht mehr zu Wort gekommen war, denn sie brach mitten im Satz ab und wollte wissen, was mich denn nach Indien gebracht hätte.
»Mein sogenannter Freund Karsten«, sagte ich und klagte ihr mein Leid. Dass Karsten alle Mädchen abkriegte und ich keines, weil er mit Hasch um sich werfen konnte, während ich nicht mal wusste, woher er das Zeug überhaupt hatte. Und dass ich mir die Reise nach Indien eigentlich anders vorgestellt hätte.
Daraufhin musterte sie mich von oben bis unten und meinte: »Es zwingt dich doch niemand zu bleiben. Komm einfach mit mir in den Ashram. Du wirst sehen, das wird dein Leben völlig verändern.«
Damit sollte sie recht behalten, wenngleich weder sie noch ich in diesem Moment hätten ahnen können, wie sehr.
»Ich weiß nicht …«, zierte ich mich wie die Jungfrau, die ich im Prinzip war. Ich hatte durchaus Lust, mehr von Indien zu sehen als nur den unglaublich weißen Sand und die unglaublichen Wellen und Palmen von Goa. Ich hatte nur Schiss, mich alleine auf den Weg zu machen.
»Wie viel Zeit hast du denn?«, fragte sie. »Wann geht dein Rückflug?«
»In vier Wochen«, sagte ich. Mir graute bei der Vorstellung, es noch so lange hier mit Karsten und seinem Potenzmarathon aushalten zu müssen.
»Das ist mehr als genug Zeit«, meinte Gertie. »Ich fahre morgen früh mit dem Bus um neun. Wenn du willst, sei einfach an der Haltestelle, dann fahren wir gemeinsam.« Sie lächelte. »Wär mir, ehrlich gesagt, sogar ganz recht. Ich würde lieber nicht alleine fahren.«
Da sich Karsten in dieser Nacht gar nicht mehr blicken ließ, schrieb ich ihm einen Zettel, dass ich mir noch ein wenig das übrige Indien ansehen wolle und wir uns ja zum Rückflug in Bombay treffen würden. Dann packte ich, war pünktlich am Bus und fuhr mit Gertie nach Norden.
***
Inzwischen sitze ich wieder auf meiner Dachterrasse, im Schatten eines breiten dunkelgrünen Sonnenschirms, und blicke über die Stadt. Der Computer steht vor mir auf einem Tischchen, das sich so über den Liegestuhl stellen lässt, dass ich gut daran schreiben kann. Der Etagenkellner hat es für mich aufgetrieben. Er war richtig stolz, mir meinen diesbezüglichen Wunsch erfüllen zu können. Vermutlich haben die Leute, die sonst in dieser Suite logieren, andere Dinge zu tun, als zu schreiben.
Wobei mir das Schreiben heute Vormittag Spaß gemacht hat, so großen Spaß in der Tat, dass ich mir jetzt sicher bin, das richtige Projekt für das Finale meines Erdendaseins gewählt zu haben. Ich hoffe nur, ich werde meine Erinnerungen zu einem einigermaßen sinnvollen Abschluss bringen können, ehe mein Schicksal mich ereilt. Immerhin, zehn Tage bleiben mir noch, oder genauer gesagt, neuneinhalb. Und wenn es weiter so gut vorangeht, lässt sich in dieser Zeit noch vieles niederschreiben.
Keinesfalls habe ich vor, die leiblichen Genüsse darüber zu vernachlässigen. Kurz vor Mittag bin ich auf mein Zimmer gegangen, um mich umzuziehen, anschließend habe ich im Restaurant gespeist. Ich habe mir das »Mare«-Menü gegönnt, und ich muss sagen, das Filet vom weißen Heilbutt, in Nussbutter gebraten, mit Steinpilzcannelloni, Röstzwiebeln und Champagneraufguss, war ein Gedicht.
Gerade eben hat sich ein Spatz auf die Brüstung gesetzt und schaut mich nun aus dunklen Knopfaugen an, als wolle er sagen: Aber wie ging es denn weiter, damals in Indien?
Das will ich nun erzählen. Auch wenn der kleine braungefleckte Vogel nicht geblieben ist.
***
Gertie und ich reisten also nach Norden, in einem Bus, in dem es so ähnlich zuging, wie ich es auf der Herfahrt erlebt hatte. Doch die zwar melancholische, aber offenherzige Gertie war eine wesentlich angenehmere Reisebegleitung als der volltrunkene Karsten. Zudem kannte sie sich aus und wusste, wie man abends eine Bleibe fand, denn natürlich war die Fahrt nicht in einem einzigen Tag zu bewältigen, dafür war Indien ein viel zu großes Land mit viel zu schlechten Straßen.
Abgesehen davon, dass mir die Zeit dazu fehlt, brächte es auch wenig, unsere Reise in allen Details zu schildern. Wir gelangten jedenfalls zum Ashram des besagten Swami Navreen, entrichteten den Obolus, den man von Wahrheitssuchern erwartete, und reihten uns ein unter jene, die gekommen waren, den Worten des Swamis zu lauschen.
Gekommen waren die meisten übrigens aus Europa und den USA, und so wurde es Gertie nach ein paar Tagen »zu westlich«. Wir zogen also weiter und klapperten im Lauf der folgenden Wochen noch eine ganze Reihe von Ashrams, Swamis, Gurus und Yogis ab, deren Namen ich beim besten Willen nicht mehr alle zusammenbrächte, und wozu auch? Denn sie erzählten, wenngleich mit verschiedenen Worten und in mehr oder weniger verständlichem Englisch, alle mehr oder weniger dasselbe.
Zum Beispiel, dass die Grenzen unserer Vorstellung auch die Grenzen unserer Möglichkeiten sind. Nichts engt uns so sehr ein wie das, was in unserem Kopf stattfindet. (Das fand ich irgendwie einleuchtend, allerdings wenig hilfreich.)
Zum Beispiel, dass Gott, oder das Schicksal, oder wie immer man die höhere Macht nennen wollte, die hinter allem steckt, unsere Wünsche erhört, sofern sie aufrichtig sind und uns wahrhaft weiterbringen. (Das hörte ich zwar, nahm es aber mit Skepsis auf. Meine Erfahrung war da anders: Nämlich, dass das Schicksal ein Arschloch ist, das dir etwas Leckeres vor die Nase hält und es dir genau dann wegzieht, wenn du danach greifen willst.)
Zum Beispiel, dass man sich von Besitz freimachen soll, denn nicht wir besitzen die Dinge, die uns gehören, sondern die Dinge besitzen uns und machen uns zu ihren Sklaven. (Von allen Weisheiten, denen ich in diesen Wochen begegnete, hat mich diese am nachhaltigsten beeindruckt.)
Ja, und dann wollten sie immer, dass man meditierte. Ich hatte nie das Gefühl, zu kapieren, wie man das machte und was das bringen sollte. Für mich sah es einfach verdammt so aus, als sei Meditieren dasselbe wie Herumsitzen und Nichtstun und sich dabei toll erleuchtet vorkommen.
Heute ist mir klar, dass ich das durchaus richtig erkannt hatte. Wobei man das mit dem sich toll erleuchtet vorkommen ohne Weiteres weglassen kann, herumsitzen und Nichtstun reicht völlig.
Was, wie gesagt, eine hohe Kunst ist, die nur wenige Menschen beherrschen.
***