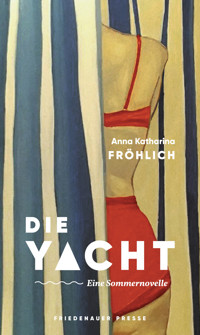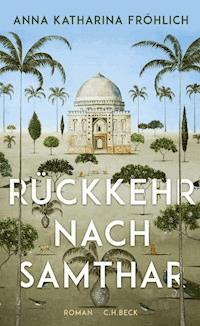Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein Garten, die schöne Erbin eines Botanikers, ein heruntergekommener Snob, ein indischer Angestellter und eine große Bibliothek: In diese Konstellation bricht ein junger Kroate von abenteuerlich balkanischer Eleganz, der die Ich-Erzählerin in eine geradezu dämonische Amour fou verstrickt. Am Ende geht nur die Natur heil aus der Geschichte hervor – in ihrer unendlich wandelbaren Fülle vielleicht die heimliche Hauptfigur dieses bei allem Schmerz zutiefst heiteren Romans. "Keiner von uns mag Mittelmäßigkeit, wir alle verehren das Vollkommene", sagte Mark Twain, und danach richtet sich auch die Heldin dieses mit Geist, Witz und Größe geschriebenen Romans, wohl wissend, welch tragikomische Folgen der Versuch in sich birgt, diesem Wort nachzuleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hanser E-Book
Anna Katharina Fröhlich
Der schöne Gast
Roman
Hanser Berlin
Die Arbeit an diesem Roman wurde durch den Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.
Das Zitat auf Seite 11 entstammt dem Dhammapada in der Übersetzung von Munish B. Schiekel, Freiburg im Breisgau 2009, S. 102.
ISBN 978-3-446-24556-3
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2014
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung einer Photographie von © Herbert List / Agentur Focus
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für Josephine
Wüßt’ ich genau, wie dies Blatt aus seinem Zweige herauskam,
Schwieg’ ich auf ewige Zeit still: denn ich wüßte genug.
Hugo von Hofmannsthal
Erster Teil
Wenn du keinen weisen Freund findest, keinen Gefährten, der auf die rechte Weise lebt und der versteht, so gehe wie ein König, der sein Königreich aufgibt, und wandre allein wie der Elefant im Dschungel.
Was mich betraf, so fand ich mich eindeutig ohne einen weisen, recht und maßvolllebenden Gefährten auf dieser Welt, und mir schien es auch ganz gewiss, dass ich weiterhin meinen Weg allein gehen würde – doch das Wunderbare, das Ermutigende an Vers 329 aus dem Dhammapada war der Ratschlag, diesen Weg wie eine ihr Reich zurücklassende Königin, wie ein sich seinen Urwaldpfad bahnender Elefant einzuschlagen. Ja, die alten Inder hatten gewusst, dass es sich nur in der Haltung eines Königs oder mit dem Temperament eines Elefanten mit der Einsamkeit, dieser widrigsten aller irdischen Lagen, aufnehmen lässt. Der Buddha aber kannte seinen Weg und trug diesen Schatz auf dem Grunde seines Geistes.
Es war mir seltsam zumute, als ich mich auf meinen kleinen Landsitz, wie der Herzog von Saint-Simon so etwas nannte, mit dem felsenfesten Entschluss zurückzog, die drei Hektar Land niemals mehr zu verlassen und mich für immer in die Gesellschaft meiner Bäume und Tiere zu begeben.
Mein Rückzug aus der Welt war der Eintritt ins alte Land meiner Väter und Großväter, ein Land, dem der seltsame Geruch von Erde und Papier anhaftete – meine Ahnen waren Gärtner und Gelehrte. Und war ich nicht eine Blüte dieses nördlichen Stammes, in der sich die Leidenschaft für die Natur mit der Liebe zum Buch aufs glücklichste verband?
In früheren Zeiten hätte mein Besitz als lächerlich klein gegolten, doch damals legte man ein anderes Maß an diese Welt, die noch groß und weit war. Felder gingen in Wälder über, und wo auch immer man den Kopf aus dem Kutschenfenster streckte: vor und hinter einem lag weites Land. Die Pferde trabten an Bächen und Meeren, an Felsgebirgen, Schluchten und Hainen vorbei, es rauschte, zirpte und pfiff in den Wiesen, und von den Bäumen zwitscherte, schlug und hallte es. Weiher, Schilf und Linde, Kraut und Kräuter, Kiebitze und Moos, Kies und Staub drangen ins Herz des Reisenden und machten auch den Stummen zum Dichter. Welch ein Geruch von Füchsen, wildem Thymian, Tannen, Nebelrauch und Gras, Gras und nochmals Gras lag in der Luft!
Meine Vorfahren hätten über mich und mein kleines Grundstück gelacht, doch mir war es groß genug, dieses Stück Erde, aus dem kein Geld und kein Glück, doch Gemüse, Obst und Poesie zu schlagen war, wollte einem nicht das Talent dazu ausgehen wie mir an klaren, warmen Wintermorgen, wenn weder Laub noch Gebüsch den Lärm der Motorsägen dämpften, der vom gegenüberliegenden Hügel in meinen Garten drang. Dann hörte ich aus dem dumpfen, widerhallenden Aufprall der geschlagenen Stämme das Geräusch eines niedersausenden Fallbeiles heraus.
Aus der breiten, einst sumpfigen, unterhalb meines Besitzes gelegenen Talmulde, die in vorchristlicher Zeit die Etrusker trockengelegt, im neunzehnten Jahrhundert die Engländer zu einem Golfplatz gemacht hatten, hallte an manchen Tagen das grelle Gedröhn von Mähmaschinen und Laubbläsern in den Garten, ein Lärm, den ich mit der komischen Ruhe eines Stoikers ertrug, indem ich die Stunde des Sonnenuntergangs herbeisehnte, wenn es für jene lauten Arbeiten zu dunkel wurde und es sich wieder aufatmen ließ.
Im Sommer bestiegen die Angestellten des Golfplatzes schon um sieben Uhr am Morgen ihre Mähtraktoren, auf deren hohen Sitzen sie im aufsteigenden Sonnenlicht mit dem Ausdruck verschlafener Kamele über die weiten giftgrünen Flächen fuhren, aus denen an feuchten Tagen die in die Gräser gesprühten Pestizide wie Tropenwolken aufstiegen. Wenn dann die ersten Clubmitglieder auf den Wiesen mit ihren zuweilen in der Sonne aufblitzenden Golfschlägern erschienen, die sie als Standarten ihres gesellschaftlichen Aufstiegs über der Schulter trugen oder in Trolleys hinter sich herzogen, kleine Kappen mit großen Schirmen und Schriftzügen auf dem Kopf, vertieft in ihre schweigsamen Runden von Loch zu Loch, erscholl dann und wann ein obszöner Siegesschrei, sobald ein Ball seinen Weg in die anvisierte Grube fand, und es hatte den Anschein, als gehörte zum Einlass in die Welt des Golfplatzes auch das Privileg der Taubheit. Kreuzten sich unsere Wege, zeigte ich den Spielern stets ein abweisendes Gesicht. Für mich stand fest, dass alles, was mit dem Golfspiel zusammenhing, unbestreitbar zum Albernsten gehörte, mochten auch noch so raffinierte Theorien über die intelligente Kunstfertigkeit dieser Sportart kursieren. Es lag mir fern, je mit den Clubmitgliedern ins Gespräch zu kommen – ich nahm sie aus meinem Garten als ferne Schauspieler wahr, die langsam über japanisch geschwungene Holzbrücken dahinzogen, sich in den großen Teichen spiegelten, hinter Lorbeerhecken und Feuerdornbüschen verschwanden und zwischen hohen Birken und Pappeln wieder auftauchten.
Es gab Tage, da überfiel mich der Taumel des Sonnenkönigs, wenn ich das breite, tiefe und dunkelgrüne Tal in seiner überirdischen Parkordnung überblickte, das sich unter mir als Verlängerung meines Gartens ausdehnte.
Über dem See ragte der Monte Baldo. Der hohe Berg, der See und der Golfplatz bürgten für eine unverbaute Aussicht, solange den Bauspekulanten und ihren Ingenieuren die Technik fehlte, auch auf dem Wasser Wohnsiedlungen und Hotels zu errichten. Dass Wind und Wasser noch ihrem rohen Zugriff entkamen, war das nicht Grund genug, diese Elemente im Stillen anzubeten?
Und wenn es schneite, wurde die Welt wieder zum Himmel – herrlich und voller Harmonie war sie dann. Nebel quoll aus dem Tal, duftige Schneewolken trieben durch die Luft, und der Monte Baldo ragte als Arche aus den Wellen des Sees. Endlich schwiegen die Maschinen, und im stillen Triumph sagte ich zu mir: Die Natur behält doch die Oberhand!
Wie das flimmerte, wie das glitzerte, wie es stäubte und wehte! Kein Mensch bewegte sich durchs Tal, nur Eichhörnchen sprangen von Baum zu Baum, nur Vögel zogen sirrend durch die Luft, ließen sich auf den Ligusterzweigen vor meinem Fenster nieder und flatterten durch die Flockenlawinen wieder fort, die leise und weich ins Schneegras niederstürzten.
Mit weiten Flügeln schlugen die Gänse den Schnee zu Schaum, der Hund schritt als schwarzbepelzter Lebemann durch die Hecken und grub seine Schnauze unter die frostige Flockenschicht, als wollte er die Materie schmecken, die da über Nacht auf Wege und Pfade gefallen war.
Endlich wurde es still, doch wie aus der Tiefe einer Gruft gurrte es aus dem Taubenschlag. Zwei Enten standen unter einer Tanne – Nonnen in einem verschneiten Wald. Sie trugen kleine weiße Hauben auf ihren blutroten Schnäbeln. Nur an den Hähnen und Hühnern blieb keine Flocke haften, ihre Kronen leuchteten weithin.
Am seltsamsten aber benahmen sich an Schneetagen die südlichen und tropischen Bäume. Statt ihre Wedel wie sonst als Fächer in die Luft zu strecken, verwandelten sich die Palmen unter dem Gewicht des Schnees in stille Pagoden. Die Nespolibäume neigten ihre Äste mit den harten langen Blättern bis zum Boden, als wäre auch für sie die Zeit des Nachsinnens und der Demut gekommen, und die Akanthuspflanzen, bei deren Anblick mir den ganzen Winter über Bilder von griechischen Tempeln und Säulengängen, vom Ägäischen Meer und seinen glutheißen Felsen durch den Kopf gingen, beugten nun überwältigt von der Last ihre Blätter zur Erde.
Der Farn hingegen, diese weitab von Städten und Dörfern wachsende Märchenpflanze, die in alten Zeiten zum Liebeszauber dienlich und jedenfalls in den »Flugsalben« enthalten war, welche die Hexen für ihre Ritte unter die Fußsohlen strichen, stand nun wie ein zerrupfter, vom Schneetreiben gepeitschter Fasan neben der Treppe zum Gemüsegarten, nah den Orangenbäumen, aus deren bitteren Blättern die Früchte wie kleine Lampions hervorglühten und als Garant der Frühlingswiederkehr ihren Duft in die eisige Luft verströmten.
Kronen, kleine und große, zierten an diesen weißen Tagen Stein und Pflanze – ja, das einzige wahre Königreich auf Erden, das Reich der Natur, hatte die Herrschaft wieder übernommen, leise, sanft und eisig.
An solchen seltenen Morgen setzte ich mich mit einem Glas gekühltem Weißwein in die Glyzinienlaube, um in leichtem Rausch vom Schneegestöber überschauert zu werden, bis der Frost mir an die Haut gedrungen war, während der einzige Mensch, der mit mir auf dem Grundstück lebte, der Inder Nanda, Holz vors Haus fuhr, die Tiere fütterte und die Enten in den Stall zurücktrieb.
Es gab keine Aufgabe, die Nanda in Verlegenheit gebracht hätte. Gelernt hatte er nicht in einer Schule, sondern als Kind auf dem Feld seines Vaters, als Halbwüchsiger in Dubai auf dem Bau und schließlich als Schreiner für einen Sikh-Tempel in der Nähe von Mantua, wo in den Landwirtschaftsbetrieben die Sikhs aufgrund ihrer meisterlichen Schlachtkunst sehr gefragt waren. Nandas Lehrmeister war die Natur gewesen, die fruchtbare Ebene des Punjab, wo er aufgewachsen war, doch Herrscher über ihn war Gott, den er überall sah und von dem er sich Tag und Nacht gesehen fühlte. Auf die Frage »Was ist Gott?« lautete seine Antwort »Was ist nicht Gott?«.
Nanda war ein großer, hagerer, von unmenschlich harten Arbeitsbedingungen geprüfter Mann, doch hatte diese Härte nicht die leiseste Spur in seinem jungen Gesicht hinterlassen. Seine taillenlangen, in die Stoffbahnen eines Turbans eingewickelten Haare von leuchtendem Rabenfederschwarz und sein ebenso glänzender, lockiger Bart umrahmten ein feines, tierhaft bewegliches, anziehendes Frauengesicht, aus dessen schrägen dunklen Augen es vor Lebhaftigkeit blitzte. Es war leicht, von Nanda zu behaupten, er könne nicht bis drei zählen und sei nahezu beschränkt, da er weder lesen noch schreiben gelernt hatte, und doch war er jedem westlich gebildeten Akademiker an feinfühliger Intelligenz, schäumender Erfindungsgabe und schwärmerischer Dankbarkeit, am Leben zu sein, überlegen. Als Fünfzehnjährigem war es ihm gelungen, seine Familie (der Vater war ein ambulanter, trunksüchtiger Getränkeverkäufer, die Mutter eine gläubige Hausfrau), sein kleines Stück Erde, sein Dorf, sein Land zu verlassen, um sein Glück erst im saudi-arabischen Emirat und später im kalten Europa zu versuchen, doch sein Übermut erwuchs vor allem aus seiner Liebe zu Gott. An seinem linken Ringfinger – er besaß Hände von tänzerisch behänder Gelenkigkeit – trug er einen kleinen silbernen Gebetskranz und um den Hals eine Sandelholzkette. Nur ich wusste von dem scharfen, unter seinem Turban verborgenen Messer.
Die Demütigungen durch seine arabischen Arbeitgeber, die an Sklavenausbeutung erinnernde Misshandlung, sein quälendes Heimweh nach dem kleinen Dorf im Punjab, seine Armut und sprachliche Ohnmacht, alle aus seinem Analphabetentum hervorgegangenen Missgeschicke hatten sein Wesen nicht verfinstert. Sein Gesicht war rein geblieben wie sein Herz. Er zählte zu den Auserwählten.
Nanda trank nicht, Nanda rauchte nicht, Nanda aß kein Fleisch. Das Schlachten einer Ente kam für ihn einer Beleidigung des Schöpfers gleich, der Genuss eines Schluckes Wein war in seinen Augen Betrug an der ungetrübten Kontemplation der göttlichen Wirklichkeit und ein einziger Zug an einer Zigarette eine sinnlose, die Sicht auf den Gerechten nehmende Benebelung des Geistes.
Nanda war in Gott verliebt. Wenn er kurz nach Sonnenaufgang Kardamomtee und Chapatis in der Küche bereitete, hörte ich ihn laut singen wie jemand, der sich seine Liebe aus dem Leib jubeln muss. Ohne Nanda wäre ich bei den frostigen Temperaturen wohl länger liegen geblieben, doch sein Gesang, das in den Räumen widerhallende Klirren und Klacken seiner geweihten Armreife und Ketten, der Geruch des frischen Kardamoms und der angebrannten Chapatis trieben mich aus dem Bett, und wenn ich dann gewaschen und angezogen in der Küche erschien, leuchtete mir in der Morgendämmerung aus den schrägen Ritzen seiner Augen schon jenes Licht entgegen, mit dem der anbrechende Tag noch auf sich warten ließ.
»Good morning, madam!« – so grüßte er mich jeden Tag von neuem, doch waren das auch die einzigen, vielleicht einmal in einem Film aufgeschnappten englischen Worte, die er aussprechen konnte. Ansonsten unterhielten wir uns in einem flüssigen Deutsch, das ihm mein Vater im Laufe langer Jahre beigebracht hatte, bis er sogar die schöne Kunst des Fluchens meisterhaft verstand.
Wie mein Großvater und Urgroßvater hatte auch mein Vater den Beruf des Gärtners ausgeübt. Er war ein ruhiger und heiterer Mann gewesen, der nach der Gartenarbeit die Abende in seiner Bibliothek am Schreibtisch verbrachte, umgeben von schmalen hohen Regalen, die nicht nur angefüllt waren mit Folianten und Büchern über die Geschichte der Gärten, über Gartenbaukunst und Gartenarbeit, sondern auch mit astronomischen, medizinischen und literarischen Werken aus vielen Jahrhunderten. In dunklen Kästen befanden sich getrocknete und frische Blumenwurzeln, Pflanzensamen, Körner, Kräuter, Knollen, Zwiebeln, Blätter, Rhizome und Schösslinge. Aus diesen Behältern, die mit kleinen hölzernen, den jeweiligen Inhalt angebenden Tafeln versehen waren, strömte der Geruch des Erdreichs hervor, und wer die Tür zu diesem Raum öffnete, der sog mit jedem Atemzug den Duft des gesamten Kreislaufs von Verwesung und Wiederkehr ein.
Stets herrschte Stille in diesem Raum, eine Stille, die nur hin und wieder durch das Umblättern einer Buchseite oder das Aufschieben eines Kastens unterbrochen wurde. Der schwache Lichtschein aus den über den Regalen angebrachten Klavierlampen fiel auf einige der Täfelchen, auf denen ein einzelner Begriff, etwa Myosotis, Cydonia oblonga oder Nelumbo nucifera, rätselhaft aus der weiten Düsternis des Raumes herausstach.
In den siebenunddreißig Jahren seines Lebens in diesem Haus hatten sich in der Bibliothek antiquarische Objekte aus vielen Zeiten und Ländern angesammelt: eine Quanon mit wundersam geschnitztem Gewand, ein marmorner, in sich hineinlächelnder Vishnukopf, eine Urne aus Pompeji oder eine alte jadegrüne Teetasse aus Japan, Dinge, die aus dem Raum ein Raritätenkabinett machten, ein kleines Museum, wo sich neben Fossilien Scherben und neben Schmetterlingskästen winzige Götterstatuetten den Platz teilten. Von den obersten Buchregalen blickten ausgestopfte Kakadus und Papageien mit Glasaugen in den dunkel dämmerigen, duftenden Raum hinab.
Eine Welt für sich bildeten die alchimistischen Werke wie das Theatrum Chemicum oder der Fasciculus Chemicus von Arthur Dee, dem Sohn jenes John Dee, Meister der schwarzen Magie, der später als Vorbild des Prospero in Shakespeares Sturm identifiziert werden sollte. Doch der wahre Lehrmeister meines Vaters war der Wunderarzt und Sprachmeister, Träumer und Revolutionär Paracelsus, dessen Leibspruch »Wer in sich selbsten kann bestan, gehöre keinem andern an«er sich schon früh zu eigen gemacht hatte.
Von Paracelsus, der nicht nur auf den hohen Schulen Europas gelernt und gelehrt, sondern sein Wissen bei alten Kräuterfrauen, Zigeunern, Henkern und Badern eingeholt hatte, hatte sich mein Vater auch die hohe Kunst der genauen Beobachtung abgeschaut. Wohin auch immer er sich in der Natur bewegte, stets hatte er einen Spazierstock bei sich, mit dem er sich Blätter, Blüten, Steine und Insekten zur genauen Musterung heranholte.
Dass der Vater des Paracelsus seinen kleinen Sohn auf Spaziergängen durch die Hochmoorflora des Sihltals anhand der botanischen Bücher des Theophrast von Eresos in die Geheimnisse der Kräuterkunde eingeführt hatte, hinterließ einen so starken Eindruck in ihm, dass mein Vater ihm nacheiferte, sobald ich sprechen konnte.
Ich werde die Nächte nicht vergessen, da wir von einer Reise zurückkehrten und er mit einer Taschenlampe noch in den Garten ging, wo er zwischen den Hecken, Beeten und Lauben umherleuchtete, um zu sehen, was sich unter den Pflanzen getan hatte, ob gar noch eine Handvoll Himbeeren aus dem Gesträuch zu pflücken oder eine Pfingstrose aufgeblüht war.
Die Geschichte meines Vaters ist schnell erzählt. Er stammte aus einer Tuchmacherfamilie aus Flandern, die am Ausgang des Mittelalters nach Schlesien versetzt wurde, wo in Grünberg eine Gärtnerdynastie entstand. Mein Vater studierte Anglistik und ging nach seinem Studium nach London, wo er sich einige Jahre als Buchhändler durchschlug – ein wenig glanzvoller, doch glücklicher Auftakt, da er eines Tages in einem Antiquariat meiner Mutter begegnete, die ihre Suche nach der Grammaire des jardins dorthin geführt hatte.
Meine Mutter war die Tochter eines Berliner Naturforschers, der sie, nach ihrem Biologiestudium, bei sich als Assistentin angestellt und auf seine Reisen durch die Welt mitgenommen hatte, auf denen Vater und Tochter gemeinsam sammelten und forschten. Ihre Mutter stammte ebenfalls aus einer Gärtnerfamilie. Die Verbindungen waren schnell geknüpft, und schon nach wenigen Monaten wusste mein Vater, dass die Natur seine Bestimmung war. Er machte bei Oxford eine dreijährige Gärtnerlehre, heiratete die Forschertochter und erwarb mit zweiunddreißig Jahren, dank des väterlichen Erbes, das Grundstück am See, wo er einen Garten anlegte und die Gärtnerei eröffnete.
Mir war wirklich seltsam zumute, nun endgültig auf dieses Stück Land meiner verstorbenen Eltern in Nandas Gesellschaft zurückzukehren, doch so hatte ich es nun einmal auf einer Reise nach Venedig entschieden, in einer Nacht, die mir wunderbar erschienen war. Kaum jemals habe ich so viele funkelnde Sterne am Firmament gesehen. Es war eine eisige Nacht, so klirrend kalt, dass ich nach dem Abendessen in der Wohnung eines ungarischen Komponisten lieber ins Bett als in Harry’s Bar gegangen wäre, vor deren Tür ein Ober neugierigen Fremden den Eintritt verwehrte.
Haupt- und Seiteneingang der Bar waren von innen verschlossen, doch hinter den Mauern hörte man leise die Gäste feiern. Die fernen, lachenden Stimmen erzeugten bei den Außenstehenden ein Gefühl neidischer Unruhe. Ein Passant blieb wie gebannt stehen und starrte auf einen Lichtstrahl, der sich durch einen winzigen Spalt im Türladen den Weg in die kalte Nacht gebahnt hatte und wie ein schimmernder Draht auf dem nassen Asphalt lag.
Als ein Ober, um eine Zigarette zu rauchen, in die Gasse heraustrat und meinen Begleiter unter der hin- und hertreibenden Menge auf der Calle Valleresso erkannte, ließ er ihn mit der Gewandtheit und geheimnisvollen Autorität eines der Generalität nahestehenden Untergebenen ein, der sich die Freiheit nimmt, in gewissen Fällen nach eigenem Gutdünken zu handeln. Doch ehe man sich’s versah, hatte sich hinter uns ein blonder, großgewachsener Mann mit einer roten Nelke im Knopfloch mit hineingeschwungen.
In der Bar vermischte sich Champagnerluft mit dem fettigen Dampf gefüllter Schweinsfüße. Die Oberkellner und Kellner, deren Meisterschaft im Bedienen weltberühmt ist, wirkten einschüchternd und der Barbesitzer beunruhigend auf mich. Dieser kleine weißhaarige Mann mit den Fischaugen und der großen Nase, dessen sentimentale Kaltblütigkeit durch eine hellrosa Krawatte unterstrichen wurde, die hart wie Rosenquarz auf seiner Brust lag, kam meinem Begleiter mit jener zurückhaltenden Ehrerbietung eines Mannes entgegen, dem aufgrund der eigenen Machtposition keine seiner Gesten bescheiden genug sein konnte. Es hatte nicht einmal eines Winkes von ihm bedurft, damit drei Kellner zwei gefüllte Champagnergläser und zwei Teller mit Schweinsfüßen brachten.
Wie sich ein Parvenü in der Aristokratie in jedem Augenblick seiner Herkunft erinnert, so vergaß der Barbesitzer nie seine einzigartige Stellung in der gastronomischen Welt.
An diesem Abend waren die Tische und Stühle an die Wände gerückt worden, damit die Gäste zur Musik eines singenden Keyboardspielers tanzen konnten, doch mein Begleiter betrachtete das Publikum als gesellschaftlich zu wenig ebenbürtig, als dass er sich vor den Augen des Gastgebers, der Menschen ganz anderen Schlages als die Klientel dieser Nacht kannte, zu solch einer vulgären Selbstdarstellung erniedrigt hätte, denn auch der Tanz wurde in dieser Bar zu einer Frage des hierarchischen, nicht des körperlichen Instinkts.
»Sie müssen meine Linsen versuchen«, wandte sich der Barbesitzer mit übertriebener Liebenswürdigkeit an mich, als handelte es sich nicht um Hülsenfrüchte, sondern um ein Jugendelixier, »sie sind heute ex-quisit!«
Ein Blick meines Freundes bedeutete mir, auf keinen Fall abzulehnen, sondern unverzüglich die schon servierten Linsen zu verzehren und zu loben. Beobachte alles, schau dir alles genau an, das ist das Einzige, was du hier tun kannst, sagte ich zu mir, den heißen Teller auf den Knien und den Blick wie ein Insektenforscher auf die Ober gerichtet, deren perfekte Dressur die Vorstellung weckte, dass sie mit Pistolen ebenso meisterhaft umzugehen verstanden wie mit Besteck.
Die vollkommene, doch herzlos wirkende Liebenswürdigkeit des Barbesitzers gründete auf seiner geradezu dämonischen Beobachtungsgabe, mit der er ein auf den Boden gefallenes Messer, eine fehlende Krebsgabel auf dem Tisch eines Gastes oder die Notwendigkeit eines weiteren Stuhles für die Handtasche einer Dame erfasste. Sie steuerte auch die sichere Intuition, mit der er, jeweils wenige Sekunden bevor ein Gast nach einem neuen Gesprächsstoff hätte suchen müssen, diesem einen schönen Abend wünschte und sich von dessen Tisch entfernte. Seine Begabung, die Schwächen seiner Gäste zu erkennen und auszubeuten, war unerreicht.
»Sie müssen auch unsere Crêpes versuchen«, wandte er sich später wieder an mich, so sanft, als spräche er mit einer würdevollen alten Dame, »sie sind köstlich!«
Nach nichts in der Welt sehnte ich mich weniger als nach flammend heißen Crêpes, doch ich hatte begriffen, dass mein Begleiter an diesem Ort keine Launen duldete, und so warf ich dem Barbesitzer ein Claudette-Colbert-Lächeln zu, dessen Anwendung mir im Leben wenig genützt hat, da diese Art zu lächeln ganz aus der Mode gekommen und heute überholt ist wie der Einsatz eines Chassepotgewehrs.
Mein Begleiter zeigte dem Barbesitzer ein höheres Maß an Achtung, als mir angenehm war. Ich spürte, dass dieser Gastwirt, der die Menschen kannte, im Grunde seines Herzens auf das Erscheinen eines literarischen Genies wartete, dem er jene Achtung entgegenbringen konnte, die sein eigener Vater einst Hemingway erwiesen hatte. Wenn dieser Mensch, der sich alle nur denkbaren Wünsche eines Mannes erfüllt hatte, der zu Macht und Geld gelangt ist, überhaupt zu Gram fähig war, dann darüber, in seinem Leben kein wirkliches Genie bewirtet zu haben. Er wusste, dass niemals mehr ein Mann wie Hemingway über die Schwelle von Harry’s Bar treten würde, der ihn als das behandelte, was er war: als einen Kellner.
Meine plötzliche Einsicht, dass Dantes Höllenbild das exakte Abbild unserer Welt liefert, änderte nichts an der Tatsache, dass mein Begleiter sich in dieser modernen Hölle mehr als wohl zu fühlen schien, seit er unter dem Publikum eine schwarze Schönheit entdeckt hatte, die in einem kurzen roten Kleid, unter dessen Saum ihre glatten muskulösen Beine hervorschimmerten, mit dem Barbesitzer tanzte. Sie sandte überlegene Blicke, die etwas Hartes und Verletzendes hatten, zu dem kleinen Mann, in dessen trüben Augen das ewige Vergnügen lag, sich zu Silvester die aufsehenerregendste und skandalöseste Schönheit in seiner Bar zur Tanzgefährtin zu wählen, um auch durch diese Wahl klarzustellen, wer hier das Sagen hatte.
»Hast du gesehen? Natürlich hat er sich die einzige interessante Frau ausgesucht!«, bemerkte mein Begleiter mit erkennbarem Respekt vor einem Mann, der weder Talent noch künstlerische Erfindungsgabe hatte entwickeln müssen, um die Aufmerksamkeit einer Frau für sich zu gewinnen.
Unter den vielen Gästen tanzte auch eine Dame in einem bodenlangen, bis kurz unter den Po geschlitzten, algengrünen Abendkleid. Ihre langen, straffen und bleichen Beine, die in dem Schlitz sichtbar wurden, zogen viele Blicke auf sich. Ihr Tanz war von lasziver Schwermut, als folgte sie der Melodie einer alten Drehorgel. Ich hatte in meinem Leben solche Augen noch nicht gesehen, derart milchige Pupillen mit marmorgrüner Iris.
»Sie ist sechsundachtzig«, flüsterte mir der Barbesitzer lächelnd zu, als habe er selber mit dem Alter nichts zu schaffen.
Dieses Meisterwerk eines Schönheitschirurgen tanzte mit einem hochgewachsenen, leicht gebeugten Herrn im Smoking.
»Und er, raten Sie, wie alt er ist!«, forderte der Barbesitzer mich nun auf, den Blick auf den Tänzer gerichtet. »Achtzig?«, rief er dann leise aus, »siebenundneunzig, cara mia, er ist siebenundneunzig und kommt jedes Jahr nach Venedig, um bei mir Silvester zu feiern!«
Es war zu bewundern, bis zu welchem Grad es der Amerikanerin gelungen war, sich die Gesten eines Fotomodells anzueignen, wie sie ihren alten, operierten Kopf leicht schräg hielt, um sich immer wieder eine graublond gefärbte Haarsträhne aus dem Gesicht zu streichen, damit einer Geste nacheifernd, die zur Hauptbewegung vieler junger Mädchen geworden ist. Mit ihrem Mund, weich und voll wie eine überreife Himbeere, warf sie ihrem Mann Küsse zu, als tanzte er nicht unmittelbar vor ihr, sondern als verlasse er auf einer Jacht den Hafen von Venedig. Ich war mir sicher, dass eine solche Reise sehr bald bevorstand, da man jeden Moment befürchten musste, seine Knie einknicken und ihn in seinem Smoking mitten unter den Tanzenden zusammensinken zu sehen.
So elegant dieses amerikanische Paar war, so wenig wollten die jüngeren Gäste mit ihm zu tun haben, denn die Furcht, einer der beiden könnte in der Hitze des Raumes tot umfallen, spürte nicht nur ich, diese Ahnung lag über dem Paar, lag in dem gebrochenen, vom opalfarbenen Schleier des nahen Endes überzogenen Blick der Frau, lag in dem charmanten, klapprigen Lächeln des alten Galans.
Mir war die Lust aufs Tanzen an diesem Ort vergangen, wo es allein zu einem trotzigen Lebenszeugnis wurde. Dies warf in mir die alte Frage nach dem Sinn des Lebens auf, eines Lebens, das zu feiern sich zwei greise Menschen von Amerika nach Europa aufgemacht hatten, um in Harry’s Bar einen Abend zu verbringen, an dem eine am Boden zertretene Linse ausgereicht hätte, die Dame auf ihren Pfennigabsätzen tödlich ausrutschen zu lassen.
Inmitten dieser Betrachtungen kam mir der große blonde Mann mit der roten Nelke im Knopfloch ins Visier. Er ging von Tisch zu Tisch, küsste den Damen die Hände und schenkte sich aus allen Flaschen etwas ein, ohne darauf zu achten, ob es Rotwein, Weißwein oder Champagner war. Der Herr genoss sichtlich seine Eleganz, die auch mich fröhlich stimmte, wobei mir der Anblick der roten Blume in seinem Knopfloch das besondere Vergnügen der Botanikerin schenkte.
Wie alle Menschen interessiere auch ich mich für Berühmtheiten, deren strahlendes Erscheinen, wie eine plötzliche erotische Leidenschaft oder ein vollkommenes Gedicht, die Monotonie unseres Daseins zu durchbrechen vermag, doch beginnt mein Herz erst dann schneller zu schlagen, wenn ich einem der seltenen Vertreter jener fast gänzlich verschwundenen Klasse der Snobs begegne. Ein echter Snob ist wie ein gelungener, beißender Witz. Er gehört zu dem kühnen und behänden Typus des Jägers, zu dem sich alle Arten von Sammlern zählen lassen, von den Schmetterlingsfängern bis zu den Knopfliebhabern, von den Dessousfanatikern bis zu den Mineralienspezialisten, welche die Jagd nach der Schönheit noch nicht ermüdet hat.
»Er trinkt die Reste aus allen Flaschen leer«, dachte ich, während er vor einem Tisch stand und einen Löffel in die Meringata eines Gastes tauchte.
»Herr Ober! Noch ein Glas Champagner!«, rief er laut, wobei er den Arm auf die Schultern eines ihm ganz offensichtlich fremden Herrn legte, der sich an ihm zur Tanzfläche hatte vorbeidrängen wollen und nun ganz verwundert stehen blieb ob dieser zärtlichen Umarmung.
Ohne zu zögern, brachte der Ober sofort ein weiteres Glas, das der Blonde in einem Zug austrank, bevor er sich über ein Stück Erdbeertorte hermachte, das er auf einem stehengelassenen Teller entdeckt hatte. Schließlich entnahm er seinem Etui eine Zigarette, die er anzündete, ohne dass jemand Einwand erhob.
»Noch ein Glas!«, rief er wieder, zog ein Taschentuch aus der Reverstasche und fuhr sich damit über den kleinen nassen Mund.
Der Kleidung nach zu urteilen, war der blonde Mann vermögend, dem Gebaren nach entstammte er einer alten Familie. Seine Hosen waren schon etwas abgetragen, die Smokingjacke an den Ärmeln leicht zerschlissen, doch wurde dieser Eindruck gewollter Vernachlässigung durch die blutrote Nelke aufgehoben, die wie der Inbegriff des Lebens in seinem Knopfloch blühte und glühte.
Ich hatte vor, seine Aufmerksamkeit auf irgendeine Weise auf mich zu ziehen, doch da war er plötzlich entschwunden, einfach aus der Szenerie abgetaucht. So nahm ich wohl oder übel meine Gedanken über den Sinn des Lebens wieder auf, indem ich meinen Blick umherschweifen ließ und mich beim Anblick der feiernden Gäste fragte, ob ich nicht irrte, wenn ich annahm, dass es im Leben nur auf die geistige Welt ankam, und ob die Fülle des Daseins vielleicht doch darin bestand, sich bis zum letzten Atemzug dem Vergnügen hinzugeben.
Nach einem weiteren Schluck Champagner suchte ich nach der Amerikanerin, um meine Überlegungen durch ihren Anblick zu bekräftigen. Sie erinnerte jetzt an eine alte Fee, die auf einer Lichtung ihre Kleider ablegt und vor den Vögeln des Waldes tanzt. »Ich muss mich wohl getäuscht haben, zu glauben, dass es im Leben auf etwas anderes als auf Unterhaltung ankommt«, sagte ich mir, das schöne Bild des Marschalls von Sachsen vor Augen, der bis zu seinem Ende dem Leben alle extremen Genüsse abgefordert hatte. Die Sage geht, dass er sich in seinem letzten Winter mit drei schönen Damen auf Schloss Chambord zurückgezogen habe, wo ihn in den Armen seiner Lieblingsfrau der Tod ereilte. Sein letzter Satz soll gewesen sein: »Das Leben ist nur ein Traum; der meine war schön, aber kurz.« Ein schönes Leben, ein schöner Tod.
Wo war die Schwarze in dem roten Kleid? Meine Augen suchten die Bar nach ihr ab, bis ich sie schließlich an der Theke erblickte und mir eingestehen musste, dass von ihrer Gestalt das Versprechen eines erregenden, eines erfüllenden Glücks ausging, das mit Geist und Wahrheit nicht in Verbindung zu bringen war. Wäre es mir irgendwie möglich gewesen, so hätte auch ich mein Geld und Talent eingesetzt, um sie für mich zu gewinnen und sie so lange auszukosten, bis mir keines ihrer Worte noch etwas hätte anhaben können. Doch war mir bewusst, dass eine schöne Frau ein Martyrium sein kann, dem man über kurz oder lang um alles in der Welt wieder entkommen möchte – denn was bleibt, wenn das schöne Leben bis aufs Mark ausgesaugt und zu einer hohlen Kokosnuss geworden ist? Das Bild der ausgehöhlten Kokosnuss rief mir, wer weiß woher, die Geschichte von jenem Zen-Mönch ins Gedächtnis, der einmal zu Gensha kam, um zu erfahren, wo der Eingang zum Pfad der Wahrheit sei. Gensha fragte: »Hörst du das Murmeln des Baches?« »Ja, ich höre es«, erwiderte der Mönch. »Dort ist der Eingang«, lautete die Antwort.
Das Murmeln des Baches! Das war es! Wie vom Blitz getroffen, stand ich auf, eilte aus dem heißen Raum und holte meinen Mantel, da ich es für klug hielt, mich, ohne einen Blick zurück zu werfen, auf ein neues Abenteuer einzulassen.
Ich kehrte meinem Begleiter den Rücken, brach meine Zelte in London ab und zog mich auf meinen kleinen Landsitz zurück, den meine kurz zuvor verstorbenen Eltern mir mit Nanda als Teil des Inventars vermacht hatten.
***
Auf diesem Landsitz wollte ich da ansetzen, wo mein Vater aufgehört hatte. Seine letzte Zeichnung war die Skizze eines Buchsbaumgartens gewesen, den er mitten auf einer weiten Wiese als Meditationsgarten hatte anlegen wollen.
Anfang März rief ich den Pflanzenhändler an, der selber eine Landwirtschaft betrieb und eine große Gärtnerei besaß.
Cimaverde – so hieß er – erschien an einem feuchten, nebligen Morgen und hieß mich zu ihm in den Lastwagen zu steigen, der sich einen Weg durch einen kleinen Eichenwald bahnte, bis er auf der freien, für den neuen Garten ausgewählten Lichtung hielt. Während unserer langsamen Fahrt durch den Wald schwankten, wogten und flimmerten hellgrün Hunderte von jungen Buchsbäumen auf der Ladepritsche, deren junge Triebe eine kindliche Freude ausstrahlten, als könnten sie vor Aufregung das Blätterrascheln nicht lassen. Eine große Fächerpalme stand wie eine Heiligenfigur zwischen ihnen.
Der Gedanke, dass ich selbst diese junge Buchsbaumschar zu einem geometrischen Garten in Form eines Quincunx pflanzen und hochziehen würde, erfüllte mich mit Genugtuung.
Mein Vater hatte wieder und wieder die kleine Schrift über den Garten von Sir Thomas Browne gelesen, doch war es trotz all seiner Zeichnungen nie zur Umsetzung jenes einen Gartens gekommen, dessen Gestaltung von der Zahl Fünf beherrscht wird.
Wiewohl ich als Kind meinem Vater zur Hand gegangen, ihm stets auf seinen Wegen durch den Garten gefolgt und von ihm in seine Welt hineingezogen worden war, so hatte ich doch niemals, auch weil ich als Studentin und dann nach dem Studium meine Eltern auf dem Land selten besuchte, selber einen Gartenentwurf verwirklichen können. Wie groß war meine Erregung, als Cimaverde die Bäumchen aus dem Wagen lud und zu einer Gruppe unter einer Eiche zusammenstellte.
Cimaverde war ein junger Mann mit dem Gesichtsausdruck eines grimassenschneidenden gotischen Wasserspeiers. Da er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an der Luft war und mittags und abends Fleisch aß, glühte einem sein Gesicht schon von weitem scharlachrot entgegen. Die ganze Natur schien ihm eine einzige erotische Anspielung zu sein, was ihm unaufhörlich Anlass zu lauten Lachanfällen gab, die etwas Donnerndes, Rübezahlhaftes an sich hatten. Es war Cimaverde, der meinen entstehenden Buchsbaumgarten noch an jenem Morgen jardin du thé blanc nannte, eine Bezeichnung, die mir so treffend schien, dass ich sie übernahm. Doch wie war er zu diesem Namen gekommen? Wie kam ein Mann wie er zu Französisch und weißem Tee?
Es dauerte noch zwei Tage, bis die Buchsbäume gepflanzt werden konnten. Cimaverde musste erst das Stück Land umgraben und ebnen, die Mitte des zukünftigen Gartens finden und von dort aus die Furchen für die Pflanzen graben, doch am dritten Tag traf er noch vor Sonnenaufgang ein und pflanzte die Bäume in Form eines Quincunx um die große Fächerpalme.
Als nun aus dem wilden, brachen Stück Land Baum für Baum ein geometrisches Gebilde erwuchs, als unter Cimaverdes und meinen Händen ein Buchsbaumlabyrinth entstand, da begriff ich den gärtnerischen Bann, unter dem mein Vater zeit seines Lebens gestanden hatte. Und als der Gärtner schließlich aus einem großen Sack Rasensamen in die Luft streute, die auf die umgegrabene Erde niederrieselten, sah ich schon die Birkenbank vor mir, die ich bald hier aufstellen wollte.
Nanda und ich trafen uns allmorgendlich in dem neuen Garten, um zu hacken, Unkraut zu ziehen und um zu gießen. An Sonnentagen trug Nanda einen Strohhut auf seinem Turban. Dieser Hut meines Vaters setzte ihm allerlei seltsame Gedanken in den Kopf. Einmal stemmte er die linke Hand in die Taille und stützte sich mit der rechten auf die in die Erde gestoßene Hacke: »Zuerst schuf Gott die Fische, dann die Tiere und schließlich die Menschen. Den Menschen setzte er einen Hut auf den Kopf, damit sie ihn abziehen und sich vor ihresgleichen verbeugen«, sagte er, nahm den Hut vom Turban, schwenkte ihn mit der Rechten und verneigte sich tief vor mir.
Es war die Zeit, da die ersten Veilchen aus der Erde sprießen und die Luft von Vogelgezwitscher widerhallt. Die Unruhe der treibenden Tulpen, die bald mit ihren lanzenspitzen Knospen die Erdoberfläche durchstoßen würden, ein Durchbruch, der etwas Ritterliches an sich hatte, wenn man die Schar grüner Speere überblickte, die nach und nach aus dem Grund schossen und an die kämpferische Natur des Lebens gemahnten – diese Unruhe hatte auch mich erfasst.
Die Tulpen blühten noch nicht, doch ich konnte an keinem Veilchen vorübergehen, ohne dass mich aus seiner dunkelvioletten Blüte die Lust anflog, ein schönes Kleid aus dem Schrank zu nehmen und mich auf die Suche nach dem Liebesglück zu begeben, aber ich bezwang diese Lust und konzentrierte mich auf die Veilchen als Kochingredienzen. Wie konnte ich ihre Farbe konservieren, wie diese Märztage durch das Einfangen ihres Geruchs festhalten? Da standen sie in Scharen auf den Wiesen, nah an den Wegrändern und den modrigen Baumwurzeln, und erfreuten den Betrachter, der sich ihrer Macht weder entziehen noch sie erklären konnte.
»Morgen ist mein Geburtstag. Ich würde am Abend gerne für Sie und mich kochen«, verkündete eines Tages Nanda, der sich ansonsten nach der Arbeit mit einem Bananenshake in sein Zimmer zurückzog, um dort Bollywoodfilme zu sehen und zu beten.
Da ich meine Abende allein in der Bibliothek verbrachte, sah ich diesem Essen mit einer gewissen Freude entgegen, wenngleich mich der Gedanke zum Verzweifeln brachte, dass ich den letzten Rest der mir gebliebenen Grazie nicht für die Eroberung eines geistreichen Mannes, sondern für einen Inder aufwenden sollte, der mit mir am liebsten über Gott und Geld sprach, denn was das Geld anbetraf, verstand Nanda keinen Spaß. »Tu l’as voulu, Georges Dandin!«, sagte ich mir laut und griff nach Meister Yoka Daishis Shodoka, um durch seine Ideogramme zur Ruhe zu finden.
***
Meine Tage verliefen nach der Einteilung, der auch mein Vater gefolgt war: Die Tagesstunden galten der Haus- und Gartenarbeit, die Abendstunden der Lektüre, wobei nicht pliniushafte Landhausheiterkeit die nächtlichen Stunden beherrschte, sondern eine Suche nach Erkenntnis, an der ich mich wie an einem Seil zu einem höheren Blick auf das Leben hinaufschwingen wollte. Die Wege dorthin waren zahllos. Aus jedem Teil der Welt strömten sie mir in Gestalt von Büchern zu, ob durch die Lösung eines mathematischen Problems, durch ein Gebet, durch einen philosophischen Gedanken, durch eine magische oder poetische Formel. Wenn ich von Morgen zu Morgen aus meinem Garten ein immer dichteres und schattigeres Netz der Ordnung schaffen wollte, so schlug ich abends ein Buch nach dem anderen auf, auf der Suche nach dem einen Satz oder Vers, die mich wie in einen Brunnen zu sich hinabziehen und mir jenseits ihrer konsonantischen und vokalischen Zusammensetzung zu einer Erleuchtung verhelfen konnten. Dafür lebte und las ich, dass ich diesen Stoß erhielt, der mich unter Strom setzen und mit einer Wahrheit verbinden würde.