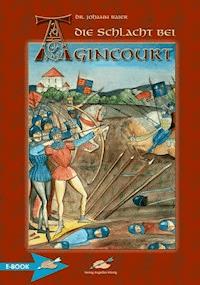Der schwarze Prinz und die Schlacht bei Poitiers
von Dr. Johann Baier
Mit Illustrationen von Dr. Johann Baier und Luise Baier
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus in irgendeiner Form zu reproduzieren oder zu verbreiten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
© 2014 ebook
ISBN: 978-3-938921-30-2
Verlag Angelika Hörnig
Siebenpfeifferstr. 18
D-67071 Ludwigshafen am Rhein
www.bogenschiessen.de
Ich danke meiner Verlegerin Angelika Hörnig und ihrem Team dafür, dass sie nach meinen Büchern „Die Schlacht bei Agincourt“ und „Krähen über Crécy“ nun auch jenes über die Schlacht bei Poitiers veröffentlicht haben
Meinen Freunden Mag. Walter Hornik, Andreas Schweiger BSc (WU), Suse und Bela Kromer-Fabieneke, Sigrid Schreckenthaler und Dieter Senk danke ich dafür, dass sie das Manuskript zu diesem Buch gelesen, korrigiert und kritisiert haben.
Meiner Frau Luise danke ich für ihre Mithilfe bei der Überarbeitung des Manuskripts und für ihre Mitarbeit an den Illustrationen.
Inhalt
Vorwort BRÜCKEN ÜBER DEM ABGRUND DER ZEIT
PROLOG
1. Kapitel CHERCHEZ LA FEMME
2. Kapitel DER VIERTE REITER DER APOKALYPSE
3. Kapitel DER SCHWARZE PRINZ
4. Kapitel CHEVAUCHÉE
5. Kapitel VORSTOSS INS HERZ FRANKREICHS
6. Kapitel JÄGER UND GEJAGTE
7. Kapitel DER TAG DES HERRN
8. Kapitel POITIERS – MAUPERTUIS 19. SEPTEMBER 1356
9. Kapitel KÖNIG IN KETTEN
EPILOG
Nachwort DIESE GROSSARTIGE UND FURCHTBARE SCHLACHT
LITERATURVERZEICHNIS
Vorwort
BRÜCKEN ÜBER DEM ABGRUND DER ZEIT
Montag, 19. September im Jahr des Herren 1356
Das Heer Edwards des Schwarzen Prinzen steht mit dem Rücken zur Wand – oder besser gesagt zum Wald von Nouaillé in der französischen Grafschaft Poitou. Der Feldzug, der für den englischen Thronfolger bisher so erfolgreich verlaufen ist, hat hier sein vorläufiges Ende gefunden. Vor den Engländern und Aquitaniern, die dem Prinzen bis ins Herz Frankreichs gefolgt sind, erstreckt sich ein flaches Tal. Auf dessen anderer Seite, oben auf dem Gegenhang, steht das feindliche Heer. Der Anblick, der sich den Männern des Schwarzen Prinzen bietet, ist ebenso furchterregend wie großartig. Tausende feindliche Ritter formieren sich und machen sich kampfbereit, um über sie herzufallen. Jeder der anglo-aquitanischen Krieger kann die gebrüllten Befehle, das Klirren der Waffen und das Scharren zahlloser Füße hören. Jeder von ihnen kann die zahllosen Banner, Fahnen und Wimpel sehen, die über den feindlichen Reihen flattern. Jeder von ihnen kann die blutrote Oriflamme, die geheiligte Kriegsfahne der Franzosen sehen, die verkündet, dass kein Feind Frankreichs Gnade erwarten kann.
Viele Tausend französische Ritter erwarten den Angriffsbefehl. Sie sind ihren Feinden zahlenmäßig weit überlegen – und sie fühlen sich ihnen auch an Ehre und Ritterlichkeit überlegen. Sie fühlen sich als Ritter reinsten Geblütes, als die edelsten Vertreter der abendländischen Ritterkaste, deren Aufgabe und Vorrecht es ist, auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Sie verachten ihre Feinde dafür, dass diese ihrem niedrig geborenen Fußvolk eine so bedeutende, ja oft schlachtentscheidende Rolle überlassen, dass sie selbst dadurch gezwungen sind, nichtadelige Kriegsknechte in ihren Reihen zu dulden. Sie sind hier, nahe der Stadt Poitiers angetreten, um die Invasoren für alles zu bestrafen, was diese dem Königreich Frankreich angetan haben. Sie wollen sich, ihr Königreich und die Ehre ihres Königs für die Demütigungen, die sie durch ihre Feinde erlitten haben, rächen.
Wenn es nach den Franzosen geht, soll hier der zweite der Raubzüge des Schwarzen Prinzen zu Ende sein. Seit fast einem Jahr sind der Prince of Wales und seine Männer mordend, plündernd und brandschatzend durch französische Gebiete gezogen und haben Gehöft um Gehöft, Siedlung um Siedlung zerstört, haben Menschen vertrieben, vergewaltigt und getötet. Es ist nicht so, als ob diese Art der Kriegsführung den Kriegern des französischen Königs Jean II. fremd wäre, als ob sie sie als nicht legitim empfinden würden. Sie haben sie selbst oft genug angewendet. Seit dem Abklingen der furchtbaren Seuche, die ein Drittel der Bewohner der christlichen Reiche dahingerafft hat, haben die Vasallen des englischen Königs Edward III. in diesem Krieg, der nun schon seit neunzehn Jahren andauert, die Oberhand behalten – bis heute!
*
Viel ist über die Schlacht, die an jenem Septembermontag bevorstand, geschrieben worden. Viele Chronisten haben sie bereits wenige Jahre nach ihrem Ende beschrieben. Ihre Schriften sind heute unsere wichtigsten Quellen. Manche der Geschichtsschreiber waren selbst an den Ereignissen beteiligt oder hatten Gelegenheit, mit Teilnehmern der Schlacht zu sprechen und ihre Erinnerungen aufzuzeichnen.
Einer von ihnen war der Herold des Sir John Chandos, eines Freundes und Beraters des Schwarzen Prinzen, der ein Werk über das Leben des Sohnes des englischen Königs Edward III. hinterlassen hat. Ein anderer war Jean Foissart, ein Hennegauer, der – nachdem er Jahre am englischen Königshof verbracht hatte – durch ganz Europa reiste, um mit den Zeugen wichtiger Ereignisse zu sprechen. Er darf wohl als der bedeutendste und vermutlich meistgelesene unter den Chronisten des 14. Jahrhunderts angesehen werden. Andere bedeutende Schriften stammen von Männern wie Jean le Bel, Geoffrey le Baker, Giovanni Villani oder Francesco Petrarca. Dazu kommen neben anderen namentlich bekannten Historikern auch die Verfasser von Chroniken, deren Namen bis heute unbekannt geblieben sind.
Die Chronisten haben oft ein Bild der Ereignisse gezeichnet, das nicht nur von den Aussagen jener Männer geprägt ist, von denen sie ihre Informationen erhalten hatten, sondern das auch von den Anschauungen ihrer Zeit beeinflusst wurde. Je nach Blickwinkel, Interesse, nationaler und standesmäßiger Zugehörigkeit, lassen sich aus ihren Aufzeichnungen oft unterschiedliche Standpunkte herauslesen. Ein Beispiel für einen derartigen individuellen Blickwinkel sind die Werke Froissarts. Sein Interesse galt vor allem dem höfischen Leben und den Waffentaten der adeligen Kriegerkaste. Deren Kriegsabenteuer zeigte er oft in einem verklärenden Licht, indem er sie wie großartige Abenteuer oder wie ritterliche Turniere darstellte. Das einfache Volk, dessen Schicksal und dessen Leiden, erwähnte er kaum. Umso bemerkenswerter ist es daher, dass er von den militärischen Erfolgen der niedrig geborenen englischen Bogenschützen erzählte. Geoffrey le Baker dagegen beschrieb die Schrecken des Krieges und die Grausamkeit der Schlacht so plastisch, dass von Verklärung oder Idealisierung keine Rede sein kann.
Darüber hinaus sollte nicht außer Acht bleiben, dass jeder Leser durch den Blickwinkel, den er seinerseits einnimmt, in seiner Vorstellung ein anderes Bild erzeugt – sei er auch um noch so viel Objektivität bemüht. Dieses Bild und seine Aussage entsprechen oft genug nicht jenem, das die zeitgenössischen Chronisten entwerfen wollten. Die rund sechshundertsechzig Jahre, die seit den damaligen Ereignissen vergangen sind, haben die Anschauungen der Leser so verändert, dass die Schilderungen der mittelalterlichen Chronisten heute ganz andere Empfindungen auslösen als zu ihrer eigenen Zeit. Diese Schilderungen sind es jedoch, die uns die Geschehnisse rund um die Schlacht von Poitiers näher bringen. Wir verfügen – abgesehen von zeitgenössischen Malereien, wenigen Museumsstücken und seltenen Funden – über keine anderen authentischen Quellen. Jede Überlegung, die wir zu den Ursachen der Schlacht, zu ihrem Verlauf und den aus ihr resultierenden Folgen anstellen, kann daher nur auf diesen Quellen basieren. Die zeitgenössischen Chroniken sind also im wahrsten Sinne des Wortes „Brücken über dem Abgrund der Zeit“, der uns von den Ereignissen vor, während und nach der Schlacht bei Poitiers trennt.
In diesem Buch werden immer wieder Auszüge, vor allem direkte Reden, aus den Schriften der zeitgenössischen Chronisten zitiert. Diese Zitate sind im Text kursiv dargestellt. Die jeweilige Zahl an ihrem Ende – (x) – weist auf die laufende Nummer der Quelle im Literaturverzeichnis am Ende dieses Buches hin. Wenn die Zitate manchmal etwas holprig klingen, so liegt das vor allem an den verwendeten Quellen, gelegentlich vielleicht auch an den Übersetzungen von mittelalterlichen Schriften in die Sprache der Neuzeit und dann weiter von einer Sprache in die andere. Die Übersetzungen in diesem Buch sind so wortgetreu wie möglich abgefasst.
Wir wissen nicht, ob die von den Chronisten zitierten Personen tatsachlich das gesagt haben, was diese ihnen in den Mund gelegt haben. Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass die zeitgenössischen Geschichtsschreiber, wenn sie schon nicht den genauen Wortlaut überliefert haben, so doch zumindest versucht haben, den Geist der damaligen Zeit wiederzugeben. Die direkten Reden in diesem Buch sollen etwas von diesem Geist vermitteln und den geschilderten Ereignissen, jenseits der Darstellung trockener Fakten, Farbe verleihen.
Der Leser verfolgt das Geschehen immer wieder durch die Augen eines Offiziers der Walisischen Leibgarde des Schwarzen Prinzen. Diese Figur hat keinen Namen. Sie ist keine Person, die es tatsächlich gegeben hat, aber Bogenschützen, die sich die Rangleiter hinaufgedient und verantwortungsvolle Posten bekleidet haben, hat es immer wieder gegeben. Die Funktion, die diese Figur erfüllt, hat es gegeben, und die Taten, die sie vollbringt, unterscheiden sich nicht von jenen, die über die Bogenschützen im Heer des Schwarzen Prinzen überliefert sind. Die Figur, die dem Leser ihre Augen leiht, trifft selbst keine Entscheidungen, die den Gang der Ereignisse beeinflussen, aber sie ist in einer Position, die es ihr erlaubt, die geschilderten Vorgänge aus nächster Nähe mitzuerleben. Wenn also in diesem Buch Begriffe wie „jetzt“ oder „heute“ verwendet werden, so ist dies immer aus der Warte des Jahres 1356.
Die geschilderten Fakten sind historisch belegt und haben als Ergebnis ausgedehnter Recherchen und Studien Eingang in dieses Buch gefunden. Die in der Literaturliste im Anhang dieses Buches aufgezählten Quellen haben dabei wertvolle Dienste geleistet. Dieses Buch soll dem Leser etwas von den gesellschaftlichen, politischen und militärischen Vorgängen während jener von 1337 bis 1356 dauernden Phase der europäischen Geschichte nahe bringen, die wir heute den „Hundertjährigen Krieg“ nennen. Es soll die Kluft von beinahe sechshundertsechzig Jahren zwischen den Ereignissen rund um jenen 19. September 1356 und dem beginnenden 21. Jahrhundert überbrücken und dem Leser einen Blick in den Kriegsalltag des Spätmittelalters eröffnen.
Dr. Johann Baier
Prolog
Eustace d´Aubrecicourt bewegt sich nicht, beobachtet nur, was um ihn herum vorgeht – alles andere wäre sinnlos. Die Deutschen haben ihn aufrecht stehend an den Wagen gefesselt. Er hat den Versuch, die Fesseln zu zerreißen, längst aufgegeben. Sie sind zu fest, zu gut gebunden. Er hat nicht die geringste Chance, aus eigener Kraft zu entkommen – und wenn es ihm gelänge, was würde er dann tun, mitten unter den Feinden?
Die Aufregung des Kampfes und der Gefangennahme lässt nach und mit ihrem Schwinden kommen die Schmerzen. Erst der harte Zusammenprall mit dem Deutschen und der Sturz vom Pferd, dann die Schläge der Feinde, die ihn überwältigt haben – kein Wunder, wenn jede Bewegung Wellen von Schmerz durch seinen Körper jagt. Er hofft, dass nichts gebrochen oder gerissen ist, dass seine hervorragende Konstitution und das jahrelange harte Training verhindern, dass er bleibende Schäden davonträgt.
Die Deutschen – genau genommen seine Landsmänner, die wie er, der aus dem Hennegau stammt, aus dem Heiligen Römischen Reich kommen – formieren sich neu, machen sich offenbar bereit aufzubrechen. Sollen sie etwa gemeinsam mit den französischen Panzerreitern angreifen?
Fußvolk sammelt sich. Ritter, Knappen und Reisige formieren sich zu einem dichten Pulk, überprüfen den Sitz ihrer Rüstungen und Schilde, halten Waffen bereit und warten augenscheinlich nur mehr auf den Befehl, der sie angreifen lässt.
Die französischen Reiter, die offenbar dazu ausersehen sind, die Speerspitze des Angriffes zu bilden, zählen zu den bestausgerüsteten Kämpfern, die er je gesehen hat. Jeder von ihnen trägt eine hervorragend gearbeitete Rüstung unter dem bunten Wappenrock. Selbst ihre Pferde sind gepanzert – mit massiv wirkenden Rossharnischen, die vor allem Kopf, Nacken und Brust der Tiere schützen. Diese Information wäre äußerst wertvoll für den Prince of Wales. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, solche Informationen zu beschaffen – aber er ist hilflos an den Wagen gefesselt und muss sich mit dem Zusehen begnügen.
Mit einem Mal ändert sich etwas, mehr fühlbar als hörbar. Ist etwas anders geworden an den Wortfetzen, die er in der ohrenbetäubenden Kakophonie aus Männerstimmen, Pferdewiehern, Fußscharren, Hufstampfen und Waffenklirren verstehen kann? Schwingt ein anderer Ton mit? Ist es Angst? Ärger? Aufregung?
Plötzlich übertönen Befehle den Lärm. Die gepanzerten Reiter heben ihre Schilde, senken ihre Lanzen und geben ihren Pferden die Sporen. Die Schlacht beginnt!
1. Kapitel
Cherchez la Femme
Er spürt die Bewegung des Schiffes und legt die Hand auf die Reling, während sich die andere unwillkürlich um seinen Bogen krampft. Der Rumpf des Seglers knirscht jedes Mal, wenn er sich an den Seilen reibt, die von der Kaimauer hängen und unten, verborgen durch die Rundung des Rumpfes, im düsteren Schatten, gluckert Wasser. Wie so oft stellt er sich die Frage, wie es wohl einem Menschen ergehen mag, der zwischen Kaimauer und Schiffsrumpf gerät; was die gewaltige Masse des Schiffes mit ihm anstellen würde. Er schüttelt sich. Die Planke, die das Schiff mit dem Ufer verbindet, flößt ihm auch kein Vertrauen ein – zu leicht kann sie verrutschen, kann ein unvorsichtiger Schritt den Sturz zwischen Mauer und Schiff bedeuten. Er seufzt unhörbar. Er ist schon so oft mit einem Schiff gefahren, dass es ihm nichts mehr ausmachen sollte, aber er wird sich wohl nie daran gewöhnen. Dennoch lächelt er. Die Freude, nach den langen Tagen der Überfahrt das Schiff verlassen zu können, endlich der Enge des mit Passagieren überfüllten Decks zu entgehen, verdrängt jeden Gedanken an Sturz, an gebrochene Knochen und an dunkles Wasser.
Die kleine Flotte, zu der der Segler gehört, ist auf der Fahrt von England nach Aquitanien weder von Stürmen noch von feindlichen Schiffen bedroht worden. Seit König Edward III. im Jahr des Herrn 1347 Calais eingenommen hat und seit dem Waffenstillstand mit den baskischen Städten, beherrscht England den Ärmelkanal. Französische und schottische Piraten zeigen sich kaum, und die guten Beziehungen zur Bretagne garantieren den englischen Schiffen auch auf dem weiten Weg um die bretonische Halbinsel Sicherheit vor einheimischen Piraten. Die Galeeren des mit Frankreich verbündeten Aragon, die in den letzten Jahren gelegentlich die englische Schifffahrt im Atlantik bedroht haben, können wegen der Stürme im Golf von Biscaya vor dem Sommer kaum das Mündungsgebiet der Garonne erreichen. Damit sind die Seefahrtswege zwischen dem englischen Mutterland und Aquitanien einigermaßen sicher.
Die Passagiere verlassen einer nach dem anderen das Schiff. Er beobachtet, wie sie über die Planke balancieren und festen Boden erreichen. Dann ist auch der letzte der ihm Anvertrauten von Bord. Er seufzt, nimmt sein Gepäck auf und tritt, sorgfältig auf sein Gleichgewicht achtend, auf das trügerische Brett. Dann holt er tief Luft und überwindet mit ein paar schnellen Schritten die Kluft zwischen Schiff und Mauer. Seine Füße berühren den festen Boden des Kai, und er lächelt erleichtert. Es ist ein strahlender, sonnendurchfluteter Frühsommertag im Jahr des Herrn 1356. Vor ihm liegt Bordeaux, eine der größten und aufregendsten Städte des bekannten Erdkreises.
Am Ufer wimmelt es von Menschen. Schiffe und Boote in allen Größen sind dicht an dicht am Kai vertäut. Männer mit Gepäck und Waffen gehen von Bord. Waren und Nachschubgüter aus England werden ausgeladen. Pferde, manchmal widerspenstig, manchmal betäubt von der langen Seereise, werden an Land gebracht. Frachtgut wird von großen Schiffen auf kleinere umgeladen, die sich auf den Weg zu den Städten am Oberlauf der Garonne machen. Fässer mit Wein werden auf Schiffe verladen, deren Ziel die englischen Häfen sind. Der Lärm im Hafen ist ohrenbetäubend nach den Tagen auf See. Jedermann hier scheint sich ausschließlich schreiend verständigen zu wollen. Man hört Englisch und Walisisch, Französisch und Spanisch und natürlich den Dialekt der Einheimischen. Es ist ein wahrhaft babylonisches Sprachgewirr. Es ist ein unbeschreibliches, lautes und farbenfrohes Durcheinander, das seinen Männern, von denen viele zum ersten Mal ihre abgelegenen und rückständigen walisischen Dörfer verlassen haben, vor Staunen die Münder offen stehen lässt.
Bordeaux liegt strategisch günstig am Unterlauf der Garonne, dort wo sich das Band des Flusses zu einem langgestreckten Delta zu weiten beginnt, rund hundert Kilometer von der Küste landeinwärts. Es ist eine geschäftige, weltoffene Stadt, fast so groß wie London. Hier residiert Edward of Woodstock, der Prince of Wales. Hier hat er nach dem erfolgreichen Feldzug des vergangenen Jahres mit einem Großteil seines Heeres den Winter verbracht. Von hier aus verwaltet er im Namen seines Vaters, König Edward III. von England, dessen aquitanische Provinzen.
Aquitanien ist durch die Heirat Henri Plantagenets, der später als Henry II. einer der mächtigsten englischen Könige aller Zeiten werden sollte, mit Eleonore d´Aquitaine unter englische Herrschaft gekommen. Es liegt im Südwesten des französischen Königreiches. Es umfasst derzeit wenigstens Teile der Provinzen Guyenne, Gascogne, Armagnac, Agenais, Quercy, Perigord und Saintonge. Es ist eine weite, flache Beckenlandschaft, die von der Küste des atlantischen Ozeans im Westen bis zu den Ausläufern des Massiv Central im Osten und den Pyrenäen im Süden reicht. Die Niederungen der Flüsse Charente, Dordogne, Garonne und Adour und ihrer Zuläufe sind sehr fruchtbar, während das Land zwischen ihnen so karg und oft so sumpfig ist, dass es kaum eine andere Landwirtschaft als Schafzucht zulässt. Im Nordosten Aquitaniens gedeiht Wein. Er ist das begehrteste Erzeugnis der gesamten Region. Der englische Kleriker und Chronist Ralph of Diceto, der zur Zeit der angevinischen Könige lebte, schrieb in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts über dieses Land:
„Aquitanien fließt über mit Reichtümern vieler Art, es übertrifft andere Teile der westlichen Welt in solch einem Ausmaß, dass es die Geschichtsschreiber für die glücklichste und blühendste der Provinzen Galliens halten. Seine Felder sind fruchtbar, seine Weingärten ertragreich und seine Wälder wimmeln von Wild. Von den Pyrenäen nordwärts wird die ganze Landschaft vom Fluss Garonne und anderen Flüssen bewässert, in der Tat hat die Provinz von diesen lebensspendenden Wassern ihren Namen.“ (41)
Die Menschen hier sind anders als im Rest Frankreichs. Sie haben sich ihre mediterran geprägte romano-christliche Kultur seit den Tagen des Untergangs des römischen Imperiums bewahrt. Sie sprechen untereinander nicht einmal Französisch, sondern Okzitanisch, eine vom Baskischen geprägte Sprache. Der Name des Herzogtums „Aquitanien“ hat sich im Lauf der Jahrhunderte im Sprachgebrauch zu „Guyenne“ abgeschliffen.
Die Männer, die er aus der walisischen Grafschaft Flint hierher gebracht hat, scharen sich um einen Mann, der ebenso wie sie einen kurzen Mantel und eine Gugel – eine die Schultern bedeckende Kapuze mit einem langen Zipfel – in den Farben Grün und Weiß trägt. Der Mann, den er als Vintainer – als Befehlshaber über zwanzig Männer – in einer der walisischen Hundertschaften des Prince of Wales kennt, hat auf sie gewartet und wird sie zu ihren Unterkünften bringen. Er tritt zu dem Offizier, der ihn erkennt und respektvoll grüßt. Sie tauschen ein paar Höflichkeiten aus, wie dies Veteranen immer tun, die einander kennen und wissen, dass sie von der gleichen Art sind, wissen dass der andere ähnliche Erfahrungen gemacht und ähnliche Verdienste erworben hat wie sie selbst. Es ist so laut im Hafen, dass auch sie fast schreien müssen, um sich verständigen zu können. Er händigt dem Vintainer eine in Leder gebundene Liste aus. Auf ihr sind die Namen der Männer verzeichnet, die die Grafschaftsbeamten im heimatlichen Flint angeworben haben, damit sie auf dem bevorstehenden Feldzug des Prince of Wales als Bogenschützen dienen. Damit ist er seiner Verantwortung entbunden und kann sich wieder seinen eigentlichen Aufgaben im Gefolge des Prinzen widmen. Es ist ohnehin nur ein günstiger Zufall gewesen, dass er den Winter in der Heimat und nicht am Hof Prinz Edwards verbracht hat, sodass ihm die Grafschaftsbeamten in Flint den Befehl über diese Gruppe von Bogenschützen übertragen konnten. Er hat sie auf einem fast drei Wochen dauernden Marsch über Shrewsbury, Worcester, Tewksbury und weiter über Gloucester, Bristol und Exeter nach Southampton geführt. In Southampton, das sich nach langen Jahren des Wiederaufbaus endlich wieder einigermaßen von den Folgen des genuesisch-französischen Überfalls im Jahr 1338 erholt hat, hatten sie sich mit Kurs auf Aquitanien eingeschifft. Der Vintainer wirf einen langen, nachdenklichen Blick auf die Liste und schaut in die Runde der Männer, die ihn ihrerseits erwartungsvoll anschauen. Sie haben die durch leinene Hüllen geschützten Bogen geschultert und ihr restliches Gepäck neben sich auf dem Boden, während sie auf Anweisungen warten.
Die Männer, die einen Kreis um den Vintainer bilden – wie alle Soldaten des Prince of Wales aus Chestershire und Flint in grün-weiße Livreen gekleidet – sind 3-Pence-Männer, Bogenschützen, die zu Fuß in einer Hundertschaft des Prinzen dienen. Würden sie über Pferde verfügen, also vielseitiger einsetzbar sein, würden sie 6 Pence am Tag verdienen. Dennoch können sie mit dem Sold zufrieden sein, denn in der Heimat müssten sie fleißige Handwerker oder Bauern sein, um so viel Geld zu verdienen – aber Handwerker und Bauern haben keine Aussicht auf Beute. Ein berittener Bogenschütze verdient so viel wie ein Handwerksmeister – der auch keine Beute machen kann – während im Vergleich dazu ein einfacher walisischer Spießknecht nur 2 Pence am Tag bekommt. Ein erfolgreicher Feldzug in Frankreich kann aus einem tüchtigen Soldaten, der daheim vielleicht nur ein niederer Knecht war, einen wohlhabenden Mann machen.
Der erfolgreiche Feldzug König Edwards im Jahr 1346, der vom überragenden Sieg des englischen Heeres bei Crécy und von der Einnahme Calais gekrönt war, hat viele, die daran teilgenommen haben, reich gemacht. Jetzt ist keine Rede mehr davon, dass die Werber des Königs und der großen Herren nicht genug Männer für die Unternehmen in Frankreich rekrutieren können, wie dies früher der Fall war. Das Versprechen von gutem Sold und von Beute lockt viele, die sonst wohl kaum Aussicht auf ein gutes Auskommen oder gar sozialen Aufstieg hätten. Verdienten Männern winkt nicht nur Wohlstand, sondern oft auch ein Sprung die soziale Leiter hinauf, der manchmal sogar zur Erhebung in den Adelsstand führen kann. Die Chance, reiche Beute zu machen, ist aber wahrscheinlich die stärkste Triebfeder, die die Untertanen König Edwards in Scharen zu den Fahnen treibt. Man sagt, dass es keinen Haushalt in England gibt, in dem sich nicht wenigstens ein Beutestück aus Frankreich befindet.
Der Vintainer blickt ihn nur fragend an, versucht erst gar nicht, den Lärm des Hafens nochmals zu übertönen. Er nickt dem Mann zu. Der Vintainer nickt zurück und gibt den Befehl zum Aufbruch. Die Waliser nehmen ihr Gepäck auf und setzen sich in Bewegung. Da er trotz seiner bevorzugten Stellung niemanden hat, der sich seines Gepäcks annimmt, schultert auch er seinen Feldsack und den langen Bogen und folgt dem Trupp der walisischen Bogenschützen in die Stadt. Während er an der Seite des Vintainers dahinmarschiert, beobachtet er aufmerksam das Treiben in den Straßen. Die Menschen wirken zufrieden. Der erfolgreiche Feldzug des letzten Jahres hat sich auch auf den Wohlstand der Bürger ausgewirkt. Die Truppen, die hier seit Anfang Dezember im Winterquartier liegen, haben viel Geld ausgegeben und die glänzende Hofhaltung des Prinzen hat viele der hier Ansässigen wohlhabend gemacht. Eine geschäftige Atmosphäre liegt in der Luft.
Unter der vorspringenden Fassade eines neu gebauten Hauses steht eine Gruppe von Frauen und winkt den Walisern lachend zu. Die Bogenschützen, von denen viele nie zuvor anderen Frauen als den einfachen Bäuerinnen in ihren Heimatdörfern begegnet sind, bleiben stehen, aber ein harter Befehl des Vintainers scheucht sie weiter. Ganz offensichtlich profitieren diese Frauen auch von den englischen Erfolgen. Es erscheint ihm, als ob Frauen einen ganz besonderen Einfluss auf diesen Krieg hätten, als ob es ohne sie diesen Krieg vielleicht gar nicht gäbe. Während er weiter geht, schweifen seine Gedanken durch die Zeit zurück in jenes Jahr, in dem alles hier in Aquitanien begonnen hatte.
Begonnen hatte es im Jahr 1152 mit der Hochzeit der Herzogin Éléonore d´Aquitaine mit Henri Plantagenet, dem Comte d´Anjou.
*
Élénores Hochzeit war ein Skandal.
Sie fand am 18. Mai 1152 in der Kathedrale von Poitiers statt – obwohl Éléonores Scheidung von König Louis VII. von Frankreich keine zwei Monate her lag; obwohl Henri der Erzfeind von Éléonores Exmann war; obwohl Éléonore elf Jahre älter war als Henri; obwohl Éléonore mit Henri ebenso nahe verwandt war wie mit Louis und die beiden den notwendigen Dispens des Papstes erst gar nicht eingeholt hatten, obwohl sie auch nicht die Erlaubnis von Louis VII. eingeholt hatten, der schließlich ihr Lehensherr war und – da Éléonore ja nicht verheiratet war – zudem noch ihr Protektor und obwohl Éléonore die skandalumwittertste Frau ihrer Zeit war, der man zahlreiche Affären, nicht zuletzt mit ihrem Onkel Raimund von Antiochia und selbst mit dem Vater ihres Bräutigams, nachsagte.
An jenem schicksalhaften 18. Mai 1152 verschob sich das Gefüge der Macht. Die Vereinigung der beiden mächtigsten Lehensnehmer des französischen Königs veränderte das politische Angesicht Frankreichs. Mit dem Ja-Wort in der Kathedrale von Poitiers gewann Henri Plantagenet nicht nur eine der attraktivsten und begehrtesten Frauen der Christenheit, sondern er verdreifachte auch seinen Machtbereich. Mit diesem Ja-Wort beherrschte er die westlichen zwei Drittel Frankreichs. Was für ein Schachzug! Das französische Königshaus war in Aufruhr; die adelige Gesellschaft in ganz Europa war in Aufruhr.
Nun, von Éléonore war wohl nichts anderes zu erwarten gewesen. Sie wurde im Jahr 1122 als Tochter des aquitanischen Herzogs Guilhelm X. in Poitiers geboren und wurde von ihm nach dem Tod ihres Bruders Guilhelm Aigret zu einer willensstarken und klugen Herrscherin erzogen. Sie wuchs am bewunderten, aber auch skandalumwitterten aquitanischen Hof auf, der weit über Frankreich hinaus als das Zentrum der Dichtkunst und des Minnesanges galt. Man sagt, Guilhelm IX., Éléonores Großvater, sei der erste Troubadour gewesen, ein Mann voll Leidenschaft und Abenteuerlust, dessen Lieder und Gedichte erotisch und manchmal auch blasphemisch waren. Éléonore, deren eigentlicher Name Aenòr war, die aber zur Unterscheidung von ihrer Mutter in ihrer oktzitanischen Muttersprache „Aleonòr“ – „die andere Aenòr“ – genannt wurde, wuchs in einer extravaganten, von den schönen Künsten und von romantischen ritterlichen Idealen geprägten Umgebung auf. Sie liebte den Luxus und die schönen Künste. Wo immer sie Hof hielt, förderte sie die Dichtkunst und den Minnesang und scharte Troubadoure um sich. Bald nannte man sie die „Königin der Troubadoure“ und sagte ihr erotische Beziehungen zu einigen von ihnen nach, wie etwa zu Marcabru und zu Bernart de Ventadorn.
Er lächelt, während er, beladen mit Bogen und Gepäck, weiter durch die Gassen stapft. Selbst er, der nicht mehr als ein Freisasse aus der Grafschaft Flint ist, kennt die Namen der beiden Troubadoure. Selbst heute noch wird ihre Dichtung am Hofe des Prinzen hier in Bordeaux vorgetragen. Von Bernart de Ventadorn sagt man, er habe die Minnedichtung in ihre lichtesten Höhen geführt. Der große Marcabru hatte eine neue Form der Minnedichtung erfunden, die man „Pastorelle“ nennt. Bei diesen Gedichten geht es immer um einen Ritter, der einer Schäferin den Hof macht und der – je nachdem wie geschickt er dabei ist – mehr oder weniger bei dem Mädchen erreicht. Die „Königin der Troubadoure“ hatte sich also mit keinen geringeren, als mit den Allergrößten unter den Troubadouren abgegeben. Diese Éléonore muss eine ziemlich lebenslustige Frau gewesen sein – und Marcabru war offenbar so geschickt wie die von ihm besungenen Ritter, denn Éléonores eifersüchtiger Ehemann Louis VII. vertrieb ihn vom Pariser Hof. Es war der perfekte gesellschaftliche Skandal am damals doch sehr prüden französischen Königshof! Er lächelt wieder.
Éléonore kam an den zu dieser Zeit noch wirklich spartanischen Pariser Hof, als sie am 25. Juli 1137 den späteren französischen König Louis VII., „Le Jeune“ – „den Jungen“ heiratete, wie dies ihr Vater in seinem Testament gewünscht hatte. Louis war das genaue Gegenteil seiner lebenslustigen und weltgewandten Braut. Er war introvertiert, still und tiefreligiös. Er hatte den größten Teil seines Lebens im Kloster von Saint Denis bei Paris verbracht, wo er bis zum Tod seines älteren Bruders Philip vom sittenstrengen Abt Suger, seinem späteren Berater, auf eine Laufbahn als Kirchenfürst vorbereitet worden war. Für ihn diente körperliche Liebe nur dazu, einen Thronfolger zu zeugen – nichts anderes war von einem Mann mit seiner Erziehung zu erwarten.
Er schüttelt wieder den Kopf. Selbst einem einfachen Mann wie ihm ist klar, dass diese Ehe zum Scheitern verurteilt sein musste. Sogar ein walisischer Bauernsohn weiß, dass in manchen Situationen auch Könige nur Männer und Königinnen nur Frauen sind.
Die Ehe zerbrach endgültig, als Éléonore ihren Mann, der wie sie selbst gesagt haben soll, „kein Mann, sondern ein Mönch“ war, im Jahr 1147 auf den 2. Kreuzzug ins Heilige Land begleitete. Ein Streit folgte dem anderen. Erst wollte sie nicht aus Byzanz, der luxuriösesten Stadt der bekannten Welt, weg, dann verbrachte sie für Louis´ Geschmack in Antiochia viel zu viel Zeit mit ihrem Onkel Raimund, der damals der Herr dieses inzwischen längst verloren gegangenen Kreuzfahrerstaates war. Letztlich wurde die Ehe Éléonores mit dem französischen König, dem sie zwei Töchter aber keinen Sohn geschenkt hatte, auf dem Konzil von Beaugency wegen zu enger Blutsverwandtschaft – Eleonore und Louis waren Cousine und Cousin im vierten Grad der Seitenlinie – annulliert.
Nach allem, was er von den gebildeten Männern am Hof des Prinzen gehört hatte, war die Scheidung gerade zur richtigen Zeit gekommen. Der nächste Mann war schon in Éléonores Leben getreten: Henri Plantagenet, der Comte d´Anjou, Comte de Maine und Duc de Normandie, dessen Kind sie nur fünf Monate nach der skandalösen Trauung in Poitiers zur Welt brachte. Henri passte weit besser zu Éléonore als Louis. Er war gutaussehend, willensstark, intelligent und gebildet. Er liebte die Jagd und die Kunst – und er war ein Frauenheld.
Henri beendete den seit Jahren andauernden englischen Thronfolgekrieg zwischen seiner Mutter Mathilde, der Tochter des englischen Königs Henry I., und deren Cousin, dem englischen König Stephen, indem er sich von diesem adoptieren und als Erben einsetzen ließ. Als Stephen starb, wurde Henri gemeinsam mit Éléonore am 19. Dezember 1154 von Erzbischof Theobald von Canterbury in Westminster als König Henry II. gesalbt und gekrönt.
Éléonores Ehe mit Henry entsprangen acht Kinder, unter ihnen Richard und John, die beide als Könige herrschten. Damit war die angevinische Dynastie – nach Angers, der Hauptstadt der Grafschaft Anjou – gegründet. Die Ehe verlief stürmisch, besonders da Éléonore die Machtbestrebungen ihrer Söhne gegen ihren immer tyrannischer werdenden Ehemann unterstützte. Er hielt sie daraufhin sechzehn Jahre lang auf der Insel Oléron gefangen. Dennoch hatte sie während der langen Jahre als Königin und Königinmutter bedeutenden Einfluss auf die Politik in Westeuropa. Sie war die Frau, die mehr als fünfzig Jahre lang hinter dem Thron der angevinischen Könige stand.
Immer wieder kehrte sie nach Poitiers zurück, um von dort aus ihre eigenen Länder zu verwalten und sich der Treue ihrer Vasallen zu versichern. In Poitiers unterhielt sie auch ihren sagenumwobenen Minnehof, um den sich noch heute viele Gerüchte ranken. Éléonore starb zweiundachtzigjährig am 1. April des Jahres 1204 und wurde in dem von ihr geliebten und geförderten Kloster Fontevraud neben ihrem Mann Henry II. und ihrem Sohn Richard I. begraben. Sie war die begehrteste, berüchtigtste und bestimmendste Frau eines ganzen Zeitalters.
Die angevinischen Könige Henry II., Richard I. „the Lionheart“ – „Löwenherz“ und John „Lackland“ – „ohne Land“ beherrschten England, Irland, Schottland, die walisischen Fürstentümer und weit mehr als die Hälfte Frankreichs. Damit übertraf ihr Herrschaftsgebiet bei weitem das der französischen Könige, mit denen sie – da sich diese ihrer übermächtigen Lehensleute entledigen wollten – in fast ständiger Fehde lagen. In den Jahren nach Éléonores Tod verloren die englischen Könige den Großteil ihrer Besitzungen in Frankreich. Nur Aquitanien ist ihnen geblieben – und selbst von diesem sind Teile von den Truppen des französischen Königs Jean II. besetzt. König Edward III. kann sich der Unterstützung des aquitanischen Adels sicher sein, auch wenn der Grund dafür nur sein mag, dass vielen dieser unabhängigkeitsliebenden Edelleute ein König in England lieber ist, als ein König im nahen Paris. Edward III., der Urenkel John Lacklands, kann also Anspruch auf den Westen Frankreichs von den Pyrenäen bis hinauf nach Ponthieu am Ärmelkanal erheben. Den Anspruch auf Ponthieu hat er allerdings nicht von seinen angevinischen Vorfahren, sondern von seiner Mutter Isabelle geerbt.
*
Isabelle war die schönste Frau der Christenheit – dennoch nannte man sie „die französische Wölfin“.
Am 25 Jänner 1308 wurde Isabelle im Alter von zwölf Jahren mit dem englischen König Edward II. verheiratet. Die Ehe sollte nach dem Plan des Papstes Bonifacius VIII. dem Frieden dienen. Papst Bonifacius hatte auf eine Doppelhochzeit gedrängt, um einen weiteren drohenden Krieg um Aquitanien, das seit dem Jahr 1296 von den Truppen des französischen Königs Philip IV. besetzt war, zu verhindern. Die Häuser Plantagenet und Capét sollten so eng verbunden werden, dass es keine weiteren Auseinandersetzungen um das aquitanische Lehen mehr geben würde. Edward I., der verwitwete Vater Edwards II., hatte in Ausführung des päpstlichen Planes Marguerite, die Schwester Philips IV., geheiratet und im Jahr 1303 wieder die Herrschaft über Aquitanien übernommen. Die Hochzeit seines Sohnes mit der französischen Königstochter sollte folgen, sobald diese das heiratsfähige Alter erreicht hatte.
Isabelle war wunderschön. Geoffroy de Paris beschrieb sie als „die Schönste der Schönen … im Königreich, wenn nicht in ganz Europa.“ Ihrer Mutter, der Königin Navarras, glich sie also offenbar nicht, denn diese war eine plumpe Frau mit einem geröteten Gesicht. Isabelle dagegen war schlank und hatte die helle Haut und das helle Haar ihres Vaters Philip IV. geerbt, den man nicht ohne Grund „le Bel“ – „den Schönen“ nannte. Trotz ihrer berauschenden Schönheit beachtete ihr Ehemann sie kaum. Seine Gunst galt seinem Favoriten Piers Gaveston, dem er sogar Schmuck aus der Mitgift Isabelles schenkte.
Edward II. war groß, schlank und bei seiner Thronbesteigung beim englischen Volk beliebt – ein perfekter Plantagenet. Er war der letzte überlebende Sohn Edwards I. Da seine Geschwister viel älter waren als er, wurde er auf Geheiß seines Vaters mit zehn anderen Jünglingen gemeinsam erzogen. Unter diesen war auch sein späterer Favorit Piers Gaveston.
Er zuckt unbewusst mit den Schultern, während die Gruppe der Waliser in eine weitere Gasse einbiegt. Einige der Bogenschützen, die ihm und dem Vintainer folgen, sind ausgesprochen hübsche junge Burschen, die mit ihrem robusten ländlichen Charme schnell den Gefallen jeder Frau erwecken könnten. Natürlich gibt es immer wieder Männer, die die Gesellschaft anderer Männer derer von Frauen vorziehen. Ein einfacher Mann muss befürchten, dass er für seine Neigungen vor den Richter geschleppt und bestraft wird – aber wer will die Macht eines Königs herausfordern, nur weil dieser Gefallen an schönen jungen Männern findet?
Nicht nur in den Tavernen, sondern auch in den Quartieren des Hofstaates wird erzählt, schon William Rufus, der Sohn und Nachfolger Williams des Eroberers habe dieser Neigung gefrönt. Selbst der große Kriegerkönig Richard Löwenherz soll sich in der Kathedrale von Messina selbst gegeißelt und widernatürlicher Sünden angeklagt haben. Bedenkt man, dass er mit seiner Gemahlin Berengaria keine Nachkommen gezeugt hat und dass man ihm – untypisch für einen adeligen Herrn – keine Frauengeschichten nachsagt, so mag an den Gerüchten etwas Wahres dran sein. So gesehen hat sich Edward II. mit seinen Vorlieben jedenfalls in bester Gesellschaft befunden.
Der Vintainer scheint jedenfalls frei von derlei Gelüsten zu sein, denn er winkt grinsend einer drallen Schankdirne zu, die gerade mit einem großen Krug Wein aus der Tür eines Gasthauses tritt.
Edward II. überhäufte Piers Gaveston mit Ehren und Geschenken, während das Land verkam und England im Jahr 1314 bei Bannockburn eine beschämende Niederlage gegen die Schotten hinnehmen musste. Sogar das Parlament warf Edward vor, üblem Rat zu folgen und den Krieg gegen die Schotten nicht mit genug Vehemenz zu führen. Im Jahr 1312 konnten die Barone, die das Verhältnis Edwards zu Gaveston zunehmend von ihrem König entfremdet hatte, dessen Günstlingswirtschaft nicht mehr ertragen. Sie ergriffen unter der Führung von Thomas, Earl of Lancaster, einem Cousin Edwards II., Piers Gaveston und richteten ihn ohne förmliches Verfahren hin. Isabelle, die ihrem Selbstverständnis als Königin folgend, die Interessen ihres Mannes gegen die Barone unterstützt hatte, gebar in diesem Jahr ihren ältesten Sohn, Edward of Windsor, den heutigen König Edward III.
Edward II. umgab sich im Lauf der Jahre mit einem neuen Kreis von Günstlingen, nicht zuletzt, um ein Gegengewicht zur Macht des Parlaments aufzubauen. Politisch wuchs Isabelle in dieser Zeit immer mehr in die Rolle der Vermittlerin zwischen ihrem Mann und den Baronen sowie zwischen ihm und dem französischen König, und zwischen den Städten und kirchlichen Institutionen hinein. Im Jahr 1318, jenem Jahr, in dem England die strategisch wichtige Grenzstadt Berwick an die Schotten verlor, verdrängte ein junger Mann namens Hugh le Despenser den aktuellen Favoriten Edwards.