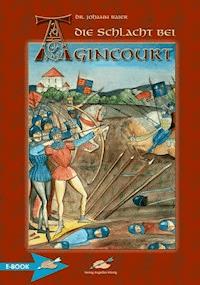Krähen über Crécy
von Dr. Johann Baier
Mit Illustrationen von Dr. Johann Baier und Luise Baier
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus in irgendeiner Form zu reproduzieren oder zu verbreiten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
© 2014 ebook
ISBN: 978-3-938921-36-4
Verlag Angelika Hörnig
Siebenpfeifferstr. 18
D-67071 Ludwigshafen am Rhein
www.bogenschiessen.de
Die Personen
Englischer Kammerherr
Walisischer Centenar
Englischer Kapitän
Englischer Bogenschütze
Englischer Waffenmeister
Genuesischer Gonfalionere
Französischer Mundschenk
Böhmischer Kreuzfahrer
Französischer Fahnenträger
Französischer Ritter
Inhalt
Vorwort Battle Pieces
Prolog
1. Kapitel England, Frühling 1346
2. Kapitel Frankreich, Frühsommer 1346
3. Kapitel Kanalküste, Juli 1346
4. Kapitel Saint Vaast la Hogue, 12 Juli 1346
5. Kapitel Halbinsel Cotentin, 13. – 25. Juli 1346
6. Kapitel Caen, 26. Juli 1346
7. Kapitel Blanchetaque, 24. August 1346
8. Kapitel Crécy en Ponthieu, 26. August 1346
9. Kapitel Crécy en Ponthieu, 27. August 1346
10. Kapitel Calais, 3. August 1347
Epilog
Nachwort Eine Analyse
Literaturverzeichnis
Vorwort
Battle Piece
Man schreibt den 26. August im Jahre des Herrn 1346. Es ist ein heißer Sommernachmittag, und am Himmel ballen sich die ersten Wolken eines aufziehenden Gewitters. Ein gewaltiges Heer unter der Führung des französischen Königs Philip VI. bewegt sich von Süden her auf die kleine Ortschaft Crécy en
Ponthieu zu. Sein Rivale um den Thron Frankreichs, der englische König Edward III., hat sein Heer auf einem flachen Hang nordöstlich des Städtchens in Stellung gebracht und wartet hier auf seinen Gegner, um sich ihm zur Schlacht zu stellen.
Die vielen tausend französischen Ritter, die als Angehörige der paneuropäischen Kriegerkaste die Hauptlast des Kampfes tragen werden, bieten auf ihren wertvollen Schlachtrössern mit ihren bunten Wappenröcken und Pferdedecken ein prächtiges Bild. Sie sehen sich selbst als die Blüte der Ritterschaft des christlichen Abendlandes. Sie fühlen sich durch die Engländer gedemütigt, die weite Teile des Königreichs Frankreich verwüstet haben, und sind begierig, sich auf die verhassten Feinde zu stürzen. Fußvolk, auch ihr eigenes – kampfunerfahrene Milizen und genuesische Söldner – betrachten sie als notwendiges Übel, keinesfalls aber als ebenbürtige Kämpfer.
Englands Ritter hingegen haben sich längst vom Idealbild des strahlenden Kämpfers zu Pferd gelöst und erwarten ihre Gegner zu Fuß. Sie haben auch die Vorstellung des Kampfes Mann gegen Mann – Ritter gegen Ritter – als einzige standesgemäße Form der Kriegsführung aufgegeben und neue Taktiken entwickelt. Für sie sind die erfahrenen und vielfach kampferprobten Bogenschützen, die zahlenmäßig den größten Teil des englischen Heeres bilden, unverzichtbare Mitstreiter.
Bei Crécy en Ponthieu prallen also zwei von Grund auf verschiedene militärische Weltanschauungen aufeinander. Die Schlacht bei Crécy ist die erste große Landschlacht in einer Auseinandersetzung, die spätere Generationen den „Hundertjährigen Krieg“ nennen werden.
Seit jenem 26. August 1346, an dem sich die Heere Edwards III. und Philips VI. nordöstlich der kleinen Ortschaft Crécy en Ponthieu gegenüber standen, sind mittlerweile mehr als 660 Jahre vergangen. Wenn wir nachvollziehen wollen, was an jenem Sommernachmittag und in den Wochen davor und danach geschehen ist, so stehen wir vor dem Problem, dass es heute naturgemäß niemanden mehr gibt, der uns die damaligen Geschehnisse aus eigener Anschauung berichten könnte.
Wir sind also auf die wenigen Berichte der Teilnehmer der Schlacht und die Erzählungen jener Historiker angewiesen, die sich in den Jahren danach mit den Geschehnissen auf dem Feldzug König Edwards III. in Frankreich in den Jahren 1346 und 1347 beschäftigt haben. Jene „erste“ Generation von Historikern konnte noch die Gelegenheit nutzen, um mit den Überlebenden beider Seiten, mit den Siegern, den Verlierern und den Opfern, zu sprechen.
Jean Froissart, der prominenteste und meistgelesene unter den Chronisten des 14. Jahrhunderts, bereiste sein Leben lang die Fürstenhöfe Europas und sprach mit den Zeugen der Ereignisse seiner Zeit, die er in seinen Werken schildert. Wie andere Historiker dieser Epoche, etwa Jean le Bel, Geoffrey le Baker oder Giovanni Villani, konnte er auf Informationen aus erster Hand zurückgreifen.
Dennoch standen schon die Zeitgenossen der Kämpfer von Crécy – bei allem Willen zu einer objektiven Schilderung der Ereignisse – vor demselben Problem, vor dem wir heute auch stehen: Jeder Zeuge sieht nur einen kleinen, auf ihn selbst bezogenen Teil der Ereignisse, an denen er teilhat. Die Art und Weise, wie er die Fakten aufnimmt, wie er sie verarbeitet und wie er sie weitergibt, ist durch vielerlei Umstände beeinflusst. Sie hängt nicht zuletzt davon ab, wo er sich zu welchem Zeitpunkt befunden hat, was er zu jenem Zeitpunkt getan hat, und natürlich auch davon, wie seine Psyche auf die Ereignisse reagiert hat.
Ein einfacher englischer Bogenschütze, der in der ersten Reihe der Division des Prince of Wales Pfeil um Pfeil auf die heranbrandenden französischen Ritter abgeschossen hat, wird die Ereignisse während der Schlacht ganz anders erlebt haben als etwa ein Kammerherr des englischen Königs, der mit diesem von der Windmühle aus, welche sich im Rücken der englischen Formation befand, die Angriffe der feindlichen Kavallerie beobachtet hat. Niemand, selbst der erfahrenste Historiker nicht, kann in jedem einzelnen Moment einer Schlacht das komplexe Zusammenspiel der gleichzeitigen Handlungen von tausenden Männern erfassen.
Jeder Historiker, der sich bei seiner Wiedergabe der Ereignisse während einer Schlacht auf die Berichte anderer Menschen stützt, verarbeitet daher Material, das bereits eine Verarbeitung durch seine Informanten durchgemacht hat. Er selbst schildert die Handlungsabläufe wieder von einer Warte aus, die durch seine persönliche Stellung zu den Geschehnissen bestimmt ist. Außerdem muss er die Lücken in den Berichten, auf welche er sich stützt, manchmal durch Vermutungen schließen, um ein möglichst komplettes Bild der Ereignisse geben zu können.
In seinem Standardwerk „The Face of Battle” nennt der englische Autor John Keegan die Schilderungen der Historiker „Battle Pieces“ – Schlachtengemälde. Je nach seinen persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben, gefärbt von seiner Umwelt und den Traditionen in denen er steht, wird ein Historiker seinem „Battle Piece“ mehr oder weniger Farbe geben – und mancher Augenzeuge, der an einem geschilderten Ereignis selbst teilgenommen hat, wird dieses Geschehen vielleicht gar nicht mehr als jenes erkennen, dem er teilhaftig geworden ist.
In diesem Sinne ist auch das vorliegende Buch ein „Battle Piece“: ein Schlachtengemälde, das, gemalt in den verbalen Farben des 21. Jahrhunderts, das Bild einer spätmittelalterlichen Schlacht zeichnen soll.
Dieses Buch unternimmt den Versuch, den Leser durch die Augen von verschiedenen – weitgehend erfundenen – Teilnehmern an den Kampfhandlungen und Ereignissen jenes Feldzuges teilhaben zu lassen. Es ist der Versuch, den Leser nicht nur mit geschichtlich belegten Fakten zu konfrontieren, sondern das Buch soll ihm ein „Gefühl“ dafür vermitteln, was es bedeutet haben muss, Teilnehmer, Zeuge oder Opfer dieses Feldzuges gewesen zu sein.
Die geschilderten Personen haben, so wie sie dargestellt sind, vielleicht nie existiert. Menschen, die die dargestellten Funktionen erfüllt haben, hat es natürlich gegeben. Wir wissen etwa, dass der Kammerherr Edward III. seinen König auf dem geschilderten Feldzug ebenso begleitet hat, wie der Mundschenk Philips VI. den seinen.
Wir wissen heute viel über die Herkunft, die Ausrüstung und das Training der englischen Bogenschützen, wir wissen aber nicht, was es für den einzelnen Schützen bedeutet haben muss, seine heimatlichen Waliser Berge zu verlassen und in einer Armee zu dienen, deren Sprache er ebenso wenig verstanden hat, wie die Sprachen und Dialekte der Menschen auf dem europäischen Festland, welche er bekämpft hat.
Keine der Personen, durch die der Leser den Verlauf der Ereignisse miterlebt, befindet sich in einer Position, von der aus sie den Fluss der Ereignisse entscheidend beeinflussen kann. Sie stehen immer nur unmittelbar neben den Entscheidungsträgern oder im Zentrum von Geschehnissen, die sie beobachten.
Für uns Menschen des 21. Jahrhunderts ist kaum vorstellbar, was die Menschen in einer von mittelalterlichen Denkansätzen geprägten Welt gedacht und empfunden haben. Zu weit hat sich unsere Kultur von der damaligen entfernt. Der Versuch, die Ereignisse an jenem 26. August 1346 und während des Feldzuges, dessen Höhepunkt die Schlacht bei Crécy zweifelsohne gewesen ist, durch die Augen erfundener Personen darzustellen, mag gewagt erscheinen. Die geschilderten Fakten sind historisch belegt und das Ergebnis ausgedehnter Recherchen und Studien, wobei vor allem auf die Literaturliste im Anhang dieses Buches zu verweisen ist. Die Handlung, in die diese Fakten eingebettet sind, soll es dem Leser erleichtern, sich in eine mittelalterliche Welt zu versetzten und so die Kluft von 660 Jahren zwischen dem Spätmittelalter und dem beginnenden 21. Jahrhundert zu überbrücken.
Es ist für uns heute schwer nachzuvollziehen, dass die Gräueltaten, die in diesem Krieg von beiden Seiten verübt worden sind, Mittel einer „normalen“ – von König und Kirche sanktionierten – Kriegsführung gewesen sind. Dieses Buch soll dem Leser auch diese Aspekte des mittelalterlichen Kriegsalltages nahe bringen und ihm die Abgründe jenseits der Ritterromantik Hollywoods und die Wahrheit jenseits der Helden in den glänzenden Rüstungen aus den Romanen der Romantik zeigen.
Um dem „Schlachtengemälde“ weitere Farbe zu verleihen, werden immer wieder auszugsweise direkte Reden zitiert, die die zeitgenössischen Chronisten den handelnden Personen in den Mund gelegt haben. Sie sind im Text kursiv dargestellt und die jeweilige Zahl an ihrem Ende – (x) – weist auf die laufende Nummer der Quelle im Literaturverzeichnis am Ende dieses Buches hin.
Dr. Johann Baier
Prolog
Die beiden großen Krähen fliegen hoch über das sommerliche Land. Sie erkennen die Zeichen am Himmel: Schwarze Wolken ballen sich zusammen, künden von Unwetter, Verderben und Tod. Die beiden großen Krähen lassen sich von den Flüchen, Verwünschungen und Gebeten, die sie auf dem Feld unter sich hören, in ihrem Flug nicht beirren. Wesen, die auf den Schultern der alten Götter gesessen sind und die nach den Schicksalsfäden der Nornen gepickt haben, lassen sich von sterblichen Menschen nicht beirren.
Der auffrischende Wind reißt die Worte von den Lippen der Männer, deren Hände Kreuze schlagen, Zeichen gegen den Bösen Blick und anderes Unheil machen und Amulette berühren.
Die beiden großen Krähen, wie alle Angehörigen ihrer Art sensibel für die Wandlungen des Wetters und die Energien, die sie steuern, suchen Schutz in den Bäumen des nahen Waldes. Schon öffnen sich die Schleusen des Himmels, und ein wütender Regenguss geht auf die Menschen nieder, die ihm auf dem offenen Feld schutzlos ausgeliefert sind.
Die beiden großen Krähen sehen, dass sich die Menschen auf dem Feld weder durch die Zeichen am Himmel noch durch das Unwetter von ihrem Tun haben abhalten lassen. Tausende Geschosse steigen mit bösartigem Zischen in den nach dem Regensturm glasklaren Himmel. Ihre scharfen Spitzen, die sie im Flug wie tödliche Schnäbel vorrecken, glänzen in der blendenden Abendsonne. Den beiden großen Krähen erscheinen sie wie Raubvögel, die mit mörderisch scharfen Schnäbeln die Lüfte auf der Suche nach Beute zerschneiden.
Die beiden großen Krähen fliegen hoch über das sommerliche Land. Auch ohne die Zeichen am Himmel und auch ohne auf die Flüche, Verwünschungen und Gebete unter ihnen zu achten, wissen sie, dass der heutige 26. August im Jahre 1346 ein Festtag für sie sein wird.
1. Kapitel
England,
Frühling 1346
Der König Englands, Edward III. aus dem Haus Plantagenet, verlässt den Saal; seine Berater folgen ihm. Zurück bleibt die spannungsgeladene Atmosphäre, in der die Besprechung stattgefunden hat. Wie eine giftige, dunkle Wolke scheint sie im Raum zu hängen, jeden bedrohend, der über die Schwelle tritt.
Der Kammerherr erhebt sich aus seiner Verbeugung. Er spürt die gespannte Atmosphäre wie ein bösartiges Tier in den Ecken des Raumes und hinter den Gobelins lauern. Für ihn ist sie eine alte Bekannte. Er ist schon oft dabei gewesen, wenn sie sich langsam entwickelt hat, gewachsen ist und schließlich wie ein vielarmiger Krake alle im Raum erfasst hat.
Er weiß, dass teures Räucherwerk sie zurückdrängen aber nicht endgültig vertreiben kann, solange der Besitz und die Ländereien des englischen Königs in Aquitanien in Gefahr sind. Denn der französische König Philip VI. hat ein Heer unter der Führung seines Sohnes Jean und des Connétable von Frankreich in die aquitanische Grafschaft Agenais entsandt und belagert die befestigte Stadt Aiquillon. Der Earl of Derby hat sie bis jetzt verteidigen können, aber der Druck auf Aquitanien ist groß.
Der Kammerherr kennt die Ursprünge des Krieges, den die Könige Englands und Frankreichs in den letzten neun Jahren führen. Seit Jahrhunderten sind die englischen Könige übermächtige Lehnsnehmer der französischen Krone. Nachdem William der Bastard – als Herzog der Normandie Lehnsmann des französischen Königs – England im Jahr des Herrn 1066 erobert hatte, waren nach und nach auch noch die französischen Lehen Maine, Anjou, Touraine, Poitou und Aquitaine durch Heirat und Erbschaft unter die Herrschaft der Könige Englands gekommen. Die Nachfolger Williams des Eroberers können Anspruch auf den Westen Frankreichs von Ponthieu bis hinunter zu den Pyrenäen erheben.
Das ist für die Könige Frankreichs immer untragbar gewesen.
Im Lauf der Jahre konnten die französischen Könige unter Ausnutzung ihrer Lehnshoheit und mit militärischer Gewalt all diese Gebiete mit Ausnahme Aquitaniens im Südwesten Frankreichs zurückerobern.
Im Jahr 1314 starb König Philip IV. von Frankreich. Seine drei Söhne: Louis IX., Philip V. und Charles IV., folgten ihm auf den Thron und starben nacheinander. Nachdem Charles IV. ohne männlichen Erben verstorben war, bestieg Philip de Valois, sein Cousin, als Philip VI. mit Unterstützung des französischen Hochadels am 29. Mai 1328 den Thron Frankreichs.
Durch die Anwendung des salischen Rechts, das die Thronfolge von weiblichen Kindern und deren Abkömmlingen verbietet, war Isabella, Tochter Philips IV. und Schwester von Charles IV., damit Cousine Philips VI., als Erbin des französischen Thrones ausgeschlossen. Isabella, die Witwe des in ihrem Auftrag ermordeten englischen Königs Edward II. beanspruchte den Thron Frankreichs für ihren noch jungen Sohn König Edward III.
Als Neffe stand Edward dem verstorbenen König näher als Philip als Cousin. Man beschied ihn jedoch, dass er von der Thronfolge ausgeschlossen sei, da er seinen Anspruch von einer Frau ableite und er darüber hinaus als Lehnsnehmer für die aquitanischen Gebiete nur ein Vasall der französischen Krone sei. Der Kammerherr war schon Mitglied des königlichen Haushalts, als der Prince of Wales, den man nach seinem Geburtsort auch Edward of Windsor nannte, am 1. Februar des Jahres 1330 als Edward III. den Thron Englands bestiegen hatte. Er hat miterlebt, wie die Spannungen zwischen England und Frankreich von Mal zu Mal stärker wurden.
Die Interessen der Herrscher der beiden Reiche prallen immer wieder aufeinander. Im Kampf um die Thronfolge in der Bretagne unterstützt König Edward die Erben Jean de Montforts gegen Charles de Blois, den Neffen Philips VI. Im Streit um die Grafschaft Artois steht er auf der Seite von Robert d’Artois gegen den Grafen von Flandern, der von seinem Onkel Philip VI. unterstützt wird. In Flandern ist er mit den reichen Städten verbündet, die sich gegen ihren ungeliebten französischen Grafen erhoben haben. Hier stehen für England vitale wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel, denn die flandrischen Städte sind die Hauptabnehmer für die qualitativ hochwertige englische Schafwolle. Flandern gehört zum Königreich Frankreich, und Philip hat seinen flandrischen Untertanen den Handel mit England untersagt. Das bedroht die englische Landwirtschaft ebenso wie Gewerbe und Handel in Flandern, die von der englischen Wolle abhängig sind. Beide Könige haben Verbündete im Heiligen Römischen Reich gewonnen, und König Philip ist eng mit König David II. von Schottland verbunden, der Englands Nordgrenze bedroht.
Der Kammerherr tritt auf den Gang vor dem Saal hinaus und winkt zwei seiner Sekretäre herein, die schon warten. Unter seinen wachsamen Augen beginnen die beiden jungen Männer die Schriftstücke, die überall im Raum liegen geblieben sind, einzusammeln und zu sortieren. Der Kammerherr fragt sich, ob auch sie die noch immer greif bare Spannung spüren. Er lässt seine Gedanken zurückschweifen und erinnert sich an das Jahr, in dem die ersten schweren Kampfhandlungen ausbrachen.
In jenem Jahr 1337 hatte der französische König Philip VI. das aquitansche Lehen, das immerhin die Provinzen Gascogne, Armagnac, Saintonge und Agenais umfasste, für verfallen erklärt und begonnen, mit seinen Truppen das Gebiet zu besetzen. Nur entschlossener Widerstand und der Umstand, dass der aquitanische Adel hinter der englischen Krone stand, hatten bis jetzt eine Katastrophe für England verhindert. Edward III antwortete mit der Entsendung von Truppen in die Aquitaine und mit Feldzügen in Flandern. Bei diesen war er bisher auf die Hilfe seiner holländischen und deutschen Verbündeten angewiesen, die jedoch nicht immer so zuverlässig und tatendurstig waren, wie König Edward sich dies gewünscht hatte. Der Kammerherr kann sich noch gut an die Temperamentsausbrüche seines Herrn erinnern.
Jetzt plant König Edward einen neuen Feldzug. Diesmal will er nicht auf das Wohlwollen seiner Verbündeten angewiesen sein. Diesmal sollen sie nur für Ablenkung sorgen. Diesmal ist es eine rein englische Armee, die den König begleiten wird.
Der Kammerherr zweifelt ebenso wenig wie irgendjemand sonst in England am Recht des Königs, Krieg zu führen. Krieg ist das Mittel, mit dem der König sein Recht verteidigt. Der König und sein Volk sind eins: Sein Krieg ist auch der ihre. Verteidigt er sein Recht, so verteidigt er auch das Recht seines Volkes. Dies wird in königlichen Proklamationen verlautbart und von den Kanzeln der Kirchen gepredigt. König Edwards Männer, die sich darauf vorbereiten, in Frankreich einzufallen, fühlen sich daher im Recht – ebenso wie die Krieger König Philips, die sie erwarten.
Der König hat den Adel Englands angewiesen, Truppen für den bevorstehenden Feldzug zu sammeln. Die Mächtigen des Königreiches sind der Verpflichtung nachgekommen, aber die Zahl der Männer, die sie für ihre Gefolgschaft auf bringen konnten, ist zu gering. Der König hat daher den Sheriffs und den Rekrutierungskommissionen in den Grafschaften und Städten südlich des Flusses Trent den Befehl erteilt, zusätzliche Truppen auszuheben. Die Kämpfer in den nördlichen Grafschaften sind unabkömmlich, denn sie müssen bereit stehen, falls König David seinem französischen Verbündeten zu Hilfe kommt und schottische Krieger in England einfallen.
Der Kammerherr weiß allerdings, dass dennoch Adelige von der Nordgrenze mit ihren Gefolgschaften den König nach Frankreich begleiten werden. Zu ihnen zählen etwa Thomas Hatfield, der kriegerische Bischof von Durham, und John, der älteste Sohn des Baron de Neville, der einer der mächtigsten Männer des Grenzlandes ist.
Eine Flotte muss bereitgestellt werden: Schiffe müssen gebaut, gekauft, gemietet oder beschlagnahmt und zu Truppentransportern umgebaut werden. Die Häfen müssen überwacht und feindliche Spione in die Irre geführt werden. Zusätzliche Anforderungen müssen an die Grafschaften hinausgehen. Der Kammerherr glaubt nicht, darauf hinweisen zu müssen, dass man besonders auf die Versorgung mit Pfeilen zu achten hat. Jeder Beamte des Königs weiß, dass der Erfolg eines kriegerischen Unternehmens maßgeblich von den Bogenschützen abhängt.
Der Kammerherr ist als Adeliger selbst in der Kriegskunst ausgebildet und erfahren. Er hat seinen König auf dessen Feldzügen begleitet, seit dieser sein Heer im Jahr 1333 nach Schottland geführt hat. Er wird seinen königlichen Herrn auch diesmal begleiten.
Er zieht die Sehne des Bogens bis hinter sein Ohr. Für einen Moment spürt er die gewaltige Kraft, die sich in der Waffe aufgebaut hat. Dann geben seine Finger dem Zug der Sehne nach. Der Pfeil wird von seiner Bogenhand geschnellt und rast fauchend davon. Die Nocke des Pfeils hat kaum die Sehne verlassen, da weiß er schon, dass dieser Pfeil treffen wird – wie die anderen Pfeile vor ihm. Mit einem dumpfen Geräusch schlägt der Pfeil in den weichen Erdhügel, der als Auflage für das Ziel dient, und bleibt in dem Kreis stecken, der von einem zusammengerollten Stück roten Stoffes gebildet wird– wie die anderen Pfeile vor ihm.
Er macht eine übertriebene, nicht ganz ernst gemeinte Verbeugung in Richtung der Grafschaftsbeamten, die hinter dem Tisch im Schatten eines Baumes am Eingang des Dorfes sitzen, und gesellt sich dann grinsend zu den anderen Schützen. Die Männer, die der Sheriff geschickt hat, um Truppen für das Heer des Königs auszuheben, nicken anerkennend.
Einer macht ein Zeichen neben der langen Liste der Namen der Wehrpflichtigen auf dem Pergament, das er vor sich auf dem Holztisch ausgebreitet hat. Die Grafschaftsbeamten haben den Befehl, nur die besten unter den Bogenschützen anzuwerben. Dazu lassen sie die Männer ihr Können an den „Butts“, den Zielscheiben, zeigen.
Hier in der Grafschaft Flint werden die Beamten keine Probleme haben, ihr Soll zu erfüllen. Die Männer Flints rühmen sich, die besten Bogenschützen Britanniens – und damit natürlich der ganzen Welt – zu sein. Natürlich behaupten das die Schützen im benachbarten Cheshire ebenso von sich. Der Sold, den die Grafschaftsbeamten bieten, ist dem angemessen. Ein Bogenschütze, der dem König zu Fuß folgt, erhält am Tag drei Pence. Das ist so viel, wie ein guter Handwerker oder ein fleißiger Bauer verdient. Ein Schütze, der so gut gestellt ist, dass er zu Pferd in den Kampf zieht, kann natürlich vielseitiger und flexibler eingesetzt werden als ein Infanterist. Er erhält sechs Pence am Tag, was dem Einkommen eines Handwerksmeisters entspricht – und dann ist da noch die Beute, die winkt.
Der Leiter der Rekrutierungskommission ruft die Männer zum Tisch. Ein Teil von ihnen sind Veteranen, die in Schottland, Flandern, der Bretagne oder in Aquitanien für König Edward III. gekämpft haben. Sie kennen die Prozedur, die sie jetzt erwartet. Die Jungen, die heute das erste Mal in den Dienst des Königs treten, sind neugierig und unruhig. Einige von ihnen haben nicht so gut geschossen, wie es eigentlich von Männern zu erwarten sein sollte, die von Kindesbeinen an mit Pfeil und Bogen trainieren. Sie müssen befürchten, für das Unternehmen, bei dem sie den Thronfolger Englands, Edward of Woodstock, begleiten sollen, nicht tauglich genug zu sein.
Die Grafschaftsbeamten, die alle auch das Walisisch sprechen, das die Sprache der Einwohner dieses Grenzlandes ist, lassen die Männer vor dem Tisch in einer Reihe antreten. Einer nach dem anderen treten die Bogenschützen vor den Tisch, nennen ihren Namen und zeigen den Werbern ihre Waffen und ihre Ausrüstung. Die Beamten, die seit vielen Jahren hier in Flint Männer für die Heere des Königs anwerben, mustern die Bogen und die Pfeile, die Handwaffen und die Rüstungen der Männer mit Kennerblick. Ausrüstung, die nicht den Anforderungen entspricht oder fehlt, wird der Sheriff aus seinen Beständen ersetzen müssen.
Er legt seinen Bogen und die beiden Leinensäcke mit den Pfeilen auf den Tisch und grüßt den Grafschaftsbeamten vor ihm lächelnd. Der Mann ist ein alter Bekannter, der wie er aus der Grafschaft Flint stammt. Er hat schon öfter bei Rekrutierungen mit seinen Waffen vor diesem Beamten gestanden. Er ist ein Veteran der Feldzüge König Edwards III. und hat für ihn in Flandern und zuletzt als Vintainer, als Kommandant von 20 Männern, in der Bretagne gegen die Franzosen gekämpft. Er ist ein gut situierter Mann, der über eigenen Grund und Boden verfügt und über Vieh, um das sich seine Frau und seine Kinder kümmern, wenn er auf einem Feldzug ist. Der Sold des Königs und die paar Beutestücke, die er vom Festland mitgebracht hat, ermöglichen seiner Familie neben den Einkünften aus der Landwirtschaft ein ruhiges, wenn auch arbeitsreiches Leben.
Sein Bogen hat die ideale Länge. Von Sehnennocke zu Sehnennocke ist er so lang wie der Abstand zwischen den Spitzen seiner Mittelfinger bei waagrecht ausgestreckten Armen. Der Bogen hat einen D-förmigen Querschnitt und ist dort, wo er ihn beim Schuss hält, gut zwei Finger dick.
Die Nocken, in denen die gespleißte Leinensehne sitzt und die die Enden seines Bogens schützen, sind aus Horn geschnitzt. Keiner der Bogen, die die Männer vor dem Tisch in den Händen halten, scheint weniger als 80 Pfund Zuggewicht zu haben; manche leisten sogar deutlich mehr.
So wie er haben die meisten der Männer Bogen aus Eibenholz mit seinem fast weißen Splintholz und dem dunklen, rötlichen Kernholz. Es gilt als das beste Holz für Bogen. Als allerbestes Holz gilt importiertes Eibenholz aus dem Süden des Heiligen Römischen Reiches, aus dem Baltikum und vor allem aus Spanien. Am besten eignet sich Holz von Eiben aus den Rändern des Verbreitungsgebietes dieser Bäume. In diesen Gebieten wachsen die Eiben wegen der für sie nicht idealen Bedingungen nicht so schnell, und die Wachstumsringe sind ganz dicht beieinander. Das gibt dem Bogen mehr Schnellkraft und Widerstandsfähigkeit.
Bogen werden auch aus dem Holz von Ulmen, Eschen, Hasel und Goldregen gefertigt. Aber kein Holz kommt dem der Eibe gleich.
Er öffnet einen der beiden Leinensäcke und zeigt dem Mann vor ihm die zwei Dutzend Pfeile. Der Grafschaftsbeamte wirft nur einen kurzen Blick darauf. Pfeile sind Massenware und werden in riesigen Mengen im ganzen Königreich aus allen möglichen Hölzern produziert. Die Pfeilmacher bevorzugen allerdings das Holz von Espen, Erlen, Eschen und Birken. Für Pfeile, die besonders hart treffen sollen, ist Eschenholz gefragt, aber es ist schwer zu bearbeiten und wird in großen Mengen für die Lanzen der Ritter und für die Schäfte der Stangenwaffen der Infanterie benötigt.
Üblicherweise sind die Pfeile, die für die Truppe gefertigt werden, eine Dreiviertelelle, also 34 Zoll lang und können bis zu einem Zoll dick sein. Zur Stabilisierung des Fluges sind hinten an den Schäften, zirka ein Zoll vor den einfachen, in das Ende der Pfeile eingeschnittenen Nocken, mehrere Zoll lange, dreieckig zugeschnittene Gänsefedern festgeklebt. Sie sind mit einem spiralig um den Schaft gewickelten Leinenfaden zusätzlich gesichert. Alle seine Pfeile haben dieselben, zwei Zoll langen, flachen Spitzen mit nur kleinen Widerhaken, die sich als wirksam für die Bekämpfung der meisten Ziele erwiesen haben.
Er streckt dem Beamten seine Arme hin, um ihm zu zeigen, dass er seine Finger vor dem scharfen Zug der Sehne mit Handschuhen schützt. Seine Finger sind wie bei den meisten Bogenschützen vom vielen Schießen so hart, dass er eigentlich keinen Fingerschutz braucht, aber er hat gelernt, dass ihm die Handschuhe zusätzlichen Schutz geben, wenn es zum Nahkampf kommt. Manche Schützen bevorzugen Handschuhe, die nur zwei oder drei Finger ihrer Zughand schützen. Andere begnügen sich mit einem einfachen Stück Leder, in das ein Loch geschnitten ist, durch das sie den Mittelfinger stecken können, um es in der Hand zu fixieren. An den linken Unterarm hat er mit einem einzelnen Riemen einen Armschutz geschnallt, der seinen Arm und seine Kleidung vor dem Schlag der Sehne schützt. Denn da er beim Schießen seinen Bogenarm voll durchstreckt, um jeden Millimeter Auszugsweite nutzen zu können, schlägt die Sehne aufgrund der Konstruktion des Bogens immer wieder hart gegen seinen Unterarm.
Das Schwert, das er dem Werber zeigt, hat im Vorjahr noch dem Gefolgsmann eines bretonischen Ritters gehört. Hinter der ledernen Gürteltasche trägt er einen langen, zweischneidigen Dolch in einer schmucklosen Lederscheide. Der ist leichter zu führen als das Schwert, wenn das Gewühl des Nahkampfes so dicht wird, dass kaum noch eine Bewegung möglich ist.
Zuletzt legt er auch noch sein Wams und den Helm auf den Tisch. Er hat die Sachen eingerollt unter dem Arm getragen. Das Wetter ist jetzt schon viel zu warm, um das warme Zeug über der Alltagskleidung zu tragen, wenn es nicht notwendig ist. Der Helm ist eine einfache Beckenhaube ohne Visier, die über seinem Schädel konisch zusammenläuft. Auch sie hat dem Bretonen gehört. Wie alle Bogenschützen bevorzugt er Helmtypen, die die Sicht nicht behindern.
Sein Wams ist von der Art, die die Engländer „Jack“, die Franzosen und andere Ausländer aber „Gambeson“ oder „Aketon“ nennen. Die Jacke, die auf seine halben Schenkel hinabreicht, besteht aus einem guten Dutzend Lagen von sehr festem Leinengewebe und ist längs abgesteppt, damit sie ihre Form behält. Oft stopft man zwischen die Stofflagen Wolle oder Filz, fest gedrehten Hanf oder auch nur Heu.
Sie behindert ihn nicht, wenn er sich bewegt und ist einigermaßen billig; billiger jedenfalls als die teuren und schweren Kettenhemden, die sich kaum ein Bogenschütze leisten kann.
Der Grafschaftsbeamte schreibt seinen Namen als ersten auf ein neues Stück Pergament und schreibt daneben „Yeoman“. Damit stellt er fest, dass der Mann vor ihm ein Freisasse ist, frei auf eigenem Grund und Boden und kein untertäniger Knecht. Die Yeomen stellen die große Masse der Infanterie, vor allem aber der Bogenschützen. Sie sind es, die den Kern und die Elite des englischen Fußvolkes bilden. Sie gelten als die besten und die verlässlichsten Soldaten.
Die Bogenschützen kommen für gewöhnlich aus den ländlichen Gebieten, seltener aus den Städten. Sie sind harte Arbeit, Entbehrungen und das Leben in der freien Natur gewohnt. Es sind muskulöse Männer, deren Arme und Schultern durch das jahrelange Training mit immer stärker werdenden Bogen kräftig geworden sind und deren Schultergelenke sich den gewaltigen Belastungen durch Überentwicklung angepasst haben.
Schon der Großvater des jetzigen Königs, Edward I., hat seinen Untertanen per Verordnung das Schießen mit Pfeil und Bogen befohlen. Sein Sohn Edward II. hat gar das Fußballspielen und andere „unnötige“ Spiele zugunsten des Bogenschießens verboten. Der regierende König Edward III. hat den männlichen Einwohnern seines Königreiches Arbeit an den Wochentagen und Kirchenbesuch und Bogenschießen am Sonntag verordnet.
Der Beamte dreht das Pergament um und reicht ihm die Schreibfeder, nachdem er sie nochmals in den Tintenkessel getaucht und die überflüssige Tinte abgestreift hat. Er nimmt die Feder und kritzelt mit beträchtlicher Anstrengung die Buchstaben, die seinen Namen bilden, dort auf das Pergament, wohin der Finger des Mannes hinter dem Tisch zeigt. Er ist jetzt Teil des Heeres des Königs.
Die Dorfschenke ist zum Bersten voll. Die Luft ist zum Schneiden dick. Es riecht nach Männerschweiß, verbranntem Essen, verschüttetem Ale und noch ein paar Dingen, die der Centenar, der Befehlshaber der hier ausgehobenen Hundertschaft, gar nicht wissen will. Die gut hundert Männer, die sich im Schankraum und draußen vor der Tür drängen, prosten einander zu, lachen, schreien quer durch den Raum und verlangen nach noch mehr Ale. Die Stimmung ist gut, der Lärm ohrenbetäubend. In einer Ecke des Raumes beginnen ein paar von den Betrunkeneren in ihrer walisischen Mundart ein zotiges Lied zu grölen. Einer der fünf Männer, die in der Hundertschaft des Centenars als Vintainer – als Anführer von 20 Männern – dienen sollen, grinst ihn an und prostet ihm zu. Die Worte des Mannes gehen im Lärm unter, aber der Hundertschaftsführer grinst zurück und nimmt einen tiefen Zug Ale aus dem Tonkrug in seiner rechten Hand.
Der Centenar ist hierher ins nördliche Wales geschickt worden, um in diesem Dorf eine frisch ausgehobene Hundertschaft von walisischen Spießknechten zu übernehmen. Die keltischen Randgebiete des Königreiches, Wales, Cornwall und Irland, sind im Vergleich zum englischen Kernland rückständig und ärmlich. Hier ist es leicht, Truppen auszuheben.
Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich. Die Männer in den walisischen Hügeln sind froh, wenn sie ihre kargen Einkünfte durch die Teilnahme an einem Feldzug auf bessern können. Obwohl die walisischen Krieger hartgesottene und brutale Kämpfer sind, bekommen sie nur zwei Pence am Tag, unabhängig davon, ob sie als Spießknechte oder als Bogenschützen dienen. Sie sind daher ständig auf der Suche nach Beute, und nichts und niemand ist vor diesen beutegierigen Plünderern sicher.
Der Centenar kennt die Probleme, die auf dem geplanten Feldzug auf ihn zukommen werden. Seine Männer werden jede Gelegenheit zum Rauben, Plündern und Brandschatzen nützen, sie werden morden und vergewaltigen, aber wenn er sie richtig führt und eisern im Griff behält, werden diese Wilden kämpfen wie die Teufel.
Der Centenar trinkt sein Ale aus, winkt seinen Vintainern zu und drängt sich dann durch die Masse der grölenden Spießknechte hinaus ins Freie. Die Abendluft umfängt ihn wie ein kühler Mantel. Er genießt es für einen Moment, dem Lärm und dem Gestank im Inneren der Schenke entkommen zu sein.
Die walisischen Krieger haben ein ganzes Sammelsurium von Stangenwaffen an die Wand des niedrigen Hauses gelehnt. Waffen, die je nach ihrer Form Namen wie Kriegssense, Hippe und Glefe tragen, stehen da. Man sieht ihnen auf den ersten Blick an, dass als Ausgangsmaterial für ihre Herstellung landwirtschaftliches Werkzeug gedient hat.
Sensenklingen, Sicheln und Haumesser sind mehr oder minder unverändert auf kräftige Holzstangen genagelt worden. Sie sehen primitiv und brutal aus – wie ihre Eigentümer. Ein paar Speere lehnen daneben, denen die Spießknechte ihre englische Bezeichnung „Spearmen“ verdanken.
Sehr beliebt ist bei den Fußsoldaten auch die Voulge, bei der eine wuchtige Klinge an einem langen Schaft befestigt ist, die sich mehr zum Hauen als zum Stechen eignet. Sogar ein paar einfache Hellebarden finden sich unter dem vorspringenden Strohdach. Wegen des vielen Eisens, das für ihre Herstellung notwendig ist, sind sie teuer. Ihre Eigentümer sind also für die hiesigen Verhältnisse wohlhabend oder haben sie auf früheren Feldzügen erbeutet. Keine der Stangenwaffen gleicht der anderen, und jede Art hat einen anderen Namen, der von Gegend zu Gegend unterschiedlich ist.
Ein paar der Krieger, die vor dem Haus der kühlen Abendluft trotzen, singen ein walisisches Lied. Ihr Dialekt ist kaum zu verstehen, aber der Centenar glaubt, dass es um ein Mädchen und um grüne Wiesen geht. Einige der Sänger haben Helme auf dem Kopf. Es sind einfache Hirnhauben oder Eisenhüte, ein paar haben auch nur Helme aus gehärtetem Leder. Fast alle tragen eine Gugel, das ist eine Kapuze, die Kopf und Schultern bedeckt und deren Kopfteil in einen langen Zipfel, die „Liripipe“, ausläuft. Die Engländer nennen dieses universelle Bekleidungsstück „Hood“. Im Land beginnen gerade Balladen zu kursieren, die von einem Mann handeln, dem dieses Kleidungsstück seinen Namen gegeben hat. Manche der Männer besitzen nur die einfachen Leinenhauben, die fast jedermann trägt und die nicht nur vor den Unbilden des Wetters, sondern auch vor Ungeziefer schützen sollen.