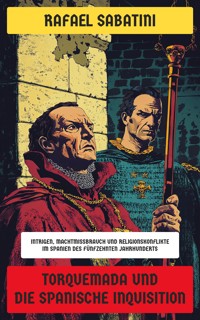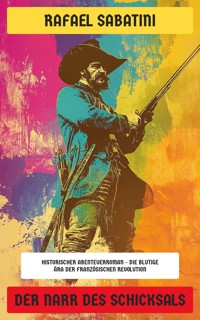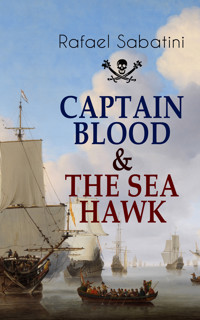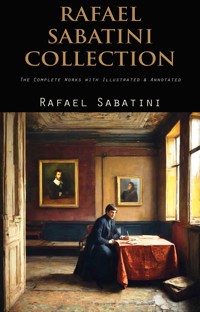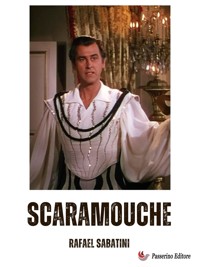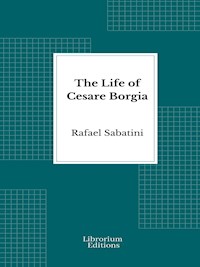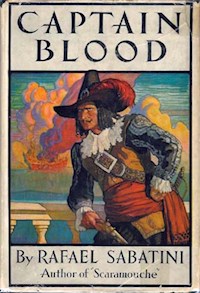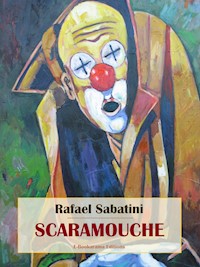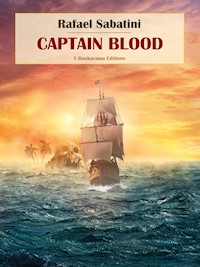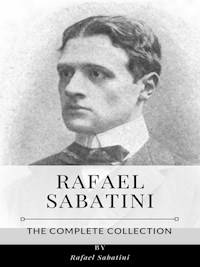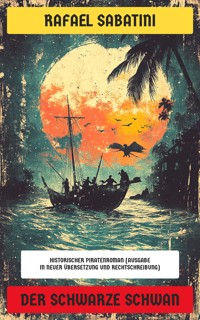
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Rafael Sabatinis Meisterwerk "Der Schwarze Schwan" wird der Leser in eine fesselnde Geschichte entführt, die im turbulenten Umfeld der Karibik im 17. Jahrhundert spielt. Das Buch kombiniert meisterhaft Abenteuer, Romantik und Intrigen, während es die Geschichte von Peter Blood, einem unglücklichen Arzt, erzählt, der in die Sklaverei verkauft wird und seine Freiheit sowie die Liebe zu einer unerschütterlichen Schönheit sucht. Sabatini zeichnet sich durch seinen lebendigen, atmosphärischen Schreibstil aus, der es dem Leser ermöglicht, die raue Schönheit der tropischen Landschaften und die gesellschaftlichen Konflikte jener Zeit intensiv zu erleben. Zum Teil historischer Roman, zum Teil fesselnde Abenteuererzählung, gefüllt mit dramatischen Wendungen, spiegelt das Buch die Dynamik und die Herausforderungen des Lebens auf See wider. Rafael Sabatini, ein italienisch-britischer Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts, erlangte Ruhm durch seine historischen Romane und Abenteuergeschichten. Geboren in einer Künstlerfamilie und stark geprägt von den Geschichten seiner Kindheit, entwickelte er eine Leidenschaft für Geschichte und Literatur, die in seinen packenden Erzählungen zum Ausdruck kommt. "Der Schwarze Schwan" ist nicht nur ein Produkt seiner beeindruckenden Vorstellungskraft, sondern auch ein Abbild seines interkulturellen Hintergrunds und seiner tiefen Kenntnisse maritimer Themen. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden Liebhaber von historischen Abenteuern. Sabatinis geschickte Charakterentwicklung und seine eindringliche Erzählweise fesseln die Leser und lassen sie in die Ansichten und Erfahrungen des 17. Jahrhunderts eintauchen. "Der Schwarze Schwan" ist mehr als nur eine Geschichte über Freiheit und Liebe; es ist eine Celebration des menschlichen Geistes und eine Einladung, die unentdeckten Abenteuer im eigenen Leben zu suchen. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Schwarze Schwan
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1. FORTUNA UND MAJOR SANDS
Major Sands, der sich seiner hohen Verdienste bewusst war, war geneigt, die Geschenke, die ihm Fortune seiner Meinung nach anbot, herablassend anzunehmen. Sie konnte ihn nicht mit ihnen bestechen, damit er ihre Urteilskraft respektierte. Er hatte gesehen, wie sie die Wertlosen mit Gefälligkeiten überschüttete und die Verdienstvollen um ihren gerechten Lohn betrog. Und sie hatte ihn warten lassen. Wenn sie sich ihm endlich zuwandte, dann vermutlich weniger aus einem gnädigen Gerechtigkeitssinn heraus als vielmehr, weil Major Sands es verstanden hatte, sie zu zügeln.
Dies war, nach allem, was ich herausgefunden habe, die Stimmung seiner Gedanken, als er neben dem Tagesbett lag, das für Fräulein Priscilla Harradine unter der Markise aus braunem Segeltuch aufgestellt worden war, die auf dem hohen Poop des Zentaurs improvisiert worden war.
Das schmucke gelbe Schiff lag in der weitläufigen Bucht von Fort Royal vor Anker, die es nach der kurzen Fahrt von Barbados als ersten Anlaufhafen anlief. Sie nahmen frisches Wasser an Bord, und dies war eine Gelegenheit, sie dazu zu bewegen, auch andere Dinge mitzunehmen. In den Vorderketten wurden der Neger-Steward und der Koch von einer Gruppe Periaguas, die mit Obst und Gemüse beladen waren und an der Seite entlang stießen und schabten, mit verstümmeltem Englisch und geschmeidigem Französisch bombardiert. Die Periaguas waren mit Weißen, Mischlingen, Negern und Kariben bemannt, die alle lautstark versuchten, ihre Waren zu verkaufen.
An der Spitze der Eingangsleiter stand Kapitän Bransome in einem dunkelblauen Mantel mit steifem Rock und angelaufener Goldspitze und verweigerte dem hartnäckigen Juden im Cockboot am Fuße der Leiter den Zutritt, der ihm Schnäppchen bei Kakao, Ingwer und Gewürzen anbot.
Nahe der Küste, über die durchscheinend jadegrünen Wasser der Bucht hinweg, die sanft von der nordöstlichen Brise gekräuselt wurden, welche die glühende Hitze der Sonne angenehm milderte, erhob sich das Gewirr von Masten und Spieren der dort vor Anker liegenden Schiffe. Dahinter zeichnete sich die kleine Stadt Fort Royal scharf weiß gegen die smaragdgrünen, welligen Hänge von Martinique ab, Hänge, die im Norden von der vulkanischen Masse des Mont Pelé beherrscht wurden, dessen zerklüfteter Gipfel sich in den kobaltblauen Himmel reckte.
Kapitän Bransome, dessen Blick zwischen dem Juden, der sich nicht abwimmeln ließ, und einem Beiboot, das sich in einer Entfernung von einer halben Meile dem Schiff näherte, hin und her schweifte, nahm seine runde schwarze Augenrolle ab. Darunter war sein Kopf in ein blaues Baumwolltaschentuch gewickelt, da dies kühler war als eine Perücke. Er stand da und wischte sich die Stirn, während er wartete. Er spürte die Hitze in der schweren europäischen Pracht, die er aus Rücksicht auf die Würde seines Amtes als Kapitän anzog, wenn er in einen Hafen einlief.
Auf dem Poopdeck darüber spürte auch Major Sands trotz der Brise und des Schattens der Markise die Hitze, da er zu einer eher fleischlichen Körperform neigte, und das trotz eines längeren Aufenthalts im Wendekreis des Krebses. Er war vor fünf Jahren ausgewandert, als König Karl II. noch am Leben war. Er hatte sich freiwillig für den Dienst im Ausland gemeldet, in der Überzeugung, dass er in der Neuen Welt das Glück finden würde, das ihm in der Alten verwehrt blieb. Die Notwendigkeit wurde ihm von einem ausschweifenden Vater auferlegt, der die großen Familiengüter in Wiltshire verspielt und vertrunken hatte. Major Sands' Erbe war daher spärlich ausgefallen. Zumindest beinhaltete es nicht – und dafür dankte er täglich seinem Schöpfer – die verschwenderischen, unvorsichtigen Neigungen seines Vaters. Der Major war kein Mann für Risiken. Im Gegensatz zu seinem verschwenderischen Vater besaß er jenes kalte und berechnende Temperament, das, wenn es mit Intelligenz gepaart ist, einen Mann weit bringen kann. Bei Major Sands fehlte die Intelligenz; aber wie die meisten Männer in seinem Fall war er sich dessen nicht bewusst. Wenn er auch seine Hoffnungen nicht in Übereinstimmung mit den Erwartungen, die ihn ins Ausland geschickt hatten, verwirklicht hatte, so war er sich doch bewusst, dass er dabei war, sie in vollem Umfang zu verwirklichen. Und wie unvorhergesehen die Umstände auch waren, die zu dieser Tatsache führten, so störte dies in keiner Weise seine Wahrnehmung, dass die Leistung auf sein eigenes Verdienst und seine eigene Leistung zurückzuführen war. Daher seine verächtliche Haltung gegenüber dem Glück. Die Angelegenheit war schließlich eine einfache. Er war auf der Suche nach Glück in die Westindischen Inseln gekommen. Und in den Westindischen Inseln hatte er es gefunden. Er hatte erreicht, was er erreichen wollte. Könnten Ursache und Wirkung enger miteinander verbunden sein?
Dieses Vermögen, das er gewonnen hatte oder das er nun gewinnen konnte, lag auf einer Liege aus Rohrgeflecht und geschnitzter Eiche und war äußerst ansehnlich. Schlank und gerade, mit klaren Gliedern und von mittlerer Größe, zeigte Priscilla Harradine eine äußere Anmut des Körpers, die nur die Vor Augen gehaltene Anmut des Geistes war. Der Schatten eines breitkrempigen Hutes lag auf dem jungen Gesicht von gewinnender Lieblichkeit; es hatte die zarte Tönung, die zu dem tiefen Gold ihres Haares passte, und es zeigte kaum Anzeichen von langen Jahren, die sie im glühenden Klima von Antigua verbracht hatte. Wenn ihr entschlossenes Kinn und ihre fest geformten Lippen von Temperament zeugten, so waren ihre weit auseinanderstehenden, intelligenten Augen von einer Farbe, die zwischen dem tiefen Blau des Himmels und dem Jadegrün des Meeres lag, auf das sie blickten, von Zärtlichkeit und Offenheit erfüllt. Sie trug ein hoch tailliertes Kleid aus elfenbeinfarbener Seide, und die geschweiften Kanten ihres Mieders waren mit feiner Goldspitze verziert. Sie wedelte träge mit einem Fächer aus leuchtend grünen und scharlachroten Papageienfedern, in dessen Herz ein kleiner ovaler Spiegel eingesetzt war.
Ihr Vater, Herr John Harradine, hatte ähnliche Motive wie Major Sands, als er sich aus England in eine abgelegene Kolonialsiedlung zurückzog. Auch sein Vermögen war auf einem Tiefpunkt angelangt; und sowohl um seines einzigen und mutterlosen Kindes als auch um seiner selbst willen hatte er die Position des Generalkapitäns der Leeward-Inseln angenommen, die ihm ein Freund am Hof verschafft hatte. Einem wachsamen Kolonialgouverneur boten sich große Chancen. Sir John hatte es verstanden, sie zu ergreifen und zu nutzen, während der sechs Jahre, die seine Amtszeit als Gouverneur gedauert hatte, und als er schließlich starb – vorzeitig durch ein tropisches Fieber dahingerafft – war er in der Lage, seiner Tochter für die Jahre des Exils, die sie mit ihm geteilt hatte, etwas zurückzugeben, indem er ihr eine sehr beträchtliche Summe und ein sehr ansehnliches Anwesen in seiner Heimat Kent hinterließ, das ein vertrauenswürdiger Agent in England für ihn erworben hatte.
Es war der Wunsch von Herrn John gewesen, dass sie sofort nach Hause zu diesem und zu seiner Schwester gehen sollte, die sie führen würde. Auf seinem Sterbebett protestierte er, dass sie durch seine Selbstsucht bereits zu viel ihrer Jugend in Westindien verschwendet habe. Dafür bat er sie um Verzeihung und starb.
Sie waren ständige Gefährten und gute Freunde gewesen, sie und ihr Vater. Sie vermisste ihn schmerzlich, und sie hätte ihn noch mehr vermissen können, sie hätte durch seinen Tod in ein tieferes Gefühl der Einsamkeit versinken können, aber da waren die bereitwillige Freundschaft, Aufmerksamkeit und der Dienst von Major Sands.
Bartholomew Sands war der Stellvertreter des Generalkapitäns gewesen. Er hatte so lange mit ihnen im Regierungsgebäude gelebt, dass Fräulein Priscilla ihn als Teil der Familie betrachtete und froh war, sich jetzt auf ihn stützen zu können. Und der Major war noch froher, dass er sich auf ihn stützen konnte. Seine Hoffnungen, die Nachfolge von Herrn John als Gouverneur von Antigua anzutreten, waren gering. Nicht, dass es ihm seiner Meinung nach an Fähigkeiten mangelte. Er wusste, dass er über Fähigkeiten im Überfluss verfügte. Aber die Gunst des Hofes zählte in diesen Angelegenheiten mehr als Talent oder Erfahrung, und die Gunst des Hofes würde die freie Stelle zweifellos mit einem unfähigen Schwindler aus der Heimat besetzen.
Diese Erkenntnis bestärkte ihn in seiner weiteren Auffassung, dass seine erste Pflicht Fräulein Priscilla galt. Er sagte es ihr und überwältigte das Kind mit dieser Zurschaustellung dessen, was sie als selbstlosen Edelmut bezeichnete. Denn sie ging davon aus, dass sein natürlicher Platz auf dem vakanten Sitz ihres Vaters war, eine Annahme, die er bei weitem nicht zerstreuen wollte. Es könnte durchaus so sein, meinte er; aber es könnte wenig ausmachen, wenn man es gegen ihr mögliches Bedürfnis nach ihm abwägt. Sie würde nun nach England zurückkehren. Die Reise war lang, mühsam und mit vielen Gefahren verbunden. Für ihn war es ebenso unvorstellbar wie unerträglich, dass sie diese Reise ohne Begleitung und ohne Schutz antreten sollte. Auch wenn er seine Chancen auf die Nachfolge als Gouverneur gefährden würde, wenn er die Insel zu einem solchen Zeitpunkt verließ, ließ ihm sein Pflichtgefühl ihr gegenüber und seine Wertschätzung für sie keine andere Wahl. Außerdem, fügte er mit beeindruckender Überzeugung hinzu, wäre es das, was ihr Vater gewollt hätte.
Er hatte ihre sanften Einwände gegen diese Selbstaufopferung übergangen, sich selbst beurlauben lassen und Kapitän Grey zum stellvertretenden Gouverneur ernannt, bis neue Befehle aus Whitehall eintrafen.
Und so hatte er sich mit ihr an Bord des Zentaurs eingeschifft, und mit ihr war zunächst ihre schwarze Dienerin Isabella gewesen. Leider litt die Negerin so schrecklich unter Seekrankheit, dass es unmöglich war, sie über den Ozean mitzunehmen, und sie waren gezwungen, sie auf Barbados an Land zu setzen, so dass Fräulein Priscilla fortan auf sich selbst angewiesen war.
Major Sands hatte den Zentaur wegen ihrer Geräumigkeit und Seetüchtigkeit ausgewählt, obwohl ihr Herr vor dem Kurs auf die Heimat noch Geschäfte weiter südlich in Barbados zu erledigen hatte. Wenn überhaupt, dann begrüßte der Major diese Verlängerung der Reise und damit diese enge und intime Verbindung mit Fräulein Priscilla. Es lag in seiner berechnenden Natur, langsam vorzugehen, um nichts durch Übereilung zu verderben. Er war sich bewusst, dass sein Werben um die Erbin von Sir John Harradine, das ja erst nach dem Tod von Sir John begonnen hatte und sie ihm sozusagen in die Hände gespielt hatte, noch ein wenig andauern musste, bevor er behaupten konnte, sie gewonnen zu haben. Es gab gewisse Nachteile zu überwinden, gewisse mögliche Vorurteile abzubauen. Schließlich gab es, obwohl er zweifellos ein sehr sympathischer Mann war – eine Tatsache, die ihm sein Spiegel mit größter Zuversicht versicherte –, einen unbestreitbaren Altersunterschied zwischen ihnen. Fräulein Priscilla war noch keine fünfundzwanzig, während Major Sands bereits die Vierzig überschritten hatte und unter seiner goldenen Perücke eine leichte Glatze zu erkennen war. Zunächst hatte er deutlich wahrgenommen, dass sie sich seiner Jahre nur allzu bewusst war. Sie behandelte ihn mit einer fast kindlichen Ehrerbietung, was ihm einige Schmerzen und noch mehr Bestürzung bereitete. Durch die enge Verbindung, die sie verband, und die suggestive Fähigkeit, mit der er ein Gefühl der annähernden Gleichaltrigkeit hergestellt hatte, wurde diese Haltung ihrerseits allmählich zerstreut. Er blickte nun auf die Reise, die es ihm ermöglichen sollte, die so gut begonnene Arbeit abzuschließen. Er wäre in der Tat ein Dummkopf, wenn er es nicht schaffen würde, dass diese äußerst begehrenswerte Dame und ihr ebenso begehrenswertes Vermögen sich mit ihm verloben würden, bevor sie in Plymouth Roads vor Anker gingen. Darauf hatte er seine geringen Chancen auf die Nachfolge als Gouverneur von Antigua gesetzt. Aber wie gesagt, Major Sands war kein Spieler. Und dies war kein Wurf für einen Spieler. Er kannte sich selbst, seine Persönlichkeit, seinen Charme und seine Künste gut genug, um zuversichtlich zu sein, was das Ergebnis anging. Er hatte lediglich eine Möglichkeit gegen eine Gewissheit eingetauscht; die Gewissheit, dass er das Glück, dessentwegen er ursprünglich nach Übersee gekommen war, nun fast schon in der Hand hatte.
Dies war seine feste Überzeugung, als er sich in seinem Stuhl vorbeugte und näher zu ihr kam, um sie mit den peruanischen Süßigkeiten in der silbernen Schachtel zu verführen, die er ihr anbot und die er ihr mit der rührenden Vorfreude auf jeden ihrer möglichen Wünsche besorgt hatte, was sie inzwischen an ihm bemerkt haben musste.
Sie rührte sich auf dem Kissen aus violettem Samt mit seinen goldenen Troddeln, das seine fürsorglichen Hände aus der Kabine geholt und hinter sie gelegt hatten. Sie schüttelte den Kopf, um abzulehnen, lächelte ihn aber mit einer Sanftheit an, die fast zärtlich war.
„Sie achten so sehr auf mein Wohlergehen, Major Sands, dass es fast unhöflich ist, etwas abzulehnen, das Sie mir bringen. Aber ...“ Sie wedelte mit ihrem grün-scharlachroten Fächer.
Er täuschte schlechte Laune vor, was vielleicht nicht ganz gespielt war. „Wenn ich für Euch bis an mein Lebensende Major Sands sein soll, dann werde ich Euch nichts mehr bringen. Ich heiße Bartholomew, Ma'am. Bartholomew.“
„Ein schöner Name“, sagte sie. „Aber zu schön und zu lang für den alltäglichen Gebrauch bei dieser Hitze.“
Seine Antwort darauf war fast eifrig. Ungeachtet ihres ermahnenden Tons entschied er sich dafür, sie wörtlich zu nehmen: „Manchmal werde ich von meinen Freunden Bart genannt. So hat mich meine Mutter immer genannt. Ich befreie dich davon, Priscilla.“
„Ich fühle mich geehrt, Bart“, lachte sie und freute ihn damit sehr.
Vier Couplets erklangen vom Schiffsglockenturm. Es brachte sie dazu, sich aufzusetzen, als wäre es ein Signal gewesen.
„Acht Glocken, und wir liegen immer noch vor Anker. Kapitän Bransome sagte, wir sollten schon längst unterwegs sein.“ Sie stand auf. „Was hält uns hier auf, frage ich mich.“
Als ob sie eine Antwort auf ihre Frage suchte, trat sie aus dem Schatten der Markise. Major Sands, der sich mit ihr erhoben hatte, trat neben sie an die Reling.
Das Beiboot mit dem verwirrten Juden war bereits auf dem Weg zurück zum Ufer. Die Periaguas entfernten sich, ihre Insassen waren immer noch lautstark und stritten sich mit einigen Matrosen, die sich auf die Schanz lehnten. Aber das Beiboot, das Kapitän Bransome beobachtet hatte, kam am Fuße der Einstiegsleiter längsseits. Einer der nackten braunen Kariben, aus denen die Besatzung bestand, kniete sich in den Bug, um sich an einem Tau festzuhalten und sie an der Bordwand zu stabilisieren.
Von ihren Heckleinen erhob sich die große, schlanke, kräftige Gestalt eines Mannes in einem Anzug aus hellblauem Taft mit silberner Spitze. Um die breite Krempe seines schwarzen Hutes wickelte sich eine hellblaue Straußenfeder, und die Hand, die er ausstreckte, um sich auf der Leiter abzustützen, war mit Handschuhen bedeckt und tauchte aus einer Wolke aus feiner Spitze auf.
„Verdammt noch mal!“, sagte Major Sands erstaunt über diese Mode aus Martinique. „Und wer mag das sein?“
Sein Erstaunen wuchs, als er die geübte Geschicklichkeit sah, mit der dieser modische Kerl schnell die unhandliche Leiter hinaufkletterte. Ihm folgte, etwas unbeholfener, ein Mischling in einem Baumwollhemd und einer Reithose aus haarigem, ungegerbtem Leder, der einen Umhang, einen Degen und eine Schlinge aus violettem Leder trug, die mit Goldbarren gefüllt war und an deren Enden die gravierten silbernen Kolben eines Pistolenpaares hervorstanden.
Der Neuankömmling erreichte das Deck. Einen Moment lang blieb er stehen, groß und gebieterisch am oberen Ende der Leiter; dann stieg er in die Plicht hinab und nahm seinen Hut ab, als höfliche Antwort auf die ähnliche Begrüßung des Kapitäns. Unter einer glänzenden schwarzen Perücke, die sorgfältig gekräuselt war, kam ein dunkler Teint zum Vorschein.
Der Kapitän bellte einen Befehl. Zwei der Matrosen eilten zur Hauptluke, um eine Segeltuchschlinge zu holen, und begannen, sie von den Bollwerken aus herunterzulassen.
So sahen die Beobachter auf dem Poop zuerst eine Truhe und dann eine weitere, die an Deck gezogen wurde.
„Er scheint zu bleiben“, sagte Major Sands.
„Er hat die Ausstrahlung einer wichtigen Person“, wagte Fräulein Priscilla zu sagen.
Der Major war seltsamerweise versucht, ihr zu widersprechen. „Du urteilst nach seiner affektierten Aufmachung. Aber Äußerlichkeiten, meine Liebe, können trügerisch sein. Sieh dir seinen Diener an, wenn dieser Schlingel sein Diener ist. Er hat die Ausstrahlung eines Freibeuters.“
„Wir sind in Indien, Bart“, erinnerte sie ihn.
„Ja, das stimmt. Und irgendwie scheint dieser Galant fehl am Platz zu sein. Ich frage mich, wer er ist.“
Ein schriller Pfiff der Schiffspfeife rief die Matrosen in ihre Quartiere, und das Schiff wurde plötzlich von geschäftig umherlaufenden Männern belebt.
Als das Knarren der Ankerwinde und das Klappern der Kette das Lichten des Ankers ankündigten und die Matrosen nach oben eilten, um die Segel zu setzen, wurde dem Major klar, dass sich ihre Abfahrt verzögert hatte, weil sie auf diesen Reisenden gewartet hatten, der an Bord kommen wollte. Zum zweiten Mal fragte er sich vage angesichts der Brise aus Nordosten: „Wer zum Teufel mag das wohl sein?“
Sein Tonfall war alles andere als gut gelaunt. Er war leicht von dem Groll getrübt, dass man in ihre Privatsphäre als einzige Passagiere an Bord des Zentaurs eindrang. Dieser Groll wäre weniger unvernünftig gewesen, wenn er gewusst hätte, dass dieser Reisende von Fortuna geschickt wurde, um Major Sands zu lehren, ihre Gunst nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
KAPITEL 2. MONSIEUR DE BERNIS
Zu sagen, dass ihre Neugierde auf den Neuankömmling im Laufe der nächsten Stunde gestillt wurde, als sie ihn beim Abendessen trafen, wäre nicht nur eine Übertreibung, sondern stünde in völligem Widerspruch zur Realität. Dieses Treffen, das in der großen Kabine stattfand, in der das Abendessen zur Seite stand, weckte lediglich eine noch tiefere Neugier.
Kapitän Bransome stellte ihn seinen beiden Mitreisenden als Monsieur Charles de Bernis vor, woraus hervorging, dass er Franzose war. Aber die Tatsache war kaum zu vermuten, wenn man sein fließendes Englisch hörte, das nur die geringste Spur eines gallischen Akzents aufwies. Wenn sich seine Nationalität überhaupt verriet, dann nur in einer gewissen Freiheit der Gestik und, für die auffälligen blauen englischen Augen von Major Sands, in einer leicht übertriebenen Höflichkeit. Major Sands, der darauf vorbereitet war, ihn nicht zu mögen, war froh, in der Persönlichkeit des Mannes keinen Grund dafür zu finden. Wenn es nichts anderes gegen den Mann gegeben hätte, wäre seine ausländische Herkunft mehr als genug gewesen; denn Major Sands verachtete all jene, die nicht das Glück hatten, als Brite geboren zu sein.
Monsieur de Bernis war sehr groß, und obwohl er schlank war, vermittelte er dennoch einen Eindruck von Härte. Das schlanke Bein in seinem faltenlosen hellblauen Strumpf sah aus, als wäre es aus Peitschenschnur. Er war sehr dunkelhäutig und hatte, wie Major Sands sofort bemerkte, eine merkwürdige Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Majestät König Charles II. in seinen jüngeren Tagen; denn der Franzose konnte kaum älter als fünfunddreißig sein. Er hatte dasselbe hagere Gesicht mit den hervorstehenden Wangenknochen, dasselbe hervorstehende Kinn und dieselbe Nase, denselben winzigen schwarzen Schnurrbart über vollen Lippen, um die derselbe leicht sardonische Ausdruck schwebte, der das Antlitz des Stuart-Monarchen geprägt hatte. Unter tiefschwarzen Brauen lagen seine dunklen, großen Augen, die normalerweise sanft und samtig waren, aber, wie er bald zeigte, durch einen flammenden, direkten Blick äußerst beunruhigend sein konnten.
Wenn seine Mitreisenden sich für ihn interessierten, konnte man kaum sagen, dass er das Kompliment zunächst erwiderte. Die Art und Weise, wie höflich er ihnen gegenüber war, schien an sich schon eine Barriere zu errichten, hinter der er sich abschottete. Er wirkte in Gedanken versunken, und die Sorge, die sich in seinem Gespräch während des Essens zeigte, galt seinem Reiseziel.
Damit schien er ein früheres Gespräch zwischen sich und dem Kapitän des Zentaurs wieder aufzunehmen.
„Selbst wenn Sie nicht in Mariegalante anlegen, Kapitän, kann ich mir nicht vorstellen, dass es Sie aufhalten oder stören könnte, mich in einem Boot an Land zu schicken.“
"Das liegt daran, dass Ihr meine Gründe nicht versteht", sagte Bransome. "Ich habe nicht vor, mich Guadeloupe auf zehn Meilen zu nähern. Wenn mir Ärger in die Quere kommt, kann ich damit umgehen. Aber ich suche ihn nicht. Dies ist meine letzte Reise, und ich möchte, dass sie sicher und friedlich verläuft. Ich habe eine Frau und vier Kinder zu Hause in Devon, und es ist an der Zeit, dass ich sie wiedersehe. Deshalb mache ich einen großen Bogen um ein Piratennest wie Guadeloupe. Es ist schlimm genug, dich nach Sainte Croix zu bringen.
„Oh, das ...“ Der Franzose lächelte und wedelte mit einer langen braunen Hand, wobei er den feinen Mechelner vom Handgelenk zurückwarf.
Doch Bransome runzelte die Stirn bei dieser abwertenden Geste. "Du kannst lächeln, Mossoo. Du kannst lächeln. Aber ich weiß, was ich weiß. Eure Französische Westindien-Kompanie ist nicht über jeden Verdacht erhaben. Sie wollen nur ein Geschäft machen, und es ist ihnen egal, wie sie es anstellen. Viele Waren werden nach Sainte Croix gebracht, um dort für ein Zehntel ihres Wertes verkauft zu werden. Die Französische Westindien-Kompanie stellt keine Fragen, solange sie zu solchen Bedingungen handeln kann. Und sie muss keine Fragen stellen. Die Wahrheit ist offensichtlich genug. Sie kreischt. Und das ist eine Tatsache. Vielleicht wusstet ihr das nicht.
Der Kapitän, ein Mann in den besten Jahren, breit und kräftig, mit rötlichem Haar und Teint, verlieh seiner Aussage Nachdruck und dem Ärger, den sie in ihm hervorrief, Farbe, indem er eine massive, sommersprossige Hand auf den Tisch schlug, auf der die roten Haare wie Feuer leuchteten.
„Sainte Croix, seit ich mich verpflichtet habe, euch dorthin zu bringen. Und das ist schlimm genug, wie ich schon sagte. Aber kein Guadeloupe für mich.“
Frau Priscilla rührte sich auf ihrem Sitz. Sie beugte sich nach vorne. 'Sprechen Sie von Piraten, Herr Kapitän Bransome?'
„Jawohl!“, sagte Bransome. „Und das ist eine Tatsache.“
Der Major war beunruhigt und mischte sich in die Diskussion ein, um sie zu beruhigen.
„Glaubt mir, das ist keine Tatsache, die man vor einer Dame erwähnen sollte. Und heutzutage ist es ohnehin nur noch für Ängstliche eine Tatsache.“
„Oho!“ Kapitän Bransome blies heftig seine Backen auf.
„Freibeuter“, sagte Major Sands, „gehören der Vergangenheit an.“
Das Gesicht des Kapitäns wurde noch röter. Sein Widerspruch nahm die Form von ausgefeiltem Sarkasmus an. „Es ist sicher, heute in der Karibik zu kreuzen, genauso wie auf jedem der englischen Seen.“
Danach wandte er sich wieder seinem Essen zu, während Major Sands sich an Monsieur de Bernis wandte.
„Ihr begleitet uns also nur bis Sainte Croix?“ Seine Art war freundlicher als bisher, denn seine gute Laune wurde durch die Entdeckung wiederhergestellt, dass dieser Eingriff nur von kurzer Dauer sein würde.
„Nicht weiter“, sagte Monsieur de Bernis.
Die lakonische Antwort regte nicht gerade zum Fragenstellen an. Dennoch ließ Major Sands nicht locker.
„Habt Ihr Interessen in Sainte Croix?“
„Nein, keine Interessen. Nein. Ich suche ein Schiff. Ein Schiff, das mich nach Frankreich bringt.“ Es war typisch für ihn, in kurzen, scharfen Sätzen zu sprechen.
Der Major war verwirrt. „Aber wenn Ihr an Bord eines so schönen Schiffes wie diesem seid, könntet Ihr doch bequem nach Plymouth reisen und dort eine Schaluppe finden, die Euch über den Ärmelkanal bringt.“
„Stimmt“, sagte Monsieur de Bernis. „Stimmt! Daran hatte ich nicht gedacht.“
Der Major spürte plötzlich, dass er vielleicht zu viel gesagt hatte. Zu seiner Bestürzung hörte er, wie Fräulein Priscilla die Idee äußerte, von der er befürchtete, dass er sie dem Franzosen gegenüber geäußert haben könnte.
„Werden Sie jetzt darüber nachdenken, Monsieur?“
Monsieur de Bernis' dunkle Augen leuchteten, als sie auf ihr ruhten; aber sein Lächeln war wehmütig.
„Bei meinem Glauben, Mademoiselle, dazu müsst Ihr einen Mann zwingen.“
Major Sands schnupperte hörbar an dem, was er für einen Ausdruck unbändiger, frecher, gallischer Galanterie hielt. Nach einer kurzen Pause fügte Monsieur de Bernis mit einem vertieften, sehnsüchtigen Lächeln hinzu:
„Aber leider! Ein Freund erwartet mich in Sainte Croix. Ich soll mit ihm nach Frankreich übersetzen.“
Der Major schaltete sich mit einem Hauch von Verwunderung in seiner Stimme ein.
„Ich dachte, Sie wollten in Guadeloupe an Land gehen und dass der Kapitän Sie gezwungen hat, nach Sainte Croix zu fahren.“
Wenn er dachte, Monsieur de Bernis mit diesem Widerspruch aus der Fassung zu bringen, wurde er bald enttäuscht. Der Franzose drehte sich langsam zu ihm um und lächelte immer noch, aber die Wehmut war einem verächtlichen Lächeln gewichen.
„Aber warum die unschuldige Täuschung aufdecken, die mir die Höflichkeit gegenüber einer Dame auferlegt hat? Das ist eher schlau als freundlich, Major Sands.“
Major Sands errötete. Er wand sich unter dem überlegenen Lächeln des Franzosen und machte in seinem Unbehagen einen groben Fehler.
„Wozu Täuschungen, Herr?“
„Und außerdem: Wozu Höflichkeit? Jeder nach seiner Fasson, Herr. Ihr überführt mich einer höflichen Täuschung und entlarvt Euch selbst als von einer rüden Offenheit. Jeder von uns ist auf seine Weise bewundernswert.“
„Das ist etwas, dem ich überhaupt nicht zustimmen kann. Stich mich, wenn du kannst.“
„Dann soll Mademoiselle zwischen uns entscheiden“, forderte der Franzose lächelnd auf.
Aber Fräulein Priscilla schüttelte ihren goldenen Kopf. „Das würde bedeuten, gegen einen von euch zu entscheiden. Eine zu unangenehme Aufgabe.“
„Verzeihen Sie mir also, dass ich es wage, es anzusprechen. Nun, lassen wir die Sache unentschieden.“ Er wandte sich an Kapitän Bransome: „Sie sagten, glaube ich, Kapitän, dass Sie in Dominica anlegen.“ So lenkte er das Gespräch in andere Bahnen.
Der Major fühlte sich unwohl und herabgesetzt. Es wurmte ihn, und später, als er sich mit Fräulein Priscilla wieder auf dem Achterdeck befand, fand es seinen Ausdruck:
„Ich glaube nicht, dass der Franzose erfreut darüber war, herabgesetzt zu werden“, sagte er.
Beim Essen hatte die kaum verhüllte Feindseligkeit des Majors dem Fremden gegenüber ihr Gefühl für Angemessenheit verletzt. In ihren Augen hatte er im Vergleich mit dem höflichen und lockeren Franzosen schlecht abgeschnitten. Seine derzeitige Selbstgefälligkeit weckte erneut ihren Ärger.
„Wurde er bloßgestellt?“, fragte sie. „Ich habe es nicht bemerkt.“
„Du hast nicht ...“ Die prominenten blassen Augen schienen in seinem blassen Gesicht anzuschwellen. Dann lachte er ausgelassen. „Du hast geträumt, Priscilla, ganz sicher. Du kannst nicht dabei gewesen sein. Ich ließ ihn deutlich sehen, dass ich mich von seinen Widersprüchen nicht täuschen ließ. Ich bin nie langsam darin, Betrug zu erkennen. Es ärgerte ihn, so leicht entlarvt zu werden.“
„Er verbarg seinen Ärger sehr glaubwürdig.“
"Oh ja! Als Heuchler gebe ich ihm volle Anerkennung. Aber ich konnte sehen, dass ich ihn berührt hatte. Ich könnte ihn erstechen. Hast du das Ausmaß seiner Verstellung bemerkt? Zuerst war es nur so, dass er nicht daran gedacht hatte, mit dem Zentaur den Ozean zu überqueren. Dann war es so, dass er einen Freund in Sainte Croix erwartete, und ich wusste die ganze Zeit, dass Sainte Croix ihm vom Kapitän aufgezwungen wurde, der sich nicht davon abbringen ließ, ihn in Guadeloupe an Land zu bringen, wie er es wünschte. Ich frage mich, was der Kerl zu verbergen hat, dass er so verzweifelt ungeschickt ist?
„Was auch immer es ist, es geht uns nichts an.“
„Da seid Ihr vielleicht zu vorsichtig. Schließlich bin ich ein Beamter der Krone, und es ist kaum weniger als meine Pflicht, über alles, was in diesen Gewässern geschieht, Bescheid zu wissen.“
„Warum quälst du dich damit? In ein oder zwei Tagen wird er uns wieder verlassen haben.“
„Das stimmt. Und dafür danke ich Gott.“
„Ich sehe wenig Grund zum Danken. Monsieur de Bernis sollte sich auf einer Reise als lebhafter Begleiter erweisen.“
Der Major hob die Augenbrauen. „Du hältst ihn für lebhaft?“
„Hast du das nicht? War da kein Witz in seinen Paraden, als du dich mit ihm angelegt hast?“
„Witz! Herrgott! Ich hielt ihn für den ungeschicktesten Barkeeper, dem ich je begegnet bin.“
Ein schwarzer Hut, der mit einer ausladenden blauen Feder geschmückt war, erschien über dem Durchbruch des Achterdecks. Monsieur de Bernis stieg die Treppe hinauf. Er gesellte sich zu ihnen auf die Heckplattform.
Der Major war geneigt, sein Auftauchen als ungebetene Störung zu betrachten. Aber Fräulein Priscillas Augen strahlten dem höflichen Franzosen ein Willkommen entgegen; und als sie ihn mit einem einladenden Beiseitesprechen zum Kopfende des Tagesbetts bat, um ihm Platz zu machen, damit er sich neben sie setzen konnte, musste Major Sands seinen Ärger so gut er konnte mit kühler Höflichkeit verbergen.
Martinique verschwand nun schemenhaft hinter ihnen, und der Zentaur, deren Segel voll gesetzt waren, segelte mit einer leichten Schlagseite nach Backbord nach Westen.
Monsieur de Bernis lobte die nordöstliche Brise in Worten eines Kenners der Materie. Sie hätten Glück, meinte er. Zu dieser Jahreszeit wehe der vorherrschende Wind aus nördlicher Richtung. Er vertrat die weitere Ansicht, dass sie, wenn der Wind anhielte, noch vor Tagesanbruch morgen in der Nähe von Dominica sein sollten.
Der Major, der Monsieur de Bernis in Bezug auf sein Wissen über karibische Angelegenheiten nicht nachstehen wollte, zeigte sich erstaunt, dass Kapitän Bransome eine Insel anlaufen sollte, die hauptsächlich von Kariben bewohnt war und auf der es in Roseau nur eine unbedeutende französische Siedlung gab. Die schnelle Antwort des Franzosen überraschte ihn.
„Für Fracht auf gewöhnliche Weise stimme ich Euch zu, Major. Roseau wäre keinen Besuch wert; aber für einen Kapitän, der auf eigene Rechnung handelt, kann es sehr profitabel sein. Ihr könnt davon ausgehen, dass dies bei Kapitän Bransome der Fall ist.“
Die Richtigkeit seiner Vermutung zeigte sich am nächsten Tag, als sie vor Roseau auf der Westseite von Dominica vor Anker lagen. Bransome, der in Partnerschaft mit seinen Eigentümern Handel trieb, ging an Land, um Häute zu kaufen, für die er reichlich Platz unter den Luken gelassen hatte. Er wusste von einigen französischen Händlern hier, bei denen er zum halben Preis kaufen konnte, den er in Martinique oder anderswo hätte zahlen müssen; denn die Kariben, die die Tiere schlachteten und häuteten, gaben sich mit unendlich weniger zufrieden als es kostete, Negersklaven zu beschaffen und zu unterhalten, die die Arbeit in den etablierteren Siedlungen erledigten.
Da das Verladen der Häute die Reise um ein oder zwei Tage verzögern würde, schlug Monsieur de Bernis seinen Mitreisenden einen Ausflug ins Innere der Insel vor, ein Vorschlag, der von Fräulein Priscilla so wärmstens befürwortet wurde, dass er sofort angenommen wurde.
Sie besorgten Ponys an Land, und die drei, nur begleitet von Pierre, dem Mischlingsdiener von de Bernis, ritten hinaus, um das Wunder von Dominica, den kochenden See und die fruchtbaren Ebenen, die vom Layou bewässert wurden, zu besichtigen.
Der Major hätte auf einer Eskorte bestanden. Aber Monsieur de Bernis, der wieder einmal sein Wissen über diese Regionen unter Beweis stellte, versicherte ihnen, dass sie die Kariben von Dominica als sanftmütige, freundliche Rasse kennenlernen würden, von der nichts Böses zu erwarten sei.
„Wenn es anders wäre“, schloss er, „würde die gesamte Schiffsbesatzung nicht ausreichen, um uns zu schützen, und ich hätte den Ausflug nie vorgeschlagen.“
Priscilla ritt an diesem Tag zwischen ihren beiden Kavalieren; aber es war der schlagfertige de Bernis, der ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf sich zog, bis Major Sands sich zu fragen begann, ob die bemerkenswerte Ähnlichkeit des Mannes mit seiner verstorbenen Majestät nicht über sein persönliches Aussehen hinausgehen könnte. Monsieur de Bernis machte deutlich, so dachte der Major, dass er mit den gleichen Gaben der spontanen Ritterlichkeit ausgestattet war; und der Major war verärgert, als er Anzeichen dafür wahrnahm, dass er etwas von der Anziehungskraft König Karls auf das andere Geschlecht besaß.
Seine Besorgnis hätte noch viel größer sein können, wenn er nicht das beruhigende Wissen gehabt hätte, dass dieser langbeinige Eindringling mit dem Zigeunergesicht in ein oder zwei Tagen aus ihrem Leben in Sainte Croix verschwinden würde. Was Fräulein Priscilla an dem Mann erkennen konnte, dass sie ihm so viel Aufmerksamkeit schenken sollte, konnte sich der Major nicht vorstellen. Verglichen mit seinem eigenen soliden Wert war der Kerl nicht besser als ein oberflächlicher Schwindler. Es war unvorstellbar, dass Priscilla von seinem billigen Glitzern geblendet sein sollte. Und doch, Frauen, selbst die besten von ihnen, wurden oft, wie er wusste, durch mangelndes Urteilsvermögen in die Irre geführt. Daher war es ein Grund zur Dankbarkeit, dass der Kontakt dieses Abenteurers mit ihrem eigenen Leben so flüchtig sein sollte. Wenn er sich in die Länge ziehen würde, könnte der Schurke auf das große Vermögen aufmerksam werden, das Fräulein Priscilla geerbt hatte, und zweifellos würde er darin einen Anreiz finden, alle Anziehungskünste einzusetzen, die ein solcher Kerl beherrschte.
Major Sands war überzeugt, dass er ein Abenteurer war. Er schmeichelte sich, dass er einen Mann auf einen Blick durchschauen konnte, und sein ganzer Instinkt warnte ihn vor diesem finsteren Schurken. Seine Vermutungen wurden noch am selben Abend in Roseau bestätigt.
Als sie dort am Strand ihre Ponys abgaben, trafen sie auf einen stämmigen, älteren, derb gekleideten Franzosen, der nach Rum und Tabak stank. Es handelte sich um einen der Händler, von denen Kapitän Bransome seine Häute kaufte. Der Mann blieb wie vom Donner gerührt vor ihnen stehen und starrte Monsieur de Bernis lange mit großen Augen an. Dann breitete sich ein seltsames Grinsen auf seinem wettergegerbten Gesicht aus, er zog einen zerlumpten Hut von einem grauen, ungepflegten Kopf und erwiderte die Begrüßung mit einer Höflichkeit, die durch Übertreibung ironisch wirkte.
Major Sands konnte kein Französisch. Aber der unverschämt vertraute Tonfall der Begrüßung war nicht zu verkennen.
„Bist du es wirklich, de Bernis? Verdammt! Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen.“
De Bernis erledigte die Aufgabe, ihm zu antworten, und seine Antwort hielt dem lockeren, halb spöttischen Ton des anderen stand. „Und du, mein Witzbold? Ah, machst du jetzt den Hauthändler?“
Major Sands ging mit Fräulein Priscilla weiter und ließ de Bernis mit seinem seltsamen Bekannten zurück. Der Major war seltsam amüsiert.
"Eine seltsame Begegnung für unseren feinen Herrn. Höchst seltsam. Wie die Qualität seiner Freunde. Mehr denn je frage ich mich, wer zum Teufel er sein mag.
Aber Fräulein Priscilla war ungeduldig, dass er sich so wunderte und amüsierte. Sie fand ihn kleinlich. Sie kannte die Inseln anscheinend besser als er. Sie wusste, dass das Leben in der Kolonie einem Mann die seltsamsten Assoziationen aufzwingen konnte und dass nur Unüberlegte oder Unwissende daraus Schlüsse ziehen würden.
Sie sagte etwas in der Art.
„Das Leben ist voller Zufälle, Ma'am! Verteidigen Sie ihn?“
„Ich habe nicht wahrgenommen, dass er angegriffen wurde, es sei denn, du meinst, ihn anzugreifen, Bart. Schließlich hat Monsieur de Bernis nie behauptet, dass er aus Versailles zu uns kommt.“
„Das wird daran liegen, dass er bezweifelt, dass es überzeugend wäre. Pah, Kind! Der Kerl ist ein Abenteurer.“
Ihre Zustimmung schockierte und bestürzte ihn mehr, als es ein Widerspruch vermocht hätte.
„Das hatte ich mir schon gedacht“, lächelte sie ablenkend. „Ich liebe Abenteurer und das Abenteuerliche.“
Nur die Tatsache, dass de Bernis auf sie zuschritt, um sie einzuholen, bewahrte sie vor einer Moralpredigt. Aber ihre Antwort, die der Major als leichtsinnig bezeichnete, wurmte ihn; und vielleicht lag es daran, dass er nach dem Abendessen an diesem Abend, als sie alle in der großen Hütte versammelt waren, auf die Angelegenheit dieses Treffens anspielte.
„Das war ein seltsamer Zufall, Monsieur de Bernis, dass Sie hier auf Dominica einem Bekannten von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden.“
„Ein seltsamer Zufall, in der Tat“, stimmte der Franzose bereitwillig zu. „Das war ein alter Waffenbruder.“
Der Major hob die Augenbrauen. „Ihr wart Soldat, Herr?“
In den Augen des Franzosen leuchtete es gelegentlich auf, während er seinen Gesprächspartner einen Augenblick lang betrachtete. Er schien sich amüsiert zu haben.
"Oh, so in der Art", sagte er schließlich. Dann wandte er sich Bransome zu, der nun in Baumwollhemd und Kattunhosen saß und die europäische Kleidung abgelegt hatte. "Es war Lafarche, Kapitän. Er hat mir erzählt, dass er mit euch Handel treibt." Und er fuhr fort: "Wir waren zusammen auf Santa Catalina unter dem Sieur Simon und gehörten zu den wenigen, die den spanischen Überfall auf Perez de Guzman überlebt haben. Lafarche, ich und zwei andere, die sich in einem Maisfeld versteckt hatten, als alles verloren war, konnten in dieser Nacht in einem offenen Boot entkommen und schafften es, den Main zu erreichen. Ich wurde verwundet und mein linker Arm wurde während des Beschusses von einem Stück Langrel gebrochen. Aber nicht alle Übel kommen, um uns zu verletzen, wie die Italiener sagen. Es hat mir das Leben gerettet. Denn es war meine Nutzlosigkeit, die mich dazu trieb, mich zu verstecken, wo sich mir später die anderen drei anschlossen. Das waren die ersten Wunden, die ich erlitt. Ich war damals noch keine zwanzig. Nur meine Jugend und meine Kraft retteten meinen Arm und mein Leben in den folgenden Prüfungen und Nöten. Soweit ich weiß, waren wir die einzigen vier, die von den hundertzwanzig Männern, die mit Simon auf Santa Catalina waren, lebend entkommen sind. Als Perez die Insel einnahm, rächte er die Verteidigung der Insel auf gnadenlose Weise, indem er jeden Mann, der am Leben geblieben war, mit dem Schwert tötete. Ein abscheuliches Massaker. Eine mutwillige Grausamkeit.
Er wurde nachdenklich und hätte die Angelegenheit vielleicht auf sich beruhen lassen, wenn Fräulein Priscilla nicht das Schweigen gebrochen und ihn nach weiteren Einzelheiten gefragt hätte.
Er gab nach und erzählte ihr von der Kolonie, die Mansvelt auf Santa Catalina gegründet hatte, und wie sie sich daran gemacht hatten, das Land zu kultivieren, indem sie Mais und Kochbananen, Süßkartoffeln, Maniok und Tabak anpflanzten. Während sie ihm mit geöffneten Lippen und weichen Augen zuhörte, zeichnete er ein Bild von dem blühenden Zustand, den die Plantagen erreicht hatten, als Don Juan Perez de Guzman mit vier Schiffen und einer überwältigenden Streitmacht aus Panama herüberkam, um sein Unheil zu verbreiten. Er erzählte von Simons stolzer Antwort, als er zur Kapitulation aufgefordert wurde: Er halte die Siedlung für die englische Krone und bevor er sie aufgebe, würden er und seine Leute lieber ihr Leben lassen. Er rührte sie zu Tränen, als er von dem tapferen Widerstand dieser kleinen Garnison gegen die überwältigende spanische Übermacht berichtete. Und er rührte sie zu Mitgefühl, als er von dem anschließenden Massaker und der mutwilligen Zerstörung der mühsam bewirtschafteten Plantagen erzählte.
Als er am Ende angelangt war, erschien ein Lächeln auf seinem hageren, zigeunerfarbenen Gesicht, das zugleich grimmig und wehmütig war. Die tiefen Falten darin, die weitaus tiefer waren, als es seine Jahre rechtfertigten, wurden noch ausgeprägter.
„Die Spanier haben in Porto Bello, in Panama und anderswo dafür bezahlt. Mein Gott, wie sie dafür bezahlt haben! Aber all das seitdem vergossene spanische Blut konnte die brutale, feige Zerstörung der Engländer und Franzosen nicht rächen, die in Santa Catalina verbündet waren.“
Er hatte sie mit diesem Einblick in seine Vergangenheit und in die Geschichte der westindischen Siedlungen beeindruckt. Selbst der Major, so sehr er sich auch dagegen wehren konnte, fand sich im Bann der Persönlichkeit dieses seltsamen Kerls gefangen.
Später, als das Abendessen beendet und der Tisch abgeräumt war, holte Monsieur de Bernis eine Gitarre aus seinen Kabinensachen. Er setzte sich auf die Heckkiste, mit dem Rücken zum großen Fenster, das zur purpurnen tropischen Nacht hin offen stand, und sang einige kleine Lieder aus seiner Heimat, der Provence, und ein oder zwei seltsam bewegende spanische Weisen in Moll, wie sie in Málaga frei komponiert wurden.
Mit seiner weichen Baritonstimme vorgetragen, hatten sie die Kraft, Fräulein Priscilla mit brennenden Augen und einem Schmerz im Herzen zurückzulassen; und selbst Major Sands war bewegt genug, um zuzugeben, dass Monsieur de Bernis eine erstaunlich schöne Gesangsstimme hatte. Aber er achtete darauf, das Eingeständnis mit Gönnerschaft zu machen, als wollte er die Kluft zwischen sich und seinem Schützling auf der einen Seite und diesem Fremden, dem er zufällig begegnet war, auf der anderen Seite markieren. Er hielt dies für eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, denn er konnte nicht blind für den Eindruck sein, den der Mann auf Fräulein Priscillas Unerfahrenheit machte. Zweifellos war dies auch der Grund dafür, dass sich der Major am nächsten Tag einen Spott über Monsieur de Bernis erlaubte. Dies hätte beinahe zu einem Bruch zwischen ihm und der Dame in seiner Obhut geführt.
Sie lehnten sich zu dieser Zeit auf die geschnitzte Reling des Achterdecks, um das Beladen zu beobachten, das unter den wachsamen Augen von Kapitän Bransome selbst durchgeführt wurde, der sich nicht damit begnügte, die Angelegenheit dem Quartiermeister und dem Bootsmann zu überlassen.
Die Lukensülle war von der Hauptluke entfernt, und mit Schlingen von der Rah wurden die Ballen mit Häuten von den Flößen, die sie längsseits gebracht hatten, an Bord gehievt. In der Taille hievten und schwitzten ein Dutzend behaarter Seeleute, die oberhalb der Gürtellinie nackt waren, in der gnadenlosen Hitze, während unten in der stickigen, stinkenden Dunkelheit des Laderaums andere an der Verstauung arbeiteten. Der Kapitän, in Baumwollhemd und -unterhose, das blaue Kopftuch um seinen kahlrasierten roten Kopf geschlungen, sein rötliches, sommersprossiges Gesicht schweißüberströmt, lief hin und her, gab Anweisungen zum Hissen und Verstauen und legte manchmal, vor lauter überschäumender Energie, selbst kräftig Hand an den Seilen an.
In dieses schwüle Treiben trat Monsieur de Bernis von der Gangway, die nach achtern führte. Als Zugeständnis an die Hitze trug er keinen Mantel. In dem prall gefüllten weißen Hemd aus Batist mit seinen zahlreichen Rüschen, das ihn über einer weinroten Kniehose kleidete, sah er trotz seiner schweren schwarzen Perücke und seines breiten schwarzen Hutes kühl und gelassen aus.
Er begrüßte Bransome mit vertrauter Leichtigkeit, und nicht nur Bransome, sondern auch Sproat, den Bootsmann. Von den Bollwerken aus betrachtete er die Flöße unten mit ihren schweigenden Besatzungen aus nackten Kariben und wies die französischen Aufseher lautstark an. Er rief ihnen etwas zu – Major Sands nahm an, dass es sich um eine französische Zote handelte – und brachte sie zum Lachen, worauf sie ihm mit heiserer, fröhlicher Freiheit antworteten. Er sagte etwas zu den Matrosen über die Luke und hatte sie sofort alle zum Lachen gebracht. Als dann der Händler Lafarche an Deck kletterte, sich abwischte und Rum verlangte, unterstützte de Bernis die Forderung und schob Bransome vor sich zur hinteren Gangway, während er selbst Lafarche mitbrachte und ihm achtlos einen Arm um die Schulter des schurkischen alten Händlers legte.
„Ein ungehobelter Kerl, ohne Würde oder Sinn für Disziplin“, war der empörte Kommentar des Majors.
Fräulein Priscilla sah ihn von der Seite an, und ein leichtes Stirnrunzeln verzog ihre Brauen an der Wurzel ihrer zierlich gemeißelten Nase.
„So beurteile ich ihn nicht.“
„Nein?“ Er war überrascht. Er streckte seine dicken Beine aus, nahm die Ellbogen von der Brüstung und stand auf, eine schwere Gestalt, die durch einen Hauch von Selbstgefälligkeit noch schwerfälliger wirkte.
„Doch wenn man ihn dort sieht, wie er sich mit diesem Gesindel so wohlfühlt, wie sollte man ihn sonst einschätzen? Ich würde mich in einer ähnlichen Situation nicht wohlfühlen. Ich würde mich ohrfeigen.“
„So schnell schaust du garicht.“
„Ich danke dir. Nein.“
„Weil ein Mann sich seiner selbst sehr sicher sein muss, bevor er sich so weit herablassen kann.“ Es war ein wenig grausam. Aber sein spöttischer Tonfall der Überlegenheit hatte sie seltsamerweise verärgert.
Das Erstaunen ließ ihn erstarren. „Ich ... ich glaube nicht, dass ich verstehe. Stich mich, wenn ich es tue.“
Sie war ebenso gnadenlos in ihrer Erklärung, unbeeindruckt von seinem frostigen Ton.
„Ich sehe Monsieur de Bernis als einen Mann, der aufgrund seiner Herkunft und Erfahrung über dem kleinlichen Bedürfnis steht, auf seiner Würde zu beharren.“
Der Major sammelte seine Gedanken, die durch wütende Verwunderung zerstreut worden waren. Nach einem Moment des Keuchens lachte er. Spott, dachte er, war das sicherste Mittel, um solche Ketzereien zu widerlegen.
„Herr! Das ist eine Anmaßung! Und Geburt, sagst du. Fächelt mir zu, ihr Winde! Welche Zeichen der Geburt seht ihr in diesem geschmacklosen Kerl?“
„Sein Name, seine Haltung, seine ...“
Aber der Major ließ sie nicht weiterreden. Wieder lachte er. „Sein Name? Du meinst das “de„? Mein Gott, das tragen viele, die schon lange keinen Anspruch mehr auf Vornehmheit haben, und viele, die nie ein Recht darauf hatten. Wissen wir überhaupt, dass es sein Name ist? Was sein Auftreten angeht, denk mal darüber nach. Du hast ihn dort unten gesehen, wie er sich mit den Arbeitern und dem Rest eins gemacht hat. Würde sich ein Gentleman so verhalten?“
„Wir kommen zum Anfang zurück“, sagte sie kühl. „Ich habe dir einen Grund genannt, warum jemand wie er es ohne Verlust tun kann. Du antwortest mir nicht.“
Sie war ihm ein Ärgernis. Aber das sagte er ihr nicht. Er zügelte seine aufsteigende Wut. Eine so gut ausgestattete Dame muss von einem umsichtigen Mann, der sie zur Frau nehmen will, mit Humor genommen werden. Und Major Sands war ein sehr umsichtiger Mann.
„Aber, liebe Priscilla, es liegt daran, dass du keine Antwort bekommen wirst. Du bist ein wenig stur, Kind.“ Er lächelte, um sie zu beruhigen. „Du solltest meinem reiferen Urteilsvermögen über Männer vertrauen. Das solltest du, stich mich.“ Und dann änderte er seinen Ton. „Aber warum den Atem an einen Mann verschwenden, der morgen oder übermorgen gegangen sein wird und den wir nie wieder sehen werden?“