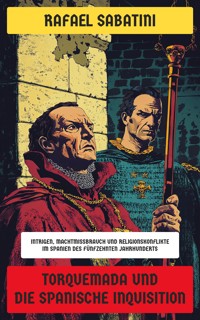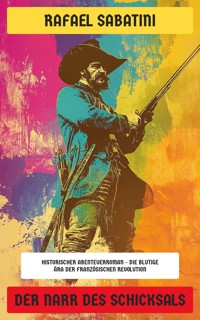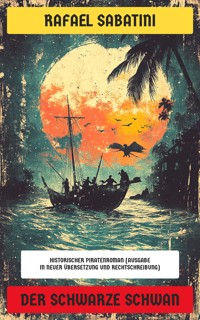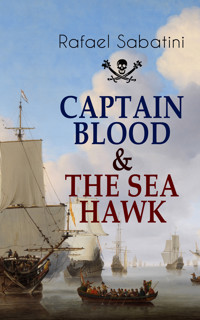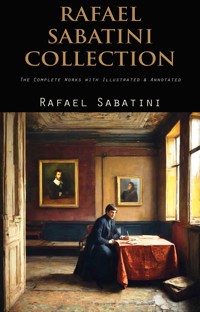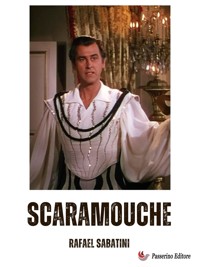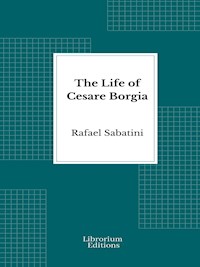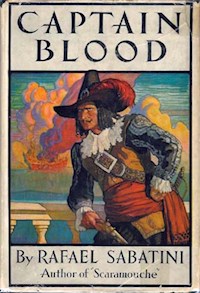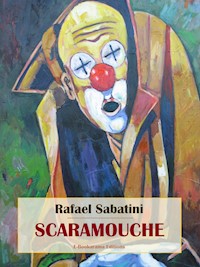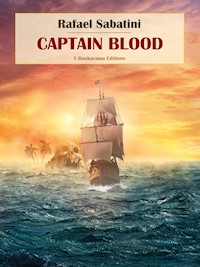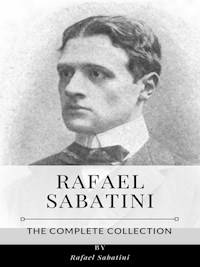2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rafael Sabatinis "Kolumbus" ist eine fesselnde biographische Romanbiografie, die das Leben und die Entdeckungsreise des legendären Genuesen Christoph Kolumbus in den Mittelpunkt stellt. Sabatini, bekannt für seinen prächtigen und zugleich zugänglichen Schreibstil, kombiniert historische Genauigkeit mit einer packenden Erzählweise. Der Roman vermittelt nicht nur die Abenteuer und Herausforderungen, die Kolumbus während seiner Reisen überwinden musste, sondern beleuchtet auch die politischen und gesellschaftlichen Strukturen der damaligen Zeit, die seine Suche nach den Reichtümern Indiens komplizierten. Die Mischung aus sofistizierten Charakteren, dramatischen Wendungen und lebendigen Beschreibungen der Seefahrt zieht den Leser unweigerlich in die Welt des 15. Jahrhunderts hinein. Rafael Sabatini, ein gebürtiger italienischer Schriftsteller, lebte im frühen 20. Jahrhundert und war bekannt für seine umfangreichen und leidenschaftlichen Recherchen. Seine Herkunft und sein tiefes Interesse an Geschichte und Abenteuerliteratur trugen maßgeblich dazu bei, dass er Kolumbus' fesselnde Erzählung niederschrieb. Sabatini verstand es, die Ambivalenz des menschlichen Geistes und die Komplexität des historischen Kontextes in Worte zu fassen, während er gleichzeitig die heroischen und tragischen Elemente des Lebens seines Protagonisten beleuchtet. "Kolumbus" ist eine unverzichtbare Lektüre für Historiker, Literaturbegeisterte und Abenteuerliebhaber gleichermaßen. Sabatini lädt den Leser ein, die Höhen und Tiefen eines Mannes zu erleben, dessen Entdeckungen die Welt für immer veränderten. Ein Buch, das sowohl Spannung als auch tiefere Einsichten in die menschliche Natur bietet, ist ideal für alle, die sich für die großen Erzählungen der Geschichte interessieren. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kolumbus
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL IDER WANDERER
Ein Mann und ein Junge stiegen den Hang von der Mündung des Tinto auf einem sandigen Pfad hinauf, der sich durch ein weitläufiges Kiefernwäldchen schlängelte. Es war der Abend eines Wintertages, etwa zu der Zeit, als die spanischen Herrscher sich auf die Eroberung Granadas vorbereiteten, was darauf hindeutet, dass diese Ereignisse im letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts stattfanden.
Von der langen Dünenreihe unter ihnen, den Arenas Gordas, die sich kilometerweit in Richtung Cadiz erstreckten, wurde der Sand von einem bitteren Wind, der aus Südwesten blies, aufgewirbelt und herumgewirbelt wie Gischt. Dahinter lag der sturmgepeitschte Atlantik unter einem grauen Himmel.
Der Mann war weit überdurchschnittlich groß, breitschultrig und langgliedrig, mit athletischen Zügen. Unter einem schlichten runden Hut hing sein rotes, dichtes und glänzendes Haar bis in den Nacken. Graue Augen leuchteten klar in einem wettergegerbten Gesicht, dessen aristokratische Form und der Stempel des Stolzes gelegentlich mit der Schäbigkeit seiner Kleidung in Konflikt gerieten. Ein Umhang aus selbstgesponnenem Stoff, der einst schwarz gewesen war, aber jetzt zu einem traurigen Grünton verblasst war, bedeckte ihn bis zu den Knien und wurde um seine Mitte von einem schlichten Ledergürtel gehalten. An diesem hing ein Dolch an seiner rechten Hüfte und eine Ledertasche an seinem linken Oberschenkel. Seine Strümpfe waren aus grober schwarzer Wolle; er war mit groben Schuhen bekleidet, und er trug seine spärliche Habe in einem Mantel gebündelt und mit einem Stab aus Quittenholz über der Schulter. Er war kaum älter als Mitte dreißig.
Der Junge, ein kräftiges Kind von sieben oder acht Jahren, klammerte sich an seine rechte Hand und blickte auf, um zu fragen: „Ist es noch weit?“
Er sprach Portugiesisch und wurde von seinem Vater in derselben Sprache mit einer halb bitteren, halb launischen Bemerkung beantwortet.
„Nun, Gott steh mir bei, Kind, das ist eine Frage, die ich mir seit zehn Jahren stelle und auf die ich noch keine Antwort gefunden habe.“ Dann wechselte er abrupt zum Alltäglichen und fügte hinzu: „Nein, nein. Sieh mal. Wir sind fast da.“
Eine Wegbiegung hatte den Blick auf ein langes, niedriges Gebäude freigegeben, das unregelmäßig viereckig war und sich in starkem Weiß von der schwarzen Wand aus Kiefern abhob, die es von Osten abschirmte. Aus seiner Mitte ragte wie ein verbranntes rotes Pilz das runde Ziegeldach einer Kapelle empor.
„Denn heute Nacht sollte das das Ende unserer Reise sein. Wenn ich Glück habe, Diego, könnte es auch ein Anfang sein.“ Er nahm seinen launischen Ton wieder auf, als würde er laut denken und nicht mit jemandem sprechen. „Der Prior, so wurde mir gesagt, ist ein Mann des Wissens, der das Ohr einer Königin hat, da er einst ihr Beichtvater war. Einer Frau die Beichte abzunehmen bedeutet gewöhnlich, sie danach in einem gewissen Maß zu unterwerfen. Eines der kleineren Mysterien unseres geheimnisvollen Lebens. Aber wir gehen behutsam vor und bitten um nichts. In dieser Welt, mein Kind, bedeutet bitten, abgewiesen und gemieden zu werden. Diese Lektion wirst du später lernen. Um zu besitzen, was dir fehlt, studiere, damit niemand ahnt, dass du danach suchst. Zeige ihnen lieber die Vorteile für sie selbst, wenn sie dich davon überzeugen, es anzunehmen. Sie werden dann begierig sein, es dir zu geben. Es ist zu subtil, Diego, für deinen unschuldigen Verstand. Tatsächlich entging es selbst mir lange Zeit, und ich bin alles andere als unschuldig. Wir werden es jetzt an diesem guten Franziskaner testen.“
Zu den obiter dicta des guten Franziskaners, von dem er sprach, Frey Juan Perez, Prior des Klosters La Rabida, gehört, dass sich das Temperament der Seele eines Menschen gewöhnlich in seiner Stimme zeigt. Es ist möglich, dass Frey Juans Gehör feiner gestimmt war als das gewöhnliche Ohr. Es ist möglich, dass seine große Erfahrung als Beichtvater – in dieser Funktion hörte er gewöhnlich, ohne zu sehen, so dass sich sein Bewusstsein auf sein Gehör konzentrierte – ihn dazu gebracht hatte, eine eindeutige Affinität zwischen den spirituellen Qualitäten und dem Ton und der Tonhöhe der Stimme eines Büßers zu entdecken, dessen Antlitz für ihn durch den Bildschirm des Beichtstuhls unsichtbar war.
Wie dem auch sei, sicher ist, dass unser Wanderer ohne diese feste Überzeugung von Frey Juan seine Ziele nicht so leicht erreicht hätte.
Der Prior ging im Hof umher, etwa zur Stunde der Komplet, also bei Sonnenuntergang. Der Borgia-Papst, dessen besondere Verehrung der Jungfrau Maria den Angelus hervorbrachte, hatte den Petersdom noch nicht bestiegen. Während Frey Juan mit dem Brevier in der Hand auf und ab ging und mit beweglichen Lippen das tägliche Amt las, wie es kanonisch vorgeschrieben ist, wurde seine Aufmerksamkeit durch eine Stimme gestört, die sich an den Laienbruder wandte, der das Tor bewachte.
„Von deiner Nächstenliebe, mein Bruder, ein wenig Brot und eine Tasse Wasser für dieses erschöpfte Kind.“
Die Worte an sich, die an einem Klostertor alltäglich genug waren, hätten die Aufmerksamkeit des Priors nicht erregen müssen; aber die Stimme und mehr noch der Kontrast zwischen dem bewussten Stolz, der durch ihre verhüllende Heiserkeit klang, und der Demut der Bitte, die sie aussprach, hätten die Aufmerksamkeit eines noch weniger empfänglichen Ohrs als das von Frey Juan erregen können. Sein Akzent war definitiv fremd, und die Würde seiner Intonation wurde vielleicht durch die Präzision verstärkt, mit der ein kultivierter Mann sich in einer anderen Sprache als seiner eigenen ausdrücken muss.
Frey Juan, den wir nicht von einer sehr menschlichen Neugierde freisprechen dürfen, insbesondere in Angelegenheiten, die eine Ablenkung von der sanften Monotonie des Lebens in La Rabida versprachen, schloss sein Brevier mit dem Zeigefinger und trat um eine Ecke des Hofes, um den Sprecher zu sehen.
Auf den ersten Blick erkannte er, wie vollkommen die Stimme zu dem Mann passte, den er vor sich sah. Er entdeckte spirituelle und körperliche Kraft in seiner wohlgeformten Größe und aufrechten Haltung ebenso wie in seinem rasierten Gesicht mit dem kräftigen Kiefer und der gebogenen Nase. Aber es waren vor allem seine Augen, die den Prior in ihren Bann zogen: volle Augen von klarem Grau, leuchtend wie die eines Visionärs oder Mystikers, Augen, deren steten Blick nur wenige Männer leicht ertragen konnten. Er hatte sein Bündel auf der Steinbank am Tor abgesetzt. Aber weder das noch die übrigen schäbigen Details des Fremden konnten in Frey Juans scharfsinniger Betrachtung die dem Mann innewohnende Vornehmheit verschleiern. Neben ihm stand das Kind, in dessen Namen er diese karge Gastfreundschaft suchte, und blickte mit großen, sehnsüchtigen Augen zu dem sich nähernden Prior auf.
Frey Juan näherte sich mit klappernden losen Sandalen, ein stämmiger Mann in einem grauen Gewand. Sein Gesicht war lang und blass, mit viel losem Fleisch, aber es strahlte Freundlichkeit aus, durch den Humor in den Augen und um den schwerlippigen Mund. Er begrüßte den Fremden mit einem freundlichen Lächeln und in formellem Latein, um vielleicht seine Gelehrsamkeit oder vielleicht seinen Glauben zu prüfen, denn diese adlernasige Nase über den vollen Lippen muss nicht christlich sein.
„Pax Domini sit tecum.“
Worauf der Wanderer förmlich antwortete, mit einer ernsten Neigung seines stolzen Hauptes: „Et cum spiritu tuo.“
„Ihr seid ein Reisender“, sagte der Prior unnötigerweise, während der Laienbruder sich durch Beiseitesprechen zurückhielt.
„Ein Reisender. Gerade erst aus Lissabon hier gelandet.“
„Reist du heute Nacht noch weit?“
„Nur bis Huelva.“
„Nur?“ Frey Juan hob seine buschigen Augenbrauen. „Das sind gute zehn Meilen. Und bei Nacht. Kennst du den Weg?“
Der Wanderer lächelte. „Die Richtung sollte für jemanden, der darin geübt ist, seinen Weg über den weglosen Ozean zu finden, ausreichen.“
Der Prior hörte in der Antwort einen prahlerischen Unterton heraus. Dies veranlasste ihn zu seiner nächsten Frage: „Ein großer Reisender?“
„Wenn ich mich so bezeichnen darf. Ich bin bis nach Nordthule und Südguinea gesegelt und ostwärts bis zum Goldenen Horn.“
Der Prior hielt den Atem an und musterte den Mann noch genauer, als ob er einer so weitreichenden Behauptung misstrauen würde. Die Prüfung muss ihn beruhigt haben, denn sofort wurde er herzlich.
„Das bedeutet, dass man die Grenzen der Welt berührt hat.“
„Der bekannten Welt vielleicht. Aber nicht der tatsächlichen Welt. Nicht um viele tausend Meilen.“
„Wie kannst du das behaupten, ohne es je gesehen zu haben?“
„Wie kann deine Vaterschaft behaupten, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, ohne sie je gesehen zu haben?“
„Durch Glauben und Offenbarung“, lautete die ernste Antwort.
„Ganz genau. Und in meinem Fall kann ich dem Glauben und der Offenbarung Kosmographie und Mathematik hinzufügen.“
„Ah!“ Frey Juans hervorstechende Augen betrachteten ihn mit wachsendem Interesse. „Tretet ein, Herr, in Gottes Namen. Es zieht hier und es ist abendlich kühl. Schließe das Tor, Innocencio. Tretet ein, Herr. Wir wären beschämt, wenn wir keine bessere Gastfreundschaft als die Eures bescheidenen Gebets hätten.“ Er nahm den Fremden am Ärmel, um ihn hereinzuziehen. „Wie heißt Ihr, Herr?“
„Kolumbus. Christoph Kolumbus.“
Wieder musterten Frey Juans scharfsinnige Augen die semitischen Züge dieses erhabenen Gesichts. Es gab Neuchristen dieses Namens, und er konnte sich an mehr als einen erinnern, der vom Heiligen Amt als rückfälliger Judenversteher dem Feuer übergeben worden war.
„Was ist dein Beruf?“ fragte er.
„Ich bin von Beruf Seefahrer und Kosmograf.“
„Ein Kosmograf!“ Der Tonfall ließ darauf schließen, dass die Beschreibung das Interesse des Priors geweckt hatte; und das war tatsächlich der Fall, denn Frey Juan war ein Gelehrter, dessen breitgefächertes Studium, wie Kolumbus informiert worden war, auch die provozierenden Geheimnisse der Kosmografie umfasste.
Eine Glocke begann zu läuten. Das Licht, das durch die bleiverglasten gotischen Fenster mit Blick auf den Innenhof und die Fenster der Kapelle fiel, erhellte schwach das verbliebene Tageslicht.
„Es ist die Stunde der Vesper“, sagte Frey Juan. „Ich muss Euch nun verlassen. Innocencio wird Euch zu unserem Gästezimmer führen. Wir sehen uns beim Abendessen wieder. In der Zwischenzeit werden wir uns um die Bedürfnisse Eures Kindes kümmern. Es versteht sich von selbst, dass Ihr die Nacht bei uns verbringt.“
„Ihr seid sehr freundlich zu einem Fremden, Herr Prior“, bestätigte Colon die Einladung, mit der er gerechnet hatte und auf die er sich in seiner prahlerischen Selbstbeschreibung eingestellt hatte.
Frey Juan, nicht weniger unaufrichtig, begnügte sich mit einer abwehrenden Handbewegung als Antwort. So freundlich er auch war, es war nicht nur Freundlichkeit, die ihn zu dieser Gastfreundschaft veranlasste. Wenn er seine Welt kannte, war dies kein gewöhnlicher Reisender. Ein Gespräch mit einem solchen Mann könnte gewinnbringend sein; und wenn nicht gewinnbringend, dann zumindest unterhaltsam, wie es in Frey Juans gegenwärtigem klösterlichen Leben zu selten vorkam.
Der Laienbruder hielt eine Tür auf, aber Colon blieb zurück, um sich in Worten auszudrücken, die den Prior in Bezug auf seinen Glauben beruhigten.
„Ruhe ist weniger dringend als Gott und Unserer Lieben Frau dafür zu danken, dass sie meine Schritte zu einem so gastfreundlichen Haus geführt haben. Mit Eurer Erlaubnis, Vater, werde ich mit Euch zur Vesper gehen. Für den zarten Kleinen ist es anders. Wenn unser Bruder ihn in der Zwischenzeit in seine Obhut nimmt, wird das meine Verpflichtung noch verstärken.“
Er bückte sich, um mit dem Kind zu sprechen, das, in Portugal geboren und aufgewachsen, aufmerksam, aber verwirrt von diesem Gespräch in unbekanntem Kastilisch dastand. Was er sagte, versprach Erfrischung und schickte den Jungen eifrig zur Seite des Laienbruders. Vom gotischen Portal der Kapelle aus sah sein Vater ihm mit zärtlichen Augen nach. Dann drehte er sich abrupt um.
„Ich bewahre Eure Ehrerbietung.“
Mit einem freundlichen Lächeln winkte der Prior ihn in die kleine Kapelle Unserer Lieben Frau von Rabida, deren Bild als Prophylaxe gegen den Wahnsinn wundersamen Ruhm genoss.
Die Glocke verstummte. Die Mönche befanden sich bereits im Chor, und Frey Juan ließ Colon im leeren Kirchenschiff zurück und ging weiter zu seinem Platz.
KAPITEL II DER PRIOR VON LA RABIDA
„Dixit Dominus, Dominus meus: Sede a dextris meis .“
Der gregorianische Gesang schwoll an, und Frey Juan, der durch den leuchtenden Nebel, den die Wachsstöcke erzeugten, in die Dämmerung spähte, war erfreut, seinen knienden Gast in einer Haltung verzückter Hingabe zu sehen.
Bald war der Prior aufgrund des Interesses, das er in ihm geweckt hatte, nicht mehr damit zufrieden, dass dem Fremden das Abendessen in der kahlen Halle, in der Wohltätigkeit an zufällige Wanderer verteilt wurde, zur Seite stand, sondern behandelte ihn wie einen Ehrengast und bat ihn an seinen eigenen Tisch.
Colon nahm die Einladung als sein gutes Recht an, ohne Überraschung oder Zögern, und die Brüder, die an den Bänken entlang der Wände des Refektoriums saßen, beobachteten verstohlen diesen bescheiden gekleideten Fremden, der neben dem Prior mit der stolzen Haltung eines Prinzen schritt, und fragten sich, welcher Hidalgo ihr Haus beehren könnte.
Durch den langen, kahlen Saal führte Frey Juan ihn zum Tisch des Priors auf einer flachen Estrade am Ende des Saals, die von einem Fresko des Letzten Abendmahls gekrönt wurde, das so grob gemalt war, dass man annehmen konnte, es sei das Werk eines der Mönche. Ein weiteres, nicht weniger grobes Fresko, das den heiligen Franziskus bei der Stigmatisierung zeigte, schmückte die Decke, die jetzt im Licht einer daran aufgehängten Öllampe mit sechs Flügeln schwach zu erkennen war. Die übrigen zwei Herzöge von Medina Celi, in Lebensgröße gemalt und so, als wären ihre Gliedmaßen, Oberkörper und Köpfe aus Holz, starrten sich über den Saal hinweg von den Wänden aus an, die mit der Tünche bestrichen waren, die der Araber nach Spanien gebracht hatte. Die Fenster, quadratisch und vergittert, befanden sich entlang der Nordwand in einer Höhe, die zwar Licht hereinließ, aber keinen störenden Blick auf die Außenwelt bot.
Das Essen war einfach, aber gut: Fisch, der frisch aus dem Hafen unten kam, in einem scharfen Eintopf, gefolgt von einer Brühe mit Kalbfleisch. Es gab Weizenbrot und einen herben, aber bekömmlichen Wein aus Palos, der aus den Weinbergen an den westlichen Hängen hinter den Kiefernwäldern stammte.
Sie aßen zum Dröhnen der Stimme eines Mönchs, der von einer steinernen Kanzel an der Südwand ein Kapitel aus der Vita et Gesta des heiligen Franziskus vorlas.
Colon saß zur Rechten des Priors, der Almosengeber saß auf seiner anderen Seite. Zu Frey Juans Linken vervollständigten der Subprior und der Novizenmeister die Gruppe am Tisch des Priors. Durch das neblige Licht des Kerzenleuchters, der den Tisch schmückte, wirkten die grauen Linien der Minoriten darunter gespenstisch in der sie umhüllenden Dämmerung.
Als die Lesung endlich zu Ende war, erwachten sie zum Leben, und in dieser Stunde der Entspannung erhob sich ein leises Gemurmel. Auf den Tisch des Priors kam eine Schale mit Früchten – glatte Orangen, getrocknete Feigen aus Smyrna und einige halb verwelkte Äpfel, dazu eine Flasche Malmsey. Frey Juan schenkte seinem Gast eine Tasse ein, vielleicht in der Absicht, eine Zunge zu lockern, die viel zu erzählen haben sollte. Danach, als er immer noch nachdenklich dasaß, wagte es der Prior, ihn mit einer direkten Frage anzuspornen.
„Und so, Herr, seid Ihr nach einer weiten Reise nun hier in Huelva zur Ruhe gekommen.“ Mit vor Scham gespitzten Lippen lispelte er ein wenig bei seinen Worten.
Colon riss sich zusammen. „Zur Ruhe?“ Sein Tonfall verspottete den Vorschlag. „Dies ist nur eine Etappe auf einer neuen Reise. Ich werde vielleicht einige Tage dort bleiben, bei einem Verwandten meiner Frau, die nun im Frieden Gottes ruht. Dann werde ich wieder auf Reisen gehen.“ Und er fügte fast flüsternd hinzu: „Wie Cartaphilus, und vielleicht genauso vergeblich.“
„Cartaphilus?“ Der Prior suchte in seinem Gedächtnis. „Ich glaube nicht, dass ich von ihm gehört habe.“
„Der Schuster von Jerusalem, der unseren Herrn bespuckte und dazu verdammt ist, auf der Erde zu wandeln, bis der Erlöser wiederkommt.“
Frey Juan zeigte ihm ein schockiertes Gesicht. „Herr, das ist ein harter Vergleich.“
„Schlimmer. Es ist eine Gotteslästerung, die mir die Ungeduld entlockt hat. Heiße ich nicht Cristobal? Gibt es kein Omen, das mich in einem solchen Namen ermutigt? Cristobal. Christum ferens. Träger Christi. Das ist meine Mission. Dafür wurde ich geboren. Dafür bin ich auserwählt. Das Wissen über Ihn in noch unbekannte Länder zu tragen.“
Die Augen des Priors waren vor Neugierde rund. Doch bevor er etwas sagen konnte, neigte der Subprior zu seiner Linken den Kopf, um ihm etwas zuzuflüstern. Frey Juan nickte zustimmend, und alle erhoben sich für das „Deo gratias“, das der Subprior sprach.
Colon sollte jedoch nicht mit den abreisenden Mönchen gehen. Als sie hinausgingen, nahm Frey Juan wieder auf dem Hochstuhl Platz und zog seinen Gast mit einer Hand am Ärmel herunter, damit er sich wieder neben ihn setzte. „Wir brauchen uns nicht zu beeilen“, sagte er und füllte Colons Becher mit dem süßen Malmsey nach.
„Ihr spracht, Herr, von unbekannten Ländern. Um welche Länder handelt es sich? Denkt Ihr an das Atlantis des Platon oder an die Insel der sieben Städte?“
Colons Augen senkten sich, damit Frey Juan ihr plötzliches Leuchten bei genau der Frage, die er sich wünschte, nicht bemerkte. Die Frage, die darauf hindeutete, dass der gelehrte Mönch, der eine Königin beeinflussen könnte, bereits im Netz des Interesses gefangen war, das sein Gast spann.
„Eure Ehrwürden scherzen. Doch war Platons Atlantis wirklich nur ein Märchen? Könnten die Glücklichen Inseln und die Azoren nicht Überreste davon sein? Und könnte es nicht noch andere, größere Überreste in Meeren geben, die bisher noch nicht kartiert wurden?“
„Sind das dann eure unbekannten Länder?“
„Nein. Ich habe keine derartigen spekulativen Dinge im Sinn. Ich suche das große Reich im Westen, von dem ich weiß, dass es definitiv existiert, und mit dem ich die Krone ausstatten werde, die mir gegeben werden könnte, um meine Suche zu unterstützen.“
Eine plötzliche Heftigkeit in ihm erschreckte den Prior zuerst; dann entlockte ihr theatralischer Ton seinen schmalen Lippen ein Lächeln. Er spottete gutmütig.
„Ihr wisst von der Existenz dieser Länder. Ihr wisst es, sagt Ihr. Habt Ihr sie denn gesehen?“
„Mit den Augen der Seele. Mit den Augen des Intellekts, mit denen mich Gottes Gnade ausgestattet hat, damit ich in ihnen das Wissen über ihn verbreite. Meine Vision ist so klar, ehrwürdiger Herr, dass ich diese Länder kartiert habe.“
Ein Mann von Frey Juans Glauben verspottete keine Visionen. Doch als Mann der Praxis misstraute er Visionären von Natur aus.
„Ich bin selbst ein bescheidener Student der Kosmografie und Philosophie, aber ich bin vielleicht ein Dummkopf. Denn das Wissen, das ich besitze, erklärt nicht, wie etwas kartografiert werden kann, das noch nie gesehen wurde.“
„Ptolemäus hatte die Welt, die er kartografierte, nicht gesehen.“
„Aber er besaß Beweise, die ihn leiteten.“
„Das habe ich auch. Und mehr als nur Beweise. Eure Vaterschaft wird zugeben, dass wir durch logische Schlussfolgerung aus dem Bekannten zum Unbekannten gelangen. Wäre dem nicht so, müsste die Philosophie stillstehen.“
„In Angelegenheiten des Geistes mag das wahr sein. In physischen Angelegenheiten bin ich mir nicht so sicher, und ich muss Beweise den Vorstellungen vorziehen, wie logisch sie auch begründet sein mögen.“
„Dann lasst mich auf die Beweise hinweisen, die es gibt. Stürme aus westlicher Richtung haben gelegentlich geschnitzte Holzbalken an die Küste von Porto Santo getragen, die noch nie mit Eisen in Berührung gekommen sind, große Kiefern, wie sie auf den Azoren nicht wachsen, und riesige Schilfrohre, die so monströs sind, dass sie in einem einzigen Abschnitt Gallonen von Wein aufnehmen können. Einige davon sind jetzt in Lissabon zu sehen, wo sie aufbewahrt werden. Und es gibt noch mehr. Viel mehr.“
Er hielt einen Moment inne, als würde er sich sammeln; in Wirklichkeit, um seinen Gastgeber zu beobachten. Als er die gebannte Aufmerksamkeit in dem blassen Gesicht erkannte, beugte er sich vor und begann seine Ausführungen mit einem ruhigen, gleichmäßigen und präzisen Ton.
„Vor 200 Jahren reiste ein venezianischer Reisender namens Marco Polo weiter nach Osten als jeder andere Europäer vor oder nach ihm. Er erreichte Cathay und die Herrschaft des Großkhans, eines Monarchen von sagenhaftem Reichtum.“
„Ich weiß, ich weiß“, warf Frey Juan ein. „Ich besitze eine Ausgabe seines Buches. Ich habe erwähnt, dass dies Dinge sind, in denen auch ich ein bescheidener Schüler bin.“
„Ihr besitzt sein Buch!“ In Colons Gesicht zeigte sich plötzlich ein Eifer, der es jünger wirken ließ. „Das erspart mir viel. Ich wusste nicht“, log er, „dass ich bereits mit einem Erleuchteten spreche.“
„Du sollst mir nicht schmeicheln, mein Sohn“, sagte Frey Juan, der vielleicht nicht ganz frei von Ironie war. „Was hast du in Marco Polo gefunden, das ich nicht mit Verstand zu entdecken vermochte?“
„Eure Vaterschaft wird sich an die Anspielung auf die Insel Zipangu erinnern, die den Menschen von Mangi bekannt ist – der am weitesten entfernte Punkt, den er selbst erreicht hatte – und die sich fünfzehnhundert Meilen weiter östlich befinden soll.“ Frey Juans Nicken ermutigte ihn fortzufahren. „Ihr werdet Euch an den sagenhaften Goldreichtum dieser Regionen erinnern. Seine Quellen, sagt er, sind unerschöpflich. Das Metall ist so weit verbreitet, dass das Dach des Königspalastes mit Platten aus Gold bedeckt ist, so wie wir unseres mit Blei bedecken. Er erzählt uns auch von dem großen Reichtum an Edelsteinen und Perlen, insbesondere von einer rosafarbenen Perle von großer Größe.“
„Vanitas vanitatum“, missbilligte der Prior.
„Nicht, wenn man es richtig einsetzt. Nicht, wenn man es für die Förderung würdiger Ziele einsetzt. Reichtum ist dann keine reine Eitelkeit; und hier gibt es Reichtümer, die alle europäischen Träume übertreffen.“
Allein der Gedanke daran schien ihn in einen Zustand der Kontemplation zu versetzen, aus dem er von Frey Juan ungeduldig herausgerissen wurde.
„Aber was hat dieser Zipangu von Marco Polo mit deinen Entdeckungen zu tun? Du sprachst von Ländern jenseits des westlichen Ozeans. Angenommen, alle östlichen Wunder von Marco Polo sind wahr, wie sind sie dann ein Beweis für deine westlichen Länder?“
„Glaubt Eure Väterlichkeit, dass die Erde eine Kugel ist?“ Er nahm eine Orange aus der Schale und hielt sie hoch. „So etwa.“
„Das ist jetzt die allgemeine Überzeugung unter Philosophen.“
„Und du akzeptierst natürlich die Unterteilung ihres Umfangs in 360 Grad?“
„Eine mathematische Konvention. Das bereitet keine Schwierigkeiten. Und dann?“
„Von diesen 360 Grad umfasst die bekannte Welt nur etwa 280 Grad. Das ist eine Tatsache, der alle Kosmografen zustimmen. Somit bleiben von den bekannten Ländern vom westlichsten Punkt, sagen wir Lissabon, bis zum äußersten Punkt der kartografierten östlichen Länder noch etwa 80 Grad – fast ein Viertel der gesamten Erde – zu berücksichtigen.“
Der Prior verzog zweifelnd die Lippen. „Uns wurde gesagt, dass es sich um eine reine Wasservergeudung handelt, so sturmgepeitscht und wild, dass es keine Hoffnung gibt, sie zu befahren.“
Colons Augen blitzten verächtlich auf. "Eine Geschichte von Schwächlingen, die es nicht wagen, es zu versuchen. Es gab auch Fabeln von einem unpassierbaren Flammengürtel entlang der Äquinoktiallinie, ein Aberglaube, den portugiesische Seefahrer entlang der Küste Afrikas verspottet haben.
"Schenken Sie mir Ihre Aufmerksamkeit, Herr Pfarrer. Hier ist also Lissabon." Er markierte einen Punkt auf der Orange. "Und hier der äußerste Punkt von Cathay: eine gewaltige Entfernung von etwa vierzehntausend Meilen nach meiner eigenen Messung des Grades, der auf dieser Parallele meiner Berechnung nach fünfzig Meilen beträgt.
„Wenn wir nun statt auf dem Landweg nach Osten auf dem Wasserweg nach Westen reisen, also ...“ und sein Finger bewegte sich nun von dem Punkt, an dem er Lissabon platziert hatte, nach links um die Orange herum, „... kommen wir innerhalb von achtzig Grad zum gleichen kartierten Punkt. Eure Urheberschaft wird erkennen, dass es nicht nur ein Paradox ist zu sagen, dass wir den Osten erreichen können, indem wir nach Westen reisen. Für den goldenen Zipangu von Polo kann die Entfernung im Westen nicht viel mehr als zweitausend Meilen betragen. Soweit gehen wir nach Beweisen. Die Schlussfolgerung rechtfertigt die Annahme, dass Zipangu keineswegs die äußerste Grenze Indiens ist. Es ist lediglich so weit, wie das Wissen der Venezianer reichte. Es muss andere Inseln, andere Länder und ein Reich geben, das auf seinen Besitz wartet.“
Mit solcher Inbrunst hatte er seine Ausführungen gemacht, dass Frey Juan von etwas von seinem Feuer angesteckt wurde. Die einfache, alltägliche Demonstration mit der Orange hatte eine dieser offensichtlichen Tatsachen offenbart, die sich dem schärfsten Verstand entziehen können, solange sie nicht aufgezeigt werden. Der Prior war fast hilflos von der starken Strömung des Enthusiasmus des jungen Kosmografen mitgerissen worden. Doch plötzlich bemerkte er ein Hindernis, an dem sich sein Verstand festhalten musste, um nicht völlig davongetragen zu werden.
„Warte. Warte. Du sagst, es muss andere Länder geben. Das bedeutet, weiter zu gehen, als ich es wage, dir zu folgen, mein Sohn. Es ist nicht mehr als dein Glaube, ein Glaube, in dem du getäuscht werden kannst.“
Kolons Begeisterung ließ nicht nach. Sie wurde eher noch angefacht und flammte noch heißer auf. „Wenn es nur das wäre, wäre es keine Schlussfolgerung. Und eine wohlbegründete Schlussfolgerung, die deine Vaterschaft anerkennen sollte. Sie basiert nicht mehr auf Mathematik, sondern auf Theologie. Wir haben die Autorität des Propheten Esdras, dass die Welt aus sechs Teilen Land und einem Teil Wasser besteht. Wendet das hier an und sagt mir, wo ich im Unrecht bin. Oder lass es unbeachtet. Lass meine imaginären Länder außer Acht, die die Entfernung halbieren würden.“ Er legte die Orange zurück in ihren Teller. „Es bleibt dennoch dabei, dass die Westindischen Inseln zweitausend Meilen westlich von uns liegen.“
„Und ist das nichts?“ Der Prior war plötzlich entsetzt über die Vision, die vor seinen Augen auftauchte. „2000 Meilen leeres Wasser, das Gefahren birgt, die nur Gott allein kennt. Allein der Gedanke ist erschreckend. Wo ist der Mut, der sich so in das Unbekannte wagen würde?“
„Er ist hier.“ Colon schlug sich an die Brust. Er saß aufrecht, voller Stolz, mit einem fanatischen Glanz in den Augen. „Der Herr, der mit so greifbarer Hand mein Verständnis öffnete, so dass Vernunft, Mathematik und Karten meiner Inspiration nichts bedeuten, öffnete auch mein Verlangen und stattete mich mit dem Geist aus, der für ein Instrument des göttlichen Willens notwendig ist.“
Die Kraft in ihm war eine, die die Vernunft niederknüppelte, das Vertrauen ein Feuer, in dem alle Zweifel verzehrt wurden. Frey Juan, der bereits von Colons Kosmographie und Logik überzeugt war, fand sich nun in die Teilnahme an der fanatischen Gewissheit des Mannes unterworfen.
„In meiner Eitelkeit – möge Gott mir vergeben – dachte ich, ich hätte etwas gelernt. Aber du zeigst mir, dass ich in diesen Mysterien nur ein Tappen bin.“ Er senkte einen Moment lang nachdenklich den Kopf. Colon nippte an seinem Malvasier und beobachtete ihn wie eine Katze.
Plötzlich fragte der Prior: „Woher kommt Ihr, Herr? Denn aus Euren Worten geht hervor, dass Ihr kein Spanier seid.“
Kolumbus zögerte, bevor er eine Antwort gab, die jedoch keine Antwort war. „Ich komme vom Hof Seiner Hoheit König Johann von Portugal und bin auf dem Weg nach Frankreich.“
„Nach Frankreich? Was sucht Ihr dort?“
„Ich suche nicht. Ich biete an. Ich biete dieses Reich an, von dem ich gesprochen habe.“ Er spielte darauf an, als wäre es bereits in seinem Besitz.
„Aber nach Frankreich?“ Frey Juans Gesicht war ausdruckslos. „Warum nach Frankreich?“
„Einst bot ich es Spanien an und wurde dem Urteil eines Kirchenmannes überlassen, was so war, als würde man mich zu einem Seefahrer schicken, um ein Urteil über Theologie zu erhalten. Dann ging ich nach Portugal und verschwendete Zeit mit gelehrten Dummköpfen, deren Rüstung aus Vorurteilen ich nicht durchdringen konnte. Dort, wie in Spanien, gab es niemanden, der mich unterstützte, und die Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass man, wenn man niemanden hat, der einen unterstützt, seine Zeit damit verschwendet, die Herrscher dieser Königreiche um Gehör zu bitten. Es gibt kein Land, dem ich diese Schätze lieber schenken würde als Spanien. Es gibt keine Herrscherin, der ich lieber zur Seite stehen würde als Isabella von Kastilien. Aber wie kann ich Ihre Hoheit erreichen? Wenn ich ein Interesse hätte, das mächtig genug ist, um ihr Gehör zu finden, intelligent genug, um den Wert dessen, was ich bringe, zu erkennen, und überzeugend genug, um sie dazu zu bewegen, mich zu empfangen, dann ... dann sollte ich zufrieden sein zu bleiben. Aber wo soll ich einen solchen Freund finden?“
Abwesend zeichnete der Prior mit dem Zeigefinger einen Kreis auf den Eichentisch, auf dem ein Tropfen verschütteten Weins zurückblieb.
Colon beobachtete ihn heimlich und antwortete nach einer kurzen Pause auf seine eigene Frage. „In Spanien habe ich keinen solchen Freund. Deshalb suche ich den König von Frankreich auf. Wenn ich auch bei ihm scheitere, werde ich mein Glück in England versuchen. Vielleicht begreift Ihr jetzt, warum ich mich mit dem verirrten Juden Cartaphilus vergleiche.“
Der Zeigefinger des Priors fuhr immer noch geistesabwesend über die Seite.
„Wer weiß?“, murmelte er schließlich.
„Wer weiß was, Herr Pfarrer?“
„Eh? Ah! Ob du weise bist. Schlaf bringt Rat, sagt man. Lass uns darüber schlafen und wieder reden.“
Colon war zufrieden, es dabei zu belassen. Es war vielleicht nicht viel erreicht worden, aber doch genug, um ihm die Hoffnung zu geben, dass er seine Zeit nicht verschwendet hatte, als er nach La Rabida kam.
KAPITEL III DER GÖNNER
Nichts in den Jahren seines friedlichen Klosterlebens hatte in Frey Juan ein solches Fieber entfacht wie die Worte und die Person von Cristobal Colon. Er verbrachte, wie er später gestand, eine Nacht, in der sich ablenkende wache Gedanken mit fantastischen Träumen von Zipangu mit goldenen Dächern abwechselten – unter diesem Namen ist es allgemein anerkannt, dass Marco Polo Japan bezeichnet – und von glitzernden, juwelenbesetzten Inseln, die voller monströser Stöcke waren, aus denen Wein sprudelte, wenn man sie anstieß. Es schmerzte seine spanische Seele, dass das Reich über solche Länder an die Herrscher verloren gehen sollte, die so dringend Schätze benötigten, um die Verwüstungen ihres Krieges gegen die Ungläubigen zu beheben. Seine Gefühle in dieser Angelegenheit waren sowohl patriotischer als auch persönlicher Natur. Es war nur natürlich, dass er, der einst Beichtvater von Königin Isabella gewesen war, ihr nicht nur als treuer Untertan ergeben war; er empfand auch eine liebevolle väterliche Zuneigung, die, wie er gerne glaubte, von ihr mit einem gewissen Maß an kindlicher Frömmigkeit erwidert wurde. Gesuche von ihm im Namen seines gelegentlichen Gastes könnten sie dazu bewegen, den Forderungen des Mannes die Beachtung zu schenken, die ihnen, wie Kolumbus sich beschwerte, früher verweigert worden war.
Während er darüber nachdachte, lag der gute Prior wach auf seiner harten Pritsche und war bereit, die Hand Gottes in dem seltsamen Zufall zu erkennen, der Colon nach La Rabida gebracht hatte. Er sollte nicht ahnen, dass es hier überhaupt keinen Zufall gab; dass Colon, der seine Ziele ebenso kaltblütig verfolgte, wie er sie leidenschaftlich darlegte, sich des Interesses von Frey Juan an der Kosmographie und der Verbindung, die ihn mit der Königin verband, wohl bewusst war, seinen Weg mit voller Absicht zum Kloster gefunden hatte, um den Franziskanern einen Köder vor die Augen zu halten. Die Neugier des Priors, geweckt durch den Klang der sonoren Stimme des Wanderers, hatte den Verlauf vereinfacht. Hätte es daran gefehlt – und es ist klar, dass Kolumbus nicht damit rechnen konnte –, wäre auf die Bitte um etwas Brot und Wasser für sein Kind das Gebet um eine Übernachtungsmöglichkeit gefolgt. Im Laufe dessen muss er eine Gelegenheit für ein solches Gespräch geschaffen haben, wie es Frey Juans Interesse spontan geliefert hatte.
Da der Prior nichts davon ahnte, fragte er sich, ob es in der Folge der von ihm angebotenen Gastfreundschaft eine wundersame Qualität, eine göttliche Intervention, gab. Es lag jedoch in der Natur von Frey Juan, seinen Enthusiasmus mit Vorsicht zu mäßigen. Bevor er sich verpflichtete, Colons Fall zu unterstützen, würde er sich von anderen, die besser beurteilen konnten, bestätigen lassen, welchen Glauben der Mann in ihm weckte.
Die anderen, an die er dachte, waren Garcia Fernandez, ein Arzt aus Palos, dessen Wissen weit über die Heilkunst hinausging, und Martin Alonso Pinzon, ein wohlhabender Kaufmann, der zur See gefahren war, dem einige Schiffe gehörten und der als erfahrener Seemann bekannt war.
Seiner Überzeugung, dass Kolumbus die Abfahrt um mindestens einen weiteren Tag verschieben sollte, gab sein Gast mit einer hochmütigen Geste nach, als er Gefälligkeiten gewährte, und in dieser zweiten Nacht nach dem Abendessen, als der kleine Diego im Bett war, versammelten sich die vier in der Zelle des Priors. Sie drängten sich in dem engen kleinen Raum, der nicht mehr als drei Stühle, einen Tisch, eine Schreibkanzel und Frey Juans Klappbett sowie zwei Bücherregale an der weiß getünchten Wand enthielt.
Dort wurde Colon aufgefordert, die Darlegung zu wiederholen, mit der er Frey Juan gestern Abend unterhalten hatte. Er tat dies mit einem Hauch von vager Zurückhaltung, sei es, um diese Herren zu ermüden, sei es, um sich selbst zu ermüden. Aber nachdem er begonnen hatte und in den Glanz seiner eigenen Begeisterung verstrickt war, wurde diese durch die offensichtlich eifrige Aufmerksamkeit seines Publikums noch verstärkt. Während er sprach, verließ er seinen Stuhl, um auf und ab zu gehen, mit feurigem Blick und großzügigen Gesten. Er sprach mit vernichtender Verachtung über diejenigen, die seine Gaben verschmäht hatten, und mit hochmütigem Selbstvertrauen über die unwiderstehliche Kraft in ihm, die letztlich dazu führen würde, dass die verblendeten Augen für eine schillernde Vision dieser Gaben geöffnet würden.
Schon bevor er auf die Details einging, die Frey Juan so beeindruckt hatten, waren sowohl der Arzt als auch der Kaufmann von der Macht, die Kolumbus besaß, so eingenommen, dass er leicht die Liebe aller, die ihn sahen, gewinnen konnte, wie uns Bischof Las Casas, der ihn kannte, berichtet.
Fernandez, der Arzt, schlank und lang, mit einem eiförmigen Kopf und einer Glatze unter der Schädeldecke, kämmte sich mit knöchernen Fingern einen strähnigen Bart, während er zuhörte, seine blassen Augen weit aufgerissen, seinen Körper in den schwarzen Gabardine gehüllt, der ihn kleidete. Scheide für Scheide wurde ihm der Skeptizismus, in den er gehüllt war, rücksichtslos entzogen.
Pinzon hingegen gab sich bereitwillig dieser wilden Zauberei hin. Er war der Einladung des Priors mit unverdächtigem Eifer gefolgt, denn die Angelegenheiten, über die er von diesem Reisenden erfahren sollte, waren Themen, mit denen er sich schon lange beschäftigt hatte. Als kräftiger, behaarter Mann in der Blüte seines Lebens, mit O-Beinen und lebhaft blauen Augen unter dichten schwarzen Augenbrauen, hatte er etwas von der traditionellen, lockeren und herzlichen Art eines Seefahrers. Seine Lippen schienen sehr rot unter dem schwarzen Bart, aber der Mund war zu schmal und klein für Großzügigkeit. Sein nüchterner Wohlstand zeigte sich in einem weinroten Samtwams mit Luchspelzbesatz und den Stiefeln aus feinem Cordovan-Leder, die seine kräftigen Beine umhüllten.
Als die Ausstellung zu Ende ging, brauchten die beiden, die zum Gericht gebracht worden waren, kaum noch ihre Überzeugung zu äußern, dass Kolumbus eine Karte ausbreiten sollte, auf der er der bekannten Welt jene Gebiete hinzugefügt hatte, von deren Existenz er durch sein eigenes inneres Licht überzeugt war, neben Marco Polo und dem Propheten Esdras. Dennoch kamen sie ehrfürchtig über diese Karte, die auf dem Tisch des Priors ausgebreitet war, und begannen auf sein Geheiß hin zu studieren.
Fernandez, aufgrund seiner Studien, und Pinzon, aufgrund seiner umfassenden Erfahrung, waren in der Lage, nicht nur die klare Perfektion als kartografisches Werk zu bewerten, sondern auch, bis auf ein Detail, die gewissenhafte Genauigkeit bei der Darstellung der bekannten Welt.
Auf dieses Detail ging der alte Arzt ein. „Eure Karte gibt zweihundertdreißig Grad des Erdumfangs als Entfernung von Lissabon zum östlichen Ende Indiens an. Das stimmt meiner Meinung nach nicht mit Ptolemäus überein.“
Kolumbus nahm die Kritik auf, als würde er sie begrüßen. „Auch nicht mit Marinus von Tyrus, den Ptolemäus korrigierte, so wie Ptolemäus hier korrigiert wird. Ich korrigiere ihn auch, wie ihr sehen werdet, in Bezug auf die Position von Thule, die ich, nachdem ich darüber hinaus gesegelt bin, weiter westlich fand, als Ptolemäus es einschätzte.“
Aber Fernandez beharrte darauf: „Das ist deine Autorität. Deine ausreichende Autorität. Aber welche Autorität gibt es für die Position, die du Indien gibst?“
Es dauerte einen Moment, bis Kolumbus antwortete, und dann sprach er langsam und widerwillig, als würde ihm etwas abverlangt, das er nur ungern preisgeben wollte.
„Ihr habt sicher von Toscanelli aus Florenz gehört?“
„Paolo del Pozzo Toscanelli? Welcher Student der Kosmographie kennt ihn nicht?“
Nun, Fernandez könnte die Frage stellen, denn der Name Toscanelli, der vor kurzem verstorben ist, war unter gebildeten Männern als der des größten Mathematikers und Physikers, der je gelebt hat, berühmt.
Pinzons tiefe Stimme dröhnte: „Wer hat das nicht?“
„Er ist meine Autorität. Die Berechnung, die die von Ptolemäus korrigiert, ist sowohl seine als auch meine.“ Brüsk fügte er hinzu: „Aber was macht es schon, wenn sie fehlerhaft ist? Was macht es schon, wenn der goldene Zipangu in der einen oder anderen Richtung einige Grade weniger oder mehr liegen sollte? Was hat das mit der Hauptsache zu tun? Es braucht nicht das Wort eines Toscanelli, um festzustellen, dass, egal ob wir auf einer Kugel nach Osten oder Westen gehen, letztendlich derselbe Punkt erreicht werden muss.“
„Es braucht vielleicht nicht sein Wort, wie du sagst, aber dein Fall würde unermesslich gestärkt, wenn du zeigen könntest, dass dieser große Mathematiker die gleiche Meinung vertritt.“
„Das kann ich beweisen.“ Er sprach hastig und hätte sich an die Worte erinnert, denn es beleidigte seine Eitelkeit, dass man annahm, seine Schlussfolgerungen seien von einem anderen inspiriert worden.
Das plötzliche, fast erschreckte Interesse, das seine Behauptung hervorrief, trieb ihn zur Erklärung.
„Sobald ich meine Theorien formuliert hatte, legte ich sie Toscanelli vor. Er schrieb mir, dass er sie nicht nur voll und ganz befürwortete, sondern mir auch eine eigene Karte schickte, die im Wesentlichen der Karte entspricht, die vor euch liegt.“
Frey Juan beugte sich gespannt vor. „Ihr besitzt diese Karte?“
„Das und den Brief, in dem die Argumente dargelegt werden, die dies rechtfertigen.“
„Das“, sagte Fernandez, „sind sehr wertvolle Dokumente. Ich glaube nicht, dass ein Mensch mit so viel Wissen leben kann, dass er Toscanellis Schlussfolgerungen anfechten kann.“
Pinzon, der unverblümt vehement war, schwor bei Gott und Unserer Lieben Frau, dass so viel für ihn nicht notwendig sei. Die Spekulationen von Meister Kolumbus hätten das Herz der Wahrheit durchbohrt.
Der Prior, der sich auf dem Klappbett ausstreckte, schnurrte nun vor Zufriedenheit und erklärte, dass es nicht Gottes Wille sein könne, dass Spanien, wo er ihm so treu zur Seite stand, die Macht und den Ruhm verlieren sollte, die sich aus Entdeckungen ergeben würden, die größer waren als alles, was die portugiesischen Seefahrer je gemacht hatten.
Von Kolumbus jedoch riefen diese Proteste keine weitere Reaktion hervor. Im Gegenteil, seine Art wurde kalt und abweisend.
„Spanien hatte seine Chance und hat sie verpasst. Die Herrscher waren so sehr mit der Eroberung einer Provinz von den Mauren beschäftigt, dass sie das Imperium nicht sehen konnten, mit dem ich ihre Krone zu schmücken angeboten hatte. In Portugal überließ ein König, der meine Pläne wohlwollend betrachtete, die Entscheidung einem jüdischen Astronomen, einem Arzt und einem Geistlichen, einer bunt zusammengewürfelten Kommission, die mich ablehnte, wie ich glaube, aus Böswilligkeit. Deshalb schaue ich mich anderswo um. Ich habe schon zu viele Jahre verloren.“ Er faltete seine Karte mit einem Ausdruck der Endgültigkeit.
Aber der scharfsinnige Pinzon, der seine Welt weit besser kannte als die anderen beiden, war weniger anfällig für die Ehrfurcht vor Persönlichkeiten. Er fragte sich, warum dieser Mann, wenn seine Entscheidung, nach Frankreich zu reisen, so unwiderruflich war, wie er vorgab, sich jetzt die Mühe machen sollte, seine Theorien so ausführlich darzulegen. Pinzon war der Ansicht, dass Kolumbus, während er es scheinbar verachtete, Unterstützung bei der Umsetzung seiner gewaltigen Ziele suchte. Und so wandte sich Pinzon der Überzeugungsarbeit zu, von der er annahm, dass sie erwünscht war.
Er schwor, dass er des Namens Spanier unwürdig wäre, wenn er, nachdem er gehört hatte, was sie zu sagen hatten, es unterlassen würde, sich darum zu bemühen, Spanien die Besitztümer zu sichern, die sich aus ihrer Entdeckung ergeben würden.
„Ich danke Euch, Herr“, lautete die stolze Antwort, „für Euer Vertrauen in mich.“
Pinzon wollte es jedoch nicht dabei belassen. „Es ist so solide, so sehr im Einklang mit meinen Vorstellungen, dass ich sogar daran denken könnte, einen Teil des Abenteuers zu tragen, einen Einsatz zu machen. Denken Sie darüber nach, Herr. Lassen Sie uns wieder darüber sprechen.“ Es lag ein kaum verhohlener Eifer in ihm. „Ich könnte ein oder zwei Schiffe und die Mittel, um sie auszurüsten, aufbringen. Denken Sie darüber nach.“
„Ich danke Euch wieder. Aber dies ist keine Angelegenheit für Privatunternehmen.“
„Warum nicht? Warum sollten solche Vorteile nur Fürsten vorbehalten sein?“
„Weil solche Unternehmungen die Autorität einer Krone im Rücken brauchen. Die Kontrolle von Ländern jenseits der Meere und der Reichtümer, die sie hervorbringen können, erfordert die Kräfte, die nur ein Monarch bereitstellen kann. Wenn es nicht so wäre, hätte ich all die Jahre nicht damit verschwendet, an die Türen der Fürsten zu klopfen und von dummen Türstehern abgewiesen zu werden.“
Der Prior, der Pinzons Drängen zwar mit Sympathie, aber auch kurzzeitig mit Bestürzung begegnete und erleichtert war, sie so abgewiesen zu hören, machte sich daran, zu intervenieren. „Da könnte ich Euch helfen. Vor allem jetzt, da ich von der beeindruckenden Waffe weiß, mit der Ihr bewaffnet seid. Ich meine diese Toscanelli-Karte. So bescheiden ich auch bin, könnte ich vielleicht das Ohr von Königin Isabella erlangen. Denn die Frömmigkeit und Güte ihrer Hoheit bewahrt in ihr eine Freundlichkeit für jemanden, der einst ihr Beichtvater war.“
„Ah!“, sagte Kolumbus, als wären ihm diese Neuigkeiten neu.
Unverständlich hörte er zu, während Frey Juan nun Pinzons Gefühle wiederholte und erklärte, dass es für jeden Spanier eine Schande sei, zuzulassen, dass Spanien so etwas Großes verloren gehe und ein anderes Königreich davon profitiere. Lasst Meister Colon noch ein wenig Geduld haben. Nachdem er Jahre gewartet hat, soll er nun nur ein paar Wochen warten. Wenn Colon zustimmt, würde Frey Juan morgen losreiten, um den Hof zu suchen, vor Granada oder wo auch immer er sein könnte, um bei ihrer Hoheit den Einfluss geltend zu machen, den er durch ihre Güte besitzt, damit sie Colon eine Audienz gewährt und seine Vorschläge aus seinem eigenen Munde hört. Frey Juan würde so schnell sein, wie es in menschlicher Macht liegt, und in der Zwischenzeit würde sich in La Rabida gut um Meister Colon und sein Kind gekümmert werden.
Der Ton der Fürsprache in der Stimme des Mönchs wurde immer eindringlicher, während er fortfuhr. Er wurde fast weinerlich in seinem inbrünstigen Bemühen, die kalte Distanziertheit zu durchbrechen, in die der große Abenteurer gehüllt war.
Als er schließlich aufhörte, faltete Colon die Hände, als bete er, und seufzte. „Ihr versucht mich auf eine harte Probe, guter Vater“, sagte er und wandte sich ab. Er ging zum Fenster, gefolgt von zwei Paar ängstlichen Augen, denen des Priors und des Arztes. In dem Blick des Kaufmanns Pinzon, der seine Welt und die Art der Verhandler kannte, lag weniger Angst als kluges Misstrauen.
Am Ende des Raumes drehte sich Colon langsam um. Er warf seinen roten Kopf in den Nacken und, die Majestät in Person in einem schäbigen Mantel, gewährte er die erbetene Gunst.
„Es ist unmöglich, etwas abzulehnen, das so großzügig angeboten wird. Wie Ihr wünscht, Herr Prior.“
Der Prior stürmte auf ihn zu und lächelte dankbar. Hinter ihm lachte Martin Alonso schallend. Frey Juan vermutete, dass dies ein Ausdruck purer Freude war, was durchaus möglich war, denn es ist eine Freude zu sehen, wie sich die Vorhersagen unseres Urteils erfüllen.
KAPITEL IVDER VERGESSENE BEWERBER
Der Prior von La Rabida besorgte sich ein Maultier und machte sich am nächsten Morgen auf den Weg nach Vega de Granada, wo die Herrscher sich niedergelassen hatten, um die letzte Festung der Sarazenen zu erobern.
Das hohe Vertrauen, mit dem er sich auf den Weg machte, war nicht unangebracht. Königin Isabel empfing ihren geisterhaften Vater mit all der Anmut und Frömmigkeit, die von einer geisterhaften Tochter erwartet wurde. Sie hörte sich seine Geschichte an und ließ sich von etwas von seinem Enthusiasmus anstecken. Sie erhörte sein Gebet, rief ihren Schatzmeister herbei und befahl ihm, zwanzigtausend Maravedis für die Ausrüstung und Reisekosten von Kolumbus auszuzahlen. Dann entließ sie den triumphierenden Franziskaner, um den Mann zur Audienz zu bringen.
Hier war eine Schnelligkeit, die alle Hoffnungen des Mönchs übertraf. Er eilte mit seinen Nachrichten nach La Rabida zurück.
„Die Königin, unsere weise und tugendhafte Herrin, hat das Gebet dieses armen Mönchs erhört. Tu jetzt, was dir zusteht, und die Welt gehört dir.“
Kolumbus, der ungläubig war über den schnellen und leichten Erfolg, der mit dem Wurf des Spielers einherging, wegen dem er nach La Rabida gekommen war, verlor keine Zeit und machte sich auf den Weg. Sein Sohn sollte in der Obhut des Klosters bleiben, bis er sich um ihn kümmern konnte.
Bei seiner Abreise wurde er wieder von Martin Alonso Pinzon aufgesucht, der sich äußerst freundlich zeigte.
„Ich komme, um Euch Glück zu wünschen und Euch zu dieser schnellen Audienz zu beglückwünschen. Ich schwöre, Ihr hättet keinen besseren Botschafter haben können.“
„Ich bin mir dessen ebenso bewusst wie Eurer Höflichkeit.“
„Es ist nicht nur reine Höflichkeit. Schließlich habe ich meinen Teil zu diesem Erfolg beigetragen.“ Er beantwortete Colons Blick und fuhr fort: „Seien Sie ehrlich, Herr. Es war meine Unterstützung Ihrer Ansichten, die Frey Juan dazu veranlasste, die Königin um etwas zu bitten.“
Es war, als würde er eine Forderung stellen, eine Kleinlichkeit, von der Colon nicht allzu beeindruckt war. Aber er verbarg seine leichte Verachtung.
„Ich stehe in Eurer Schuld, Herr.“
Martin Alonso lachte und zeigte dabei seine kräftigen Zähne hinter den roten Lippen seines schwarzen Bartes. „Es ist eine Schuld, mein Freund, und es könnte sich für Euch als vorteilhaft erweisen, sie zu begleichen. Bedenkt, Herr, dass ich bereit bin, Euer Projekt zu unterstützen. Ich liebe das Risiko und würde darauf wetten. Ich kann Schiffe befehligen, wie ich Euch bereits sagte.“
„Ihr ermutigt mich.“ Colon war ein Vorbild an kühler Höflichkeit. „Aber, wie ich bereits deutlich gemacht habe, ist das Unternehmen zu umfangreich für private Geldbeutel, sonst hätte es nicht so lange auf sich warten lassen.“
„Dennoch könntet Ihr zu dem Schluss kommen, dass eine private Geldbörse einen Teil dazu beitragen könnte. Warum nicht, auch wenn die Krone die Hauptunterstützung bieten sollte?“
„Mir scheint, wenn ich von der Krone unterstützt werde, wird die Krone die Kosten tragen.“
„Aber vielleicht nicht alles.“ Martin Alonso wurde aufdringlich. Er lächelte, aber in seinen Augen lag ein Ausdruck von Besorgnis. „Die königliche Schatzkammer ist in diesen Tagen stark belastet. Der Krieg hat sie stark belastet. Die Herrscher könnten Euch bevorzugen und dennoch wegen der Kosten zögern. Ein wenig Hilfe könnte dann willkommen sein. Ich bitte Euch nur, mich nicht zu vergessen, falls es so sein sollte, oder“, fügte er verschmitzt hinzu, „falls Ihr die Chance seht, es so zu machen. Schließlich wäre es, wie gesagt, nicht mehr als mein Anteil, für meinen Teil bei der Entsendung von Frey Juan an den Hof.“
„Ich werde daran denken“, sagte Colon.
Aber als er davonritt, war er entschlossen, es zu vergessen. Er wollte keine Partner, am allerwenigsten einen habgierigen Kaufmann, der für den mickrigen Geldbeutel, den er einbringen könnte, nicht nur einen Anteil am Gewinn beanspruchen, sondern auch versuchen würde, etwas vom Ruhm zu stehlen.
Nachdem er seine Prüfungen hinter sich gebracht hatte, seine Schäbigkeit abgelegt hatte und durch die Gabe der Königin so gekleidet war, dass seine natürlichen Vorzüge zur Geltung kamen, begab er sich unverzüglich an den Hof unter die Ägide von Frey Juan.
Die Worte des Franziskaners waren ihm in Erinnerung geblieben: „Die Königin, unsere weise und tugendhafte Herrin, hat das Gebet dieses armen Mönchs erhört. Tu dir jetzt selbst Gerechtigkeit und die Welt gehört dir.“
Es war eine ermutigende Zusicherung, und was von ihm selbst abhing, daran zweifelte Colon nicht. Er würde sich selbst voll und ganz gerecht werden, wie Frey Juan sehen sollte.
Und so war es kein kriecherischer Bittsteller, den die Herrscher sahen, als er zur Audienz in den Alcazar in der weißen Stadt Cordoba gebracht wurde. Im Bewusstsein, dass ihm sein rostbraunes Wams und der offene Mantel aus Maulbeerbaum mit den hängenden Ärmeln gut standen, trug er sich mit dem selbstbewussten Stolz eines Menschen, der sein Schicksal in der Hand hat.
Hätte das Ergebnis allein von der Königin abgehangen, hätte es schnell eintreten können; denn obwohl sie eine Frau mit viel Verstand und ruhigem Urteilsvermögen war, war sie immer noch eine Frau und konnte daher dem Appell der dominanten Männlichkeit dieses gelbbraunen Mannes mit den eifrigen, magnetischen, jugendlichen Augen und der von Las Casas erwähnten Fähigkeit, Zuneigung zu erregen, kaum gleichgültig gegenüberstehen. Aber König Ferdinand war da, hart und misstrauisch, der scharfsinnigste und berechnendste Prinz Europas. Ein Mann Ende dreißig, breitschultrig und kräftig gebaut, aber nur mittelgroß, mit einem eher klobigen, frischfarbigen Gesicht, blond und mit hellen, hervorstechenden Augen. Diese Augen blickten wenig wohlwollend auf die natürliche Majestät und die fürstliche Haltung des Abenteurers, den Frey Juan vorstellte.
Ihre Hoheiten empfingen Colon in einem prächtigen Saal des Alcazar, der durch zweibogige Fenster erhellt wurde und mit dem geprägten und subtil gefärbten Leder verkleidet war, für das die Mauren von Cordoba berühmt waren. Auf dem Marmorboden lagen prächtige orientalische Teppiche. Zwei Damen bedienten die Königin, die hinter ihrem hohen Stuhl stand: die hübsche junge Marquise von Moya und die Gräfin von Escalona. Der König wurde von seinem Oberhofmeister Andrés Cabrera, Marquis von Moya, begleitet, von dem man sagte, dass seine Ziegenaugen seinem Namen gerecht würden; von Don Luis de Santangel, dem graubärtigen und gütigen Kanzler von Aragon; und von Hernando de Talavera, Prior des Prado, einem großen asketischen Mönch im weißen Habit und schwarzen Mantel eines Hieronomiten.
Alle diese, wie die meisten, die die hohen Ämter um die Herrscher herum bekleideten, waren Neuchristen, Männer mit jüdischem Blut, die durch die Talente ihrer Rasse zu Ansehen gelangt waren und Neid säten, der sich in jener Grausamkeit der Verfolgung zu äußern begann, deren Agent das Heilige Offizium der Inquisition werden sollte.
Colon könnte sie dazu verleitet haben, ihn als einen der ihren zu betrachten, und sicherlich hätte er, wenn er hingeschaut hätte, eine wohlwollende Wärme in den Augen von Santangel und Cabrera entdeckt. Talavera blieb jedoch kalt und distanziert, den Blick gesenkt. Kompromisslos ehrlich, wie er Ehrlichkeit verstand, würde er eher Feindseligkeit annehmen, als sich einem schwachen Vorurteil aus rassistischen Gründen hinzugeben.
Zu Beginn schenkte Colon diesen Begleitern wenig Beachtung. Seine Augen und seine Aufmerksamkeit waren auf die Königin gerichtet, an deren Ellbogen Frey Juan Perez gekommen war, um unauffällig zu stehen. Er erblickte eine hellhäutige Frau von vierzig Jahren mittlerer Größe, deren Gestalt und Gesichtsausdruck mäßig rundlich waren und deren blaue Augen ihn freundlich ermutigten. Eine gewisse Häuslichkeit war nicht zu übersehen, selbst durch den Reichtum ihres mit Hermelin gefütterten Umhangs aus purpurrotem Satin, der so großzügig geschlitzt war, dass das goldene Tuch ihres darunter getragenen Kleides durchschimmerte. Im Gürtel aus weißem Leder an ihrer Taille glühte das Feuer eines Balas-Rubins von der Größe eines Tennisballs.
Sie sprach ihn mit sanften Worten an, und in ihrer ruhigen Stimme erkannte er einen Hauch der Autorität, die in ihr wohnte. Sie lobte die Ideen, von denen der Prior von La Rabida ihnen erzählt hatte, dass sie ihn inspiriert hätten, und sie versicherte ihm, dass es ihr Wunsch sei, mehr über diesen Dienst zu erfahren, von dem er glaubte, dass er in seiner Macht stehe, ihn den Kronen von Kastilien und Aragon zu erweisen.
Mit erhobenem Haupt und lauter Stimme antwortete er prompt:
„Ich küsse Eurer Hoheit die Füße. Ich danke Euch für die mir so großzügig gewährte Gelegenheit. Ich verspreche Entdeckungen, die im Vergleich zu denen, die der Krone Portugals zu mehr Würde und Macht verholfen haben, klein und unbedeutend erscheinen werden.“
„Ein großes Versprechen“, krächzte der König, und Kolumbus war sich nicht sicher, ob er nicht höhnisch klang. Doch das beunruhigte ihn nicht.
„In der Tat hoch, Majestät. Aber nicht höher als durch Gottes Gnade und Führung werde ich aufsteigen.“
„Sprich weiter. Sprich weiter“, sagte der König, und nun war das Grinsen nicht mehr zu übersehen. „Lass uns hören, was du zu sagen hast.“
Kolumbus neigte sein stolzes Haupt, das seine Hoheit für zu steif hielt, und begann mit wohlüberlegten Worten, seine kosmografischen Theorien darzulegen. Aber er war noch nicht weit gekommen, als Ferdinands raue Stimme und seine schnellen Worte ihn unterbrachen.
„Ja, ja. All dies haben wir bereits vom Prior von La Rabida gehört. Es ist seine klare Aussage über eure Überzeugungen, die Ihre Hoheit dazu veranlasst hat, euch eine Audienz zu gewähren, zu einer Zeit, in der, wie ihr wissen solltet, unser Kreuzzug gegen die Ungläubigen in Spanien uns reichlich beschäftigt.“
Ein weniger bedeutender Mann, einer, der mehr von der Achtung vor Personen durchdrungen ist, wäre aus dem Konzept gebracht worden. Kolumbus wurde lediglich zu größerer Zuversicht angespornt.
„Der Reichtum der Indischen Inseln, den ich zu Füßen Eures Throns lege, die unerschöpflichen Quellen, zu denen ich Euch den königlichen Weg ebnen werde, werden die Verwüstungen dieses Konflikts beheben und Ressourcen für seinen siegreichen Abschluss oder sogar für seine Ausweitung bis hin zur Befreiung des Heiligen Grabes selbst bereitstellen.“
Er hätte nichts Besseres sagen können, um Königin Isabella zu begeistern und sie in den Bann der Magie zu ziehen, die er einsetzte. Aber für den König war es fast ein Widerspruch, eine Herausforderung. Mit einem skeptischen Lächeln auf den vollen Lippen kam er der Antwort der Königin zuvor.
„Lasst uns nicht vergessen, dass Ihr von Dingen sprecht, die bisher nur mit dem Auge des Glaubens gesehen wurden.“
„Was ist dann Glaube, Majestät?“, erlaubte sich Colon zu fragen, aber indem er sofort antwortete, ließ er erkennen, dass die Frage nicht mehr als rhetorisch war. „Es ist die Kraft, durch das innere Licht der Inspiration jene Dinge zu erkennen, deren Beweise nicht greifbar sind.“
„Das klingt eher nach Theologie als nach Kosmographie.“ Ferdinand warf Talavera einen schiefen Blick über die Schulter zu und lächelte dabei. „Das liegt eher in Eurer Provinz, Herr Prior, als in meiner.“
Der Mönch hob den gesenkten Kopf. Seine Stimme war ernst und kalt.
„Als Definition des Glaubens habe ich nichts dagegen einzuwenden.“
„Ich für meinen Teil“, sagte die Königin, „bin zwar keine Theologin, aber ich habe noch nie eine bessere Definition gehört.“
„Dennoch“, wandte Ferdinand ein, der sich ihr mit aller Höflichkeit zuwandte, „ist in einer solchen Angelegenheit ein Gramm Erfahrung mehr wert als ein Pfund Glaube. Und zugegebenermaßen gibt es keine tatsächliche Erfahrung, die die Behauptungen von Meister Colon stützen könnte.“
Anstatt selbst zu antworten, bat die Königin Colon, die Antwort zu geben.
„Ihr habt Seine Hoheit gehört.“
Colon senkte den Blick; sein Tonfall war fast wehmütig. „Ich kann nur fragen, was Erfahrung ist, und antworten, dass sie nicht mehr ist als das Fundament, auf dem diejenigen jemals aufgebaut haben, die mit der göttlichen Gabe der Vorstellungskraft ausgestattet sind.“
„Das ist dunkel genug, um tiefgründig zu sein“, sagte Ferdinand, „aber es bringt uns nicht weiter.“
„Mit Verlaub, Hoheit, zumindest weist es den Weg. Durch die Anwendung der Gabe der Vorstellungskraft, durch die Vorstellung des Unbekannten aus dem Bekannten – dem Erlebten – ist der Mensch schrittweise aus einer urzeitlichen, brutalen Unwissenheit aufgestiegen.“
Seine Hoheit begann, sich zu ärgern. Dieser Mann war subtiler und schwer fassbarer, als es sich für einen Disput mit einem Prinzen gehörte. Er machte ein ungeduldiges Geräusch. „Wir bewegen uns hier im Reich des Ungreifbaren, einem Reich der Träume.“
Colon warf den Kopf in den Nacken, als wäre er beleidigt. In seinen klaren Augen lag ein fast fanatisches Leuchten. „Träume!“, wiederholte er. Seine Stimme schwoll an und vibrierte vor Kraft. „Alle Dinge sind Träume, bevor sie Wirklichkeit werden. Die Welt selbst war ein Traum, bevor sie erschaffen wurde, ein Traum im Geist Gottes.“
Es war, als hätte er ein brennendes Brandzeichen unter sie geworfen. Dem König fiel die Kinnlade herunter; Talaveras Stirn war finster; Frey Juan sah verängstigt aus. Aber in jedem anderen Gesicht, auch in dem der Königin, erblickte Colon nur ein schmeichelhaftes Wunder, während er in Santangels vollen dunklen Augen einen Ausdruck warmer, amüsierter Zustimmung erhaschte.
Der König sprach, ausnahmsweise langsam. „Ich hoffe, Herr, dass Ihr nicht in der Hitze des Streits in Häresie abgleitet.“ Und wieder forderte sein Blick Talavera auf, das Wort zu ergreifen.
Der Prior des Prado schüttelte den Kopf, sein hageres Gesicht war abweisend.
„Ich entdecke keine Ketzerei. Nein. Und doch ...“ Er wandte sich direkt an Colon. „Ihr geht gefährlich tief, Herr.“
„Das ist meine Art, Herr Prior.“
„Unerschrocken angesichts der Gefahr?“, forderte der Mönch ihn streng heraus.
Colon war froh, dass der Priester die Frage gestellt hatte, denn wenn er dem Priester antwortete, konnte er seine Verachtung in Gelächter verwandeln, was er bei einer Antwort an den König nicht wagen würde. „Wenn ich mich leicht einschüchtern ließe, ehrwürdiger Herr, würde ich nicht anbieten, ins Unbekannte zu segeln und den Schrecken zu trotzen, mit denen der Aberglaube es füllt.“
Seine Hoheit hielt es für an der Zeit, der Audienz eine Frist zu setzen.
„Es ist nicht Eure Kühnheit, Herr, die in Zweifel steht“, sagte er, und der ruhige Kommentar hatte den Klang eines Vorwurfs. „Wenn das alles wäre, könnten wir Euch vielleicht einstellen. Aber so wie es aussieht, neige ich von Natur aus dazu, die Einschätzung eines Mannes bezüglich der von ihm angebotenen Waren nicht so schnell zu übernehmen.“
„Das ist nicht meine Meinung“, sagte die Königin. „Aber wir sollten das Projekt auch nicht ablehnen, weil wir es nicht beurteilen können. Meister Colon, seine Hoheit und ich werden uns beraten und die Ernennung einer Junta aus Gelehrten in Betracht ziehen, die eure Ansprüche prüfen und uns dazu beraten sollen.“
Wenn er daran dachte, wie es ihm in Portugal ergangen war, als er einer Junta gegenüberstand, die voller Gelehrsamkeit war und in der Unwissenheit über ihre Grenzen erstarrte, wurde Colon schwer ums Herz, hätte die Königin nicht hinzugefügt:
„Ich hoffe, Euch bald wiederzusehen, Meister Colon. Bis dahin bleibt Ihr am Hof. Mein Schatzmeister, Don Alonso de Quintanilla, wird die nötigen Anweisungen erhalten.“
Mit diesem Versprechen hatte er seine Entlassung angenommen, und wenn er auch mit weniger Selbstvertrauen ging, als er gekommen war, so konnte er doch zumindest die Gewissheit mit sich nehmen, dass er bei der Königin einen guten Eindruck hinterlassen hatte.
Dass er auch bei den anderen einen guten Eindruck hinterlassen hatte, sollte sich bald herausstellen. Zunächst war da Quintanilla, in dessen Haus er auf Geheiß der Königin untergebracht war und von dem er herzlich willkommen geheißen wurde. Es war mehr als nur seine Attraktivität, die die Gunst Quintanillas erlangte. Die Finanzen der beiden Königreiche waren durch den maurischen Krieg bis zur Erschöpfung aufgebraucht, und der Schatzmeister von Kastilien war in seiner Not, für Nachschub zu sorgen, stark bedrängt. Durch die Verschärfung der Judenverfolgung, die dem Heiligen Amt freie Hand bei der Verfolgung der elenden Konvertiten gab, die zum Judentum zurückkehrten und infolgedessen ihr Leben verloren und ihr Eigentum beschlagnahmt wurde, wurde das Staatsschiff prekär über Wasser gehalten. Um es weiter zu stützen, gab es die hohen Kredite, die von so großen Juden wie Abarbanel und Senior aufgenommen wurden, die verzweifelt versuchten, die größere Verfolgung abzuwenden, von der sie ahnten, dass sie durch Habgier bald ausgelöst werden könnte – eine Verfolgung, die sich nicht auf rückfällige Marranen beschränken sollte, die sich durch ihre Bekehrung zum Christentum der Gerichtsbarkeit des Heiligen Amtes unterworfen hatten, sondern in ihrem unbarmherzigen Schwung alle Kinder Israels einschließen sollte. Wenn diejenigen Erfolg hätten, die bereits jetzt die Herrscher drängten, die Vertreibung der Juden zu beschließen und sie gleichzeitig zu zwingen, ihr gesamtes Eigentum zurückzulassen, könnte der so erwirtschaftete Reichtum alle Schwierigkeiten lösen. Aber in der Zwischenzeit blieben die Schwierigkeiten, die den Schatzmeister von Kastilien plagten. Deshalb war er umso begieriger auf Nachrichten aus erster Hand über diesen Mann, der vorschlug, Spanien die riesige Schatzkammer des Ostens zu öffnen, und aufgrund seiner Hoffnungen umso bereiter, ihm Kredit und Unterstützung zu gewähren.