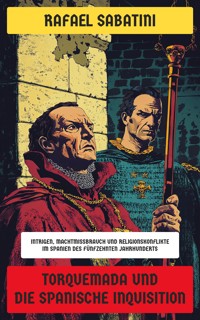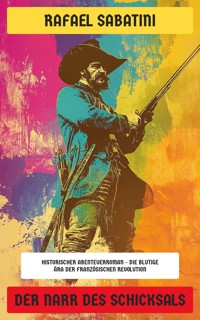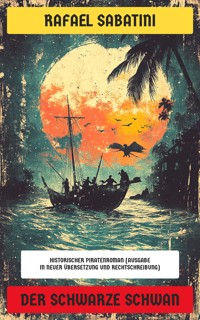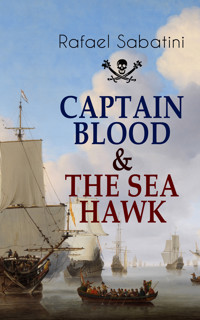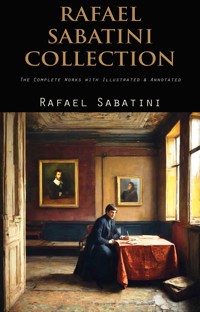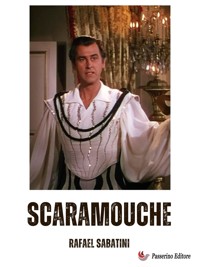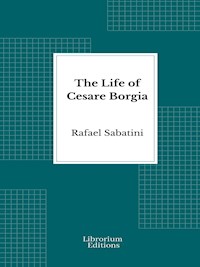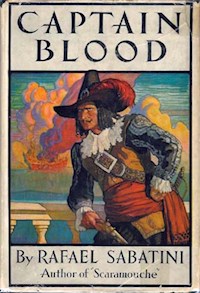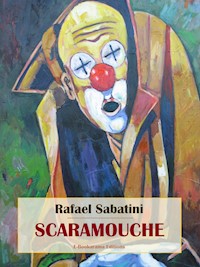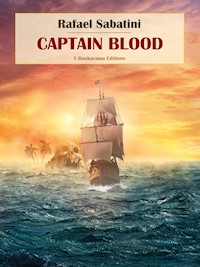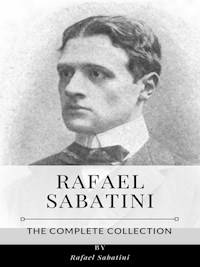2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Scaramouche" entführt Rafael Sabatini seine Leser in die turbulente Zeit der Französischen Revolution. Erzählt wird die Geschichte von André-Louis Moreau, einem brillanten Widerspruch und Schauspieler, der sich zwischen den politischen Turbulenzen und dem Sturm der Ideen für Freiheit und Gleichheit entfaltet. Sabatinis meisterhafte Prosa kombiniert historische Fakten mit fesselndem Drama und Pointiertheit, wodurch die Dynamik der Revolutionszeit lebendig wird. Der Roman verbindet Abenteuer mit einer tiefen Analyse von Identität und moralischer Verantwortung, was ihn zu einem herausragenden Werk der historischen Fiktion erhebt. Rafael Sabatini, ein angesehener italienischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, wurde für seine lebendige Erzählweise und tiefgründigen Charaktere bekannt. Seine Erfahrungen als Angehöriger einer Familie, die durch die politischen Umwälzungen Europas geprägt war, inspirierte ihn zu Geschehnissen wie der Erzählung des Moreau. Sabatinis Leidenschaft für das Theater und die Schwertkunst spiegelt sich in den fesselnden Kampfszenen und den kunstvoll gestalteten Dialogen des Romans wider. "Scaramouche" ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für die Epoche der Revolution, wie auch für Themen der Selbstfindung und des Widerstands interessieren. Dieser Roman lädt den Leser ein, sich in die emotionalen und politischen Konflikte einer bewegten Zeit einzutauchen und dabei die zeitlose Frage nach der eigenen Identität zu reflektieren. Ein Lesevergnügen von historischem Rang. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Scaramouche
Inhaltsverzeichnis
Buch IDie Amtstracht
Kapitel 1 Der Republikaner
Er wurde mit der Gabe des Lachens und dem Gefühl geboren, dass die Welt verrückt sei. Und das war sein ganzes Erbe. Seine Vaterschaft war unklar, obwohl das Dorf Gavrillac die Wolke des Geheimnisses, die über ihm hing, längst vertrieben hatte. Diese einfachen Leute aus der Bretagne waren nicht so einfach gestrickt, dass sie sich von einer vorgetäuschten Verwandtschaft täuschen ließen, die nicht einmal den Vorzug der Originalität besaß. Wenn ein Adliger ohne ersichtlichen Grund verkündet, dass er der Pate eines Säuglings ist, von dem niemand weiß, woher er stammt, und sich anschließend um die Erziehung und Ausbildung des Jungen kümmert, dann verstehen selbst die einfachsten Landbewohner die Situation vollkommen. Und so machten sich die guten Leute von Gavrillac keine Illusionen über die tatsächliche Beziehung zwischen Andre-Louis Moreau – wie der Junge genannt wurde – und Quintin de Kercadiou, dem Herrn von Gavrillac, der in dem großen grauen Haus wohnte, das das darunter liegende Dorf überragte.
Andre-Louis hatte in der Dorfschule lesen und schreiben gelernt und wohnte bei dem alten Rabouillet, dem Anwalt, der sich in seiner Funktion als Finanzintendant um die Angelegenheiten von M. de Kercadiou kümmerte. Danach wurde er im Alter von fünfzehn Jahren nach Paris geschickt, um am Lycée Louis-le-Grand Jura zu studieren, was er nun in Zusammenarbeit mit Rabouillet praktizieren konnte. All dies auf Kosten seines Patenonkels, M. de Kercadiou, der ihn erneut unter die Obhut von Rabouillet stellte, um ganz klar für seine Zukunft vorzusorgen.
Andre-Louis seinerseits hatte das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Ihr seht ihn im Alter von vierundzwanzig Jahren, vollgestopft mit Wissen, das bei einem gewöhnlichen Menschen zu einer intellektuellen Verdauungsstörung führen würde. Durch sein eifriges Studium des Menschen, von Thukydides bis zu den Enzyklopädisten, von Seneca bis Rousseau, hatte er seine frühesten bewussten Eindrücke vom allgemeinen Wahnsinn seiner eigenen Spezies zu einer unangreifbaren Überzeugung gefestigt. Ich kann auch nicht erkennen, dass irgendetwas in seinem ereignisreichen Leben ihn jemals dazu veranlasst hätte, in dieser Meinung zu schwanken.
Körperlich war er ein schmächtiger Kerl, kaum größer als mittelgroß, mit einem hageren, scharfsinnigen Gesicht, einer hervorstehenden Nase und Wangenknochen und mit schütterem, schwarzem Haar, das fast bis zu seinen Schultern reichte. Sein Mund war lang, mit dünnen Lippen und humorvoll. Er wurde nur durch die Pracht eines Paares immer suchender, leuchtender Augen, die so dunkel waren, dass sie fast schwarz waren, von der Hässlichkeit erlöst. Von der skurrilen Qualität seines Geistes und seiner seltenen Gabe des anmutigen Ausdrucks zeugen seine Schriften – leider nur spärlich – und insbesondere seine Bekenntnisse. Er war sich seiner Rednergabe noch kaum bewusst, obwohl er in der Literarischen Kammer von Rennes bereits einen gewissen Ruhm erlangt hatte – einem jener Clubs, die inzwischen im ganzen Land allgegenwärtig waren und in denen sich die intellektuelle Jugend Frankreichs versammelte, um die neuen Philosophien zu studieren und zu diskutieren, die das gesellschaftliche Leben durchdrangen. Aber der Ruhm, den er sich dort erworben hatte, war kaum beneidenswert. Er war zu spitzbübisch, zu bissig, zu sehr geneigt – so dachten seine Kollegen – ihre erhabenen Theorien zur Erneuerung der Menschheit lächerlich zu machen. Er selbst protestierte, dass er sie lediglich den Spiegel der Wahrheit vorhielte und dass es nicht seine Schuld sei, wenn sie lächerlich aussähen, wenn man sie sich vor Augen halte.
Alles, was er damit erreichte, war, dass er die Gemüter erhitzte; und sein Ausschluss aus einer Gesellschaft, die ihm gegenüber misstrauisch geworden war, wäre bereits erfolgt, wenn nicht sein Freund Philippe de Vilmorin, ein Göttlichkeitsstudent aus Rennes, der selbst eines der beliebtesten Mitglieder der Literarischen Kammer war, gewesen wäre.
Als Philippe an einem Novembermorgen nach Gavrillac kam, beladen mit Nachrichten über die politischen Stürme, die sich damals über Frankreich zusammenbrauten, fand er in diesem verschlafenen bretonischen Dorf einen Anlass, der seine ohnehin schon lebhafte Empörung noch steigerte. Ein Bauer aus Gavrillac namens Mabey war an diesem Morgen in den Wäldern von Meupont auf der anderen Seite des Flusses von einem Wildhüter des Marquis de La Tour d'Azyr erschossen worden. Der Unglückliche war dabei erwischt worden, wie er einen Fasan aus einer Schlinge nahm, und der Wildhüter hatte auf ausdrücklichen Befehl seines Herrn gehandelt.
Wütend über eine so absolute und gnadenlose Tyrannei schlug M. de Vilmorin vor, die Angelegenheit M. de Kercadiou vorzulegen. Mabey war ein Vasall von Gavrillac, und Vilmorin hoffte, den Herrn von Gavrillac dazu zu bewegen, zumindest eine gewisse Entschädigung für die Witwe und die drei Waisen zu fordern, die diese brutale Tat hinterlassen hatte.
Aber da André-Louis Philippes bester Freund war – fast wie ein Bruder – suchte der junge Seminarist ihn als erstes auf. Er fand ihn allein beim Frühstück im langen, niedrigen, weiß getäfelten Speisesaal von Rabouillets Haus – dem einzigen Zuhause, das André-Louis je gekannt hatte – und nachdem er ihn umarmt hatte, machte er ihn mit seiner Verurteilung von Herr de La Tour d'Azyr sprachlos.
„Ich habe bereits davon gehört“, sagte Andre-Louis.
„Du sprichst, als hätte dich die Sache nicht überrascht“, warf ihm sein Freund vor.
„Nichts Tierisches kann mich überraschen, wenn es von einem Tier getan wird. Und La Tour d'Azyr ist ein Tier, wie alle Welt weiß. Mabey ist ein Narr, weil er seine Fasane gestohlen hat. Er hätte die von jemand anderem stehlen sollen.“
„Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?“
„Was gibt es da noch zu sagen? Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch, hoffe ich.“
„Was es noch zu sagen gibt, werde ich deinem Patenonkel, M. de Kercadiou, sagen. Ich werde ihn um Gerechtigkeit bitten.“
„Gegen Herrn de La Tour d'Azyr?“ Andre-Louis hob die Augenbrauen.
„Warum nicht?“
„Mein lieber naiver Philippe, Hunde beißen keine Hunde.“
„Du bist ungerecht gegenüber deinem Patenonkel. Er ist ein humaner Mensch.“
„Oh, so menschlich, wie du es dir wünschst. Aber hier geht es nicht um Menschlichkeit. Es geht um die Jagdgesetze.“
M. de Vilmorin warf seine langen Arme angewidert gen Himmel. Er war ein großer, schlanker junger Herr, ein oder zwei Jahre jünger als Andre-Louis. Er war sehr schlicht in Schwarz gekleidet, wie es sich für einen Seminaristen gehörte, mit weißen Bändern an Handgelenken und Hals und silbernen Schnallen an den Schuhen. Sein ordentlich gescheiteltes braunes Haar war unschuldig von Puder.
„Du redest wie ein Anwalt“, fuhr er ihn an.
„Natürlich. Aber verschwende deinen Ärger nicht an mich. Sag mir, was ich tun soll.“
„Ich möchte, dass du mit mir zu M. de Kercadiou gehst und deinen Einfluss nutzt, um Gerechtigkeit zu erlangen. Ich nehme an, ich verlange zu viel.“
„Mein lieber Philippe, ich bin dazu da, dir zur Seite zu stehen. Ich warne dich, dass es ein aussichtsloses Unterfangen ist; aber lass mich mein Frühstück zu Ende essen, und ich stehe dir zur Verfügung.“
M. de Vilmorin ließ sich in einen Ohrensessel am gut gefegten Kamin fallen, auf dem ein Stapel Kiefernholzscheite fröhlich brannte. Und während er nun wartete, berichtete er seinem Freund von den neuesten Nachrichten über die Ereignisse in Rennes. Jung, leidenschaftlich, enthusiastisch und von utopischen Idealen beseelt, prangerte er leidenschaftlich die rebellische Haltung der Privilegierten an.
André-Louis, der bereits genau über die Stimmung in den Reihen eines Ordens informiert war, an dessen Beratungen er als Vertreter eines Adligen teilnahm, war von dem, was er hörte, keineswegs überrascht. Herr de Vilmorin fand es ärgerlich, dass sein Freund sich offenbar weigerte, seine eigene Empörung zu teilen.
„Siehst du nicht, was das bedeutet?“, rief er. „Indem die Adligen dem König nicht gehorchen, greifen sie die Grundfesten des Throns an. Erkennen sie nicht, dass ihre bloße Existenz davon abhängt; dass, wenn der Thron fällt, diejenigen, die ihm am nächsten stehen, zerschmettert werden? Sehen sie das nicht?“
„Offensichtlich nicht. Sie sind nur regierende Klassen, und ich habe noch nie von regierenden Klassen gehört, die für etwas anderes als ihren eigenen Profit Augen haben.“
„Das ist unser Missstand. Das ist es, was wir ändern werden.“
„Ihr wollt die regierenden Klassen abschaffen? Ein interessantes Experiment. Ich glaube, es war der ursprüngliche Plan der Schöpfung, und es hätte gelingen können, wenn Kain nicht gewesen wäre.“
„Was wir tun werden“, sagte M. de Vilmorin, der seine Verärgerung zügelte, „ist, die Regierung in andere Hände zu legen.“
„Und du glaubst, das wird etwas ändern?“
„Ich weiß es.“
„Ah! Ich nehme an, dass du, da du jetzt in geringerem Maße tätig bist, bereits das Vertrauen des Allmächtigen besitzt. Er wird dir seine Absicht anvertraut haben, das Muster der Menschheit zu ändern.“
M. de Vilmorins feines asketisches Gesicht verdunkelte sich. „Du bist profan, Andre“, tadelte er seinen Freund.
"Ich versichere dir, dass ich es ernst meine. Um das zu tun, was du andeutest, wäre nichts weniger als ein göttliches Eingreifen erforderlich. Du musst den Menschen ändern, nicht die Systeme. Kannst du und unsere dampfenden Freunde von der Literarischen Kammer von Rennes oder irgendeine andere gelehrte Gesellschaft Frankreichs ein Regierungssystem entwerfen, das noch nie ausprobiert wurde? Sicherlich nicht. Und können sie von irgendeinem ausprobierten System sagen, dass es sich am Ende als etwas anderes als ein Fehlschlag erwiesen hat? Mein lieber Philippe, die Zukunft lässt sich nur mit Gewissheit aus der Vergangenheit ablesen. Ab actu ad posse valet consecutio. Der Mensch ändert sich nie. Er ist immer gierig, immer habgierig, immer niederträchtig. Ich spreche vom Menschen in der Masse.
„Glaubt Ihr, es sei unmöglich, das Los des Volkes zu verbessern?“, forderte ihn M. de Vilmorin heraus.
„Wenn du sagst, das Volk, meinst du natürlich die Bevölkerung. Willst du sie abschaffen? Das ist der einzige Weg, ihr Los zu verbessern, denn solange sie Bevölkerung bleibt, wird ihr Los verdammt sein.“
„Du argumentierst natürlich für die Seite, die dich beschäftigt. Das ist wohl nur natürlich.“ M. de Vilmorin sprach zwischen Trauer und Empörung.
„Im Gegenteil, ich versuche, mit absoluter Distanz zu argumentieren. Lassen Sie uns Ihre Ideen auf die Probe stellen. Welche Regierungsform streben Sie an? Eine Republik, so lässt sich aus dem, was Sie gesagt haben, schließen. Nun, die haben Sie bereits. Frankreich ist heute in Wirklichkeit eine Republik.“
Philippe starrte ihn an. „Ich finde, das ist paradox. Was ist mit dem König?“
„Der König? Die ganze Welt weiß, dass es in Frankreich seit Ludwig XIV. keinen König mehr gibt. Es gibt einen fettleibigen Herrn in Versailles, der die Krone trägt, aber allein die Nachrichten, die du mitbringst, zeigen, wie wenig er wirklich zählt. Es sind die Adligen und Geistlichen, die an den hohen Stellen sitzen und das französische Volk unter ihren Füßen eingespannt haben, die die wahren Herrscher sind. Deshalb sage ich, dass Frankreich eine Republik ist; sie ist eine Republik, die nach dem besten Vorbild aufgebaut ist – dem römischen Vorbild. Damals wie heute gab es große Patrizierfamilien, die in Luxus lebten und sich Macht und Reichtum und alles, was sonst noch als wertvoll erachtet wurde, sicherten. Und es gab die Bevölkerung, die in den römischen Zwingern niedergedrückt wurde und stöhnte, schwitzte, blutete, verhungerte und zugrunde ging. Das war eine Republik; die mächtigste, die wir je gesehen haben.“
Philippe bemühte sich, seine Ungeduld zu zügeln. „Du wirst doch zugeben – du hast es ja zugegeben –, dass wir nicht schlechter regiert werden könnten als wir es sind?“
„Darum geht es nicht. Es geht darum, ob wir besser regiert werden könnten, wenn wir die derzeitige herrschende Klasse durch eine andere ersetzen würden? Ohne eine Garantie dafür wäre ich der Letzte, der auch nur einen Finger rühren würde, um eine Veränderung zu bewirken. Und welche Garantien könnt Ihr geben? Welche Klasse strebt nach der Regierung? Ich sage es Euch. Die Bourgeoisie.“
„Was?“
„Das überrascht dich, was? Die Wahrheit ist oft beunruhigend. Du hast nicht daran gedacht? Dann denk jetzt darüber nach. Schau dir dieses Manifest von Nantes genau an. Wer sind die Verfasser?“
„Ich kann dir sagen, wer es war. Die Stadtverwaltung von Nantes war gezwungen, es dem König zu schicken. Etwa zehntausend Arbeiter – Schiffsbauer, Weber, Arbeiter und Handwerker aller Art.“
„Angeregt, dazu getrieben, von ihren Arbeitgebern, den wohlhabenden Händlern und Reedern dieser Stadt“, antwortete André-Louis. „Ich habe die Angewohnheit, Dinge aus nächster Nähe zu betrachten, weshalb mich unsere Kollegen von der Literarischen Kammer in Debatten so sehr ablehnen. Wo ich tief grabe, streifen sie nur die Oberfläche. Hinter diesen Arbeitern und Handwerkern von Nantes, die sie beraten und diese armen, dummen, unwissenden Arbeiter dazu drängen, ihr Blut bei der Verfolgung des Willens der Fackel der Freiheit zu vergießen, stehen die Segelmacher, die Spinner, die Reeder und die Sklavenhändler. Die Sklavenhändler! Die Männer, die vom Handel mit menschlichem Fleisch und Blut in den Kolonien leben und reich werden, führen zu Hause eine Kampagne im heiligen Namen der Freiheit durch! Seht ihr nicht, dass die ganze Bewegung eine Bewegung von Krämern und Händlern und hausierenden Vasallen ist, die durch Reichtum aufgeblasen sind und die Macht beneiden, die allein in der Geburt liegt? Die Geldwechsler in Paris, die die Anleihen der Staatsschulden halten, zittern bei dem Gedanken, dass es in der Macht eines einzelnen Mannes liegen könnte, die Schulden durch Bankrott zu streichen, angesichts der prekären finanziellen Lage des Staates. Um sich abzusichern, graben sie sich unterirdisch, um einen Staat zu stürzen und auf seinen Ruinen einen neuen aufzubauen, in dem sie die Herren sein werden. Und um dies zu erreichen, hetzen sie das Volk auf. Schon in Dauphiny haben wir gesehen, wie Blut wie Wasser floss – das Blut der Bevölkerung, immer das Blut der Bevölkerung. Jetzt in der Bretagne könnten wir Ähnliches erleben. Und wenn sich am Ende die neuen Ideen durchsetzen? Wenn die Herrschaft der Feudalherren gestürzt wird, was dann? Ihr werdet eine Aristokratie gegen eine Plutokratie eingetauscht haben. Lohnt sich das? Glaubt Ihr, dass unter Geldwechslern und Sklavenhändlern und Männern, die auf andere Weise durch die unedlen Künste des Kaufens und Verkaufens reich geworden sind, das Los des Volkes besser sein wird als unter ihren Priestern und Adligen? Ist Euch jemals in den Sinn gekommen, Philippe, was die Herrschaft der Adligen so unerträglich macht? Habgier. Habgier ist der Fluch der Menschheit. Und solltet ihr weniger Habgier von Männern erwarten, die sich durch Habgier aufgebaut haben? Oh, ich bin bereit zuzugeben, dass die gegenwärtige Regierung abscheulich, ungerecht, tyrannisch ist – was auch immer ihr wollt; aber ich bitte euch, nach vorne zu schauen und zu sehen, dass die Regierung, für die sie ausgetauscht werden soll, unendlich viel schlimmer sein könnte.“
Philippe saß einen Moment lang nachdenklich da. Dann griff er erneut an.
„Ihr sprecht nicht von den Missbräuchen, den schrecklichen, unerträglichen Machtmissbräuchen, unter denen wir derzeit leiden.“
„Wo Macht ist, wird sie immer missbraucht werden.“
„Nicht, wenn die Amtszeit von einer gerechten Verwaltung abhängt.“
„Die Amtszeit ist Macht. Wir können denen, die sie innehaben, nichts vorschreiben.“
„Das Volk kann es – das Volk in seiner Macht.“
"Ich frage dich wieder: Wenn du sagst, das Volk, meinst du dann die Bevölkerung? Du tust es. Welche Macht kann die Bevölkerung ausüben? Sie kann wild werden. Sie kann eine Zeit lang brennen und töten. Aber dauerhafte Macht kann sie nicht ausüben, denn Macht erfordert Eigenschaften, die die Bevölkerung nicht besitzt, sonst wäre sie keine Bevölkerung. Die unvermeidliche, tragische Folge der Zivilisation ist die Bevölkerung. Im Übrigen können Missstände durch Gerechtigkeit korrigiert werden; und Gerechtigkeit, wenn sie nicht bei den Erleuchteten zu finden ist, ist nirgendwo zu finden. M. Necker soll sich daran machen, Missstände zu korrigieren und Privilegien einzuschränken. Das steht fest. Zu diesem Zweck sollen die Generalstände zusammentreten.
„Und wir haben einen vielversprechenden Anfang in der Bretagne gemacht, so wahr mich der Himmel hört!“, rief Philippe.
„Pah! Das ist nichts. Natürlich werden die Adligen nicht kampflos aufgeben. Es ist ein vergeblicher und lächerlicher Kampf – aber andererseits ... liegt es wohl in der menschlichen Natur, vergeblich und lächerlich zu sein.“
M. de Vilmorin wurde vernichtend sarkastisch. „Wahrscheinlich wirst du auch die Erschießung von Mabey als sinnlos und lächerlich bezeichnen. Ich sollte sogar bereit sein, dich den Marquis de La Tour d'Azyr verteidigen zu hören, dass sein Wildhüter gnädig war, als er Mabey erschoss, denn die Alternative wäre eine lebenslange Haftstrafe auf den Galeeren gewesen.“
Andre-Louis trank den Rest seiner Schokolade aus, stellte seine Tasse ab und schob seinen Stuhl zurück, da er mit dem Frühstück fertig war.
„Ich gestehe, dass ich nicht deine große Nächstenliebe besitze, mein lieber Philippe. Ich bin von Mabeys Schicksal gerührt. Aber nachdem ich den Schock über diese Nachricht für meine Gefühle überwunden habe, vergesse ich nicht, dass Mabey schließlich ein Dieb war, als er seinen Tod fand.“
M. de Vilmorin richtete sich in seiner Empörung auf.
„Das ist die Sichtweise, die man von jemandem erwarten kann, der stellvertretender Finanzintendant eines Adligen und Abgeordneter eines Adligen in den Ständen der Bretagne ist.“
„Philippe, ist das gerecht? Du bist wütend auf mich!“, rief er in echter Sorge.
„Ich bin verletzt“, gab Vilmorin zu. „Ich bin zutiefst verletzt von deiner Einstellung. Und ich bin nicht der Einzige, der deine reaktionären Tendenzen missbilligt. Weißt du, dass die Literarische Kammer ernsthaft über deinen Ausschluss nachdenkt?“
Andre-Louis zuckte mit den Schultern. „Das überrascht und beunruhigt mich nicht.“
M. de Vilmorin fuhr leidenschaftlich fort: „Manchmal denke ich, dass du kein Herz hast. Bei dir geht es immer um das Gesetz, nie um Gerechtigkeit. Mir kommt der Gedanke, Andre, dass es ein Fehler war, zu dir zu kommen. Du wirst mir bei meinem Gespräch mit M. de Kercadiou wahrscheinlich nicht helfen können.“ Er nahm seinen Hut und hatte offensichtlich die Absicht zu gehen.
Andre-Louis sprang auf und hielt ihn am Arm fest.
„Ich schwöre dir“, sagte er, „dass ich mich nie wieder dazu herablasse, mit dir über Recht oder Politik zu sprechen, Philippe. Ich liebe dich zu sehr, um mit dir über die Angelegenheiten anderer Männer zu streiten.“
„Aber ich mache sie zu meinen eigenen“, beharrte Philippe vehement.
„Natürlich tust du das, und dafür liebe ich dich. Das ist auch richtig so. Du wirst Priester, und die Angelegenheiten aller sind die Angelegenheiten eines Priesters. Ich hingegen bin Anwalt – der Finanzintendant eines Adligen, wie du sagst – und die Angelegenheiten eines Anwalts sind die Angelegenheiten seines Klienten. Das ist der Unterschied zwischen uns. Trotzdem wirst du mich nicht abschütteln können.“
„Aber ich sage dir ganz offen, jetzt, wo ich darüber nachdenke, wäre es mir lieber, du hättest M. de Kercadiou nicht bei mir gesehen. Deine Pflicht gegenüber deinem Mandanten kann mir keine Hilfe sein.“
Sein Zorn war verraucht, aber seine Entschlossenheit blieb fest, basierend auf dem Grund, den er angab.
„Sehr gut“, sagte Andre-Louis. „Es soll so sein, wie du es wünschst. Aber nichts soll mich daran hindern, zumindest mit dir bis zum Schloss zu gehen und auf dich zu warten, während du M. de Kercadiou um Hilfe bittest.“
Und so verließen sie das Haus als gute Freunde, denn die Liebenswürdigkeit von Herr de Vilmorins Wesen ließ keinen Groll zu, und gemeinsam machten sie sich auf den Weg die steile Hauptstraße von Gavrillac hinauf.
Kapitel 2 Der Aristokrat
Das verschlafene Dorf Gavrillac, eine halbe Meile von der Hauptstraße nach Rennes entfernt und daher vom Verkehr der Welt unberührt, lag in einer Biegung des Flusses Meu am Fuße des flachen Hügels, der von dem gedrungenen Herrenhaus gekrönt wurde, und erstreckte sich bis zur Hälfte des Hangs. Nachdem Gavrillac seinen Lehnsherrn mit Abgaben an die Kirche, Zehnten und Steuern an den König teilweise in Geld und teilweise in Form von Diensten bezahlt hatte, war es schwer, mit dem, was übrig blieb, Leib und Seele zusammenzuhalten. Doch so hart die Bedingungen in Gavrillac auch waren, sie waren nicht so hart wie in vielen anderen Teilen Frankreichs, nicht halb so hart wie zum Beispiel bei den elenden Lehnsleuten des großen Herrn von La Tour d'Azyr, dessen riesiger Besitz an einem Punkt durch das Wasser des Meu von diesem kleinen Dorf getrennt war.
Das Chateau de Gavrillac verdankte seine herrschaftliche Ausstrahlung, die man ihm zuschreiben könnte, eher seiner beherrschenden Stellung über dem Dorf als irgendetwas Eigenem. Wie der gesamte Rest von Gavrillac aus Granit erbaut, wenn auch durch sein rund drei Jahrhunderte währendes Bestehen etwas verwittert, handelte es sich um ein gedrungenes, zweistöckiges Gebäude mit flacher Front, das jeweils von vier Fenstern mit äußeren Holzläden beleuchtet wurde und an beiden Enden von zwei quadratischen Türmen oder Pavillons mit Dächern mit Feuerlöschern flankiert wurde. Weit hinten in einem Garten gelegen, der jetzt kahl, aber im Sommer sehr angenehm war, und direkt davor eine schöne geschwungene Terrasse mit Balustrade, sah es aus, was es tatsächlich war, und war es immer gewesen, das Wohnhaus von unprätentiösen Leuten, die mehr Interesse an der Landwirtschaft als an Abenteuern hatten.
Quintin de Kercadiou, Lord of Gavrillac – Seigneur de Gavrillac war der vage Titel, den er trug, wie ihn schon seine Vorfahren vor ihm getragen hatten, von denen niemand wusste, woher oder wie sie kamen – bestätigte den Eindruck, den sein Haus vermittelte. Rau wie der Granit selbst, hatte er nie die Erfahrung von Höfen gesucht, hatte nicht einmal in den Armeen seines Königs gedient. Er überließ es seinem jüngeren Bruder Etienne, die Familie in diesen erhabenen Sphären zu vertreten. Seine eigenen Interessen hatten sich von frühester Jugend an auf seine Wälder und Weiden konzentriert. Er jagte und bewirtschaftete seine Äcker, und oberflächlich betrachtet schien er kaum besser zu sein als jeder seiner rustikalen Halbpächter. Er führte keinen Stand, oder zumindest keinen Stand, der seiner Position oder dem Geschmack seiner Nichte Aline de Kercadiou entsprach. Aline, die unter der Ägide ihres Onkels Etienne etwa zwei Jahre in der höfischen Atmosphäre von Versailles verbracht hatte, hatte ganz andere Vorstellungen von dem, was der Würde eines Seigneur angemessen war, als ihr Onkel Quintin. Aber obwohl dieses einzige Kind eines dritten Kercadiou seit sie im Alter von vier Jahren Vollwaise wurde, eine tyrannische Herrschaft über den Herrn von Gavrillac ausübte, der ihr Vater und Mutter gewesen war, war es ihr noch nie gelungen, seine Sturheit in dieser Hinsicht zu brechen. Sie war noch nicht verzweifelt – Beharrlichkeit war eine dominante Eigenschaft in ihrem Charakter – obwohl sie seit ihrer Rückkehr aus der großen Welt von Versailles vor etwa drei Monaten unermüdlich und erfolglos gearbeitet hatte.
Sie ging auf der Terrasse spazieren, als Andre-Louis und M. de Vilmorin eintrafen. Ihr schlanker Körper war in einen weißen Pelzmantel gehüllt, um sich vor der kalten Luft zu schützen; ihr Kopf war von einer eng anliegenden Haube mit weißem Pelzbesatz umhüllt. Sie war mit einem Knoten aus hellblauem Band rechts am Kinn festgebunden; links war eine lange Strähne maisfarbenen Haars herausgefallen. Die scharfe Luft hatte ihre Wangen so stark gepeitscht, wie sie ihr präsentiert wurden, und schien den Augen, die von dunkelstem Blau waren, noch mehr Glanz zu verleihen.
Andre-Louis und Herr de Vilmorin waren ihr seit ihrer Kindheit bekannt. Die drei waren einmal Spielkameraden gewesen, und Andre-Louis – angesichts seiner spirituellen Beziehung zu ihrem Onkel – nannte sie ihren Cousin. Die verwandtschaftliche Beziehung zwischen den beiden hatte lange Zeit bestanden, nachdem Philippe de Vilmorin der früheren Intimität entwachsen war und für sie zu Herr de Vilmorin geworden war.
Sie winkte ihnen zur Begrüßung zu, als sie näher kamen, und stand – ein bezauberndes Bild, dessen sie sich voll bewusst war – am Ende der Terrasse, die der kurzen Allee, auf der sie sich näherten, am nächsten lag, um sie zu erwarten.
„Wenn ihr Herr, meinen Onkel, besuchen wollt, kommt ihr ungelegen, Messieurs“, sagte sie mit einer gewissen Aufregung in der Stimme. „Er ist sehr – ach, sehr beschäftigt.“
„Wir werden warten, Fräulein“, sagte M. de Vilmorin und verbeugte sich galant über die Hand, die sie ihm reichte. „Wer würde schon zu seinem Onkel eilen, wenn er noch einen Moment mit seiner Nichte verweilen kann?“
„M. l'Abbé“, neckte sie ihn, „wenn Sie in der richtigen Stimmung sind, werde ich Sie zu meinem Beichtvater machen. Sie haben ein so bereites und verständnisvolles Gemüt.“
„Aber keine Neugierde“, sagte Andre-Louis. „Daran hast du nicht gedacht.“
„Ich frage mich, was du meinst, Cousin Andre.“
„Nun, das darfst du“, lachte Philippe. „Denn niemand weiß es.“ Und dann fiel sein Blick über die Terrasse und blieb auf einer Kutsche hängen, die vor der Tür des Schlosses stand. Es war ein Fahrzeug, wie man es oft in den Straßen einer Großstadt, aber selten auf dem Land sah. Es war ein wunderschön gefedertes Zweispänner-Cabriolet aus Walnussholz, das mit einer Lackschicht wie eine Glasscheibe überzogen war und auf dessen Türverkleidungen kleine, kunstvoll gemalte Hirtenszenen zu sehen waren. Es war für zwei Personen ausgelegt, mit einem Kutschbock für den Kutscher vorne und einer Tribüne für den Diener hinten. Diese Tribüne war leer, aber der Diener schritt vor der Tür auf und ab, und als er nun hinter dem Fahrzeug hervorkam und in den Blickbereich von M. de Vilmorin trat, trug er die prächtige blau-goldene Livree des Marquis de La Tour d'Azyr.
„Was!“, rief er aus. „Ist es Herr de La Tour d'Azyr, der bei Eurem Onkel ist?“
„Ja, mein Herr“, sagte sie mit geheimnisvoller Stimme und geheimnisvollen Augen, von denen Herr de Vilmorin nichts bemerkte.
„Ah, pardon!“ Er verbeugte sich tief und hielt den Hut in der Hand. „Serviteur, Fräulein“, und er wandte sich ab, um zum Haus zu gehen.
„Soll ich mitkommen, Philippe?“, rief Andre-Louis ihm nach.
„Es wäre unhöflich anzunehmen, dass du es vorziehen würdest“, sagte M. de Vilmorin mit einem Blick auf die Fräulein. „Ich glaube auch nicht, dass es zur Seite stehen würde. Wenn du warten würdest ...“
Herr de Vilmorin ging davon. Die Fräulein lachte nach einer kurzen Pause schallend. „Wohin geht er denn so eilig?“
„Zum Herr de La Tour d'Azyr und auch zu deinem Onkel, würde ich sagen.“
„Aber das geht nicht. Sie können ihn nicht empfangen. Habe ich nicht gesagt, dass sie sehr eng miteinander verbunden sind? Du fragst mich nicht, warum, Andre.“ Sie hatte etwas Geheimnisvolles an sich, etwas Verborgenes, das vielleicht Freude oder Belustigung oder vielleicht beides war. Andre-Louis konnte es nicht bestimmen.
„Da ihr offensichtlich alle darauf brennt, es mir zu erzählen, warum sollte ich dann fragen?“, sagte er.
„Wenn du bissig bist, werde ich es dir nicht sagen, selbst wenn du fragst. Oh doch, das werde ich. Es wird dich lehren, mich mit dem Respekt zu behandeln, der mir gebührt.“
„Ich hoffe, dass mir das nie misslingt.“
„Weniger denn je, wenn du erfährst, dass ich sehr eng in den Besuch von M. de La Tour d'Azyr involviert bin. Ich bin das Ziel dieses Besuchs.“ Und sie sah ihn mit funkelnden Augen und vor Lachen geöffneten Lippen an.
„Der Rest, so scheint es, ist offensichtlich. Aber ich bin ein Dummkopf, wenn du so willst; denn für mich ist es nicht offensichtlich.“
„Warum, Dummkopf, er kommt, um um meine Hand anzuhalten.“
„Gütiger Gott!“, sagte Andre-Louis und starrte sie niedergeschlagen an.
Sie wich ein wenig vor ihm zurück, runzelte die Stirn und hob das Kinn. „Überrascht dich das?“
„Es widert mich an“, sagte er unverblümt. „Tatsächlich glaube ich es nicht. Du amüsierst dich mit mir.“
Für einen Moment legte sie ihr sichtbares Ärgernis beiseite, um seine Zweifel zu zerstreuen. „Ich meine es durchaus ernst, Herr. Heute Morgen erhielt mein Onkel ein formelles Schreiben von Herr de La Tour d'Azyr, in dem der Besuch und sein Zweck angekündigt wurden. Ich will nicht sagen, dass es uns nicht ein wenig überrascht hat ...“
„Oh, ich verstehe“, rief André-Louis erleichtert. „Ich verstehe. Einen Moment lang hatte ich fast befürchtet ...“ Er brach ab, sah sie an und zuckte mit den Schultern.
„Warum hörst du auf? Du hattest fast befürchtet, dass Versailles an mir verschwendet worden wäre. Dass ich zulassen würde, dass um mich geworben wird wie um irgendeine Dorfmagd. Das war dumm von dir. Ich werde in angemessener Form umworben, von meinem Onkel.“
„Ist seine Zustimmung also alles, was zählt, nach Versailles?“
„Was sonst noch?“
„Da ist deine eigene.“
Sie lachte. „Ich bin eine pflichtbewusste Nichte . . . wenn es mir passt.“
„Und wäre es dir genehm, pflichtbewusst zu sein, wenn dein Onkel diesen ungeheuerlichen Vorschlag annimmt?“
„Ungeheuerlich!“ Sie bremste sich. „Und warum ungeheuerlich, wenn ich fragen darf?“
„Aus einer Reihe von Gründen“, antwortete er gereizt.
„Nenne mir einen“, forderte sie ihn heraus.
„Er ist doppelt so alt wie du.“
„So viel nun auch wieder nicht“, sagte sie.
„Er ist mindestens fünfundvierzig.“
„Aber er sieht nicht älter als dreißig aus. Er ist sehr gutaussehend – das wirst du zugeben; und du wirst auch nicht leugnen, dass er sehr wohlhabend und sehr mächtig ist; der größte Adlige in der Bretagne. Er wird mich zu einer großen Dame machen.“
„Gott hat dich dazu gemacht, Aline.“
„Komm, das ist besser. Manchmal kannst du fast höflich sein.“ Und sie ging die Terrasse entlang, während André-Louis neben ihr auf und ab ging.
„Ich kann mehr sein, um dir zu zeigen, warum du nicht zulassen solltest, dass dieses Biest das Schöne, das Gott geschaffen hat, befleckt.“
Sie runzelte die Stirn und ihre Lippen wurden schmaler. „Du sprichst von meinem zukünftigen Ehemann“, tadelte sie ihn.
Auch seine Lippen wurden schmaler, und sein blasses Gesicht wurde noch bleicher.
„Und ist es so? Ist es beschlossene Sache? Dein Onkel ist einverstanden? Du wirst also ohne Liebe an einen Mann verkauft, den du nicht kennst, und wirst ihm hörig sein. Ich hatte mir Besseres für dich erträumt, Aline.“
„Besser als Marquise de La Tour d'Azyr zu sein?“
Er machte eine Geste der Verzweiflung. "Sind Männer und Frauen nichts weiter als Namen? Zählen ihre Seelen nichts? Gibt es keine Freude im Leben, kein Glück, dass Reichtum und Vergnügen und leere, hochtrabende Titel die einzigen Ziele sind? Ich hatte dich hoch gesetzt – so hoch, Aline – eine Sache, die auf Erden selten ist. In deinem Herzen ist Freude, in deinem Geist ist Intelligenz; und, wie ich dachte, die Vision, die Hülsen und Täuschungen durchdringt, um den Kern der Realität für sich zu beanspruchen. Doch du wirst alles für ein Stück Scheinwelt aufgeben. Du wirst deine Seele und deinen Körper verkaufen, um Marquise de La Tour d'Azyr zu werden.
„Du bist taktlos“, sagte sie, und obwohl sie die Stirn runzelte, lachten ihre Augen. „Und du ziehst voreilige Schlüsse. Mein Onkel wird nicht mehr zustimmen, als zu erlauben, dass meine Zustimmung eingeholt wird. Wir verstehen uns, mein Onkel und ich. Ich bin nicht wie eine Rübe zu verschachern.“
Er blieb stehen und sah sie an, seine Augen leuchteten, und eine Röte schlich sich in seine blassen Wangen.
„Du hast mich gequält, um dich zu amüsieren!“, schrie er. „Na ja, ich vergebe dir aus Erleichterung.“
„Wieder gehst du zu schnell, Cousin Andre. Ich habe meinem Onkel erlaubt, zuzustimmen, dass M. le Marquis mir den Hof machen soll. Ich mag den Anblick des Herrn. Ich fühle mich geschmeichelt, wenn ich seine Vorliebe bedenke, wenn ich seine Eminenz betrachte. Es ist eine Eminenz, die ich vielleicht gerne teilen möchte. M. le Marquis sieht nicht aus, als wäre er ein Dummkopf. Es dürfte interessant sein, von ihm umworben zu werden. Es dürfte noch interessanter sein, ihn zu heiraten, und ich denke, wenn man alles in Betracht zieht, dass ich mich wahrscheinlich – sehr wahrscheinlich – dafür entscheiden werde.“
Er sah sie an, sah die süße, herausfordernde Anmut dieses kindlichen Gesichts, das so eng von dem Oval des weißen Pelzes eingerahmt war, und alles Leben schien aus seinem eigenen Antlitz zu weichen.
„Gott steh dir bei, Aline!“, stöhnte er.
Sie stampfte mit dem Fuß auf. Er war wirklich sehr ärgerlich und auch etwas anmaßend, dachte sie.
„Ihr seid unverschämt, Herr.“
„Es ist niemals unverschämt zu beten, Aline. Und ich habe nicht mehr getan, als zu beten, und werde es auch weiterhin tun. Ich denke, du wirst meine Gebete brauchen.“
„Du bist unerträglich!“ Sie wurde wütend, wie er an der tieferen Stirnfalte und der erhöhten Gesichtsfarbe erkannte.
„Das liegt daran, dass ich leide. Oh, Aline, kleine Cousine, überlege dir gut, was du tust; überlege dir gut, welche Realitäten du für diese Täuschungen eintauschen wirst – die Realitäten, die du nie kennenlernen wirst, weil diese verfluchten Täuschungen dir den Weg zu ihnen versperren werden. Wenn M. de La Tour d'Azyr um deine Hand anhält, studiere ihn gut; höre auf deine feinen Instinkte; lass deiner eigenen edlen Natur freien Lauf, um dieses Tier nach seinen Eingebungen zu beurteilen. Bedenke, dass . . . “
„Ich denke, Herr, dass Sie sich auf die Freundlichkeit, die ich Ihnen immer entgegengebracht habe, etwas einbilden. Sie missbrauchen die Position der Toleranz, in der Sie sich befinden. Wer sind Sie? Was sind Sie, dass Sie die Unverschämtheit besitzen, diesen Ton mit mir zu sprechen?“
Er verbeugte sich, sofort wieder sein kalter, distanzierter Selbst, und nahm den Spott wieder auf, der seine natürliche Gewohnheit war.
„Meine Glückwünsche, Fräulein, zu der Bereitschaft, mit der Sie beginnen, sich an die große Rolle anzupassen, die Sie spielen werden.“
„Passen Sie sich auch an, Herr“, erwiderte sie wütend und wandte ihm die Schulter zu.
„Um wie Staub unter den stolzen Füßen von Madame la Marquise zu sein. Ich hoffe, dass ich in Zukunft meinen Platz kennen werde.“
Der Satz hielt sie inne. Sie drehte sich wieder zu ihm um, und er bemerkte, dass ihre Augen jetzt misstrauisch leuchteten. Im Nu wurde der Spott in ihm von Reue erstickt.
„Herr, was für ein Tier bin ich, Aline!“, rief er, als er näher kam. „Vergib mir, wenn du kannst.“
Sie hätte sich fast umgedreht, um ihn um Vergebung zu bitten. Aber seine Reue machte dies überflüssig.
„Ich werde es versuchen“, sagte sie, „vorausgesetzt, du verpflichtest dich, nicht wieder zu beleidigen.“
„Aber das werde ich“, sagte er. „So bin ich nun einmal. Ich werde kämpfen, um dich zu retten, wenn nötig vor dir selbst, ob du mir nun vergibst oder nicht.“
Sie standen sich so gegenüber, ein wenig atemlos, ein wenig trotzig, als die anderen aus der Veranda kamen.
Zuerst kam der Marquis von La Tour d'Azyr, Graf von Solz, Ritter des Ordens des Heiligen Geistes und des Heiligen Ludwig und Brigadegeneral in den Armeen des Königs. Er war ein großer, anmutiger Mann, aufrecht und soldatisch in seiner Haltung, mit hoch erhobenem Kopf. Er war prächtig gekleidet in einen weiten Mantel aus Maulbeersamt, der mit Gold gesäumt war. Seine Weste, ebenfalls aus Samt, war in einem goldenen Apricot gehalten; seine Kniehosen und Strümpfe waren aus schwarzer Seide, und seine lackierten Schuhe mit roten Absätzen waren mit Diamanten verziert. Sein gepudertes Haar war mit einem breiten Band aus gewachster Seide zusammengebunden; er trug einen kleinen dreieckigen Hut unter dem Arm und ein schmales Degen mit goldenem Griff hing an seiner Seite.
Wenn man ihn jetzt völlig losgelöst betrachtet, die Pracht seiner Erscheinung, die Eleganz seiner Bewegungen, die großartige Ausstrahlung, die auf so außergewöhnliche Weise Verachtung und Anmut miteinander verbindet, dann zitterte Andre-Louis um Aline. Hier war ein geübter, unwiderstehlicher Freier, dessen gutes Schicksal sprichwörtlich geworden war, ein Mann, der bisher die Verzweiflung von Witwen mit heiratsfähigen Töchtern und die Trostlosigkeit von Ehemännern mit attraktiven Frauen gewesen war.
Ihm folgte unmittelbar M. de Kercadiou, der in völligem Gegensatz dazu stand. Auf den kürzesten Beinen trug der Herr von Gavrillac einen Körper, der mit fünfundvierzig Jahren anfing, sich zur Korpulenz zu neigen, und einen riesigen Kopf, der eine mittelmäßige Portion Intelligenz enthielt. Sein Gesicht war rosig und fleckig, großzügig gezeichnet von den Pocken, die ihn in seiner Jugend fast ausgelöscht hatten. Seine Kleidung war so nachlässig, dass sie schon fast unordentlich war, und dies und die Tatsache, dass er nie geheiratet hatte – ohne die erste Pflicht eines Gentleman zu beachten, sich einen Erben zu verschaffen – war der Grund dafür, dass er auf dem Land den Ruf eines Frauenfeindes hatte.
Nach M. de Kercadiou kam M. de Vilmorin, sehr blass und in sich gekehrt, mit zusammengepressten Lippen und einer finsteren Miene.
Um sie zu begrüßen, stieg ein sehr eleganter junger Herr aus dem Wagen, der Chevalier de Chabrillane, der Cousin von Herr de La Tour d'Azyr, der während er auf dessen Rückkehr wartete, mit großem Interesse – ohne seine eigene Anwesenheit zu bemerken – die Streifzüge von André-Louis und die Fräulein beobachtet hatte.
Als M. de La Tour d'Azyr Aline bemerkte, löste er sich von den anderen und ging mit großen Schritten direkt über die Terrasse auf sie zu.
Zu Andre-Louis neigte der Marquis den Kopf mit jener Mischung aus Höflichkeit und Herablassung, die er an den Tag legte. Gesellschaftlich befand sich der junge Anwalt in einer merkwürdigen Position. Aufgrund der Theorie seiner Geburt rangierte er weder als Adliger noch als Bürgerlicher, sondern stand irgendwo zwischen den beiden Klassen, und obwohl er von keiner der beiden beansprucht wurde, wurde er von beiden vertraut behandelt. Kalt erwiderte er nun den Gruß von M. de La Tour d'Azyr und entfernte sich diskret, um sich seinem Freund anzuschließen.
Der Marquis nahm die Hand, die Fräulein ihm entgegenstreckte, und beugte sich darüber, um sie an seine Lippen zu führen.
„Fräulein“, sagte er und blickte in die blauen Tiefen ihrer Augen, die seinem Blick lächelnd und ungetrübt begegneten, „Herr, Ihr Onkel erweist mir die Ehre, dass ich Ihnen meine Aufwartung machen darf. Würden Sie, Fräulein, mir die Ehre erweisen, mich morgen zu empfangen? Ich werde etwas von großer Wichtigkeit für Sie haben.“
„Von Bedeutung, M. le Marquis? Ihr macht mir fast Angst.“ Aber in dem heiteren Gesicht unter der Pelzhaube war keine Furcht zu sehen. Nicht umsonst hatte sie die Kunstakademie in Versailles absolviert.
„Das“, sagte er, „ist sehr weit von meinem Entwurf entfernt.“
„Aber ist es für Sie selbst, Herr, oder für mich von Bedeutung?“
„Uns beiden, hoffe ich“, antwortete er ihr, und in seinen feinen, leidenschaftlichen Augen lag eine Welt voller Bedeutung.
„Sie haben meine Neugier geweckt, Herr, und natürlich bin ich eine pflichtbewusste Nichte. Es ist mir daher eine Ehre, Sie zu empfangen.“
„Nicht geehrt, Fräulein; Sie werden mir die Ehre erweisen. Dann werde ich morgen um diese Zeit das Glück haben, Sie zu bedienen.“
Er verbeugte sich wieder und führte ihre Finger wieder an seine Lippen, während sie einen Knicks machte. Daraufhin trennten sie sich, nachdem sie das Eis gebrochen hatten.
Sie war jetzt ein wenig atemlos, ein wenig geblendet von der Schönheit des Mannes, seiner fürstlichen Ausstrahlung und dem Selbstbewusstsein, das er auszustrahlen schien. Fast unwillkürlich verglich sie ihn mit seinem Kritiker – dem schlanken und frechen Andre-Louis in seinem schlichten braunen Mantel und den Schuhen mit Stahlschnallen – und sie fühlte sich eines unverzeihlichen Vergehens schuldig, weil sie auch nur ein Wort dieser anmaßenden Kritik zugelassen hatte. Morgen würde M. le Marquis kommen, um ihr eine hohe Position, einen hohen Rang anzubieten. Und schon hatte sie die Würde geschmälert, die ihr allein durch seine Absicht, sie in eine so hohe Position zu befördern, zuteil wurde. Nicht wieder würde sie das zulassen; nicht wieder würde sie so schwach und kindisch sein, dass sie Andre-Louis erlaubte, seine anzüglichen Kommentare über einen Mann abzugeben, im Vergleich zu dem er nicht besser als ein Lakai war.
So stritten Eitelkeit und Ehrgeiz mit ihrem besseren Ich, und zu ihrem großen Ärger gab ihr besseres Ich nicht ganz und gar nach.
Währenddessen stieg M. de La Tour d'Azyr in seine Kutsche. Er hatte ein Wort des Abschieds zu M. de Kercadiou gesprochen, und er hatte auch ein Wort für M. de Vilmorin, woraufhin M. de Vilmorin sich in zustimmendem Schweigen verbeugte. Die Kutsche rollte davon, der gepuderte Lakai in Blau und Gold stand sehr steif dahinter, M. de La Tour d"Azyr verbeugte sich vor Fräulein, die ihm zur Antwort winkte.
Dann legte M. de Vilmorin seinen Arm um den von Andre Louis und sagte zu ihm: „Komm, Andre.“
„Aber ihr bleibt doch zum Essen, ihr beide!“, rief der gastfreundliche Lord von Gavrillac. „Wir stoßen auf etwas an“, fügte er hinzu und zwinkerte mit einem Auge in Richtung der jungen Dame, die sich näherte. Er war ein guter Mensch und hatte keinen Sinn für Feinheiten.
M. de Vilmorin bedauerte eine Verabredung, die ihn daran hinderte, ihm selbst die Ehre zu erweisen. Er war sehr steif und förmlich.
„Und du, André?“
„Ich? Oh, ich teile den Termin, Pate“, log er, „und ich habe eine Abneigung gegen Trinksprüche.“ Er hatte keine Lust zu bleiben. Er war wütend auf Aline, weil sie Herr de La Tour d'Azyr lächelnd empfing und weil er sah, dass sie einen schmutzigen Handel abschließen wollte. Er litt unter dem Verlust einer Illusion.
Kapitel 3 Die Beredsamkeit von M. De Vilmorin
Als sie gemeinsam den Hügel hinuntergingen, war es nun M. de Vilmorin, der still und nachdenklich war, und André-Louis, der redselig. Er hatte das Thema „Die Frau“ für seinen aktuellen Vortrag gewählt. Er behauptete – völlig zu Unrecht –, die Frau an diesem Morgen entdeckt zu haben; und was er über das Geschlecht zu sagen hatte, war wenig schmeichelhaft und gelegentlich fast schon geschmacklos. Nachdem M. de Vilmorin das Thema festgelegt hatte, hörte er nicht mehr zu. So ungewöhnlich es auch für einen jungen französischen Abbé seiner Zeit erscheinen mag, M. de Vilmorin interessierte sich nicht für die Frau. Der arme Philippe war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Gegenüber dem bretonischen Arme – dem Gasthaus und Postamt am Dorfeingang von Gavrillac – unterbrach M. de Vilmorin seinen Begleiter, als dieser gerade in die schwindelerregendsten Höhen der beißenden Schmähung aufstieg, und Andre-Louis, der dadurch wieder in die Realität zurückversetzt wurde, beobachtete den Wagen von M. de La Tour d'Azyr, der vor der Tür des Gasthauses stand.
„Ich glaube nicht, dass du mir zugehört hast“, sagte er.
„Wenn du weniger an dem interessiert gewesen wärst, was du gesagt hast, hättest du es früher bemerken und dir den Atem sparen können. Tatsache ist, dass du mich enttäuschst, André. Du scheinst vergessen zu haben, warum wir hier sind. Ich bin hier mit Herr le Marquis verabredet. Er möchte mich in dieser Angelegenheit weiter hören. Oben in Gavrillac konnte ich nichts erreichen. Der Zeitpunkt war schlecht gewählt. Aber ich habe Hoffnung bei Monsieur le Marquis.“
„Hoffnungen worauf?“
„Dass er die Wiedergutmachung leistet, die in seiner Macht steht. Für die Witwe und die Waisen sorgt. Warum sonst sollte er wünschen, mich weiter anzuhören?“
„Ungewöhnliche Herablassung“, sagte Andre-Louis und zitierte „Timeo Danaos et dona ferentes.“
„Warum?“, fragte Philippe.
„Lasst uns gehen und es herausfinden – es sei denn, Ihr seid der Meinung, dass ich im Weg sein werde.“
In einen Raum auf der rechten Seite, der M. le Marquis zur Verfügung gestellt wurde, solange er sich dafür entschied, ihn zu ehren, wurden die jungen Männer vom Gastgeber geführt. Am anderen Ende des Raumes brannte ein Feuer aus Holzscheiten, und dort saßen nun M. de La Tour d'Azyr und sein Cousin, der Chevalier de Chabrillane. Beide erhoben sich, als M. de Vilmorin eintrat. André-Louis folgte ihnen und blieb stehen, um die Tür zu schließen.
„Sie erweisen mir einen Gefallen mit Ihrer prompten Höflichkeit, M. de Vilmorin“, sagte der Marquis, aber in einem Ton, der so kalt war, dass er die Höflichkeit seiner Worte Lügen strafte. „Einen Stuhl, bitte. Ah, Moreau?“ Der Tonfall war kalt und fragend. „Er begleitet Sie, Herr?“, fragte er.
„Wenn Sie gestatten, M. le Marquis.“
„Warum nicht? Nimm Platz, Moreau.“ Er sprach über seine Schulter hinweg wie zu einem Lakaien.
„Es ist gut von Ihnen, Herr, mir diese Gelegenheit zu bieten, das Thema fortzusetzen, das mich, wie es der Zufall will, so fruchtlos nach Gavrillac geführt hat.“
Der Marquis schlug die Beine übereinander und hielt eine seiner feinen Hände ins Feuer. Er antwortete, ohne sich umzudrehen, da der junge Mann etwas hinter ihm stand.
„Die Güte meiner Bitte werden wir vorerst außer Frage lassen“, sagte er düster, und M. de Chabrillane lachte. Andre-Louis fand, dass er sich leicht zum Lachen hinreißen ließ, und beneidete ihn fast um diese Fähigkeit.
„Aber ich bin dankbar“, beharrte Philippe, „dass Ihr Euch herablassen wollt, mich ihre Sache vortragen zu hören.“
Der Marquis starrte ihn über seine Schulter hinweg an. „Wessen Sache?“, fragte er.
„Nun, die Sache der Witwe und der Waisen dieses unglücklichen Mabey.“
Der Marquis blickte von Vilmorin zum Chevalier, und wieder lachte der Chevalier und schlug sich diesmal auf sein Bein.
„Ich glaube“, sagte M. de La Tour d'Azyr langsam, „dass wir aneinander vorbeireden. Ich habe dich gebeten, hierher zu kommen, weil das Chateau de Gavrillac kaum ein geeigneter Ort ist, um unsere Diskussion fortzusetzen, und weil ich gezögert habe, dich zu belästigen, indem ich dir vorschlage, den ganzen Weg nach Azyr zu kommen. Aber mein Anliegen hängt mit bestimmten Äußerungen zusammen, die du dort oben fallen gelassen hast. Es geht um diese Äußerungen, Herr, dass ich dich weiter hören möchte – wenn du mir die Ehre erweist.“
Andre-Louis begann zu begreifen, dass etwas Unheilvolles in der Luft lag. Er war ein Mann mit schneller Intuition, schneller als die von M. de Vilmorin, der nicht mehr als eine leichte Überraschung zeigte.
„Ich bin ratlos, Herr“, sagte er. „Auf welche Äußerungen spielt Herr an?“
„Es scheint, Herr, dass ich Ihr Gedächtnis auffrischen muss.“ Der Marquis schlug die Beine übereinander und lehnte sich auf seinem Stuhl zur Seite, sodass er M. de Vilmorin endlich direkt ansah. „Ihr habt, Herr, von der Schändlichkeit einer solchen Tat gesprochen – und so sehr Ihr Euch auch geirrt haben mögt, so habt Ihr doch sehr eloquent gesprochen, fast zu eloquent, wie mir schien –, von der Schändlichkeit einer solchen Tat wie der Selbstjustiz an diesem diebischen Kerl Mabey, oder wie auch immer er heißen mag. Schändlichkeit war genau das Wort, das Ihr verwendet habt. Du hast dieses Wort nicht zurückgenommen, als ich dir die Ehre erwies, dir mitzuteilen, dass mein Wildhüter Benet auf meinen Befehl hin so vorgegangen ist.“
„Wenn“, sagte M. de Vilmorin, „die Tat schändlich war, ändert sich ihre Schändlichkeit nicht durch den Rang, wie hoch er auch sein mag, der verantwortlichen Person. Sie wird vielmehr noch verschlimmert.“
„Ah!“, sagte M. le Marquis und zog eine goldene Schnupftabakdose aus der Tasche. „Ihr sagtet: “Wenn die Tat schändlich war„, Herr. Darf ich daraus schließen, dass Ihr nicht mehr so überzeugt von ihrer Schändlichkeit seid, wie es schien?“
M. de Vilmorins feines Gesicht zeigte einen Ausdruck der Verwirrung. Er verstand nicht, worauf das hinauslief.
„Mir kommt der Gedanke, M. le Marquis, dass Sie angesichts Ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, an eine Rechtfertigung für die Tat glauben müssen, die mir selbst nicht ersichtlich ist.“
„Das ist besser. Das ist eindeutig besser.“ Der Marquis nahm vorsichtig Schnupftabak und wischte sich die Fragmente von der feinen Spitze an seinem Hals. „Dir ist klar, dass du mit einem unvollständigen Verständnis dieser Angelegenheiten, da du selbst kein Landbesitzer bist, zu unberechtigten Schlussfolgerungen gelangt sein könntest. Das ist in der Tat der Fall. Möge es dir eine Warnung sein, Herr. Wenn ich Ihnen sage, dass ich seit Monaten über ähnliche Plünderungen verärgert bin, werden Sie vielleicht verstehen, dass es notwendig geworden ist, eine ausreichend starke Abschreckung einzusetzen, um ihnen ein Ende zu setzen. Jetzt, da das Risiko bekannt ist, glaube ich nicht, dass es in meinen Verstecken noch mehr Herumtreiber geben wird. Und es geht um mehr als das, M. de Vilmorin. Es ist nicht die Wilderei, die mich so sehr ärgert, sondern die Missachtung meiner absoluten und unantastbaren Rechte. Es liegt, Herr, wie Sie nicht übersehen können, ein böser Geist der Unbotmäßigkeit in der Luft, und es gibt nur einen Weg, dem zu begegnen. Ihn zu tolerieren, und sei es auch nur in geringem Maße, Nachsicht zu zeigen, sei es auch noch so nachsichtig, würde bedeuten, morgen zu noch härteren Maßnahmen greifen zu müssen. Ihr versteht mich, da bin ich mir sicher, und ich bin mir auch sicher, dass Ihr die Herablassung einer Erklärung meinerseits zu schätzen wisst, obwohl ich nicht zugeben kann, dass irgendwelche Erklärungen fällig waren. Wenn irgendetwas von dem, was ich gesagt habe, für Euch immer noch unklar ist, verweise ich Euch auf die Spielregeln, die Euer Anwaltfreund Euch bei Bedarf erläutern wird.“
Damit drehte sich der Herr wieder zum Kamin um. Es schien anzudeuten, dass das Interview zu Ende war. Und doch war dies keineswegs die Andeutung, die es dem wachsamen, verwirrten, vage unruhigen Andre-Louis vermittelte. Es war, dachte er, eine sehr merkwürdige, eine sehr verdächtige Rede. Es gab vor, mit einer Höflichkeit der Begriffe und einer kalkulierten Unverschämtheit des Tons zu erklären, während es in Wirklichkeit nur dazu dienen konnte, einen Mann mit den Ansichten von M. de Vilmorin zu ermutigen und anzustacheln. Und genau das tat es. Er stand auf.
„Gibt es auf der Welt keine anderen Gesetze als die des Wildes?“, fragte er wütend. „Habt Ihr noch nie etwas von den Gesetzen der Menschlichkeit gehört?“
Der Marquis seufzte müde. „Was habe ich mit den Gesetzen der Menschlichkeit zu tun?“, fragte er sich.
M. de Vilmorin sah ihn einen Moment lang sprachlos und erstaunt an.
"Nichts, M. le Marquis. Das ist – leider! – zu offensichtlich. Ich hoffe, dass Sie sich daran erinnern, wenn Sie sich in der Stunde, in der Sie sich an diese Gesetze wenden wollen, die Sie jetzt verspotten,
M. de La Tour d'Azyr warf den Kopf scharf zurück, sein edles Gesicht war herrisch.
„Was genau soll das heißen? Es ist nicht das erste Mal heute, dass du dunkle Sprüche verwendest, hinter denen ich fast eine Drohung vermuten könnte.“
„Keine Drohung, M. le Marquis – eine Warnung. Eine Warnung, dass Taten wie diese gegen Gottes Geschöpfe ... Oh, Ihr mögt spotten, Herr, aber es sind Gottes Geschöpfe, genau wie Ihr oder ich – nicht mehr und nicht weniger, so sehr es auch Euren Stolz verletzen mag, wenn man es sich vor Augen hält, in Seinen Augen ...“
„Ersparen Sie mir bitte eine Predigt, Herr Abbé!“
„Ihr spottet, Herr. Ihr lacht. Ich frage mich, ob Ihr lachen werdet, wenn Gott Euch für das Blut und die Plünderung, mit der Eure Hände voll sind, zur Rechenschaft zieht?“
„Mein Herr!“ Das Wort, scharf wie der Knall einer Peitsche, kam von M. de Chabrillane, der aufspringte. Aber sofort hielt ihn der Marquis zurück.
„Setzt Euch, Chevalier. Ihr unterbrecht Herr l'Abbé, und ich würde ihn gerne weiter zuhören. Er interessiert mich sehr.“
Im Hintergrund war auch Andre-Louis aufgestanden, alarmiert durch das Böse, das er auf dem hübschen Gesicht von M. de La Tour d'Azyr geschrieben sah. Er trat näher und berührte seinen Freund am Arm.
„Du solltest besser gehen, Philippe“, sagte er.
Aber M. de Vilmorin, gefangen im unerbittlichen Griff der Leidenschaften, die lange unterdrückt worden waren, wurde von ihnen rücksichtslos mitgerissen.
„O, mein Herr“, sagte er, „bedenkt, was ihr seid und was ihr sein werdet. Bedenkt, wie ihr und eure Artgenossen von Missbräuchen leben, und bedenkt die Ernte, die Missbräuche letztendlich bringen müssen.“
„Revolutionär!“, sagte M. le Marquis verächtlich. „Du hast die Frechheit, mir ins Gesicht zu treten und mir diese stinkende Heuchelei deiner modernen sogenannten Intellektuellen anzubieten!“
„Ist es Heuchelei, mein Herr? Glaubt Ihr – glaubt Ihr wirklich – dass es Heuchelei ist? Ist es Heuchelei, dass der Feudalismus alles Lebendige in seinem Würgegriff hält und es zu seinem eigenen Vorteil zermalmt wie Trauben in der Presse? Übt er seine Rechte nicht auch auf die Wasser des Flusses, das Feuer, das das Brot des armen Mannes aus Gras und Gerste backt, und den Wind, der die Mühle antreibt, aus? Der Bauer kann keinen Schritt auf der Straße machen, keine verrückte Brücke über einen Fluss überqueren, keine Elle Stoff auf dem Dorfmarkt kaufen, ohne auf feudale Habgier zu stoßen, ohne mit feudalen Abgaben belastet zu werden. Reicht das nicht, Herr Marquis? Müsst Ihr auch noch sein elendes Leben als Bezahlung für die geringste Verletzung Eurer heiligen Privilegien fordern, ohne Rücksicht darauf, welche Witwen oder Waisen Ihr dem Leid preisgebt? Reicht es Euch nicht, dass Euer Schatten wie ein Fluch auf dem Land liegt? Und glaubt Ihr in Eurem Stolz, dass Frankreich, dieser Hiob unter den Nationen, das für immer ertragen wird?“
Er hielt inne, als erwarte er eine Antwort. Aber es kam keine. Der Marquis betrachtete ihn, seltsam still, mit einem verächtlichen Lächeln an den Mundwinkeln und einer bedrohlichen Härte in den Augen.
Wieder zupfte Andre-Louis seinen Freund am Ärmel.
„Philippe.“
Philippe schüttelte ihn ab und stürzte sich fanatisch in die Arbeit.
"Seht Ihr denn nicht die sich zusammenballenden Wolken, die das Herannahen des Sturms ankündigen? Ihr stellt euch vielleicht vor, dass diese von M. Necker einberufenen und für das nächste Jahr versprochenen Generalstände nichts anderes tun werden, als neue Erpressungsmethoden zu entwickeln, um den Bankrott des Staates zu liquidieren? Ihr täuscht euch, wie ihr noch sehen werdet. Der Dritte Stand, den ihr verachtet, wird sich als die vorherrschende Kraft erweisen, und er wird einen Weg finden, diesem Geschwür der Privilegien ein Ende zu bereiten, das die Lebensadern dieses unglücklichen Landes verschlingt.
Der Marquis rutschte auf seinem Stuhl hin und her und ergriff schließlich das Wort.
„Ihr habt, Herr“, sagte er, „eine sehr gefährliche Gabe der Beredsamkeit. Und sie gilt eher Euch selbst als Eurem Thema. Denn was bietet Ihr mir letztendlich? Eine Aufwärmung der Gerichte, die den Enthusiasten in den literarischen Kammern der Provinz zur Seite stehen, zusammengestellt aus den Ergüssen Eurer Voltaires und Jean-Jacques und solcher schmutzfingrigen Schreiberlinge. Unter all euren Philosophen gibt es keinen, der den Scharfsinn besitzt, zu verstehen, dass wir ein Orden sind, der von der Antike geweiht wurde, und dass wir für unsere Rechte und Privilegien die Autorität von Jahrhunderten hinter uns haben.“
„Die Menschheit, Herr“, erwiderte Philippe, „ist älter als der Adel. Die Menschenrechte sind so alt wie der Mensch.“
Der Marquis lachte und zuckte mit den Achseln.
„Das ist die Antwort, die ich hätte erwarten können. Sie hat den richtigen Anflug von Scheinheiligkeit, der die Philosophen auszeichnet.“
Und dann ergriff Herr de Chabrillane das Wort.
„Du umgehst das Thema“, kritisierte er seinen Cousin mit einem Hauch von Ungeduld.
„Aber ich komme schon noch zum Punkt“, antwortete er. „Ich wollte mich erst ganz sicher sein.“
„Glaub mir, du solltest jetzt keine Zweifel mehr haben.“
„Ich habe keine.“ Der Marquis stand auf und wandte sich wieder an M. de Vilmorin, der von diesem kurzen Wortwechsel nichts verstanden hatte. „M. l'Abbé“, sagte er noch einmal, „Sie haben eine sehr gefährliche Gabe der Beredsamkeit. Ich kann mir vorstellen, dass Männer sich davon beeinflussen lassen. Wären Sie als Gentleman geboren worden, hätten Sie sich diese falschen Ansichten, die Sie äußern, nicht so leicht angeeignet.“
M. de Vilmorin starrte verständnislos vor sich hin.
„Ihr sagt, ich wäre als Gentleman geboren worden?“ sagte er mit langsamer, verwirrter Stimme. „Aber ich wurde als Gentleman geboren. Meine Rasse ist so alt, mein Blut so gut wie das Eure, Herr.“
Bei M. le Marquis zuckten die Augenbrauen leicht, und er lächelte vage und nachsichtig. Seine dunklen, flüssigen Augen blickten M. de Vilmorin direkt ins Gesicht.
„Ich fürchte, da wurdet Ihr getäuscht.“
„Getäuscht?“
„Eure Gefühle verraten die Indiskretion, der Eure Mutter sich schuldig gemacht haben muss.“
Die brutal beleidigenden Worte waren so schnell ausgesprochen, dass man sie nicht mehr zurückrufen konnte, und die Lippen, die sie ausgesprochen hatten, blieben kalt, als wären sie die banalsten Worte gewesen, ruhig und leicht spöttisch.
Es folgte eine Totenstille. Andre-Louis war wie betäubt. Er stand fassungslos da, alle Gedanken in ihm ausgesetzt, während die Augen von M. de Vilmorin weiterhin auf M. de La Tour d'Azyr gerichtet waren, als suchten sie dort nach einer Bedeutung, die sich ihm entzog. Ganz plötzlich verstand er die abscheuliche Beleidigung. Das Blut schoss ihm ins Gesicht, Feuer loderte in seinen sanften Augen. Ein krampfhaftes Zittern schüttelte ihn. Dann beugte er sich mit einem unartikulierten Schrei vor und schlug M. le Marquis mit der offenen Hand voll und hart ins höhnische Gesicht.
Blitzschnell stand M. de Chabrillane zwischen den beiden Männern auf.
Zu spät erkannte Andre-Louis die Falle. La Tour d'Azyrs Worte waren nur ein Schachzug, der darauf abzielte, seinen Gegner zu einem solchen Gegenzug zu verleiten – ein Gegenzug, der ihn völlig der Gnade des anderen auslieferte.
M. le Marquis sah zu, sehr blass, bis auf die Stelle, an der M. de Vilmorins Fingerabdrücke langsam sein Gesicht färbten; aber er sagte nichts mehr. Stattdessen übernahm M. de Chabrillane das Reden und übernahm seine vorher vereinbarte Rolle in diesem abscheulichen Spiel.
„Sie wissen, Herr, was Sie getan haben“, sagte er kalt zu Philippe. „Und Sie wissen natürlich auch, was unweigerlich folgen muss.“
M. de Vilmorin hatte nichts bemerkt. Der arme junge Mann hatte aus einem Impuls heraus gehandelt, aus dem Instinkt für Anstand und Ehre, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Aber er erkannte sie jetzt auf die unheilvolle Einladung von M. de Chabrillane hin, und wenn er diese Konsequenzen vermeiden wollte, dann aus Respekt vor seiner priesterlichen Berufung, die solche Schlichtungen von Streitigkeiten, wie sie M. de Chabrillane ihm eindeutig aufzwang, strikt verbot.
Er wich zurück. „Möge eine Beleidigung die andere auslöschen“, sagte er mit dumpfer Stimme. „Die Waage neigt sich immer noch zugunsten von Monsieur le Marquis. Soll er sich damit zufrieden geben.“
„Unmöglich.“ Der Chevalier presste die Lippen fest aufeinander. Danach war er die Höflichkeit selbst, aber sehr bestimmt. „Ein Schlag wurde versetzt, Herr. Ich glaube, ich liege richtig, wenn ich sage, dass so etwas dem Marquis in seinem ganzen Leben noch nie passiert ist. Wenn Ihr Euch beleidigt gefühlt habt, hättet Ihr nur um die Genugtuung bitten müssen, die von einem Gentleman zum anderen gebührt. Eure Handlung scheint die Annahme zu bestätigen, die Ihr als so beleidigend empfunden habt. Aber das macht dich nicht immun gegen die Konsequenzen.“
Es war nämlich die Aufgabe von M. de Chabrillane, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, um sicherzustellen, dass ihr Opfer ihnen nicht entkommen würde.
„Ich wünsche keine Immunität“, erwiderte der junge Seminarist, der von diesem erneuten Stachel getroffen wurde. Schließlich war er von edler Geburt und die Traditionen seiner Klasse waren stark in ihm verankert – stärker als die Erziehung des Seminaristen zur Demut. Er war es sich selbst und seiner Ehre schuldig, getötet zu werden, anstatt die Konsequenzen dessen zu vermeiden, was er getan hatte.
„Aber er trägt kein Schwert, Messieurs!“, rief André Louis entsetzt.
„Das lässt sich leicht ändern. Er kann meins leihen.“
„Ich meine, Messieurs“, beharrte André-Louis zwischen Angst um seinen Freund und Empörung, „dass es nicht seine Gewohnheit ist, ein Schwert zu tragen, dass er noch nie eines getragen hat, dass er in der Handhabung ungeübt ist. Er ist Seminarist – ein Postulant für die heiligen Weihen, bereits ein halber Priester, und daher ist ihm eine solche Auseinandersetzung, wie ihr sie vorschlagt, untersagt.“
„Daran hätte er denken sollen, bevor er einen Schlag ausführte“, sagte M. de Chabrillane höflich.
„Der Schlag wurde absichtlich provoziert“, schäumte Andre-Louis. Dann fing er sich wieder, obwohl der hochmütige Blick des anderen nichts mit dieser Erholung zu tun hatte. „O mein Gott, ich rede vergeblich! Wie soll man gegen eine Absicht argumentieren, die feststeht! Komm weg, Philippe. Siehst du nicht die Falle ...“
Herr de Vilmorin unterbrach ihn und stieß ihn von sich. „Sei still, Andre. Herr Marquis hat vollkommen recht.“
„M. le Marquis hat recht?“ Andre-Louis ließ hilflos die Arme sinken. Dieser Mann, den er mehr als alle anderen Menschen auf der Welt liebte, war in die Falle des Wahnsinns der Welt getappt. Er entblößte seine Brust dem Messer, um eines vagen, verzerrten Gefühls der Ehre willen, die ihm selbst zustand. Nicht, dass er die Falle nicht gesehen hätte. Es war so, dass seine Ehre ihn dazu zwang, sie zu missachten. Für Andre-Louis wirkte er in diesem Moment wie eine besonders tragische Figur. Edel vielleicht, aber sehr bemitleidenswert.
Kapitel 4 Das Erbe
Es war der Wunsch von M. de Vilmorin, dass die Angelegenheit außergerichtlich beigelegt werden sollte. Dabei war er gleichzeitig objektiv und subjektiv. Er war seinen Gefühlen ausgeliefert, die leider im Widerspruch zu seiner priesterlichen Berufung standen, und er war vor allem in Eile, damit er zu einer angemesseneren Einstellung zurückkehren könnte. Außerdem fürchtete er sich ein wenig; damit meine ich, dass seine Ehre seine Natur fürchtete. Die Umstände seiner Erziehung und das Ziel, das er seit einigen Jahren im Auge hatte, hatten ihm viel von der temperamentvollen Brutalität genommen, die das Geburtsrecht des Mannes ist. Er war schüchtern und sanft wie eine Frau geworden. Da er sich dessen bewusst war, fürchtete er, dass er, sobald die Hitze seiner Leidenschaft verflogen war, in der Prüfung eine unehrenhafte Schwäche verraten könnte.