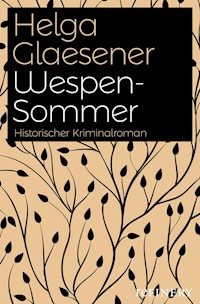5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Machthunger und Heldenmut – erleben Sie den Fantasyroman „Der schwarze Skarabäus“ von Helga Glaesener jetzt als eBook bei dotbooks. Um das Überleben seiner Volkes zu sichern, muss Albenprinz Gelwyn ein großes Opfer bringen: Für die nächsten zehn Jahre wird er als Sklave in der Menschenburg Mahoonagh dienen. Doch dort wird er in die dunklen Machenschaften von Lord Sraggs und dem Hexer DaDerga verwickelt. Diese versuchen, eine uralte Magie heraufzubeschwören, um so die Macht über das ganze Land an sich zu reißen. Gelwyn versucht verzweifelt, die finsteren Pläne zu vereiteln. Damit ihm das gelingt, benötigt er die Hilfe eines Freundes – doch dieser ist ein Mensch, den er eigentlich hassen müsste … Jetzt als eBook kaufen und genießen: ‚Der schwarze Skarabäus‘ von Helga Glaesener. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Ähnliche
Über dieses Buch:
Um das Überleben seiner Volkes zu sichern, muss Albenprinz Gelwyn ein großes Opfer bringen: Für die nächsten zehn Jahre wird er als Sklave in der Menschenburg Mahoonagh dienen. Doch dort wird er in die dunklen Machenschaften von Lord Sraggs und dem Hexer DaDerga verwickelt. Diese versuchen, eine uralte Magie heraufzubeschwören, um so die Macht über das ganze Land an sich zu reißen. Gelwyn versucht verzweifelt, die finsteren Pläne zu vereiteln. Damit ihm das gelingt, benötigt er die Hilfe eines Freundes – doch dieser ist ein Mensch, den er eigentlich hassen müsste …
Über die Autorin:
Helga Glaesener, 1955 in eine Großfamilie hineingeboren, studierte Mathematik in Hannover. Mit ihrem Roman Die Safranhändlerin landete sie 1996 einen Bestsellererfolg. Seitdem hat sie zahlreiche historische Romane sowie mehrere Fantasy- und Kriminalromane veröffentlicht. Heute lebt sie in Niedersachsen und unterrichtet Kreatives Schreiben, wenn sie nicht gerade an einem neuen Werk arbeitet.
Die Website der Autorin: http://www.helga-glaesener.de/
Die Autorin auf Facebook: http://www.facebook.com/helga.glaesener
Ebenfalls bei dotbooks erscheint die Fantasy-Trilogie THANNHÄUSER mit den Einzelbänden DER INDISCHE BAUM, DER STEIN DES LUZIFER und DER FALSCHE SCHWUR.
***
Neuausgabe November 2014
Copyright © der Originalausgabe 2000 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: © Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/soosh
ISBN 978-3-95520-862-2
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der schwarze Skarabäus an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Helga Glaesener
Der schwarze Skarabäus
Roman
dotbooks.
Für Jonas, dessen Ratschlag in Granit gemeißelt werden sollte
Aldwin, der König der Alben, hatte einen Traum. Er träumte, daß ein riesenhafter, horngepanzerter Käfer, ein schwarzer Skarabäus, aus den Bergen von Mahoonagh hinab in die Wälder von Ardfynnan kam. Und während er ihn über die Felsen krabbeln sah, wußte er – so wie man im Traum manches weiß, was man eigentlich nicht wissen kann –, daß der Käfer gekommen war, sein Volk zu vernichten.
Dies war der erste Teil des Traums, und er bewirkte, daß der König sich in seinem Bett wälzte und im Schlaf mit den Zähnen knirschte. Einen Moment lang erwachte er sogar und griff nach dem Wasserbecher, der auf der Truhe neben seinem Bett stand. Als er wieder eingeschlafen war, nahm der Traum seinen Fortgang.
Der Käfer kroch durch die Wälder von Ardfynnan – wobei er eine verbrannte Schneise hinter sich ließ, als bestünde sein Unterleib aus Feuer – und erreichte das Tor der Albenstadt. König Aldwin stand in seinem Traum unter dem marmornen Bogen des Haupttores, direkt auf der vorgezeichneten Bahn des Käfers. Er war unfähig, fortzulaufen oder auch nur ein Glied zu bewegen, und er war überzeugt, daß der Riesenkäfer ihn töten würde.
Der König war kein Feigling. Aber der Gedanke, daß das alptraumhafte Insekt sich auf ihn stürzen und sich in ihn verbeißen könnte, war so erschreckend, daß er zu schreien begann.
Davon erwachte sein Kammerdiener Logan. Der stürzte, das Schlimmste befürchtend, in das Schlafgemach seines Herrn und rüttelte ihn an den Schultern, und so geschah es, daß König Aldwin vor dem käfrigen Untier gerettet wurde – gerade noch rechtzeitig, im letzten Augenblick.
Aber in dem kurzen Moment des Erwachens sah der König etwas, etwas Bestürzendes, das mit dem Gesicht des Käfers zusammenhing. Der Anblick war so grausam, daß ihm der Schrei auf den Lippen erstarb und sein Magen vor Kälte zusammenschrumpfte. Wenn er jetzt Zeit gehabt hätte, sich zu besinnen, wenn Logan wenigstens drei, vier Sekunden mit dem Gejammere gewartet hätte, so lange, bis die Vision in das Bewußtsein des Königs gedrungen war, dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber Logan liebte seinen Herrn, und der schreckliche Zustand, in dem Aldwin sich befand, löste bei ihm eine Wortlawine aus, die alle Erinnerungen verschüttete.
So kam es, daß der König die Warnung nicht begriff; die der Traum ihm hatte bringen wollen.
Und daß er seinen Sohn Gelwyn nach Mahoonagh ziehen ließ.
Der Abschied
Gelwyn stand in einer Ecke seines Schlafgemachs, und in seinen Gefühlen herrschte das gleiche Durcheinander wie in dem Haufen von Hemden, Hosen, Socken und Wäsche, den er auf seinem Bett aufgetürmt hatte.
Er mußte fort.
Gewußt hatte er das schon lange, natürlich. Sein Vater, König Aldwin, hatte Wert darauf gelegt, ihn so früh wie möglich auf seine »Aufgabe« vorzubereiten. Aber nun war es auf einmal, als hätte man ihn an einen Abgrund gestellt und wollte ihn über den Rand stoßen.
Und überhaupt: Aufgabe!
Er haßte diesen Ausdruck, der alles so verniedlichte. In Wahrheit würde er ein Gefangener sein. Eine Geisel des schrecklichen Menschenkönigs Ezzon. Und sein einziger Lebenszweck würde darin bestehen, ein Mittel zur Erpressung seines eigenen Volkes zu sein!
Gelwyn langte nach dem Reisesack, den eine der Frauen ihm zurechtgelegt hatte, riß die Bänder auseinander und begann wütend, den Haufen auf seinem Bett hineinzustopfen.
Großartig hatten die Menschen sich das ausgedacht, wirklich großartig!
Erst hatten sie sein Volk überfallen – einfach so, niemand hatte sie auch nur mit einem Pieps herausgefordert! –, und dann hatten sie ihren Opfern das, was sie voller Hohn »Friedensmaßnahmen« nannten, diktiert. Zum Ausgleich für den Schaden, den die Menschen erlitten hatten – welchen Schaden, bitteschön? Man war ja gar nicht in ihrem Land gewesen –, mußten die Alben alljährlich zum Sonnenwendfest Seide, Schafe und Silbererz nach Mahoonagh liefern. Und um den »Frieden« zu wahren, hatten sie Geiseln zu stellen. Mitglieder der ardfynnischen Königsfamilie, die für jeweils zehn Jahre in Mahoonagh zu leben hatten. Nicht gerade im Kerker – sie bekamen zu essen und Kleidung und alles, was sonst zum Leben nötig war –, aber doch als Gefangene. Seit sechzig Jahren ging das nun schon so.
Gelwyn stopfte erbittert ein Paar Socken zwischen die Hosen. Es war ungerecht! Und ob er wollte oder nicht, er mußte immer wieder daran denken, warum sein Vater oder sein Großvater es nie gewagt hatten, sich gegen den Menschenkönig aufzulehnen. Natürlich kannte er die Gründe, die sie nannten: Die Menschen hatten bessere Waffen, sie waren stärker, und es gab so entsetzlich viele von ihnen.
Aber hatte Ardfynnan nicht seine Magier?
Gelwyn wußte, daß es so war, obwohl es selbst im Haus des Königs beharrlich beschwiegen wurde.
Die Alben waren ein Volk von Magiern, seit man denken konnte. In ihren Händen wohnte die Fähigkeit zu heilen oder Dinge zu bewegen oder beispielsweise auch, den Wuchs der Pflanzen zu beschleunigen, was Gelwyns Vater jedes Frühjahr heimlich und mit schlechtem Gewissen in seinem kleinen Gewächshaus tat. Die Menschen hatten den Alben die Anwendung von Magie verboten. Und König Aldwin und vor ihm sein Vater hatten bestimmt, daß es nötig sei, sich an diese Anordnung zu halten. So kam es, daß es aussah, als wäre alle Magie aus Ardfynnan verschwunden. Aber Gelwyn war überzeugt, daß es noch immer Männer gab, die die Geheimnisse der Magie kannten. Und warum konnte man dann nicht versuchen …
Doch es war sinnlos, darüber zu grübeln. Gelwyns Vater hatte sich entschieden, und er war der Herr der Alben. Und damit war alles erledigt.
Der Junge lauschte.
Obwohl er das Fenster, das auf den Innenhof hinausging, geschlossen hatte, drang das Gegröle der fremden Menschensoldaten bis in sein Zimmer. Er hörte jemanden etwas rufen und gleich darauf das helle Kreischen einer Frauenstimme und kniff erbittert die Lippen zusammen.
Sie waren vulgär, roh und gemein. Und egal, was sein Vater, der König, sagte: Er würde sich bei ihnen nicht wohlfühlen. Er würde sich auch nicht einleben, und er würde sie nicht – ganz sicher nicht! – irgendwann einmal gern haben. Er würde – weil sein Vater es wünschte und weil es gut für Ardfynnan war – höflich und gehorsam sein, und ansonsten würde er sich über jeden Tag freuen, der ihn seiner Heimreise näherbrachte. Lieber Himmel, zehn Jahre! Er würde erwachsen sein, wenn er nach Ardfynnan zurückkäme! Fünfundzwanzig Jahre alt!
Gelwyn schob energisch das letzte Paar Socken zwischen die Hemden und verbot sich das Rechnen und Zählen. Er angelte nach dem Strick, mit dem er den Sack zubinden wollte, zog ein Kissen beiseite, und da fiel ihm das Messerchen entgegen, das sein Vater ihm kurz zuvor hochgebracht hatte.
König Aldwin hatte nicht viel Geschick im Schenken – in der Regel bedachte er die Leute an ihren Ehrentagen mit Blumenzwiebeln oder Samen von den Pflanzen, die er in seinem Garten gezogen hatte. Und einmal hatte er seinem Sohn eine gläserne Teekanne geschenkt. Aber dieses Messerchen war das Seltsamste, was Gelwyn je von ihm bekommen hatte. Genaugenommen war es ein Witz. Eben noch hatte der König ihn ermahnt, sich keinesfalls zu etwas hinreißen zu lassen, und im nächsten Augenblick schob er ihm ein Messer in die Hand. Sekundenlang überlegte Gelwyn, ob sein Vater ihm damit vielleicht etwas hatte sagen wollen, was auszusprechen zu gefährlich oder ungehörig gewesen wäre. Er mußte über seine eigene Vermutung lächeln. Nein. Aldwin war ein guter König und Vater, und Gelwyn liebte ihn zärtlich, aber zu denken, daß er sich zu etwas so Ungeheuerlichem wie einem Ränkespiel versteigen könnte, war einfach lächerlich.
Der Junge zog das Messerchen aus der Lederhülle und betrachtete den mit Ornamenten verzierten Griff und die schwarz glänzende Klinge. Vorsichtig fuhr er mit dem Finger über die Schneide. Die Waffe war scharf, obwohl sie sehr alt zu sein schien. Und während er sich darüber wunderte, stellte er fest, daß er sie nicht mochte. Es war wie ein Unbehagen – nicht stark genug, das Ding aus der Hand zu legen, aber doch ausreichend, es in respektvollem Abstand zu halten. Nachdenklich musterte Gelwyn das Messer. Es sah aus, als wäre es aus einem sehr harten Stein – Obsidian vielleicht – gebrochen und dann geschliffen worden. Das war eine eigenartige Weise, ein Messer herzustellen. Wo mochte sein Vater es herhaben?
Der junge rümpfte die Nase. Er schob die Waffe in die Lederhülle zurück und verstaute sie zwischen seinem Unterzeug. Das Messer war ein Geschenk seines Vater und damit eine Erinnerung an Ardfynnan. Möglicherweise würde er damit einmal die Briefe öffnen, die er von zu Hause bekam – falls sie ihm erlaubten, Briefe zu bekommen.
Und damit basta.
Die Geiselübergabe fand zur Mittagszeit statt, und zwar im Audienzsaal des Königshauses von Ardfynnan. Jedenfalls nannte man den Raum so, obwohl Gelwyn, als er jetzt dort stand und wartete, die Bezeichnung reichlich hochtrabend vorkam. Es war merkwürdig: Er hatte noch keinen Schritt aus dem Haus seines Vaters getan, und schon ertappte er sich dabei, seine Heimat mit den Augen eines Fremden zu betrachten. Und seine distanzierte Haltung sagte ihm, daß dieses Zimmer weder ein Saal war, noch die pompöse Bezeichnung »Audienz« verdient hatte. Nicht daß es dort schäbig ausgesehen hätte. Aber die Alben hatten mit dem ihnen eigenen Bedürfnis nach Gemütlichkeit die Decke mit Holz verkleidet, den weißen Marmor der Wände durch Tapisserien bedeckt und in die Fenster bunte Glasscheiben eingesetzt, die das strahlende Außenlicht in milchige Wärme verwandelten. Zwischen den Fenstern standen mit Hyazinthen bepflanzte Blumenkübel, und um die Türen rankte Zimmerefeu. Auch der mit geblümtem Samt bezogene Thron, der etwas erhöht am Ende des Raumes stand, diente mit seiner hohen Lehne und den gefütterten Armstützen eher der Bequemlichkeit als der Repräsentation.
Gelwyn konnte sich nicht erinnern, daß ihn diese Intimität je gestört hätte, aber jetzt, während er darauf wartete, daß die Menschen ihn abholten, hätte er sich doch etwas Imposanteres im Rücken gewünscht. Etwas, das ihm das Gefühl gegeben hätte, mehr zu sein als nur der unwichtige Sohn eines machtlosen Königs.
Er seufzte.
Lord Sraggs, der Führer der Delegation, ließ sie warten. Vielleicht war es Gleichgültigkeit, aber Gelwyn nahm an, daß es zu dem Ritual der Demütigung gehörte, das man ihnen mit dem Vertrag aufgezwungen hatte. Die Menschen hatten tatsächlich jedes Detail der Geiselübergabe festgelegt. Wer von den Edlen Ardfynnans bei der Prozedur dabeizusein hatte, von wo aus und bis wohin die Geisel dem Gesandten des Menschenkönigs entgegenzugehen hatte, daß ihr die Hände gebunden sein müßten und so weiter. Es war lächerlich, und Gelwyn hätte auch darüber gelacht, wenn … nun ja, wenn es ihn nicht gerade selbst betroffen hätte.
Er streckte die Finger, um sich zu entspannen. Die Fesseln taten nicht weh. Aldwin, der sie ihm selbst hatte anlegen müssen, hatte sie gerade so straff gebunden, daß sie ihm nicht über das Handgelenk rutschten. Aber es war unbequem, und außerdem: Jeder, der hier mit ihm wartete, blickte so nachdrücklich nicht auf seine Hände, daß es auch schon wieder peinlich war.
Endlich schien sich etwas zu tun. Das Gelächter im Hof verstummte, eine klotzige, tiefe Stimme rief etwas. Gelwyn blinzelte, als die Tür aufgerissen wurde. In dem hellen Mittagslicht, das von draußen hereinfiel, konnte er nichts als einen Schatten erkennen, der bis an den Sturz des Türrahmens reichte. Lord Sraggs mußte ein Riese sein.
Der Mann verharrte einen Moment in der Tür, als wolle er sich einen Überblick verschaffen, oder auch – wer konnte das wissen? –, weil er den Augenblick genoß. Als er ins Zimmer trat, sah Gelwyn, daß er eine vollkommen schwarze Uniform trug. Zwei Messer im Gürtel und ein breites Schwert, das ihm blank an der Hüfte baumelte, verstärkten den Eindruck von Düsternis. Sein Gesicht konnte Gelwyn nicht erkennen, da es im Schatten der Tür lag, aber er war überzeugt, daß es so finster sein würde wie die ganze Gestalt.
Mit dem Lord drängte eine Handvoll Soldaten herein, vielleicht seine Leibwache oder irgendwelche Offiziere, und der letzte von ihnen knallte die Tür ins Schloß.
Sie hielten es nicht für nötig, ihre Gespräche zu unterbrechen oder auch nur die Stimmen zu senken. Der Lord hob den Arm, beiläufig, als winke er einen Diener heran, und gab damit das Zeichen, die Geisel zu ihm zu schicken, und demonstrierte gleichzeitig, wie lästig und nichtswürdig das fremde Volk ihm war.
Gelwyn spürte, wie sein Vater ihn an der Schulter berührte. Er lächelte flüchtig. So schwierig war es nun auch wieder nicht. Einmal quer durch den Saal, sich anhören, was die Menschen zu sagen hätten – und damit war das Unangenehmste vorüber.
Er ging langsam und achtete sorgfältig darauf, den Kopf hoch zu tragen. Das zumindest meinte er sich und seinem Volk zu schulden. Viel zu schnell nach Gelwyns Gefühl war der Gang durch den Raum geschafft. Unsicher blieb der Junge stehen. Er blickte auf den eisenbeschlagenen Waffengürtel des Lords, auf die mit schwarzem Leder bezogenen Uniformknöpfe, atmete einmal tief durch und hob die Augen zu seinem Gesicht. – Und dann wäre es fast mit seiner Fassung vorbei gewesen. Ihn traf ein Blick von … solcher Verachtung und Abneigung, ja, von einem solch persönlichen Haß, daß er blinzelte, weil er es nicht glauben konnte.
Der Lord war ernst gewesen. Aber nun, da er Gelwyns Aufmerksamkeit hatte, begann er zu grinsen. Abfällig spuckte er auf den Boden, gerade eben an Gelwyns Schulter vorbei, packte den Jungen beim Arm und drehte ihn herum, so daß seine Leute ihn anschauen konnten.
»Nicht zu fassen. Ist ja das reinste Sabberchen diesmal, ein richtiges Windelscheißerchen!« Sein Lachen klang wie das Schaben einer Brunnenkette, und als er den Jungen schüttelte, geschah es mit einer gehörigen Portion Roheit.
Gelwyn biß die Zähne zusammen. Als er klein gewesen war, hatte seine Amme ihm einmal ein Märchen erzählt. Daß sich Kindern, die wütend werden, garstige schwarze Teufelchen ins Herz schleichen, Kobolde, die ihnen Bosheiten ins Ohr flüstern und sie damit zu fürchterlichen Untaten verleiten. Nun begann Gelwyn sich zu fragen, ob diese Geschichte womöglich einen wahren Kern enthielt. Denn in seinem Herzen begann sich tatsächlich etwas zu regen, und es kam ihm fremd und schwarz und böse vor.
Der Lord ließ keine weiteren Grübeleien zu.
Er packte den Jungen an den gefesselten Händen, riß sie hoch und hielt sie in Richtung seiner Soldaten.
»Verpackt und verschnürt ist er schon. Ihr könnt ihn also aufs Pferd laden!« Lachend stieß er Gelwyn von sich.
Aber noch war es nicht vorbei. Die Soldaten schienen zu finden, daß sie mit ihrem Teil Spaß zu kurz gekommen waren. Einer von ihnen, ein dürrer, schnurrbärtiger Kerl mit einem vereiterten Auge, begann mit seinen Fingern in Gelwyns Gesicht herumzutatschen. »Sieht ja aus wie’n Mädchen, das«, höhnte er. Seine Sprache war undeutlich, und er stank aus dem Mund, als hätte er etwas mit den Zähnen. Vielleicht war er auch betrunken. Seine Kumpane lachten, und einer von ihnen machte eine Bemerkung, die Gelwyn nicht verstand.
Der Junge versuchte, von den Männern fortzukommen. Dabei stolperte er gegen jemanden, der hinter ihm stand. Der Kerl lachte, gab ihm eine Ohrfeige und dann einen Stoß, der ihn weitertaumeln und direkt in Lord Sraggs’ Arme zurücksinken ließ. Gelwyn ratschte sich das Handgelenk. Das war merkwürdig, denn er hatte nur den Arm des Lords berührt, und Sraggs war ein fleischiger, muskelbepackter Mann. Aber selbst wenn er so dürr wie sein stinkender Begleiter gewesen wäre, hätte man sich an seinen Knochen doch nicht gleich die Haut aufreißen dürfen.
Gelwyn starrte auf die Stelle, an der er sich verletzt hatte, und ihn überkroch eine Gänsehaut. Dort, wo eigentlich eine Hand hätte sein sollen, ragte nichts als ein lederner Klumpen aus dem Ärmel, fest und hart wie ein ausgestopfter Puppenkopf. Das steife Leder der Uniform schlenkerte darüber, als wäre es über einen Stock gestülpt.
Der Junge war so mit dem Anblick beschäftigt, daß ihm gar nicht auffiel, wie das Gegröle der Soldaten abflaute. Erst als es völlig verstummte, wurde er aufmerksam und blickte hoch. Jeder, Mensch wie Alb, schien plötzlich auf den Lederklumpen zu schauen, auf die künstliche Hand des Lords. Natürlich, Gelwyns Starren war wie ein leuchtender Richtungsweiser gewesen. Der junge fühlte, wie Sraggs’ Finger – die der gesunden Hand – sich in seine Schulter bohrten.
Lieber Himmel, was kann ich dafür, daß deine Hand nicht in Ordnung ist? fuhr es ihm durch den Kopf, während sich seine Muskeln verkrampften. Er begriff, daß der amputierte Arm für den Lord mehr als eine lästige Behinderung war. Und nun hatte er ihn und alle anderen an diesen Makel erinnert, und Sraggs schien durchaus nicht geneigt, solchen Frevel zu übergehen.
Die Hand des Lords löste sich, fuhr in Gelwyns Nackenhaar und riß das Gesicht des Jungen in die Höhe. Gelwyn blickte in ein Paar … Nein, Augen waren das nicht.
Eiskristalle.
Es kam ihm vor, als durchbohrten ihn zwei Eiskristalle. Nur daß es im Zentrum des Eises loderte und kochte von kaum beherrschter Wut. Gelwyn schluckte. Seine Blicke irrten von den Augen fort zu der fleischigen Nase des Lords und zu dem Grübchen, das das feiste Kinn teilte. Und dann zu den Haaren oder dorthin, wo die Haare hätten sein sollen, denn der Lord besaß nur noch wenige dünne Strähnen über einer Glatze. All diese Einzelheiten prägten sich Gelwyn ein, als hätte man sie mit einem glühenden Eisen in sein Gehirn gebrannt.
Er starrte auf den Mund, der sich jetzt spaltbreit öffnete, und stellte mit derselben überflüssigen Gründlichkeit fest, daß der Lord seine Zähne schwarz bemalt hatte. Mit angehaltenem Atem wartete er auf die Gemeinheit, die die schrecklichen Zähne über ihn ausspeien würden. Er duckte sich ein wenig und hob die Hände …
Aber da geschah etwas.
Es war so flüchtig und auch so unverständlich, daß der Junge es überhaupt nicht begriff. Lord Sraggs’ Blick fiel auf seine gefesselten Handgelenke. Er blieb darauf haften – und einen Moment lang, so kurz, daß es wahrscheinlich niemandem außer Gelwyn auffiel, versteifte sich der Körper des Menschen. Es war, als wäre er in einen plötzlichen Krampf gefallen. Der Mund mit den schwarzen Zähnen stand halb offen, die Gesichtsmuskeln erstarrten – nur die Augen verengten sich, bis sie zu dunklen Schlitzen wurden, so daß es aussah, als hätten die Augenbrauen Zwillinge bekommen. Das alles dauerte nur zwei, drei Sekunden, dann brach der Bann.
Der Mann ließ Gelwyn los und brüllte einen Befehl.
Sein Arm und sein Zorn und alles, was eben noch wichtig gewesen war, schien plötzlich vergessen. Mit heftigen Gebärden drängte er seine Männer, sich zu eilen, und als es ihm nicht schnell genug ging, bekam einer von ihnen seine Faust zu spüren.
Es war verrückt.
Was sollte das? Warum diese plötzliche Hetze? Gelwyn hatte keine Zeit, darüber nachzugrübeln. Sraggs’ Männer – der Schnurrbärtige und noch ein anderer – rissen ihn zur Tür, stießen ihn in den Hof zu den Pferden und beförderten ihn unsanft auf den Rücken eines knochigen Gauls. All das, und auch ihr Fortreiten, geschah so schnell, daß ihm nicht einmal Zeit für ein Wort des Abschieds an seinen Vater blieb.
Feindschaft
Gelwyn fühlte sich hundeelend. Sie hatten »vergessen«, ihm die Handfesseln zu lösen, aber das war es nicht, was ihn bedrückte. Es war auch nicht das halsbrecherische Tempo, mit dem sie die staubigen Waldwege entlangstürmten, und auch nicht die Hitze oder sein ausgedörrter Hals. Nein, Gelwyn Ardfynnan hatte Angst.
Er wußte nicht, was schiefgegangen war, aber er fühlte, daß etwas nicht stimmte. Dieser überhastete Aufbruch, die Eile, mit der sie die Straßen hinunterhetzten – was ergab das für einen Sinn? Sraggs hatte nicht einmal gewartet, bis Stork, der alte Reitknecht, der Gelwyn nach den Regeln des Vertrags begleiten durfte, sein Pferd aus dem Stall geholt hatte. Wäre Stork nicht ein so guter Reiter – womöglich hätte er die Menschen und seinen Herrn erst am Abend oder gar in Mahoonagh eingeholt.
Und wenn gerade das die Absicht des Lords gewesen war, der Grund für diese blödsinnige Hetze? Wenn es ihm nur darum gegangen war, sich mit einer kleinen Bosheit an Gelwyn Ardfynnan zu rächen? Nein, das allein konnte es nicht sein. Gelwyn spürte es. Irgend etwas … Sonderbares war im Audienzsaal geschehen.
Der Junge merkte, wie Stork sich zu ihm umdrehte, und lächelte verkrampft. Eigentlich war es überflüssig, sich den Kopf zu zerbrechen. Andern konnte er sowieso nichts. Seufzend entschloß er sich, den Lord und die Menschen und überhaupt alles, was mit seiner ungemütlichen Lage zusammenhing, aus seinen Gedanken zu verbannen.
Sie ritten bis tief in die Nacht hinein.
Gelwyn hatte sich eingebildet, gute Augen zu haben, aber als sie sich den Steinigen Kuppen näherten, die das Vorgebirge von Cloonee bildeten, konnte er den Weg nicht mehr von den Abhängen und Klippen trennen, und er mußte sich völlig auf sein Pferd verlassen, um nicht auszugleiten. Er war heilfroh, als der unermüdliche Lord endlich das Nachtlager ausrief.
Mit steifen Gliedern rutschte der junge aus dem Sattel, und da er sein Tier nicht versorgen konnte – sie hatten ihm noch immer nicht die Fesseln gelöst und schienen es auch nicht vorzuhaben –, zog er sich zu einem schwarzen Felsen zurück, wo er sich ins Gras sinken ließ.
Er war hundemüde. Seine Arme schmerzten von der unnatürlichen Haltung, sein Nacken war steif, und eigentlich wünschte er nichts mehr, als in Ruhe gelassen zu werden. Undeutlich erkannte er einen Teich, in dessen schwarzem Wasser sich das Mondlicht spiegelte. Die Männer begannen, die Pferde zu tränken. Sie sprachen nur noch wenig. Einige sammelten Holz für ein Feuer, und einige schlugen ein Zelt auf.
Gelwyn fuhr zusammen, als jemand seine Schulter berührte. »Ihr müßt etwas essen, mein lieber Herr«, hörte er Storks sanfte Albenstimme.
Stork. Er hatte ihn völlig vergessen und schämte sich ein bißchen dafür, denn abgesehen davon, daß er ein müder Junge war, war er auch noch der Sohn eines Königs, und Stork gehörte zu seinem Volk, und deshalb war er für Stork verantwortlich. Jedenfalls sah er das so, und er nahm an, daß sein Vater diese Auffassung teilte.
Aber im Augenblick war es Stork, der für ihn sorgte.
»Ich habe Pastete und Brot und ein paar Apfel in meinem Sack, und etwas davon werdet Ihr jetzt essen, mein Prinz, sonst fallt Ihr nämlich morgen vom Pferd. Lieber Himmel, sie reiten wie die Teufel, die sie auch sind!« Das letzte flüsterte Stork vorsichtshalber, und er ließ sich neben seinem Herrn im Gras nieder und rutschte dichter an ihn heran, als er es sonst wohl für schicklich gehalten hätte.
Gelwyn hatte keinen Hunger, er war viel zu müde und aufgewühlt. Aber er wollte den alten Mann auch nicht enttäuschen, und so begann er lustlos an dem Apfel zu kauen, den Stork ihm in die Hände legte.
Sraggs’ Männer waren mit dem Zelt fertig. Nun begannen sie, Feuersteine aneinanderzuschlagen, um ein Lagerfeuer zu entzünden. Die Flammen züngelten und vertrieben die Dunkelheit, und auch wenn die Wärme nicht bis zu Gelwyns Felsen reichte, war er doch froh darüber. Er ließ die Apfelkippe aus den Fingern fallen und schloß die Augen.
Die Stimmen der Soldaten wurden leiser. Merkwürdig, wie kantig ihre Sprache klingt, dachte Gelwyn schläfrig. Als hätten sie Kiesel im Rachen, die beim Sprechen aneinanderschabten. Er versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, mit einem Mund voller Kiesel zu sprechen.
»Herr!« Stork berührte ihn am Arm. »Ich denke, Ihr solltet versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen.«
»Was?« Gelwyn war schon fast am Schlafen.
»Es … sind merkwürdige Leute. Mir ist nicht wohl, wenn ich sie beobachte. Ich … was soll ich sagen … Sie lieben Euch nicht, mein Herr.«
Gelwyn brummelte etwas. Vermutlich wäre er jetzt endgültig eingenickt, wenn Stork ihn nicht plötzlich gekniffen hätte. »Sie kommen, Herr. Zu uns herüber.«
Von einer Sekunde zur anderen war Gelwyn wieder hellwach. Mit zusammengekniffenen Augen schaute er zum Feuer. Tatsächlich. Da hatten sich vier oder fünf Gestalten zusammengetan und kamen zum Felsen. Einer von ihnen, der größte, der sie alle um einen Kopf überragte, war zweifellos Lord Sraggs.
Der Junge spürte, wie sein Herz zu rasen begann. Sein Mut verflog. Plötzlich mußte er wieder daran denken, wie der Lord ihn angesehen hatte – in jenen merkwürdigen Sekunden vor ihrem überstürzten Aufbruch. Und auf einmal hatte er auch einen Namen für das, was in den kalten Augen gebrannt hatte: Haß.
Mühsam erhob er sich auf die Füße.
Der Lord brachte drei Männer mit sich. Gelwyn hatte sie nicht unter den Soldaten gesehen, und sie trugen auch keine Uniform. Sie mußten hier am Felsen zu ihnen gestoßen sein. Um ihre Körper flatterten schwarze Kutten, und ihre Gesichter waren von Kapuzen bedeckt, als wäre selbst das fahle Mondlicht zu grell für das, was der Stoff verbarg. Sie waren unheimlich. Wenn Gelwyn nicht den Fels hinter sich gehabt hätte, wäre er zweifellos vor ihnen zurückgewichen.
Die Kapuzenmänner kamen heran und drängten sich um ihn, wobei es sie nicht störte, daß sie den armen Stork zu Boden stießen. Dann machten sie Platz für ihren Herrn. Sraggs’ kahler Schädel glänzte wie ein beleuchteter Kürbis zwischen den schwarzen Kapuzen, aber es sah überhaupt nicht komisch aus. Und auch was er tat, war nicht komisch.
Er packte mit seiner gesunden Hand Gelwyns Fesseln und hob sie hoch. Dabei sagte er kein einziges Wort, als wären sie über diesen Bereich der Höflichkeit schon hinaus. Einer der schwarzen Männer hob seine Fackel in den Kreis. Sraggs verdrehte Gelwyns Handgelenke, so daß die oberen Knöchel in den Lichtkreis tauchten. Gesprochen wurde noch immer nicht. Der Lord beugte sich vor, und seine schwarzen Begleiter reckten stumm ihre Hälse. Sie starrten Gelwyns Hände an, als wären sie eine Monstrosität.
Die Stille war peinlich, und der Geruch, der von den schwarzen Kutten ausströmte, abstoßend. Und überhaupt, was sollte das alles? Flüssiges Wachs tropfte auf Gelwyns Haut. Sein verdrehter Arm begann ihn zu schmerzen, und schließlich sagte er in einem Versuch zu witzeln:
»Bei uns nennt man es Hanf. Es wird auf Äckern geern…«
Er kam nicht weiter. Sraggs’ Kopf schoß in die Höhe, und im nächsten Moment, ohne irgendeine Warnung oder Begründung, ließ er Gelwyns Hände fahren, und sein eisenbesetzter Handschuh schoß dem Jungen direkt auf den Mund.
Gelwyn schrie nicht, aber er taumelte zurück.
Blut schoß ihm übers Kinn und füllte seinen Rachen, und er war vor Schmerz und Überraschung wie benebelt. Bäume, Pferde, Männer, der runde, kalte Mond – alles schien sich in einem Funkenkreis zu drehen. Irgendwo in diesem Durcheinander sah er Stork, wie er die Fäuste ballte. Er hörte Sraggs auflachen und sah seine schwarzen Zähne grinsen. Der Anblick der Zähne, das Raubtiermaul, das sich so offensichtlich freute, gab ihm eine gräßliche Befürchtung ein. Verzweifelt gab er seinem Taumeln einen Dreh und brachte sich zwischen den Alben und den Menschenlord.
»Komm, Stork«, murmelte er, Blut im Mund und auf den Lippen, während er den Alten zur Seite drängte. »Kümmere dich nicht. Laß sie. Es ist nicht wichtig. Geh schon …«
Stork berührte ihn am Arm, zitternd vor Empörung, fest entschlossen, nicht zu weichen, aber zumindest ließ er die Fäuste sinken. Und das rettete ihm wahrscheinlich das Leben. Der Lord schnaubte verärgert, seine Blicke schweiften zu den Soldaten. Er schwankte und wog ab. Schließlich zuckte er die Achseln. »Gib deine Hände, Bengel!«
Gelwyn trat auf den Einarmigen zu. Steif wie ein Stock wartete er, während Lord Sraggs mit seinem Messer die Hanfstricke durchtrennte. Das Blut brannte in seinen Adern, aber er war zu aufgeregt, um darauf zu achten. Ihm fielen mindestens ein Dutzend Gemeinheiten ein, die der Lord ihm antun konnte. Vorsichtig, das Messer nicht aus den Augen lassend, fuhr er sich mit dem Handrücken über den Mund. Aber die Waffe verschwand in Sraggs’ Gürtel. Der Lord bellte etwas in die Dunkelheit, was Gelwyn vor lauter Herzklopfen nicht verstand, dann warteten sie. Einer der Soldaten, die beim Feuer gesessen hatten, war aufgesprungen und rannte zum Ufer des Teiches, wo ihre Pferde grasten. Augenblicke später kam er zu seinem Herrn. In seiner schmutzigen Klaue lagen dünne, tropfnasse Lederstreifen.
»Mistkerl«, entfuhr es Gelwyn. Er konnte nichts dafür, es rutschte ihm einfach heraus. Da stand ein Mann, doppelt so stark wie er, und wollte ihm auf gemeinste Weise Schmerzen zufügen. Einfach so, für nichts. Mit brennenden Augen sah er zu, wie Sraggs ihm das Leder um die Gelenke wickelte. Es wurde ein solides Band daraus, das vom Daumen bis über das skarabäusförmige Feuermal auf seinem Handgelenk reichte und so stramm saß, daß es keinerlei Bewegung mehr erlaubte. Der Lord schnürte einen kräftigen Knoten und sah auf.
»Vielleicht«, sagte er mit einem Hohnglitzern, »tut dein wackerer Knecht uns beiden ja einen Gefallen und versucht, das hier zu lösen?«
Gelwyn schwieg. Aber in seinem Herzen ging es böse zu. Die schwarzen Teufelchen tanzten einen Reigen aus Haß und Zorn, der ihm selber angst machte. Er war froh, als der Lord mit seinen Männern endlich ging.
»Gelwyn, o mein Herr!« Storks Augen schwammen in Tränen. »Sie … hätten Euch einen Stärkeren mitgeben sollen als mich. Ich bin ein alter Mann. Und der Mensch, dieser Lord – er haßt Euch. Mit all seiner Seele. Was sollen wir nur tun?«
Nichts, dachte Gelwyn bitter. Wir können überhaupt nichts tun.
Die Audienz
Der Weg nach Mahoonagh führte durch das halbe Clooneegebirge, und zwar durch seinen scheußlichsten Teil, wenn man denen glauben wollte, die sich auskannten. Aber es war der schnellste Weg und außerdem der sicherste, da er durch Militärstationen bewacht wurde, und deshalb hatte Lord Sraggs ihn gewählt.
Gelwyn wußte das nicht, aber wenn er es gewußt hätte, wäre es ihm gleich gewesen. Er war wirr vor Schmerzen und so müde, daß er auf dem Pferderücken schwankte und die Männer vor sich doppelt sah. Sie hätten auf den Mond reiten können, ohne daß er protestiert oder es überhaupt gemerkt hätte.
Ihr Ritt führte über kahle, steinige Serpentinen, die so schmal waren, daß es eine Bergziege schwindlig gemacht hätte, über unwegsame Pässe und durch baumlose Gerölltäler, und wenn er einen seiner klaren Augenblicke hatte, dachte er, wie schrecklich dieses Land war und daß es vielleicht gar nicht so schlimm wäre, wenn er vom Pferd stürzen und sich den Hals brechen würde.
Aber irgendwann tauchte hinter einer Schlucht die Stadt Mahoonagh auf, und als sein stumpfer Verstand es begriff, regte sich wieder ein Funke Lebensglut. Bei der Mittagsrast schnitt ihm der Lord die Lederriemen aus dem entzündeten Fleisch, das sicherste Zeichen, daß sie sich dem Ziel ihrer Reise näherten. Zwei Stunden später erklommen sie ein grasbewachsenes Plateau.
Die Menschenstadt lag vor ihnen.
Gelwyn blieb fast die Luft weg, als er das Ungetüm aus Mauern und Dächern erblickte, und einen Moment lang vergaß er sogar seine Schmerzen. Er hatte gewußt, daß Ezzons Stadt größer als Ardfynnan war, aber dies hier war – gigantisch. Steinmauern so hoch, daß man sich den Hals verrenken mußte, um ihre Zinnen zu betrachten. Tore, als wären sie für Riesen gebaut. Die Männer, die auf den Wehrgängen jenseits der Mauer Wache schoben, sahen winzig wie Puppen aus. Ein einzelner Stein in der Mauer war so hoch wie der Junge selbst – inklusive Pferd. Mit einem Mal begriff Gelwyn – gründlicher als durch jedes gesprochene Wort –, warum sein Volk Geiseln zu den Menschen sandte und warum sein Vater ihn um Wohlverhalten gebeten hatte: Nichts und niemand auf der Welt war der Macht von Mahoonagh gewachsen.
Diese Erkenntnis hätte ihn erschlagen, wenn er nicht so erschöpft gewesen wäre. Jetzt nahm er sie einfach als Tatsache hin, so wie die Schmerzen und sein ungeduldiges Pferd und alles andere, was ihn plagte.
Soldaten strömten aus dem Haupttor und liefen ihnen entgegen. Natürlich brüllten und kreischten sie. Es schien die den Menschen angeborene Form der Unterhaltung zu sein. Scherzworte flogen hin und her, und auf einmal fand Gelwyn sich von Männern umgeben. Sie nahmen ihn zwischen sich und führten ihn durch das Tunnelgewölbe des Stadttores.
Sekundenlang hörte man nur das Trappeln der Pferdehufe.
Dann verließen sie den Schatten – und im nächsten Moment brandete Geschrei auf, ein Geheul und Gejohle, das Gelwyn erschrocken den Kopf hochreißen und in seinem Sattel erstarren ließ.
Er hatte gewußt, daß sie erwartet wurden. Immer wenn sie einen Wachturm passiert hatten, waren Tauben in den Himmel gestoßen. Aber das hier? Was sollte dieses Höllenspektakel? Ganz Mahoonagh schien sich auf die Straßen gestürzt zu haben, entschlossen, die Stadt in ein Irrenhaus zu verwandeln. Vor den Fachwerkhäusern und in den Schlüpfen dazwischen drängten sich Menschen, so dicht, daß nicht einmal ein Apfel hätte zu Boden fallen können. Kleine halbnackte Jungen ritten auf den Schultern der Erwachsenen und brüllten und drohten mit den Fäusten. Aus den Fenstern hingen Weiber, die einander Bemerkungen zukreischten. Betrunkene grölten, jemand übergab sich direkt neben Gelwyn in den Rinnstein.
Plötzlich tauchte ein Schatten hinter dem Jungen auf. Lord Sraggs beugte sich zu ihm, schrie etwas, das in dem allgemeinen Getöse unterging, und stieß ihm die Faust in den Rücken. Benommen ließ der Albenprinz sein Pferd wieder antraben.
An das, was folgte, konnte er sich später nur noch bruchstückhaft erinnern, aber es kam ihm vor wie ein Alptraum. Zerlumpte Menschen drängten sich um sein Pferd, sie rissen an seinen Kleidern, schnappten nach seinen Beinen und brüllten seinen Namen, und einige warfen mit faulem Gemüse. Er mußte sich in die Mähne seines Pferdes klammern, um nicht hinabgezogen zu werden.
Wenn er nicht so müde gewesen wäre – inzwischen war er dankbar, daß er es war, denn die Müdigkeit hüllte ihn wie in einen unsichtbaren Mantel –, dann hätte er wahrscheinlich nach ihnen getreten oder sonst etwas Fürchterliches getan, was ihn und sein Volk um Kopf und Kragen gebracht hätte.
Irgendwann wurde ihm klar, daß nicht alle Rufe unfreundlich gemeint sein konnten. Eine Frau streckte ihm einen Säugling entgegen – er sah in verklebte, eitrige Augen –, und eine andere wies mit erbärmlichem Gegreine auf einen blaugrün geschwollenen Handstumpf. Seine Vorgänger, ging ihm auf, schienen es für richtig befunden zu haben, sich in Mahoonagh nützlich zu machen. Aber Heilung war Magie und somit verboten. Und selbst wenn sie nicht verboten gewesen wäre, hätte Gelwyn nichts mit der kreischenden Meute zu tun haben wollen. Ihm war schlecht vor Abneigung und Müdigkeit, und alles, was er sich wünschte, war, endlich von ihnen erlöst zu werden.
Als sie auf eine gewölbte Brücke kamen, drehte er sich im Sattel um. Von Stork war nichts zu sehen. Aber Sraggs ließ ihm auch keine Zeit zum Suchen. Seine Reitgerte sauste Gelwyns Pferd auf die Hinterkuppe, daß es mit einem Satz vorwärtssprang.
Die Brücke mußte eine Art Grenze darstellen, denn dahinter wurde es ruhiger, und gleich darauf passierten sie ein Eichentor und ritten in einen gepflasterten Hof ein. Die Burg von Mahoonagh, König Ezzons Wohnsitz. Menschen in eleganten, bunten Kleidern standen beieinander und schwatzen. Männer strömten aus den Türen, und alle füllten die Luft mit einem Stimmengesumm wie ein Wespenschwarm. Jemand trat zu Gelwyns Pferd, und hilfreiche Hände – tatsächlich, ausnahmsweise wollte ihm einmal niemand wehtun – griffen unter seine Arme und hoben ihn aus dem Sattel. Dann war da plötzlich ein rundlicher Mann mit einem Pfannkuchengesicht und kurzen, strohgelben Haaren, der auf ihn einredete und sich, als der Junge nicht reagierte, bei ihm unterhakte. Gemeinsam durchschritten sie endlose Gänge und Höfe und Steintreppen. Schließlich erreichten sie ein Turmzimmerchen, und dort ließ der Pfannkuchen Gelwyn los.
Der Junge sah sich um.
Es war ein rundes, winziges Zimmerchen, die Wände und den Boden hatte man mit Webteppichen bedeckt. Wollene Häkeldecken lagen auf den beiden Betten, die an den Wänden standen. Auf einem Hocker dampfte in einer Schüssel heißes Wasser, daneben stapelten sich Handtücher und saubere Kleider.
»Wollt Ihr etwas essen, Herr?«
Gelwyn schüttelte den Kopf. Sein Magen fühlte sich an wie ausgewrungen. Sehnsüchtig schielte er nach dem Bett. Der Pfannkuchenmann murmelte etwas – was konnte Gelwyn nicht verstehen, er war zu müde, um sich auf die Menschensprache zu konzentrieren –, dann klopfte der Fremde ihm auf die Schulter und ließ ihn endlich allein. Gelwyn streifte die schmutzigen Sandalen ab, legte sich bäuchlings auf eines der Betten, zog sich eine Decke über den Kopf, und ohne noch etwas zu tun oder zu denken, schlief er ein.
Es war Nacht, als man ihn weckte.
Der Pfannkuchenmann war zurückgekehrt. Er hielt eine Öllampe über Gelwyns Gesicht, die er an einen Haken hängte, als er merkte, daß der Junge erwacht war, und zog ihn zum Sitzen hoch. Unter einem Schwall von Worten drängte er ihm Tücher und Seife auf und schob ihn zu der Waschschüssel.
»Wo ist Stork?« murmelte Gelwyn, während er sich, noch immer nicht ganz munter, das Hemd über den Kopf streifte.
»Ihr hattet einen Begleiter?« Der Mann schüttete aus einer Zinnkanne kochendes Wasser in die Schüssel. »Vermutlich haben sie ihn im Dienstbotentrakt untergebracht. Keine Sorge, junger Herr, er wird bald wieder bei Euch sein. Darf ich Euch helfen? Nein? Auch gut. Wenn Ihr Euch nur beeilen könntet – unser Gebieter wartet nicht gern.«
»König Ezzon will mich sehen?«
»O ja. Und wenn Ihr Euch nicht sputet, mein lieber junger Herr, dann werdet Ihr feststellen, daß Warten nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehört.« Der Mann kramte in Gelwyns Sack und zog eines der weißen Hemden und eine wollene Hose heraus. »Unser Herr ist gut und gerecht«, fuhr er im Plauderton fort, »aber wenn man ihn reizt, kann das übel ausgehen.« Er glättete mit seinen Händen notdürftig, was Gelwyn so gleichgültig zusammengestopft hatte, und reichte es an den Jungen weiter. »Glücklicherweise hat Euer Volk ja ein sanftes und verträgliches Temperament – Vorsicht, hier am Ärmel sind noch ein paar Knöpfe. Sprecht respektvoll mit ihm und verbeugt Euch oft und artig, dann kann nichts schiefgehen. Eure Haare …«
Im Schein der Öllampe betrachtete Gelwyn sich in einem Spiegel. Seine schwarzen Haare hingen kraus und wirr um sein Gesicht. Er fuhr mit dem Finger über die Lippen. Lord Sraggs’ Liebesgruß war noch deutlich sichtbar. Erbittert langte er nach der Bürste, die der Mensch ihm reichte, und zog sie mit ruppigen Bewegungen durch das Haar. Sein Vater und die Geisel, die vor ihm hier gelebt hatte, und auch dieser Pfannkuchendiener hatten gesagt, König Ezzon sei gerecht. Nun, vielleicht, wer konnte das wissen, würde der Herr von Mahoonagh sich dafür interessieren, wie seine Geisel zu dieser Verzierung gekommen war.
König Ezzon würde sich nicht interessieren.
Das wußte Gelwyn schon, noch ehe er den düsteren Steinsaal, der dem König als Empfangsraum diente, zur Hälfte durchschritten hatte. Es war dunkel, aber Fackeln und ein deckenhoher Kamin erleuchteten den hinteren Teil des Raumes. Und man hätte blind sein müssen, um zu übersehen, daß der Herrscher von Mahoonagh sich in übelster Laune befand. Sein hageres Gesicht war verkniffen, die Fäuste um die Lehnen des schwarzeisernen Throns gekrallt. Vor ihm kauerte ein Mann, der aus der Nase blutete. Und wenn das nicht gereicht hätte, um Gelwyn die rauhe Tonart dieser Audienz begreiflich zu machen, dann brauchte er nur in das Gesicht Lords Sraggs’ zu blicken, um zu verstehen. Sein alter Feind wartete neben dem König und blickte ihm mit unverhohlenem Triumph entgegen.
Gelwyn lächelte spröde.
Wenigstens die artigen Verbeugungen würde er sich also sparen können: Die Katze war bereits ins Wasser gefallen. Auf krankhafte Art bereitete ihm das sogar Vergnügen. Sie hatten König Aldwins Sohn als Geisel verlangt? Bitte, er war gekommen. Und mehr hatten sie von ihm nicht zu erwarten. Er war der Prinz eines unterworfenen Landes, aber doch immer noch ein Prinz.
Mit steifen Schultern durchschritt er die Menge der raunenden Menschen – irgendwie erinnerte alles ein bißchen an Ardfynnan –, bis er wenige Schritt vor dem Thron stehenblieb. Er hob das Kinn, blickte geradewegs in das erzürnte Gesicht des Menschenkönigs und wartete.
»Ihr seid also Gelwyn Ardfynnan?« Die Worte kamen leise und ausdruckslos, aber für Gelwyns feines Ohr klangen sie wie Wolfsgeknurr.
»Ja.« Er nickte und zwang sich, deutlich zu sprechen und den Blick keinen Fingerbreit zu senken. Aber auch wirklich nicht ums kleinste bißchen.
Das Getuschel in seinem Rücken verstummte, und Gelwyn sah, wie die Lippen des Menschenkönigs schmal wurden und sein Blick auf unangenehme Art persönlich. Der eiserne Mann beugte sich vor und musterte den Jungen. »Und, mein lieber Prinz«, fragte er mit trügerischer Sanftheit, »hat man Euch in Eurer Kinderstube, der Ihr ja kaum entwachsen zu sein scheint, nicht beigebracht, vor Eurem Herrscher zu knien?«
Gelwyn schoß das Blut ins Gesicht. Er spürte, wie seine Glieder steif wurden und wie etwas in jenem Eckchen, das seine Gefühle beherbergte, aus den Fugen geriet. »Doch, König Ezzon«, erwiderte er. »Das hat man.«
Er war nicht dumm. Er wußte, was es bedeutete, daß er nun stehenblieb, mit starrem Nacken, trotzig und widerborstig, dem König zum Hohn. Er wußte, daß es kindisch war und gefährlich und nicht im geringsten das, was man in Ardfynnan von ihm erwartete. Tatsächlich hatte er das Gefühl, daß sie ihn dort schütteln würden, wenn sie von seinem Verhalten wüßten.
Aber er konnte nicht anders.
Die Menschen hatten ihn verletzt. Sie hatten ihn bis ins Herz gedemütigt. Sie hatten es fertiggebracht, daß er sich fühlte wie ein geprügelter Hund. Und wenn sie nun Gräben auftun wollten und Feindschaften begründen – dann war es ihm nur recht. Und deshalb hielt er dem eisigen Blick stand, ohne sich weiter zu äußern oder zu rühren.
Das Schweigen stand im Raum und dehnte sich auf fürchterliche Länge. Schließlich war es Sraggs, der es mit einem Hüsteln brach. »Wie ich schon sagte, mein König, ein arrogantes, kleines…«
Eine herrische Gebärde brachte den Lord zum Schweigen. Ezzon stand auf. Wenige lange Schritte brachten ihn die Stufen hinab zu dem Albenprinzen, und er packte ihn ums Kinn.
»Hör zu, Bürschchen …« Seine Worte kamen mit kalter Präzision und waren bis in den letzten Winkel des Saales zu verstehen. »Du hast Mut, und das schätze ich. Aber dein Mut hat einen Bruder mit Namen Stolz. Und der kommt mir übel hoch. Wenn du Wert darauf legst, Albenprinz, hier zehn ungeschorene Jahre zu verbringen – dann sieh zu, daß du Demut lernst und Gehorsam und die Bescheidenheit, die dir gebührt.« Die Hand schloß sich fester. »Du wirst einmal im Monat vor mir erscheinen, damit ich mich von deiner Unversehrtheit überzeugen kann. In der übrigen Zeit möchte ich von dir nichts zu sehen und vor allen Dingen nichts zu hören bekommen. Hast du das verstanden?«
Gelwyn versuchte zu nicken und sagte: »Ja.«
Er begriff, daß es glimpflich abgegangen war – warum auch immer. Die Spannung fiel von ihm ab, und plötzlich begannen seine Knie und die Hände zu zittern. Er war froh, als der König von ihm abließ und sich wieder zum Thron wandte.
Aber da war noch etwas. »Ich … vermisse meinen Begleiter, Stork.«
Ezzon reagierte nicht. Es war wieder Sraggs, der für den König antwortete. »Unser Herrscher«, erklärte der Lord mit einer Stimme, die vor Gehässigkeit vibrierte, »hat es in seiner Weisheit für richtig befunden, Euren Knecht heimzusenden, Prinz Gelwyn – nachdem ich ihm berichtet habe, welch bedauerlichen Einfluß dieser aufsässige Mann auf ein empfängliches Jungengemüt hat …«
Das also war es gewesen. Daher Sraggs’ Lächeln, daher König Ezzons Zorn.