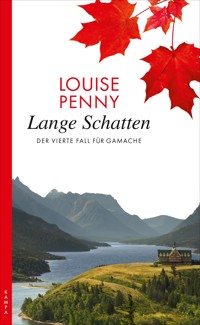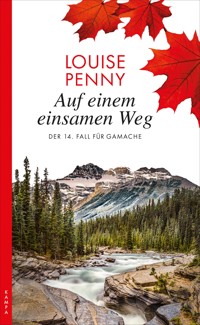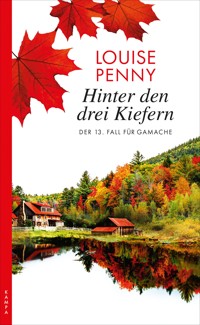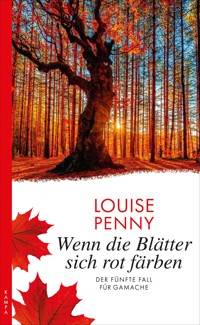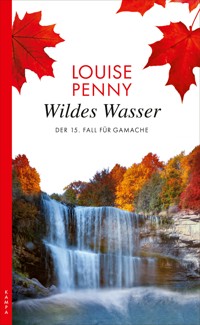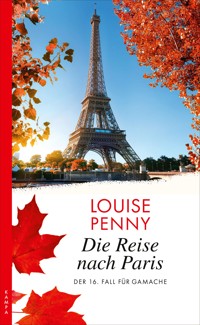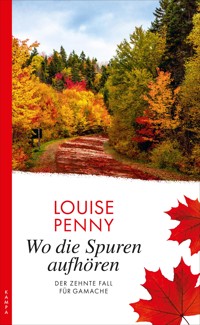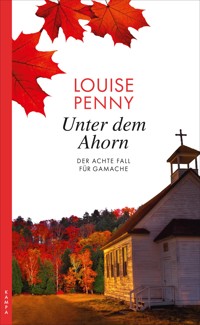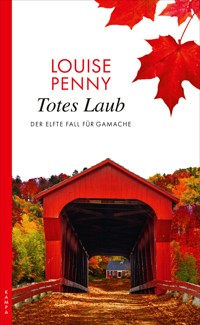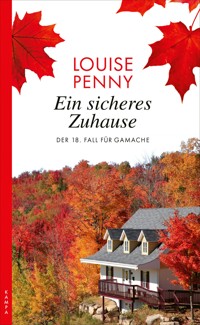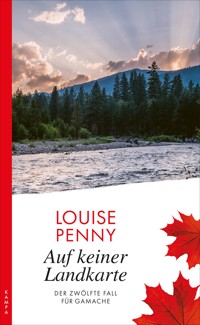19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Erst vor wenigen Wochen haben Chief Inspector Armand Gamache und sein Team von der Sûreté du Québec einen Terroranschlag in Montréal vereitelt, Tausende Leben gerettet und den Drahtzieher festgenommen. Einen Mann, den sie den schwarzen Wolf nennen. Doch die Erleichterung währt nur kurz. Gamache quält der Gedanke, dass der geplante Anschlag nur die Ankündigung für etwas viel Schlimmeres gewesen sein könnte. Offiziell sind die Ermittlungen eingestellt, und der Chief Inspector erholt sich von seinen Verletzungen. Undercover stellt er weitere Nachforschungen an, natürlich von Three Pines aus, seinem Zufluchtsort, seinem Zuhause. Während die Blätter von den Bäumen fallen und die Dorfgemeinschaft Holz für den bevorstehenden Winter hackt, brütet er über den wenigen Beweismitteln: zwei Notizbüchern und der Karte eines Sees mit rätselhaften Symbolen. An Gamaches Seite seine engsten Verbündeten – die wenigen, denen er in der Sûreté noch trauen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Louise Penny
Der schwarze Wolf
Der 20. Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck
Kampa
Für Andy Martin, meinen langjährigen Verleger und, wichtiger noch, langjährigen Freund.
Danke, dass du den Berg mit mir erklommen hast.
Vorbemerkung der Autorin
Ich habe dieses Buch in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 geschrieben und das fertige Manuskript im September 2024 meinem Verleger geschickt. Bestimmt können Sie sich meine Überraschung vorstellen, als ich im Januar 2025 Schlagzeilen las, die direkt aus dem Buch hätten stammen können …
1
»Wir haben ein Problem.«
Jetzt, Wochen später, wusste Chief Inspector Armand Gamache, was für eine gewaltige Untertreibung das gewesen war. Doch auch wenn sie vermutet hatten, dass etwas nicht stimmte, schien es zum damaligen Zeitpunkt trotzdem nichts weiter zu sein als ein Problem.
Ein schwacher Geruch. Eine Witterung, eine Ahnung, dass etwas schieflief.
Ein Problem.
Keine Krise. Keine drohende Katastrophe, die den Giftanschlag zwar nicht in den Schatten stellte, aber doch in ein anderes Licht rückte.
Jean-Guy Beauvoir und Isabelle Lacoste, seine beiden Stellvertreter bei der Sûreté du Québec, waren in den frühen Morgenstunden dieses Augusttags nach Three Pines gekommen, und gemeinsam hatten sie wieder und wieder das zweite Notizbuch gelesen, das sie unterschätzt, sogar als irrelevant abgetan hatten.
Das Notizbuch, von dem sie angenommen hatten, dass es lediglich vorbereitende Notizen enthielt. Nicht die Aufzeichnungen zu dem furchtbaren Plan, der bereits so viele das Leben gekostet hatte.
Bei ihrer Ankunft hatte Gamache Beauvoir und Lacoste nicht gesagt, was ihm durch den Kopf ging. Er wollte wissen, ob sie das Gleiche bemerkten wie er. Die Explosion in der Montréaler Wasseraufbereitungsanlage hatte sein Gehör schwer geschädigt. Vielleicht waren aber auch seine anderen Sinne in Mitleidenschaft gezogen, sodass er nicht mehr klar sehen und denken konnte. Nicht mehr auf das vertrauen konnte, was seine Augen, sein gesunder Menschenverstand, sein sechster Sinn, das Kribbeln seiner Kopfhaut ihm sagten.
Doch sowohl Beauvoir als auch Lacoste, die Besten und Klügsten in seinem Team, hatten den Kopf gehoben und genickt.
»Wir haben ein Problem«, hatten sie ihm zugestimmt.
Wegen des Lärms der Millionen Grillen, die sich seit der Explosion in seinem Kopf eingenistet hatten, konnte er die Worte zwar nicht hören, aber mittlerweile war er ziemlich gut im Lippenlesen. Und selbst wenn es ihm ihr Mund nicht gesagt hätte, so taten es ihre Augen, ihr Gesichtsausdruck, die plötzliche Anspannung ihres Körpers.
Allerdings war nach wie vor keineswegs klar, womit sie es zu tun hatten. Was sie übersehen, zur Seite geschoben hatten.
Sie wussten nur, dass sie sich getäuscht hatten, was die Reihenfolge der Notizbücher anging, die der junge Biologe versteckt hatte. Sie hatten angenommen, dasjenige, das alles über den geplanten Giftanschlag enthielt, sei das zweite. Das Ergebnis. Das Ende.
Das war ein Irrtum. Es war erst der Anfang.
Die eigentliche Bedrohung lag nach wie vor in den Worten verborgen, den Anmerkungen, den kryptischen Zeichnungen und Zahlen, die Charles Langlois hinterlassen hatte. Bevor er umgebracht worden war. Vor den Augen von Armand Gamache überfahren worden war, direkt neben ihm.
In den letzten Sekunden seines Lebens hatte er Gamaches Hand umklammert. Ihm in die Augen gesehen. Ein junger Mann, fast noch ein Junge, der im Sterben lag.
Als Gamache ihn gebeten hatte, ihm einen Hinweis zu geben, eine Andeutung zu machen, was geschehen würde, hatte Charles Langlois Blut spuckend ein einziges Wort geflüstert.
»Familie.«
Sonst nichts.
Langlois war der Erste von vielen gewesen, die sterben würden, einige davon waren an dem geplanten Giftanschlag beteiligt gewesen, andere hatten versucht, ihn aufzuhalten, einschließlich des Grauen Wolfs selbst. Er hatte sein Leben geopfert, um eine Katastrophe zu verhindern.
Dom Philippe war derjenige gewesen, der Gamache vor vielen Jahren am Ufer eines unberührten Sees die Geschichte von dem grauen und dem schwarzen Wolf erzählt hatte, die gegeneinander kämpften. Der eine trat für Anstand, Frieden, Gemeinschaftssinn und den Mut zur Güte ein. Zur Vergebung.
Der andere wurde von Hass getrieben, von Aggression. Von Rachsucht. Von dem Streben nach Macht und Herrschaft durch Angst. Durch die Verkehrung der Wahrheit zu einer riesigen Lüge, riesigem Leid.
Welcher von beiden würde gewinnen?
Der Graue Wolf war tot. Ermordet.
Sie hatten gedacht, der Schwarze Wolf sei gefangen worden. Doch als Gamache jetzt an diesem frühen Oktobermorgen aus der Dusche stieg, war er sich nicht mehr sicher.
Draußen war es noch dunkel, als der Leiter der Mordkommission der Sûreté über den beschlagenen Badezimmerspiegel wischte und sich einem Mann Ende fünfzig gegenübersah, dessen Gesicht zur Hälfte von Rasierschaum bedeckt war. Obwohl es jeden Morgen dasselbe war, konnte ihn das Gesicht, das ihm entgegenblickte, immer noch überraschen.
Wenn kein Spiegel in der Nähe war, war er Anfang vierzig. Doch Morgen für Morgen wurde er daran erinnert, dass das nicht stimmte. Und es stimmte mit jeder Sekunde weniger, dachte er, als er sich die vom Duschen nassen und verstrubbelten grauen Haare aus der Stirn strich und sich dann weiter rasierte.
Die Falten, die unter dem Rasierschaum zum Vorschein kamen, gruben sich mit jedem Jahr, jedem Monat, jedem Tag und jeder Sorge tiefer in sein Gesicht.
Er fragte sich, wie sein Vater ausgesehen hätte, wenn er so alt geworden wäre.
Viel zu oft kniete Armand Gamache neben Menschen, die nicht mehr älter werden würden, viele würden sich nie graue Haare aus der Stirn streichen oder Falten in ihrem Gesicht sehen. Würden nie Kinder oder Enkel haben.
Deshalb grämte er sich nicht über die Zeichen des Alterns, sie überraschten ihn nur ein wenig.
Hinter ihm im Spiegel sah Gamache sein und Reine-Maries Schlafzimmer. Auf den breiten Holzdielen lagen abgetretene Perserteppiche. Die Wände waren mit Bücherregalen und Bildern bedeckt, die sie nach dem Tod von Großeltern und Eltern geerbt hatten. Zusammengewürfelt und vielleicht keine große Kunst, aber in ihrer Vertrautheit heimelig. Und dafür umso mehr geschätzt.
Auf einem großen Sessel in der Ecke lagen die Kleidungsstücke, die sie am Abend zuvor ausgezogen und achtlos dort abgelegt hatten, seine über ihren, weil er später ins Bett gekrochen war. Wobei Reine-Marie noch weitergelesen hatte, nachdem er schon eingeschlafen war, das aufgeschlagene Buch auf der Brust, die Lesebrille zur Nasenspitze gerutscht.
Jeden Morgen fand er beides auf seinem Nachttisch in Sicherheit gebracht.
Ein kalter Windstoß, der durch die einen Spalt geöffneten Fenster kam, ließ die Vorhänge flattern und brachte frische Morgenluft mit, die leicht nach Kiefernnadeln und Herbstlaub roch.
Die Hunde, Henri und Fred, schliefen am Fußende des Doppelbetts, wogegen Gracie, die vielleicht, vielleicht auch nicht ein Streifenhörnchen oder ein Frettchen war, halb vergraben in dem Nest lag, dass sie sich aus ihren Kleidern gemacht hatte.
Während Gamache all das in sich aufnahm, suchte sein Blick jedoch nur eins. Als hätte er nach Hause gefunden, verharrte er schließlich bei Reine-Marie. Zusammengerollt lag sie unter der Daunendecke und schlief. Ihre grauen Haare breiteten sich über das Kissen. Ihr Mund war leicht geöffnet. Bestimmt schnarchte sie leise. Ein Geräusch, über das er nie nachgedacht hatte, das er jetzt aber vermisste.
Er lächelte, und dabei vertieften sich die Falten in seinem Gesicht. Seine Freude gewann die Oberhand und verdrängte diejenigen, die Belastung, Sorgen, Schmerz und Kummer eingegraben hatten.
Sein Lächeln war stärker. Doch eine Linie blieb. Die tiefe Narbe an seiner Schläfer, die von einem Kummer zeugte, der niemals ganz verschwinden würde, sollte, konnte. Er würde ihn ins nächste und übernächste Leben mitnehmen. Bis er Wiedergutmachung leisten konnte. Für dieses entsetzliche Versagen.
Jetzt, Anfang Oktober, ging die Sonne immer später auf, wohingegen Gamache immer früher aufstand, aus dem Bett getrieben von den zirpenden Grillen in seinem Kopf und dem quälenden Gefühl, dass er einen Fehler gemacht hatte.
Wir haben ein Problem.
Die von Beauvoir und Lacoste unisono ausgesprochenen Worte, als sie vor einigen Wochen im Wohnzimmer gesessen und das zweite Notizbuch gelesen hatten, wurden immer lauter.
Wir haben ein Problem.
Er rasierte sich fertig und rieb sich das Gesicht mit dem feuchten Handtuch ab. Dann stützte er sich auf den Rand des Waschbeckens, beugte sich vor und betrachtete sich im Spiegel. Er musste sich selbst gegenüber schonungslos ehrlich sein.
Immer wieder hatte er sich das zweite Notizbuch von Charles Langlois vorgenommen, bis er all diese seltsamen Einträge des jungen Biologen praktisch auswendig konnte.
Sie hatten ein Problem, und dieses Problem war, dass sie noch immer nicht wussten, worum es sich handelte. Nur dass es eines gab. Etwas Schreckliches würde passieren. Vor seinem Tod war Langlois über etwas gestolpert, das den Plan zur Vergiftung des Trinkwassers von Montréal einschloss, aber das war noch nicht alles. Dieser entsetzliche Terrorakt war nur ein Vorspiel, vielleicht sogar ein Ablenkungsmanöver, das verschleiern sollte, was tatsächlich vor sich ging.
Und Gamache war darauf hereingefallen.
Sicher, er und sein Team hatten den Giftanschlag verhindert, aber sie hatten nicht erkannt, dass es da noch etwas anderes gab, dem ebenso viel Bedeutung hätte beigemessen werden müssen. Einen zweiten Teil, eine tiefere, dunklere Ebene. Inzwischen ging Gamache immer später zu Bett und wurde von dem Lärm in seinem Kopf und dem unerträglichen Gefühl, erneut einen fatalen Fehler gemacht zu haben, immer früher geweckt. Indem er sich auf den einen Plan konzentriert hatte, hatte der andere Zeit gehabt, sich auszudehnen und weiterzuentwickeln, sich seinem Ziel zu nähern.
Irgendwo da draußen in der Finsternis lauerte ein Schwarzer Wolf, wurde gefüttert, wurde immer größer.
Die Kreatur wuchs ins Riesenhafte, Groteske. Wurde immer mächtiger. Rückte drohend näher. War vielleicht schon so nahe, dass man sie nicht mehr als das erkennen konnte, was sie war.
Lauerte und wartete.
Wir warten, wir warten.
Allmählich begann Gamache zu glauben, dass das Problem nicht nur da draußen war, sondern auch hier drinnen. Im Spiegel. Er war das Problem. Aber vielleicht, vielleicht auch die Lösung.
Eine Krankheit ist auf dem Weg zu uns. Wir warten, wir warten.
»Kein Problem.«
»Woher wollen Sie das wissen? Sie haben ihn schon einmal unterschätzt.«
Während sie am Telefon der sanften Stimme von Joseph Moretti zuhörte, spürte sie, wie das dünne Eis unter ihr knackte.
Sie war dem festen Boden schon so nahe gekommen. Dem sicheren Grund. Nach vielen Jahren da draußen hatte sie endlich das Ufer sehen können. Sogar riechen. Dieser wunderbare Kieferngeruch, der stets glückliche Zeiten verhieß. Der Weihnachtsbaum mit seinen hübschen Lichtern und all dem Schmuck und den Geschenken. Dieser erste Spaziergang im Wald, nachdem der Winter vorbei war und endlich ein warmer Hauch in der Luft lag und die immergrünen Nadeln ihren Duft verströmten.
Immergrün. Was für eine Vorstellung. Die Natur war widerstandsfähig. Sogar optimistisch.
Die Menschheit weniger.
Nach Jahren des Balancierens, des Schlitterns und Ausgleitens dachte sie, sie könnte sich endlich in Sicherheit bringen. Endlich.
Und dann im letzten Augenblick die Katastrophe. Dank Gamache. Dieses Arschloch. Sie konnte sich keinen weiteren Fehler leisten. Kein weiteres Fehlurteil. Keinen weiteren Moment der Schwäche.
Obwohl an diesem Samstagmorgen Anfang Oktober viele Kilometer zwischen ihr in ihrem Büro im Zentrum von Montréal und Moretti im Norden der Stadt auf dem Marché Jean-Talon lagen, spürte sie seinen Blick auf ihr. Intensiv, forschend. Als würde er sie einer Leibesvisitation unterziehen. Schicht um Schicht entfernen, nicht nur ihre Kleidung, sondern auch ihre Haut, die er in Streifen herunterriss, auf der Suche nach irgendeiner Lüge, die sie möglicherweise tief in ihrem Inneren verbarg, in ihren Knochen, ihrem Mark.
Nach all den Jahren vertraute er ihr noch immer nicht. Trotz allem, was sie getan hatte. Er war wie ein Raubtier, das sich auf seinen Instinkt verließ. Das die Witterung des Verrats, drohender Gefahr aufzunehmen versuchte.
Sie wünschte, sie könnte es dabei bewenden lassen. Ihn als wilde Kreatur abtun, aber sie hatte ihn im Lauf der Jahre sehr genau beobachtet, und dabei hatte sie nicht nur die Verschlagenheit des Mafiabosses gesehen, seine Arglist und seine Brutalität, sondern auch seinen Charme und seine Intelligenz.
Das war kein Verrückter, der ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen beging. Dieser Mann hätte alles werden können.
Wäre Joseph Moretti in eine andere Familie hineingeboren worden, in irgendeine andere Dynastie, wäre sein Leben anders verlaufen.
Doch jetzt fragte sie sich, ob sie sich da nicht täuschte.
Trotz all seiner Bildung und Intelligenz stimmte etwas nicht. Eine Schraube war locker. Ob das an seiner Erziehung lag oder angeboren war, wusste sie nicht. Was sie wusste, war, dass etwas Fauliges, etwas Zerstörerisches hervordrang.
»Sie behaupten, Gamache sei kein Problem«, sagte Moretti. »Aber er und seine Leute haben es geschafft, den ersten Teil des Plans zu durchkreuzen. Dabei haben sie sechs meiner Soldaten getötet, darunter zwei uomini d’onore. Wenn er sich nicht eingemischt hätte, wäre es jetzt vorbei. Die Fünf Familien fangen an, sich Sorgen zu machen. Wie viel weiß er? Er hat die Notizbücher gefunden, richtig?«
»Ja, er hat sie der Staatsanwaltschaft übergeben.«
»Hat er sie gelesen?«
Sie wollte schon patzig antworten: Woher soll ich das wissen?, riss sich aber zusammen.
»Ich nehme es an.« Ihre Stimme klang ruhig. »Ich habe sie auch gelesen. Mit dem zweiten Notizbuch konnte er wahrscheinlich nicht viel anfangen, selbst wenn er begriffen hat, dass es das wichtigere ist.«
»Wahrscheinlich? Wahrscheinlich?« Morettis Stimme war mit jedem Wort lauter geworden, dann senkte er sie unvermittelt zu einem heiseren Knurren. »Sie hätten dafür sorgen sollen, dass er die Kirche nicht lebend verlässt.«
»Ich wollte, dass er den Alarm auslöst. Man hätte ihm geglaubt. Man vertraut ihm.«
»Nun ja, wenn ihm ein Verdacht kommt, dass da mehr dahintersteckt …«
»Das wird nicht passieren. Hören Sie, die Ermittlungen sind abgeschlossen. Niemand achtet darauf. Schon gar nicht Gamache. Für die ist es vorbei.«
Sie hatte genug von Morettis Paranoia. Es war anstrengend. Sie war erschöpft. So nah am Ufer, so kurz vor dem Ende konnte sie sich jetzt keinen Fehler leisten. Nicht noch einen. Moretti hatte recht. Sie hätte dafür sorgen sollen, dass Gamache die Kirche nicht lebend verließ.
Sie musste das zu einem Ende bringen.
»Der Biologe ist tot …«, setzte sie an.
»Das weiß ich.« Sein Ton wurde barsch.
Das solltest du auch, dachte sie. Schließlich hast du ihn umbringen lassen.
»Er hätte um ein Haar herausgefunden, was vor sich geht«, fuhr sie fort. »Aber selbst er wusste nicht alles. Wenn es so gewesen wäre, hätte er es Gamache bei ihrem Treffen im Open Da Night gesagt. Und selbst wenn Charles Langlois darauf gekommen wäre, hätte ihm niemand Glauben geschenkt. Würden Sie das tun, wenn Ihnen jemand so eine Geschichte auftischen würde?«
Sie wartete auf sein Lachen, es kam jedoch keines.
»Nein«, beantwortete sie ihre Frage selbst. »Sie hätten es als unglaubwürdig und Charles Langlois als einen an Wahnvorstellungen leidenden Verrückten abgetan. Als paranoid. Er hatte eine entsprechende Vorgeschichte mit Drogenabhängigkeit und einer psychischen Erkrankung. Man hätte ihn als bedauernswerten jungen Mann aus einer Obdachlosenunterkunft betrachtet, der nicht bei klarem Verstand war und sich zu viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt hatte. Ironischerweise wäre die Wahrheit der Beweis für seine Verrücktheit gewesen. Nein. Er wusste nichts von dem Plan.«
»Er wusste genug, um Kontakt zu Gamache aufzunehmen«, hob Moretti hervor. »Gamache hat ihm zugehört, er hat ihm geglaubt.«
»Stimmt, aber nur, was das untergeordnete Ziel angeht. Voyons, wenn man nicht weiß, wonach man sucht, besteht dieses Notizbuch größtenteils aus Geschwafel.«
»Und Gamache weiß es nicht?«
»Er hat keine Ahnung. Er ist beurlaubt und erholt sich in seinem kleinen Dorf. Seit all das passiert ist, war er sehr still.«
»Still heißt nicht untätig. Sie haben ihn schon einmal unterschätzt. Das darf kein zweites Mal passieren.«
Sie seufzte. »Wenn Sie so beunruhigt sind, warum bringen Sie ihn dann jetzt nicht einfach um? Der erste Schnee ist angekündigt. Wahrscheinlich hat er noch keine Winterreifen an seinem Auto. Drängen Sie ihn einfach von der Straße. Fini.«
Sie wartete. Wir warten, wir warten.
Moretti dachte darüber nach.
»Nein. Wenn er in der Kirche oder in der Wasseraufbereitungsanlage ums Leben gekommen wäre, wäre das in Ordnung gewesen. In Erfüllung seiner Pflicht und so weiter. Aber jetzt? Einen ranghohen Sûreté-Beamten umbringen? Können Sie sich die Reaktionen vorstellen? Selbst wenn es wie ein Unfall aussähe, wäre der Zeitpunkt verdächtig. Es würde Fragen geben. Seine Leute würden nicht aufhören zu graben, und Gott weiß, was sie finden würden. Nein. Wir müssen einfach sicherstellen, dass er kein Problem ist.«
»Ist er nicht.«
»Das haben Sie schon gesagt, aber wie können Sie sich da so sicher sein?«
»Weil ich die Erste wäre, zu der er käme, wenn er einen Verdacht hätte.«
»Er vertraut Ihnen? Immer noch?«
»Natürlich. Warum nicht? Soweit er weiß, habe ich dazu beigetragen, den Giftanschlag zu vereiteln.«
»Sie lügen mich doch nicht an, oder?«
»Das würde ich nie tun, Don Moretti. Schon allein deshalb, weil es nicht besonnen wäre.«
Ein paar Sekunden blieb es still, dann war leises Lachen zu hören. »Na ja, Sie sind vieles, aber besonnen gehört nicht dazu.«
Da hatte er wahrscheinlich recht, dachte sie. Sonst hätte sie sich niemals so weit vom Ufer entfernt wiedergefunden.
»Bon«, sagte er schließlich. »Es ist bald vorbei.«
Das Problem mit Psychopathen, und davon hatte sie mehr als genug kennengelernt, war, dass sie sich für die Sonne hielten, um die alle anderen kreisten. Sie waren das Licht, die Dunkelheit, die Schwerkraft, die Vernunft. Die Ursache und der Grund. Joseph Moretti wusste, dass er die Sonne war, er war der Sohn und Sohnessohn. Bei ihm lief alles zusammen. Nichts geschah ohne seine Zustimmung. Er war allsehend, allwissend.
Nur irrte er sich.
Das hier war größer, als selbst ihm klar war. Es gab noch einen Himmelskörper, der sogar den Boss der Bosse überstrahlte. Sie musste bloß weiter über das Eis gleiten und aufpassen, dass sie nicht das Gleichgewicht verlor. Ihn bei Laune und bei der Stange halten. Damit er in die eine Richtung schaute, nicht in die andere.
»C’est vrai«, sagte sie und lachte. »Wir sind auf der sicheren Seite. Machen Sie sich keine Sorgen.«
»Oh, ich bin nicht derjenige, der sich Sorgen machen sollte.«
Es folgte ein kurzes Schweigen, und in diesem Moment begriff sie ihren Irrtum. Sie hatte zu denken gewagt, dass sie es noch schaffen könnte, das rettende Ufer zu erreichen.
So kam es zu Fehlern, so entstanden Risse. Die Hoffnung lockte Menschen näher an den Rand. Dabei erkannten sie nicht, dass das Eis dort zuerst schmolz. Nur ein paar Schritte von festem Boden entfernt gab es nach, und sie versanken im eiskalten Wasser, es raubte ihnen den Atem, ihr Herz verkrampfte sich, und das Letzte, was sie sahen, waren die Kiefern über ihnen, zum Greifen nah, während sie untergingen.
»Und die Karte?«, fragte er. Am anderen Ende der Leitung hörte sie Stimmen, die einander etwas zuriefen. Freundliche Stimmen.
»Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob es eine gibt. Wenn Charles Langlois eine Karte besaß, hat er sie gut versteckt. Falls sie überhaupt existiert, finden wir sie. Niemand hat sie, andernfalls hätte ich davon gehört.«
»Ich halte es für eine gute Idee, wenn Sie hierherkommen, Evelyn.«
»Jetzt, heute? Auf den Markt?« Sie spürte, wie sich die Härchen an ihren Unterarmen aufrichteten.
Meinte er das ernst? War das ein Test? Oder war sie bereits durchgefallen? War es eine Falle? »Man könnte uns zusammen sehen.«
»Ich bin sicher, dass Ihnen eine glaubwürdige Erklärung einfällt. Sie werden ja wohl fürs Abendessen einkaufen dürfen.«
In die Stille hinein stieß sie einen Seufzer aus. »Bin schon auf dem Weg.«
Sie legte auf und blickte zu der kleinen, etwas derangiert aussehenden jungen Frau, die in der Tür zu ihrem Büro stand.
»Sie gehen doch nicht dahin, oder, patron?«
»Es bleibt mir keine Wahl.« Sie zog ihren dicken Mantel an und setzte ihren großen Hut auf. »Außerdem brauche ich Rosenkohl.«
»Kriegen Sie den nicht im Gemüseladen?«
»Das war ein Witz.«
Beide gingen rasch den verlassenen langen Flur zu den Aufzügen hinunter.
»Moment!«
»Was ist?«
Ihre Assistentin zögerte. »Ich habe gehört, was Moretti gesagt hat. Er hat recht. Sie hätten Gamache töten lassen sollen.«
Sie nickte. Sie wussten beide, dass das stimmte. Das war ihr Fehler, die Schwachstelle in ihrer Rüstung, auf die Moretti zielte. Sah er die große Lüge?
»Soll ich Ihnen einen Wagen kommen lassen?«
»Nein, ich nehme die Métro.«
Während sich die Aufzugtüren schlossen, hörte sie noch: »Faites attention.«
Seien Sie vorsichtig.
Chief Inspector Evelyn Tardiff kramte in ihrer Handtasche nach ihrem Fahrausweis und wusste, dass sie die Vorsicht längst hinter sich gelassen hatten. Inzwischen ging es nur noch um verschiedene Abstufungen von Leichtsinn. Die Schlittschuhe waren unter ihr weggeglitten. Sie ruderte mit den Armen. Sie hing in der Luft, und die Frage war nur noch, wie heftig, wie hart der Sturz sein würde. Wie weh würde es tun?
Auf dem U-Bahnsteig lehnte sie sich mit dem Rücken an die geflieste Wand und hörte das Geräusch eines einfahrenden Zugs. Ein Seufzer entfuhr ihr. Sie machte das schon viel zu lange. Allmählich war sie zu alt dafür, zu müde, zu nachlässig. Sie hatte keine Ahnung, wie sie das Gleichgewicht wiederfinden sollte, geschweige denn das Ufer erreichen.
Überleben war nicht garantiert.
Sie hätten Gamache töten lassen sollen.
Das hatte nichts mit Rachsucht zu tun. Es war ganz einfach wahr. Und vielleicht immer noch nötig. Möglicherweise führte ihr einziger Weg ans Ufer über seine Leiche.
Don Moretti schob das Handy in die Tasche. Er nahm von einem ordentlich aufgeschichteten Haufen eine Ochsenherztomate und strich in einer geradezu zärtlichen Geste darüber, um ihre Festigkeit zu prüfen. Dann hielt er sie sich an die Nase, sog den Geruch ein und lächelte, als er den Blick seiner Frau einen Gang weiter auffing. Er holte mit dem Arm aus und tat so, als wollte er mit der Tomate nach seiner kleinen Tochter werfen, die sich vor Lachen kreischend duckte.
Vorsichtig legte Moretti die Tomate zurück. Ihre dünne Haut war unverletzt.
Es war kurz vor sieben an diesem Herbstmorgen, der Markt hatte noch nicht geöffnet. Die Bauern bauten noch ihre Stände auf.
Der Himmel war am Horizont von einem dunklen Samtblau. Der Tag würde klar und frisch und verheißungsvoll beginnen. Alles war möglich.
2
Clara hob den Becher mit lauwarmem Kaffee an den Mund, ohne daran zu denken, dass zwischen ihren Zähnen ein Pinsel klemmte, als wäre sie ein Revolverheld, der auf ein Stück Holz biss, weil man eine Kugel aus ihm herausschnitt.
Das war gar nicht so weit hergeholt. Diese Schaffensphase war immer schmerzhaft, weil Clara von Unsicherheit geplagt wurde. Sie blutete innerlich. Die Wunde war schlimmer, als es aussah.
Überleben war nicht garantiert.
Durch das Fenster ihres kleinen Hauses in dem Québecer Dorf Three Pines sah sie in dem weitläufigen weißen Schindelhaus auf der anderen Seite des Dorfangers Licht brennen und aus dem Schornstein Rauch aufsteigen.
Bei den Gamaches war jemand wach und mit etwas zugange. Und das so früh.
Gleich darauf bemerkte sie einen sanften Schimmer über den Wäldern und Hügeln, die das Dorf umgaben. Die Sonne ging auf.
Wie spät war es? Als sie das letzte Mal auf die Uhr gesehen hatte, war es 2:17 Uhr gewesen. Die vertraute Stimme hatte genörgelt, sie sei eine Betrügerin. Sie sei am Arsch.
Sie hatte sie aus dem Bett, die schmale Treppe hinunter und in ihr Atelier getrieben, wo sie auf die Leinwand und die merde starrte, die jemand, sicher nicht sie, dort hinterlassen hatte.
Das sollte das Herzstück ihrer Einzelausstellung im Musée d’art contemporain in Montréal werden.
Scheiße. Ach du Riesenscheiße!
Der einzige Trost war, dass das Bistro bald öffnen würde und sie Zuflucht bei buttertriefenden warmen Zimtschnecken suchen konnte. Und geräuchertem Speck. Und, und …
Myrna.
Die beiden Frauen würden vor dem knisternden Kaminfeuer sitzen und starken Café au Lait trinken, und für ein paar Minuten könnte Clara vergessen, dass es ihr vorkam, als ob eine Pistole auf ihr Herz gerichtet war. Ein Finger am Abzug lag. Ihn drückte …
Clara Morrow stellte den Kaffeebecher ab, spuckte den Pinsel aus und kehrte der Staffelei und der Serie, an der sie seit zwei Jahren arbeitete, den Rücken zu.
Sie trug den Titel Kurz bevor etwas passiert …
»Mario!« Joseph Moretti legte dem älteren Mann die Hand auf die Schulter. »Wie sind Ihre Eier?«
»Frisch und groß wie immer, Don Moretti.«
Die beiden Männer lachten.
Es war ein alter Scherz zwischen ihnen, der vor mehreren Jahrzehnten begonnen hatte, als Mario ein kraftstrotzender junger Mann gewesen war und Joseph ein Kind, das seinem Großvater über den Marché Jean-Talon folgte. Damals hatte der Junge gedacht, die Frage des Großvaters sei wörtlich gemeint, was ihn verwirrte, weil Mario einen Metzgerstand hatte und keine Eier verkaufte.
Der Scherz war an den Sohn und mittlerweile an den Enkel weitergegeben worden, der ihn schließlich verstanden hatte, als er in die Pubertät kam. Es war klar, dass dieser kurze Wortwechsel, der noch nie geistreich oder witzig gewesen war, dem würdevollen älteren Mann peinlich war. Von Anfang an. Und genau deshalb stellte Moretti jedes Mal wieder die Frage, wie sein Vater und sein Großvater vor ihm. Jedes Wochenende.
Seit er ein Kind war, jünger als seine Tochter heute, besuchte Joe Moretti samstagmorgens den Bauernmarkt in Little Italy. Noch bevor der Markt geöffnet wurde, war er an der Hand seines Vaters ein paar Schritte hinter dem Großvater die Gänge entlanggelaufen, in denen die Bauern geschäftig ihre Waren ausluden. Sie bauten ihre Stände auf, an denen sie leuchtende Kürbisse und bunte Paprika, duftende Äpfel, erdige Kartoffeln und verschiedene Zwiebelsorten feilboten.
Die Männer und Frauen riefen sich gegenseitig Bemerkungen zu. Manche sangen, andere stritten über ein Fußballspiel. Ein nicht gegebener Elfmeter. Gestöhne wegen eines Freistoßes, der an die Latte gegangen war.
Es war ein gutmütiges Geplänkel, und der kleine Joe hatte sie beneidet. Um ihre Kameradschaft. Um die Unbekümmertheit, mit der sie lachten und stritten. Die offenkundige Einfachheit ihres Lebens. Die Gewissheit und Vorhersehbarkeit. Was zu tun war. Wie es zu tun war. Wenn es hin und wieder eine Missernte gab, war das nicht ihre Schuld. Sie hatten sich nichts vorzuwerfen.
Schon als Kind hatte er Neid empfunden und war sich des Unterschieds zwischen ihnen und ihm bewusst gewesen.
Dem kleinen Joseph war auch aufgefallen, dass die Bauern verstummten, das Gelächter aufhörte, wenn sich sein Großvater und sein Vater näherten, selbst wenn er sich näherte.
Die Scherze erstarben auf ihren Lippen, sie tippten an ihre Mützen und nickten. Jeder hoffte, Don Moretti würde stehen bleiben. Würde seine Waren bewundern und ihm die Gelegenheit geben, der Moretti-Familie das Beste, was er hatte, anzubieten.
Jetzt, Jahrzehnte später, sah und klang es an diesem Ort genauso wie früher, es roch sogar genauso. Immer noch herrschte Geschäftigkeit. In der Luft lag immer noch der Duft von frisch geerntetem Obst und Gemüse. Selbst das Blut der geschlachteten Tiere roch für Moretti angenehm. Oder zumindest vertraut. Mittlerweile.
Als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann hatte er es wahrgenommen, so wie seine Tochter heute. Unbewusst hatte der junge Joe den Respekt wahrgenommen, die Ehrerbietung, die seinem Großvater und seinem Vater, seiner gesamten Familie entgegengebracht wurde. Sie hatten ein Recht darauf, es war ihr Geburtsrecht.
So schien es jedenfalls.
Ein Jahrzehnt später, in seinen späten Teenagerjahren, hatte er beobachtet, wie all das dahinschwand, als der Alte festgenommen wurde, weil er Waffen in die USA geschmuggelt hatte, und sein Vater die Führung übernahm. Er war für diese Aufgabe nicht geeignet. Er war zu nett, allzu schnell bereit zu vergeben, mit anderen Québecer Mafiafamilien Kompromisse zu schließen und zu kooperieren. Bündnisse mit den Motorradgangs einzugehen, mit der East End Gang. Den irischen und jüdischen Mafiafamilien. Zu schnell bereit, ein Territorium aufzugeben, um den Frieden zu wahren.
Er war schwach.
Joe junior wusste das. Und er hatte von klein auf gewusst, was zu tun war, um ihr Überleben zu sichern.
Die Zeichen mangelnden Respekts, nachdem der Großvater verhaftet worden war und der Sohn seine Nachfolge angetreten hatte, waren nicht plakativ, kamen aber prompt und unmissverständlich. Die Kuchen, die Joe senior angeboten wurden, waren an den Rändern verbrannt. Man konnte sie nur verschenken. An die Armen oder an die Morettis.
Die Bauern offerierten ihnen immer noch ihre Waren, aber vielleicht waren es nicht die besten Stücke Fleisch. Nicht das frischeste Obst oder Gemüse. Die Druckstellen waren nicht zu übersehen. Genauso wenig wie die Botschaft.
Trotzdem nahm Joe senior, der neue Don, die Geschenke an und dankte den Bauern sogar dafür, während Joe junior das Gesicht verzog und Groll hegte, und er merkte sich die Namen, während das Moretti-Imperium verfiel.
Die an Schadenfreude grenzende Genugtuung derer, die sich an dem Niedergang der Morettis delektierten, war kurzlebig. So wie sie selbst.
Nach dem Tod des Großvaters im Gefängnis hatte der Enkel keine Zeit verloren, um sich als das neue Oberhaupt zu etablieren, und dabei den eigenen Vater übergangen. Ein kühner, manche sagten unkluger Schritt, der einen offenen Krieg nach sich zu ziehen drohte. Bis Joseph Moretti senior in Sainte-Émiline nördlich von Montréal bei einem Feuer im Landhaus seiner Geliebten ums Leben kam. Ein Feuer, das von einer jungen Brandermittlerin bei der Sûreté als Unfall eingestuft wurde.
Dann hatten die Vergeltungsmaßnahmen begonnen, rasch, unerbittlich, gnadenlos.
Und als es vorbei war, war Joe Moretti der Jüngere der neue capo di tutti i capi. Das Oberhaupt der Sechsten Familie. Der mächtigste Mafiaboss in Kanada und einer der mächtigsten in Nordamerika, nach den fünf New Yorker Mafiafamilien.
Während Don Moretti an diesem klaren Samstagmorgen Anfang Oktober die Gänge des Marché Jean-Talon entlangschlenderte, Geschenke und Zeichen des Respekts entgegennahm, ihm »Bon matin, Don Moretti« zugerufen wurde, und er die Früchte der Arbeit anderer genoss, saß die ehemalige Brandermittlerin in der Métro und betrachtete im Fenster ihr Spiegelbild, während der Zug durch einen weiteren Tunnel fuhr.
Jean-Guy Beauvoir blieb an der Tür der Kirche stehen und hielt Ausschau nach seinem Schwiegervater.
Der Geruch frisch gebrühten Kaffees und ein kalter Luftzug, der über sein Gesicht strich, hatten ihn in aller Frühe geweckt. Er öffnete die Augen und betrachtete missmutig die Vorhänge, die sich am offenen Fenster bauschten.
Scheiße. Ach du Riesenscheiße.
Er rutschte tiefer unter die Daunendecke, legte die Arme um Annie und spürte, wie ihre Körper die Decke aufwärmten. Er zog sie fester um sich und versuchte so zu tun, als würde keine kalte Luft ins Zimmer strömen.
In der Hoffnung, Annie würde aufwachen und das Fenster schließen, versetzte er ihr einen zarten Stups. Aber sie rührte sich nicht.
Er stand auf und eilte in der festen Absicht zum Fenster, es zu schließen und sofort wieder ins Bett zu springen. Doch als er davorstand, sah er im weichen Licht der Morgendämmerung seinen Schwiegervater die unbefestigte Straße hinaufgehen, die aus dem Dorf führte. Wie Dr. Doolittle gefolgt von einer kleinen Tierparade. Henri, zwei Ohren auf vier Pfoten, der alte Fred und die kleine Gracie.
Beauvoir warf einen Blick zum warmen Bett, wo Annie leise schnarchte, dann wandte er sich wieder dem Fenster zu, aber Gamache war verschwunden.
Er schloss das Fenster, gab Annie einen Kuss und flüsterte: »Ich weiß, dass du wach bist, du fürchterliches Weib.«
Das Schnarchen wurde ein bisschen lauter.
Nachdem er einen Blick in das Zimmer von Honoré und Idola geworfen hatte, stellte er sich rasch unter die Dusche, rasierte sich und zog eine Cordhose und seinen dicken, nach dem Zedernholzschrank riechenden Herbstpullover an. Er folgte dem Geruch des Kaffees in die Küche, schenkte zwei Becher ein und verließ das stille Haus.
Die Sonne spitzte gerade erst hinter den Bäumen des Waldes hervor. Das Licht war eher eine Andeutung. Ein Versprechen kommender Dinge. Es war kurz nach sieben, und glitzernd brach ein klarer, frischer und verheißungsvoller Tag an. Alles war möglich.
Über dem sich in das Tal schmiegenden Dorf hatte sich Nebel gebildet, als die kühlere Herbstluft auf die von der Erde aufsteigende Wärme traf. Über dem Bella Bella wurde er dichter und wand sich wie ein breites Band am Wald entlang, während er dem Flüsschen durch Three Pines und auf der anderen Seite wieder hinaus folgte.
All dies verlieh einem ohnehin schon geheimnisumwitterten Dorf etwas geradezu Mystisches, das durch die phantastische herbstliche Färbung des Waldes noch verstärkt wurde.
Der aus den Bechern aufsteigende Dampf vermischte sich mit dem Nebel und fügte dem Geruch nach frischem Gras, feuchter Erde und Laub das Aroma von Kaffee hinzu. Beauvoir atmete tief ein und wurde von einem Gefühl des Friedens erfüllt.
Er wusste, dass es nicht von Dauer war, vielleicht sogar illusorisch, aber er genoss es trotzdem, als er in Gamaches Fußstapfen den Hügel zur Kirche St. Thomas erklomm.
Dort angekommen, stieg er die Stufen hoch und hielt kurz inne, um einen Blick zurück auf die Häuser aus Feldstein, hellrotem Backstein und weißen Schindeln um den Dorfanger herum zu werfen. In der Mitte des Dorfes standen drei riesige Kiefern, die die Häuser und Läden wie Wachtürme überragten. Wie Beauvoir gelernt hatte, stellten drei in einer bestimmten Anordnung gepflanzte Kiefern einen alten Code dar, der Menschen, die aus Angst um ihr Leben auf der Flucht waren, verriet, dass sie sich endlich in Sicherheit befanden. Sie hatten einen Zufluchtsort gefunden.
Auch in Three Pines wurden Menschen krank und starben. Wurden Menschen verletzt, verwundet. Geschahen genau wie anderswo schreckliche Dinge. Das Dorf garantierte keine Sicherheit vor den Schlägen, die das Leben austeilte, könnte es auch nicht. Das wäre lächerlich gewesen.
Dieses Dorf bot den Menschen nicht physische, sondern emotionale Sicherheit.
Was auch immer geschah, sie waren hier nicht allein. Sie fanden Hilfe und Gesellschaft, und schließlich, am Ende, Trost. Eine Hand, die sie hielt.
Beauvoir sah, wie Olivier die Pension, die er zusammen mit seinem Lebensgefährten Gabri betrieb, verließ und über den Dorfanger zum Bistro ging. Gleich darauf fiel Licht durch die Sprossenfenster. In Kürze würde aus den Schornsteinen des Bistros weißer Rauch aufsteigen, und die Dorfbewohner würden darin ein Zeichen sehen, das in ihrem Leben eine wichtigere Rolle spielte als jede Papstwahl.
Das Frühstück war fertig.
Ihr Samstag würde mit starkem Kaffee und Crêpes vor einem der beiden großen Kamine beginnen, oder mit French Toast und frischem Obst und Ahornsirup, gezapft von den Bäumen, die Beauvoir von dort, wo er stand, sehen konnte.
Es würde Rührei mit geschmolzenem Brie und geräuchertem Speck geben, knusprige Croissants und warme Zimtschnecken aus Sarahs Bäckerei eine Tür weiter.
Vor allem aber würden die Dorfbewohner ihren Tag gemeinsam beginnen. Während Gamache allein hinauf zur Kirche ging. Jeden Morgen setzte er sich auf die gleiche Bank unter dem Buntglasfenster mit den drei Jungen, den Brüdern, die Three Pines vor über hundert Jahren verlassen hatten, um in den Ersten Weltkrieg zu ziehen, und nie zurückgekehrt waren.
Es war ein Bild, das dem Betrachter nicht wegen des zweifellos dargestellten Heldenmuts im Gedächtnis blieb, sondern wegen der Angst, die sich tief und für alle Ewigkeit in die Gesichter von zwei der Jungen gegraben hatte, während der dritte, der jüngste Bruder, die Gemeinde ansah. Nicht anklagend, was durchaus verständlich gewesen wäre, sondern mit einem Blick, der viel schlimmer war. Geradezu abgründig.
Im Alter von siebzehn Jahren marschierte er mit seinen Brüdern dem sicheren Tod entgegen, in einer aussichtslosen Schlacht, die lediglich das nächste Gemetzel vorwegnahm. Und dann verbrachte er das folgende Jahrhundert damit, die Gemeinde anzusehen, diejenigen, die das hatten geschehen lassen, die sie hatten ziehen lassen. Sie sollten eines wissen.
Dass er ihnen vergab.
Geh leise heim und bete darum, dass du sie nie kennenlernst / die Hölle, in der Jugend und Lachen verschwinden.
Auch heute saß Gamache hier zwischen Angst und Vergebung, zog die Kopie, die er von Charles Langlois’ Notizbuch gemacht hatte, aus der Tasche und versuchte herauszufinden, was er übersehen hatte. Versuchte zu verstehen, was von einem anderen jungen Mann, der ebenfalls sein Leben für andere geopfert hatte, auf diesen Seiten festgehalten worden war.
Er wusste, dass es unverzeihlich wäre, wenn er scheiterte.
All das wusste auch Beauvoir, als er sich von der friedlichen Aussicht abwandte und die Kirche betrat.
Die Falten zwischen Gamaches Augenbrauen vertieften sich.
Es gab nach wie vor so viel, was sie nicht wussten, aber ihm war klar, dass noch etwas geplant war. Was bedeutete, dass sie nicht alle erwischt hatten. Dass sich einige einer Verhaftung entzogen hatten. Um das zu bewerkstelligen, musste ihr Einfluss bis in die höchsten Ebenen der Regierung, der Justiz, der Wirtschaft reichen. Des organisierten Verbrechens.
Der Polizei.
Sogar, wie er fürchtete, der Sûreté. Wer es war, wusste er nicht, aber er hegte einen Verdacht. Bei der ersten Razzia waren einige Beamte verhaftet worden, aber ein übrig gebliebener fauler Apfel reichte, um die anderen anzustecken. Deshalb wusste nur Gamaches allerengster Kreis, dass er die Ermittlungen nicht eingestellt hatte. Nur einige wenige seiner Leute. Sehr wenige. Sorgfältig ausgewählt.
»Es muss noch mehr geben«, hatte Gamache an diesem Morgen geflüstert, als er auf den Rand des Waschbeckens gestützt sein Spiegelbild angestarrt hatte.
Da gibt es noch mehr, hatte er gedacht, als er die stille Kirche betreten hatte, gefolgt von der kleinen Tierparade. Und den Geistern, die ihn nie verließen.
»Ganz sicher«, murmelte er, während er reglos dasaß und geradeaus blickte. Während er sich bemühte zu verstehen, was gerade geschah. Was geschehen würde.
Falls es denn so war.
Ein Teil von ihm hoffte immer noch, dass er sich irrte. Dass er viel zu viel in die hingekritzelten Notizen eines toten Mannes hineininterpretierte. Hatte das Zirpen in seinem Ohr, in seinem Kopf, ihn taub für die Stimme der Vernunft gemacht?
Alle anderen waren davon überzeugt, dass die Gefahr vorüber war. Die Verschwörer waren verhaftet worden. Saßen im Gefängnis. Einschließlich des Mannes, der hinter alldem steckte.
Der ehemalige kanadische Vizepremierminister.
Marcus Lauzon hatte geleugnet, beteiligt gewesen zu sein, aber die Beweise gegen ihn waren erdrückend gewesen. Während sich die Beweise gegen Don Moretti in Luft aufgelöst hatten. Einfach verschwunden waren.
Wie konnte das sein? Wie konnte es sein, dass dieser Mann, dieser Mörder, nicht einmal verhaftet worden war?
Die Antwort war natürlich klar. Irgendjemand ganz oben hatte die Hand im Spiel gehabt.
Wenn Gamache diesen Gedankengang weiterverfolgte, drängte sich ihm allerdings eine noch beunruhigendere Frage auf: Warum war Moretti davongekommen, während Marcus Lauzon verurteilt worden war? Hätte Lauzon, wenn er der Schwarze Wolf war, nicht dafür gesorgt, dass sich die Beweise gegen ihn in Luft auflösten und Moretti zu Fall kam?
Warum war es andersherum? Warum?
Darauf gab es wiederum zwei mögliche Antworten.
Lauzon zog es vor, im Gefängnis zu sitzen, wo kein Verdacht auf ihn fiel, während etwas anderes passierte.
Oder …
Gamache schloss die Augen, holte tief Luft und wagte den Sprung.
Oder … er hatte sich geirrt. Marcus Lauzon war nicht der Schwarze Wolf.
Nach Abschluss der Ermittlungen einige Wochen zuvor hatte Gamache die Leiterin der Abteilung zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens bei der Sûreté angerufen. Zwar zog er ein persönliches Gespräch immer vor, aber für den Moment mussten Videotelefonat und virtuelle Welt genügen.
»Ich habe mir die gleichen Fragen gestellt, Armand.« Was Evelyn Tardiff sagte, wurde am unteren Rand des Bildschirms als Schrift eingeblendet, sodass er es lesen konnte. »Es ist wirklich unglaublich, dass Moretti davongekommen ist. Wer ist sonst noch involviert? Und warum hat sich der Mafiaboss überhaupt darauf eingelassen, mit jemandem zusammenzuarbeiten? Er ist berüchtigt dafür, Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen, nicht mit ihnen zu kooperieren.«
»Ja. Wie man an der Ermordung seines eigenen Vaters sehen kann.«
»Leider konnte das nie bewiesen werden. Gott weiß, dass ich es versucht habe. Wie Sie wissen, war ich in diesem Fall die Brandermittlerin.«
»Ja.«
Es gab noch etwas, was er wusste. Zum Zeitpunkt des Feuers, bei dem Morettis Vater ums Leben gekommen war, hatte Evelyn Tardiff, damals noch Agent, vom Leiter der Sûreté die Anweisung erhalten, den jungen Moretti wissen zu lassen, dass sie für Bestechung empfänglich war. Damit die Ermittlungen eingestellt wurden.
Das hatte sie getan. Und im Lauf der Jahre hatte sie sich allmählich Zugang zum Boss der Montréaler Mafia verschafft, während sie bei der Sûreté die Karriereleiter hochgeklettert war.
Doch was ihn jetzt beunruhigte, war, dass Evelyn Tardiff möglicherweise von dem geplanten Giftanschlag gewusst und nichts gesagt hatte. Und noch mehr beunruhigte ihn, dass er nicht mehr wusste, auf wessen Seite sie stand.
»Ich sehe mal, was ich rauskriege«, sagte sie. »Wobei die Frage glücklicherweise nicht mehr relevant ist. Es ist vorbei.«
Gamache ließ es dabei bewenden. Er wollte ihr nichts von dem Verdacht erzählen, der ihn aus seinem warmen Bett getrieben hatte und ihn jetzt im farbigen Licht der drei Jungen sitzen und über das Unvorstellbare nachdenken ließ. Das Unverzeihliche.
»Guten Morgen, Schwachkopf.«
Beauvoir zuckte so heftig zusammen, dass der Kaffee überschwappte. Das frühmorgendliche Licht ließ es durch eine optische Täuschung einen Moment lang so aussehen, als hätte einer der gläsernen Jungen gesprochen. Und ihn Schwachkopf genannt. Das war nicht gut.
Allerdings war Beauvoir schnell klar, wer es tatsächlich gewesen sein musste. Was nicht viel besser war.
Ruth Zardo, die alte Dichterin, richtete sich auf der Bank auf, auf der sie offenbar ein Nickerchen gehalten hatte.
»Na, alte Schachtel, schläfst du deinen Rausch aus?« Er schob sich neben sie. Rosa die Ente sah ihn an, unverkennbar sauer, weil sie geweckt worden war. Aber Enten waren ja oft sauer. Zumindest diese Ente.
»Fuck, fuck, fuck«, murmelte Rosa, bevor sie den Schnabel wieder zwischen Flügel und Brustfedern vergrub.
»Auf der Suche nach Clouseau?« Ruth nahm Beauvoir einen der Becher aus der Hand. »Für mich?«
»Eigentlich …«
Bevor er es verhindern konnte, trank sie einen großen Schluck. »Das ist ja bloß Kaffee. Igitt. Warum bringst du mir so was?«
»Ich …«
»Er ist im Keller. Zweifellos versteckt er sich vor dir. Kann man ihm nicht verübeln.«
Beauvoir betrachtete den Becher und überlegte, wie er ihn ihr wieder abnehmen könnte.
Armand brauchte ja nicht zu wissen, dass sie davon getrunken hatte. »Wie wirkt er denn auf dich?«
Ruth dachte über die Frage nach. »Vielleicht ein bisschen besser. Schwer zu sagen. Er scheint sich Sorgen zu machen.« Jetzt sah sie Beauvoir fragend an. »Was ist los? Worüber macht er sich Sorgen? Warum ist er da unten?«
»Ich vermute, er versteckt sich vor dir. Kann man ihm nicht verübeln.«
»Blödmann.«
»Hexe.«
Er blickte noch einmal auf den warmen Becher, den sie zwischen ihren kalten Händen hielt, und beschloss, es nicht auf einen Kampf ankommen zu lassen. Wahrscheinlich würde sie gewinnen.
Auf dem Weg zur Treppe hörte er noch: »Schönen Gruß an deinen Boss.«
Armand Gamache war zwar derzeit beurlaubt, aber er war immer noch Beauvoirs Mentor und Chef und würde es immer sein. Sein Chief Inspector. Egal, was passierte.
Und es war viel passiert.
»Bonjour, Jean-Guy.«
Überrascht blieb Beauvoir am Fuß der Kellertreppe stehen. »Hast du mich kommen hören?«
Gamache stand mit dem Rücken zu ihm, die Hände dahinter verschränkt. Beauvoir konnte die roten Striemen sehen, Narben von den Kabelbindern, die in Gamaches Handgelenke geschnitten hatten.
Schließlich drehte der ältere Mann sich um, und sein Gesicht verzog sich zu einem erfreuten Lächeln. Er war gut eins achtzig groß und von kräftiger Statur. Sein Gesicht war gezeichnet von den Tagen und Nächten, die er auf windgepeitschten Feldern verbracht hatte, durch Wälder marschiert war, im tiefen Schnee neben Toten gekniet hatte, die nie nur ein Fall waren, sondern immer auch Menschen.
Und dennoch, träfe man Chief Inspector Gamache zufällig auf einer Party, könnte man ihn leicht für einen Professor für Alte Geschichte an der Université de Montréal halten. Jemanden, der das Leben derjenigen studierte, die schon lange tot waren, und nicht für den Leiter der Mordkommission, der diejenigen jagte, die heutzutage den Tod brachten.
Beauvoir hatte ihn bei gesellschaftlichen Anlässen beobachtet, wenn ihm Fremde Einzelheiten aus ihrem Leben erzählten. Er hörte zu, nickte, stellte Fragen. Er gab seinem jeweiligen Gesprächspartner zu verstehen, dass er oder sie nicht nur interessant war, sondern bedeutsam. Ihre Geschichten wurden gehört und wertgeschätzt.
Allerdings ging Gamache nicht mehr oft auf Partys, und mit dem Zuhören war es nach dem, was passiert war, nicht mehr weit her.
Doch vielleicht der wichtigste Grund, warum niemand Gamache für einen Mordermittler halten würde, war das, was Beauvoir jetzt sah. Es war sein Lächeln. Ein strahlendes Lächeln, das Augen und Mundwinkel erfasste und quer durch die Sorgenfalten ging.
Vor ihm stand zweifellos ein glücklicher Mann, trotz oder vielleicht gerade wegen all dem, neben dem er gekniet hatte. All dem, was er gesehen hatte.
Und er hatte das Schlimmste gesehen. Armand Gamache hatte aber auch das Beste gesehen, und er bestand darauf, dass seine Leute es ebenfalls sahen und sich nicht von der vordergründigen Finsternis verschlingen ließen.
»Wie sollen wir sonst überleben«, erklärte er ihnen, »wenn wir in den Menschen nicht auch das Gute, den Mut, den Anstand sehen? Auf dieser Welt gibt es mehr Güte als Grausamkeit.«
Und das glaubte er auch.
»Ich habe Kaffee gerochen und daraus geschlossen, dass du es sein musst«, erklärte Gamache und sprach dabei nur ein bisschen lauter als nötig. Er konnte seine Stimme mittlerweile halbwegs gut steuern. »Ruth riecht völlig anders. Außerdem leistest du mir hier jedes Mal Gesellschaft, wenn du mit Annie und den Kindern das Wochenende in Three Pines verbringst.«
»Oben ja, aber nicht hier unten.« Beauvoir sprach langsam und achtete darauf, seinen Schwiegervater dabei anzusehen. »Warum bist du hier?«
Der Keller mit seiner niedrigen gedämmten Decke und den Leuchtstoffröhren war nicht nur düster, sondern auch kalt. Beauvoir blickte auf seinen unberührten warmen Kaffee und hielt den Becher Gamache hin.
»Da, für dich.«
»Für mich? Ist das nicht deiner?«
»Nein. Ich hab schon Kaffee getrunken. Den hab ich dir mitgebracht.«
Gamache musterte ihn kurz, bevor er den Becher nahm.
Wie Ruth es oben getan hatte, umschloss er den warmen Becher einen Moment lang mit seinen kalten Händen. Er wusste ganz genau, dass es Beauvoirs Kaffee war. Aber er wusste auch, dass es schlimmer gewesen wäre, die freundliche Geste abzulehnen, als sie anzunehmen.
Er trank einen großen Schluck und atmete tief aus. »Merci.« Er registrierte den erfreuten Ausdruck auf Beauvoirs Gesicht, dann drehte er sich um und zeigte auf die Wand.
»Deshalb bin ich hier.«
Evelyn Tardiffs Atem bildete in der kühlen Morgenluft kleine Wölkchen. Auf den Straßen im Norden von Montréal war es ruhig. Es versprach einer dieser Bilderbuch-Herbsttage zu werden. Hell und frisch, die Luft klar und sauber.
Auf dem Weg zum Bauernmarkt fragte sie sich, wie viele von den Menschen, an denen sie vorbeiging, jetzt tot wären, wenn der Plan, das Trinkwasser zu vergiften, aufgegangen wäre. Nach der offiziellen Schätzung mindestens die Hälfte, vielleicht auch mehr. Vielleicht dieses Kind auf der anderen Straßenseite. Wahrscheinlich das ältere Paar, das untergehakt den Bagel-Laden ansteuerte.
Don Moretti gab ihr, wahrscheinlich zu Recht, die Schuld daran, dass Gamache es geschafft hatte, den Anschlag zu verhindern. Aber das, was passiert war, oder vielmehr nicht passiert war, hatte auch einen Vorteil.
Es war nicht nur so, dass sich die Ermittlungen und Untersuchungen auf andere Dinge konzentrierten, es glaubte auch jeder, dass sich die Drahtzieher hinter Schloss und Riegel befanden und dass die Wasserversorgung sicher war.
Wassersicherheit bedeutete jedoch alles Mögliche. Die Gefahr für das Wasser ging nicht nur von Umweltverschmutzung und von vorsätzlicher Vergiftung aus. Weltweit zeichnete sich eine neue Bedrohung ab, und Kanada war auf dem besten Weg, dem Rest der Welt zu zeigen, wie gefährdet ein wasserreiches Land sein konnte.
Es überraschte sie, dass niemand das sah. Es schien so offensichtlich.
Ja, Moretti und die anderen waren davongekommen, solange niemand auf die Idee kam, tiefer in den Notizbüchern zu graben. Solange sie das Einzige waren, was Gamache gefunden hatte.
Solange Joe Moretti nicht sah, nicht ahnte, wer wirklich das Heft in der Hand hielt. Weitaus mächtiger als er. Weitaus niederträchtiger. Weitaus gefährlicher.
Eine Krankheit ist auf dem Weg zu uns. Wir warten, wir warten.
Und die Leiterin der Abteilung zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens bei der Sûreté wusste, dass das Warten bald ein Ende haben würde.
Gamache hatte an der Wand des Kirchenkellers eine zerknitterte und mit Markierungen übersäte Karte der Provinz Québec aufgehängt, die er jetzt betrachtete. Tief in Gedanken versunken, schwankte er leicht hin und her. Vielleicht auch vor Erschöpfung.
Beauvoir hatte diese Karte schon einmal gesehen. Genauer gesagt hatte er selbst sie in dem Kloster am Ufer dieses abgelegenen Sees entdeckt. Sie hatten sie eingehend studiert, in dem Wissen, dass sie wichtig sein musste, wenn der junge Biologe und der Abt sie so gut versteckt hatten.
Doch sosehr sie sich auch bemühten, hatte die Karte bisher frustrierend wenig preisgegeben.
Nachdem der Plan, das Trinkwasser zu vergiften, aufgedeckt und die daran Beteiligten verhaftet worden waren, hatte Gamache die Karte zusammengerollt und in einer Papprolle zu Hause unter seinem Schreibtisch versteckt. Außer seinen engsten Vertrauten hatte er niemandem etwas davon erzählt. Er redete sich ein, dass er kein Beweisstück zurückhielt. Die Karte hatte schließlich nichts mit dem geplanten Giftanschlag zu tun.
Und doch hatten sich der junge Biologe und der alte Abt große Mühe gegeben, sie zu verstecken. Was ein weiterer Grund war, warum Gamache annahm, dass ihnen noch mehr bevorstand.
Zum ersten Mal seit den Verhaftungen sah die Karte das Tageslicht.
Es war ein Risiko, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig.
3
»Merci.« Myrna nahm die Schale Café au Lait entgegen, bevor Gabri sich in den Sessel neben dem Kamin plumpsen ließ.
»Wie geht’s mit dem Malen voran?«, fragte Gabri.
Clara stöhnte auf.
»Lasst uns über etwas Erfreulicheres reden«, sagte Myrna. »Zum Beispiel die Frostwarnung.«
»Warum habe ich die Serie Kurz bevor etwas passiert genannt?«, fragte Clara. »Wie malt man nichts? Warum habe ich sie nicht Etwas ist passiert genannt?«
»Oder Gerade wenn etwas passiert«, schlug Gabri vor. Was nicht besonders hilfreich war.
»Aber ist das Leben nicht so?«, fragte Myrna und brachte ihr Pain au Chocolat vor Gabri in Sicherheit. »Wir sitzen hier gemütlich beisammen. Aber ich bin sicher, dass bald etwas passieren wird. Das ist doch immer so. Zum Beispiel war Gabri kurz davor, mir mein Pain au Chocolat zu klauen.«
»O mein Gott«, murmelte Clara. »Ich bin wirklich am Arsch.«
»Oder vielleicht«, sagte Gabri, »ist jemand anderes kurz davor, an deinem Arsch zu sein?«
Beauvoir trat so nahe an die Karte, bis er sie praktisch mit der Nase berührte. Dann drehte er sich zu Gamache um.
»Wir wissen immer noch nicht, warum Langlois gerade zu diesem See geflogen ist. In der Gegend gibt es Hunderte solcher Seen. Warum gerade der? Da ist nichts.«
Die beiden Männer starrten auf die Karte, als könnten sie sie so dazu bringen, eins, wenigstens eins ihrer Geheimnisse preiszugeben.
Beauvoir hatte recht, und gleichzeitig hatte er unrecht. An dem See selbst war nichts. Sie hatten nachgesehen. Aber etwas war auf den See geschrieben worden. Ziffern und Symbole. In Langlois’ Handschrift. Auch über andere Seen waren Ziffern gekritzelt, dabei handelte es sich jedoch um Aktenzeichen, wie sie herausgefunden hatten. Genehmigungen zum illegalen Verkauf von Unternehmen der Rohstoffindustrie an ausländische Investoren, die Marcus Lauzon, der Vizepremierminister, gegen immense Bestechungsgelder erteilt hatte.
Das war zwar gegen das Gesetz, hatte jedoch nichts mit dem geplanten Giftanschlag zu tun.
Also was bedeuteten die Ziffern auf diesem bestimmten See. Dem letzten, an dem Charles Langlois gewesen war, bevor er umgebracht wurde. Aber so lange sie sie auch anstarrten, sie behielten ihr Geheimnis für sich.
Jetzt zeigte Beauvoir auf den unteren Rand der Karte. »Sieht so aus, als wäre er rüber nach Vermont, da sind allerdings keine Seen oder Flüsse markiert.«
In seinem Eifer hatte er vergessen, sich zu Gamache umzudrehen, und musste es deshalb noch einmal wiederholen.
»Stimmt.« Gamache musterte den dünnen Strich, den der junge Biologe von Kanada in die Vereinigten Staaten gezogen hatte.
»Was ist?«, fragte Beauvoir.
Über Gamaches Gesicht hatte sich ein unzufriedener, geradezu frustrierter Ausdruck gelegt. »Wir haben immer noch nicht Langlois’ Laptop gefunden. Gut möglich, dass die Verschwörer weder davon noch von der Karte wussten. Ich wurde nur nach den Notizbüchern gefragt.«
Gefragt, dachte Beauvoir. Konnte man es tatsächlich als »fragen« bezeichnen, wenn jemandem eine Waffe an den Kopf gehalten wurde? Der Deputy Commissioner der RCMP konnte nicht mehr dazu vernommen werden. Er war in der Wasseraufbereitungsanlage getötet worden. Der Umstand, dass der zweitranghöchste Mountie an der Verschwörung beteiligt gewesen war, hatte einen nationalen Skandal ausgelöst und die RCMP geradezu gelähmt. Sie waren immer noch dabei, die Scherben aufzukehren.
»Wir müssen diesen Laptop finden«, sagte Gamache.
»Ganz deiner Meinung. Wir sind dran. Aber hätte Langlois dir nicht gesagt, wo du ihn findest, wenn er derart wichtig ist? Im Kloster haben wir die Karte gefunden, und die Notizbücher hatte er bei seinen Eltern versteckt. Aber keine Spur von einem Laptop. Wir haben überall gesucht.« Beauvoir zögerte, es fiel ihm schwer, seine Vermutung auszusprechen. »Könnte es sein, patron, dass die den Laptop gefunden und zerstört haben? Vielleicht haben sie deshalb nicht danach gefragt.«
Gamache schwieg. Die Vorstellung war beunruhigend.
Er hatte Beauvoir während dessen Ausführungen angesehen, aber wie die meisten Leute, wenn sie mit einem Schwerhörigen redeten, hatte Beauvoir zunächst langsam und deutlich gesprochen und war dann immer schneller geworden, sodass es Gamache zunehmend schwerer fiel, ihm die Worte von den Lippen abzulesen.
In Wahrheit erfasste Gamache auf diese Weise sowieso nur einen Bruchteil des Gesagten. Den Rest las er den hochgezogenen Augenbrauen ab, der leicht gerunzelten Stirn, den zusammengekniffenen Augen. Unwillkürlichem Erröten oder plötzlicher Blässe. Den Händen. Dem Lächeln. Die Körpersprache eines Gegenübers sprach Bände.
Als Leiter der Mordkommission hatte Armand Gamache genug Zeugen vernommen, genug Verdächtige, um sich nicht allein darauf zu verlassen, was die Leute konkret sagten.
Und jetzt war er wie die Mönche im Kloster Saint-Gilbert-Entre-les-Loups geworden. Saint Gilbert zwischen den Wölfen. Die ein Schweigegelübde abgelegt hatten und dennoch ununterbrochen kommunizierten, mit einer hochgezogenen Augenbraue, einem Stirnrunzeln, einem Lächeln. Einer Geste. Anders als bei den Mönchen beruhte die Stille in Gamaches Welt allerdings nicht auf einem Gelübde, war nicht freiwillig.
Und er lebte eigentlich auch nicht in Stille – das wäre ein Segen gewesen. Er lebte mit einem permanenten millionenfachen Zirpen. Wie Tinnitus auf Speed.
Zuerst hatte Gamache gedacht, gefürchtet, dass ihm dieses Geräusch, das durch den unmittelbar neben seinem Kopf abgefeuerten Schuss ausgelöst worden war, den Verstand rauben würde. Er musste darum kämpfen, zu schlafen, zu lesen, zu denken. Oft hatte er das Gefühl, das Gleichgewicht zu verlieren, ihm war übel. Jetzt war da ein Puffer zwischen ihm und seiner Familie. Seinen Freunden. Seinen Kollegen.
Reine-Marie.
Es machte einsam. Es machte ihn einsam.
Aber im Lauf der Zeit, und mit Hilfe, schloss er seinen Frieden mit den Grillen. Er versuchte, sie als stete Begleiter zu betrachten. Zugegeben, Begleiter, die offenbar ununterbrochen sauer auf ihn waren, aber die Vorstellung half.
Gamache war sich nicht sicher, ob es daran lag oder lediglich eine Frage der Zeit war, aber es kam ihm so vor, als würden die Grillen sich zurückziehen. Das Dauerzirpen schien leiser geworden zu sein. Noch immer konnte er nicht verstehen, was gesagt wurde, aber er hatte die Hoffnung, dass er eines Tages aufwachen und die leisen Atemzüge von Reine-Marie neben ihm hören würde.
Es überraschte ihn, was er alles vermisste. Natürlich die Stimmen seiner Familie und seiner Freunde. Auch Musik. Aber wer hätte gedacht, dass er das Brutzeln von Speck vermissen würde? Das Geräusch, wenn er den Kindern ein Glas Milch einschenkte. Das Rascheln von Blättern. Das Knistern von Papier. Das Klicken des Schalters, wenn Licht ein- oder ausgeschaltet wurde. Das Öffnen einer Tür.
Henris Schnarchen.
Die Kleinigkeiten. Die Klanglandschaft eines Lebens.
Im Moment hatte er nur seine anderen Sinne. Und sie sagten ihm alle dasselbe. Etwas kam auf sie zu. Bald würde etwas Furchtbares passieren.
Er sah auf seine Uhr und war überrascht, wie spät es war.
»Isabelle wird bald hier sein«, sagte er.
»Ich hoffe, sie bringt Doughnuts mit«, sagte Beauvoir.
»Ich hoffe, sie bringt Doughnuts mit«, sagte Gamache.
Beim Näherkommen sah Evelyn Tardiff, wie auf dem Markt Lastwagen beladen wurden. Sie wusste, dass sie bald in Richtung der Grenze zu Ontario beziehungsweise den Seeprovinzen aufbrechen würden. Aber die meisten würden mit Waffen, Alkohol und Drogen beladen ungehindert die Grenze zu den Vereinigten Staaten passieren. Einige würden unterwegs haltmachen, um menschliche Fracht an Bord zu nehmen.
Und dann kehrten sie mit anderer Schmuggelware beladen zurück.
Sie könnte diese Lastwagen nicht aufhalten, selbst wenn sie wollte, deshalb wandte sie ihnen den Rücken zu und suchte die Stände nach Moretti ab.
Sie entdeckte seine Tochter in einem glänzenden orangen Anorak und Morettis Frau, die treu an der Seite ihres Mafioso-Gatten stand. Auch sie stammte aus einer Mafiafamilie und verstand die Regeln. So wie es eines Tages ihre Tochter tun würde. Sie wuchs ganz automatisch in das Familiengeschäft hinein.
Schließlich entdeckte sie Don Moretti, der an diesem Samstagmorgen mit Segeltuchjacke und Schirmmütze bekleidet besonders harmlos aussah. Neben ihm sein schwarzer Labrador an einer Leine mit Würgehalsband.
Schlank, durchtrainiert, Mitte vierzig, mit dunklen, an den Schläfen ergrauten Haaren, sah Joe Moretti aus wie ein englischer Landadliger.
Aber niemand ließ sich täuschen. In Little Italy kannte ihn jeder. Kannte ihn als das, was er war.
»Evelyn.« Der Ruf ertönte über zwei Gänge hinweg, als er sie entdeckte und seinen groß gewachsenen Begleitern mit einem Nicken bedeutete, sie durchzulassen. »Danke, dass Sie gekommen sind.«
Er begrüßte sie mit einem Kuss auf jede Wange. Sie ließ sich nicht täuschen.
Wenn er beschloss, sie hier und jetzt erschießen zu lassen, würde niemand für sie in die Bresche springen. Und niemand würde etwas sehen oder sagen. Sie würde in einer Kiste auf einem der Laster weggeschafft werden und schließlich auf einem Feld als Dünger für die nächste Kürbisernte enden, die auf dem Markt verkauft werden würde.
»Kommen Sie.« Er fasste sie am Arm. »Flüstern Sie es mir ins Ohr. Erzählen Sie mir alles, was man am Telefon klugerweise nicht sagt. Halten Sie nichts zurück.«
Der Griff um ihren Arm wurde so fest, dass es beinahe schmerzte.
Während sie sprach, beobachtete Moretti sie aufmerksam. Er registrierte nicht nur ihre Worte, sondern auch ihren Tonfall. Ihre Körpersprache. Ihre Pupillen, die geröteten Wangen, jedes Stirnrunzeln. Suchte nach dem Riss, der Lüge, die sich hinter den Worten verbarg. Von der er wusste, dass sie existierte.
Während sie die von Kürbissen und Kürbislaternen mit geschnitzten Grimassen gesäumten Gänge entlangschlenderten und den Geruch von frischem Obst und Gemüse, unterlegt von dem moschusartigen Hauch beginnender Fäulnis einatmeten, berichtete Evelyn Tardiff, die Leiterin der Abteilung zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens bei der Sûreté, Joseph Moretti, dem Boss der Montréaler Mafia, alles, was sie über ihren Freund und Kollegen Armand Gamache wusste. Leiter der Mordkommission der Sûreté du Québec. Den sie hätte töten lassen sollen.
Im Präsidium der Sûreté saß Agent Yvette Nichol vor dem Büro von Chief Inspector Tardiff an ihrem Schreibtisch und dachte nach. Dann verschickte sie über einen verschlüsselten Messengerdienst eine Nachricht.
Armand Gamaches Handy vibrierte. Er zog es aus der Tasche und las die Nachricht.
»Ist das Isabelle?«, fragte Beauvoir. »Sag ihr, dieses Mal will ich Doughnuts mit Himbeergelee.«
Gamache lächelte. »Himbeer, zu Befehl.«
»Ach ja, und einen Double-Double.«
»Das versteht sich zwar von selbst, aber ich sage es ihr trotzdem.«
Er tippte eine Antwort, dann wandte er sich wieder der Karte zu.
Moretti las die Nachricht, die gerade auf seinem Handy eingegangen war.
»Was Wichtiges?«, fragte Chief Inspector Tardiff und musterte ihn.
»Nichts, worüber Sie sich Gedanken machen müssen, Evelyn«, erwiderte er.
Aber in letzter Zeit machte sie sich ständig Gedanken.
4
Sie saßen im Keller der Kirche St. Thomas auf Plastikstühlen und blickten auf die Karte.
Aus Beauvoirs Doughnut quoll Himbeergelee. Geistesabwesend reichte Gamache ihm eine weitere Serviette.
Isabelle Lacoste trat vor die Karte und drehte sich zu Gamache um. Um es ihm leichter zu machen, unterstrich sie ihre Worte pantomimisch. Es sollte ihm helfen und war ungewollt komisch.
»Wir wissen, was das bedeutet, patron.« Wie ein Meteorologe, der auf MétéoMédia eine heraufziehende Gewitterfront ankündigte, fuhr sie unnötig weit ausholend mit dem rechten Arm über einige der Seen.
Gamache nickte und verkniff sich ein Lächeln.
»Die Ziffern beziehen sich auf die Daten, an denen Charles Langlois an den Seen war«, fuhr sie fort. »Außerdem hat er die Aktenzeichen dieser Genehmigungen notiert.«
»Die Marcus Lauzon den ausländischen Investoren erteilt hat.«
Der Vizepremierminister war, wie sich herausgestellt hatte, nicht nur ein Terrorist, sondern auch ein Umweltverbrecher, der es bestimmten Branchen erlaubt hatte, Schadstoffgrenzwerte um das Dreißigfache zu überschreiten.
Mit großer Genugtuung hatte Chief Inspector Gamache zugesehen, wie er in Handschellen abgeführt worden war. Inmitten der Menge auf dem Parliament Hill stehend hatte Gamache sich unbewusst die Handgelenke gerieben, wo ihm die Kabelbinder in die Haut geschnitten hatten, als er in der Wasseraufbereitungsanlage auf dem Betonboden kniete und auf seine Hinrichtung wartete. Auf Befehl dieses Mannes. Des kanadischen Vizepremierministers. Ein Mann, der sich bereit machte, als nächstes Staatsoberhaupt die Geschicke des Landes zu lenken.
Gamache konnte immer noch die Pranke des Söldners spüren, der seinen Kopf nach vorne drückte. Die Mündung der Pistole in seinem Genick.
Er hatte die Augen geschlossen.
Wir warten, wir warten.
Dabei hatte er ununterbrochen zwei Worte wiederholt: Reine-Marie. Reine-Marie.
Reine-…
Lauzons Handlanger drückte den Abzug.