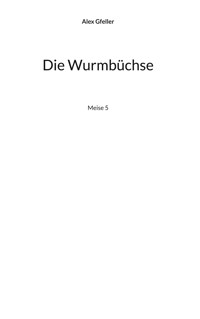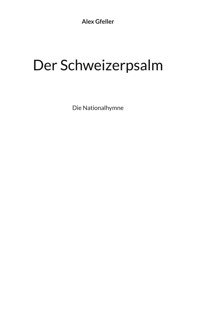
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Trittst im Morgenrot daher, Seh'ich dich im Strahlenmeer, Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! Wenn der Alpenfirn sich rötet, Betet, freie Schweizer, betet! Eure fromme Seele ahnt Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erste Strophe
Trittst im Morgenrot daher,
Seh' ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Eure fromme Seele ahnt
Glott im hehren Vaterland,
Glott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Zweite Strophe
Kommst im Abendglühn daher,
Find' ich dich im Sternenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen!
Denn die fromme Seele ahnt
Denn die fromme Seele ahnt
Glott im hehren Vaterland,
Glott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Dritte Strophe
Ziehst im Nebelflor daher,
Such' ich dich im Wolkenmeer,
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Tritt die Sonne klar und milde,
Und die fromme Seele ahnt
Und die fromme Seele ahnt
Glott im hehren Vaterland,
Glott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Vierte Strophe
Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt,
Ja, die fromme Seele ahnt,
Glott im hehren Vaterland,
Glott, den Herrn, im hehren Vaterland.
In einer Gewitternacht wie dieser, wo Flötentöne die Tannenwipfel streifen und die Gesänge der Wale auf hoher See erklingen, bleiben wir lieber schön zu Hause im warmen Bette liegen, weil die Aussichten auf Sonne schrumpfen und die Erdbeeren nicht mehr süß genug werden, sondern hart und sauer bleiben, und wenn das Grauen des Grauens einmal da ist, ist es schon zu spät für die Rettung aus Bergnot, zumal die Chancen auf Verbesserungen im Bereiche der Seerettung gering bleiben und die Regentropfen nicht nur gewaltig trommeln, sondern auch fischartig in die weite Ferne der völligen Vergessenheit verschwemmt, verirrt, verwaschen, verbogen, verwest und verdampft werden.
Die Furcht und das Grauen sind das Entsetzen vor dem Unheimlichen, vor dem drohenden Unheil, und die Buntspechte der Erkenntnis kreuzen die Lageristen der Industriegüter und der Vokabeln und bewegen sich nur noch im Notfall, weil eine gewisse Restökonomie der Verbraucherströme und der Verwesungsgerüche nicht einmal den zahlreichen schwarzgelockten, großäugigen Alpakas abgerungen werden können, denn einheitlich und gleichmäßig grau ist der handelsübliche und oft genutzte Farbton zwischen schwarz und weiß und erscheint uns einfach nur noch öde und gleichförmig in aller Gelassenheit, doch nur mit dem modischen Kurzhaarschnitt. Er bewegt sich stets knapp an der Grenze der Legalität und ist nie ganz korrekt, zeitlich weit entfernt und örtlich reichlich unbestimmt und unehrlich dazu, also nie so vorhanden, wie wir den Kurzhaarschnitt uns wünschen möchten, also als angenehm warmgrau und weich.
Ein weiteres Gräuel ist die unangenehme Empfindung der äußersten Abneigung und der innersten Abscheu, wie wir sie nur allzu gut kennen, auch wenn wir uns ernsthaft fragen müssen, wie weit wir dabei gehen wollen, um nicht als pathologisch verfallen und onkologisch-karzinogen zerstört zu gelten. Der Konsens ist reine Antipathie, kumulierte Aversion, grenzenloser Ekel, ein verlorener Notgroschen und ein extremer Widerwille dazu, eine Zustandshaltung, die uns gewiss nicht freudig stimmt, weil wir uns bewusst sind, welch zerstörerische Auswirkungen das ständige Geläute auf uns haben kann, ganz abgesehen von säumigen Zahlern und vergessenen Schoko-Talern. Wir lachen gewiss nicht darüber, doch wir können uns ein Zähneknirschen nicht verbieten, noch können wir es verbergen, auch nicht verkneifen, und wir können es auch nicht vermeiden, ohne uns über die Folgenbewirtschaftung entscheiden zu müssen.
Die Einfachheit der allseits laufenden Sachlage kommt uns dabei freundlicherweise entgegen, denn das Verb grauen zielt auf etwas Beängstigendes und vor allem auf etwas Unbehagliches, denn das Grauen ist die Furcht und das Entsetzen vor dem Unheimlichen, Drohenden und Abstoßenden, dem wir uns aus eigener Kraft nicht mehr zu entziehen vermöchten. Wir meiden deshalb die städtischen Außenbezirke ebenso, wie wir die städtischen Innenbezirke meiden; wir meiden de facto überhaupt alles, was nach Vermeidbarem aussieht. Das ist unsere persönliche und private Innenpolitik, wenn Sie gestatten, auf die wir aus verständlichen Gründen nicht verzichten können, noch jemals verzichten wollen.
Wir stehen indes nicht mit leeren Händen da; wir begeben uns absichtlich auf das blanke Eis der Vernunftmaßnahmen, im Vertrauen darauf, dass es uns zu tragen vermöge. Diese etwas gar beherzte und vor allem rechtlich furchtlose Haltung entspricht durchaus der damaligen bewegten Schaukelei im Geäst, so dass wir während des ganzen lustigen Treibens unter die reichlich undurchsichtigen Zustände der vielseitigen und vielfältigen Optionen blicken konnten.
Das mehr als eindeutige Adjektiv grauenhaft ruft indessen viel mehr Entsetzen hervor, als wir uns jemals hätten vorstellen können oder hätten imaginieren mögen, und wird somit in besonders starkem Maße als unangenehm empfunden, genauso wie das Adjektiv grauenvoll.
Davon kann allerdings nicht abgesehen werden, weil uns die angeblichen Notlagen der störrischen und unzugänglichen Seewasserverwerter unter den verstockten Seewasservertretern eigentlich viel zu unverständlich wären. Gräulich ruft aber einesteils große Abscheu und andernteils viel Entsetzen hervor und bedeutet nichts anderes, als dass etwas Unübersehbares überaus widerwärtig sein muss, viel widerwärtiger, als wir uns jemals hätten vorstellen oder als wir hätten erwarten können.
Aber kann das angesichts der strategischen Unüberwindbarkeiten in den außerirdischen Gebirgswelten überhaupt noch möglich sein? Wo sind wir mit unserer süsslichen Landeshymne nur gelandet? Haben wir eigentlich noch alle Sprossen in der Leiter und alle Tassen im Schrank? Und alldem sollen wir erst noch kindliches Vertrauen entgegenbringen! Ich bitte Sie! Wie soll das überhaupt geschehen können? Wie kann man das Geschirre jetzt noch auf diese Weise eine ganze Weile lang aufziehen? Darf man das überhaupt? Wohin soll das noch führen? Und wie soll jetzt erst noch die unbedarfte Seele, sei sie nun fromm, oder nicht, noch kindlich vertrauen können?
Da sträubt sich das Nackenhaar, und die Zwerge üben sich bereits in übertriebener Langmut. Sie sind auf der Hut und verbieten sich gegenseitig die Entmutigung, die Bequemlichkeit und die Verlustigkeit auf immer und ewig. Kein einziges Blatt sollte jemals zwischen uns treten können, versichern sie sich unablässig gegenseitig, kein einziges Huhn fände zwischen uns noch Platz zum Kuscheln, und kein einziges Muttermal hätte noch jemals die etwas unangenehme Gelegenheit, wieder aus den Untiefen der Epidermis aufzutauchen, um die regionalen Geflügelhalter zu beleidigen, die stotternden Priester auszulachen und die lokalen Türsteher mit ihren mannigfachen Tätowierungen aus der Geisteswelt der Nazis zu bedrohen.
Und der Rettende? Was hat er dazu zu sagen? Kann er sich überhaupt noch öffentlich äußern, oder hat er bereits die unausweichlichen Schlussforgerungen gezogen, ohne auf vorgezogene Neuwahlen zu pochen? Zwischen retour und Rettich finden wir nur retten. Das ist eindeutig zu wenig, aber wir können uns nicht darum bemühen oder uns deshalb gegenseitig zu erwürgen und uns darob selber zu beschuldigen, noch um uns freiwillig in Strickwolle zu kleiden, nur um die Ergebnisse vernehmen zu müssen und vernehmen zu können, noch dürfen wir uns darob erzürnen, zumal danach gleich die Einzigartigkeiten der Ornithologie folgen würden und die Erlen im Auenwald untereinander die Statuten der Gesangsvereine ausknobeln müssten, denn das westgermanisch-mittelhochdeutsche Verb retten ist eine Kausativbildung, wie sie das Altindische srathayati für wird locker, wird lose darstellt, und bedeutete ursprünglich lediglich entreißen, ablösen und befreien.
Wohlan, diese eindeutig deformative Kausativbildung hatte indes ursprünglich nichts mit Erotik, Ergonomie, Ekklesiastik oder Esoterik und dergleichen zu tun und konnte deshalb anfänglich unmöglich gleich am Anfang einer ganzen Handlungskette von Kausalverbindungen stehen; sie schaffte einzig den unausweichlichen Abstand zwischen den einzelnen Begriffen, so dass unter anderem die monumentalen bakteriologischen Zusammenhänge für immer verloren gingen.
Eine Ableitung davon ist lediglich der Retter oder der Erretter und die Rettung, mittelhochdeutsch rettunge, und all die Zusammensetzungen dazu, wie z.B. der Rettungshelikopter, das Rettungsboot, der Rettungsanker, der Rettungsdienst, der Rettungsring und der Rettungswagen, usw. Wenn wir somit vom rettenden Rettich und von der rostigen Retourkutsche der unausweichlichen Gegebenheiten sprechen, dürfen wir jedoch das dazwischenliegende Verb retten nicht vergessen, denn das führt uns direkt zum allmächtig waltenden Retter zurück, von wo wir zunächst hergekommen und ausgegangen sind.
Doch von wo sind wir überhaupt hergekommen und ausgegangen? Die Frage ist berechtigt; doch wir wissen vorderhand nur eines und müssen uns damit ab- und zurechtfinden: Wir sind hergekommen, und zwar ungefragt. Und was macht der allmächtig waltende Retter? Er rettet uns natürlich allmächtig waltend, denn er ist ja tatsächlich allmächtig waltend.
Haben wir die kirchenideologische Kurve doch noch gekriegt? Sind wir endlich auf den Trichter gekommen? Haben wir die Gebeine gekreuzt und der Garten Gethsemane am Ende doch noch gejätet und somit gepflegt? In Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm vertrauen, sagt auch der unausweichliche Volksmund plump dazu. Er kann halt nicht anders.
Groß ist indessen die Zahl der Zusammensetzungen mit Macht; Machthaber, Machtwort, Streitmacht, Machthafen, Weltmacht, Ohnmacht, Vollmacht, Wehrmacht oder Heeresmacht oder Wehresmacht und auch Nachtmachtwachtsacht. Nichts davon soll ausgelassen werden, nichts davon soll in dieser Aufzählung fehlen dürfen, denn jegliches Fehlverhalten würde sich äußerst nachteilig auf die materielle Streckenzehrung und die Reckstangen der juristischen Geborgenheit auswirken, weil die Nachteile der Flickschusterwerke die Vorteile der Kammerjäger eindeutig überwiegen würden.
Aber auch in der Namensgebung spielt das Machtwort der Wollust eine bedeutende Rolle, z.B. bei weiblichen Vornamen wie Mathilde und Mechthilde. Altgermanisch ist auch das direkt abgeleitete Adjektiv mächtig, mittelhochdeutsch mehtic, althochdeutsch mahtig, gotisch mahteigs, altisländisch mattugr. Das vom Adjektiv abgeleitete mächtigen ist heute nur noch reflexiv als sich bemächtigen oder als ermächtigen gebräuchlich, zusammen mit allmächtig und übermächtig, was uns allerdings fast übermächtig anmutet, zumal uns das spätmittelhochdeutsche übermehtic in der Tat fast übermächtig erscheint.
Wir haben es hierbei mit einem eindeutigen Machtwerk zu tun, dessen Einzigartigkeit einzig in die Unverwechselbarkeit des allmächtigen Machtwortes flutet, blutet und anmutet. Doch seine strukturelle Einzigartigkeit ist nicht unverwechselbar; nur der Charakter seiner unübersehbaren Beiläufigkeit bestätigt uns noch in seiner nach wie vor unbestrittenen Daseinsberechtigung und in seiner übermächtigen und übernächtigten Bemächtigung und Ermächtigung einer jetzt nahezu abgrundtiefen Mächtigung, wenn man so will.
Wir haben es hierbei allerdings nicht mit einer Anmut zu schaffen, die uns verwirrt und sich unser unmerklich bemächtigt, denn wie hatte es damals in Ventspils die spindeldürre ukrainische Autorin wie selbstverständlich und in aller Schlüssigkeit formuliert? Ganz einfach: Schöne Menschen haben es leichter als hässliche Menschen.
Diese Banalität bleibe unwidersprochen, doch wir können uns einfach nicht vorstellen, dass einzig die Schönheit jede andere Qualität irgendwelcher Art so leichterdings und leichterhand zu überspielen vermöchte. Es muss indes so sein, denn anders ist es nicht zu erklären, dass es schöne Menschen im Leben etwas leichter haben als andere, ganz unabhängig von ihren Qualitäten. Wir können dies nur noch zähneknirschend akzeptieren und auf ein künstliches Gebiss ohne jeden Makel hoffen.
Es ist wie bei Leuten, die rein berufeshalber ständig lächeln oder sogar lachen müssen; sie kriegen bereits nach einer kurzen Weile das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht, denn es steht bald einmal wie festgefroren oder festgetackert im Gesicht. Sobald sie irgendwo eine Kameralinse erspähen und erhaschen, lachen sie lautlos los und zeigen bereitwillig ihre Zähne mit all ihren Zahnfehlstellungen, ob sie wollen, oder nicht, oder sie zeigen allen zwei vollständige, makellose Reihen künstlich weißer Zähne, die weithin leuchten, und ihr Lachen bleibt bereits nach einigen Jahren der Einübung wie festgefahren.
Sie erwachen lachenden Gesichts, sie frühstücken lachenden Gesichts, sie begeben sich lachenden Gesichts zur Arbeit, und sie kehren lachenden Gesichts nach Hause zurück, wo sie sich lachenden Gesichts an den Esstisch setzen und ihr Essen lachenden Gesichts zu sich nehmen. Darauf gehen sie lachenden Gesichts scheißen, wischen sich lachenden Gesichts das Arschloch ab und kehren lachenden Gesichts an ihre Arbeit zurück, während sie lachenden Gesichts die Nase schäuzen oder sich lachenden Gesichts die Haare zurechtrücken, kurz bevor sie lachenden Gesichts sterben.
Besonders die Hereros unter den Hararen, die Barbaren unter den anwesenden Magyaren und die bemüßigen sich eines korrekten Haarschnitts, weil sie die Zumutung nicht mehr aussstehen können und auch nicht mehr zumutbar fänden, die Fahrräder einfach an einen Haufen zu legen und die Schlüssel für die Fahrradschlösser über die Brücke zu werfen, in der unverbrüchlichen Meinung, damit immerhin die zweitausend Flussgötter freundlicher zu stimmen, was nicht einmal sonderlich abwegig wäre, denn da es in der antiken Welt insgesamt zweitausend Flüsse gibt, umflossen vom ewigen Weltenmeer, leben und wirken in diesen zweitausend Flussbetten verständlicherweise auch die zweitausend Flussgötter. Nichts ist logischer als das.
Das gemeingermanische Verbum walten, althochdeutsch waltan, gotisch waldan gehört zum indogermanischen ual-dh und bedeutet seinerseits eine Erweiterung zu indogermanisch ual, stark sein, beherrschen. Vergleiche damit z.B. litauisch valdyti, regieren und russisch vladet, besitzen, beherrschen, ein ausgeprägt russischer Zug übrigens und wie wir alle wissen, auch und ausschließlich mittels Gewalt, nur um die Gewalt noch zusätzlich zu betonen, denn alle Gewalt ist in Russland stets betont und akzentuiert, weil die Argumentationsfähigkeit, die notwendige Toleranz und dazu auch noch die Argumentationsmöglichkeiten fehlen.
Indogermanisch ual-dh ist seinerseits eine Erweiterung zum indogermanischen ual, stark sein, vgl. Valuta, denn selbst die Valuta ist gewalttätig, wie wir alle wissen und uneingestanden billigen müssen. Die Bildungen zum Verb walten sind deshalb die unter Anwalt und Gewalt abgeleiteten Wörter, die jeden einzelnen Tierbändiger Tag und Nacht begleiten und niemals aus den Augen lassen, nicht nur zur Sommerszeit, sondern auch im Winter, wenn es schneit. Eine Präfixbildung ist verwalten, ordnungsgemäß führen, betreuen, also in Ordnung halten, mittelhochdeutsch verwalten, in Gewalt haben, für etwas sorgen, denn jegliche Ordnung ist uns natürlich ein natürliches Anliegen und ein unmittelbares Bedürfnis.
Wir beanspruchen für nahezu alles Ordnung, was uns nicht selber betrifft und berührt und allenfalls etwas bedeutet, denn unsere Welt soll eine ordentliche sein und gefälligst auch ordentlich bleiben, eine übersichtliche und eine möglichst unveränderliche Welt, bitte sehr, und dazu ein allmächtig Rettender, ganz abgesehen von der unübersehbar zwiespältigen und vor allem nahezu uneinsehbar grundsätzlichen Widersprüchlichkeit desselbigen. Sie besteht vorwiegend oder fast ausschließlich aus allmächtig und retten. Mächtig geht natürlich wieder auf die Macht zurück, womit sich der Kreis wieder einmal unvorteilhaft schließt.
Das unzweifelhaft äußerst gemeingermanische Wort Macht, das uns in unserer Inoffensivität augenscheinlich so sehr widerstrebt, althochdeutsch maht, altisländisch mattr, ist das Verbalabstraktum zu mögen, ursprünglich können, vermögen, und hinzu stellen sich die Bildungen entmachten, der Macht berauben, und mächtig, was uns wiederum zu den Anfängen und Ursprüngen eines ganzen Wasserfalls an Wortschöpfungen und Wortbildungen zurückführt, derer wir uns zuweilen kaum zu erwehren vermögen.
Wehr wiederum, mittelhochdeutsch were, althochdeutsch weri oder wari, eine Befestigung zur Verteidigung und zum Schutz, ist eine Bildung zu dem unter wehren zu behandelnden Verbum. Damit ist vielleicht Wehr mehr als ein Stauwehr, also als eine Staumauer, als ein Staudamm gemeint und identisch mit were und bedeutet demzufolge eigentlich nur eine Befestigung gegen das Wasser. Somit wäre Wehr nicht einmal eine militärische Bezeichnung, sondern eine zivile, was uns zwar die weitere Nutzung nicht gerade erleichtert, denn wir wissen alle, dass wir uns ständig der heimtückischen Angriffe erwehren müssen, die von allen Seiten her unablässig auf uns und unser Wehr, bzw. auf unsere Wehrlosigkeit eindringen und zukommen, und müssten wir uns dieser Angriffe tatsächlich ständig, also pausenlos erwehren, kämen wir wahrscheinlich aus dem Erwehren nicht mehr heraus; wir könnten uns in der Öffentlichkeit nur noch mit gezückter Waffe bewegen und begegnen, und eindeutig illegale Handlungen könnten uns nur noch davon abhalten, selber Opfer der ständigen Angriffe von außen zu werden.
Eine Kollektivbildung ist das Gewehr, und eine Ableitung davon sind wehrhaft und wehrlos. Das eindeutige Verbum wehren selber, mittelhochdeutsch wern, althochdeutsch werian, gehört mit dem altindischen vrnoti, umschließen, abwehren, und mit dem Griechischen erysthai, abwehren, bewahren zu der indogermanischen Wurzel uer-, was mit einem Flechtwerk, Schutzwall, Zaun umgeben bedeutet, und hinzu kommt auch noch verschließen, bedecken und schützen als eine weitere Bedeutung.
Wir dürfen indes nicht vergessen, dass insbesondere die Erde, also das Erdreich letztlich unser einziger Schutz und Trutz ist, in selbige wir uns wie die Würmer verkriechen müssen, wenn uns nichts anderes mehr übrig bleibt, um auf diese letztmögliche Weise zu versuchen, dem Unheil zu entgehen und zu entkommen, womit auch gleich der Zusammehang zwischen gehen und kommen geklärt ist.
Mit wehren ist auch die verwandte Wortgruppe unter wahren gebildet, wie auch die Bildungen der unter mit Wehr- und Wahr- zusammengesetzten Wörter. Urverwandt ist hier auch das Kuvert, aber auch abwehren, Abwehr und verwehren, also etwas nicht erlauben und somit verweigern, etwas nicht einfach hinnehmen, sondern tapfer dagegen angehen, sich dagegen anstemmen, sich sträuben, sich verteidigen, sich widersetzen und, eben, sich erwehren. Oder im Sinne von entgegenwirken: sich der feindlichen Umtriebe zu erwehren, Genitiv, sie abzuwehren, sich ihnen zu begegnen, ihnen offen entgegen zu treten, ihnen unverhüllt entgegen zu wirken oder sie offen zu bekämpfen. Oder was auch immer.
Von Wehrpflicht ist die Rede, von Wehrdienst und kurz danach von Weib, was entgegen allen Erwartungen durchaus einen direkten Zusammenhang haben kann, wenn auch nicht unbedingt haben muss, denn träumen doch insbesondere viele Rekruten und Kanuten, aber auch Valuten, Saluten, Balustraden und die Bewohner der Aleuten einzig von ihren teuren Schätzen, die angeblich zuhause auf sie warten, und zwar im Garten der Lüste. Das Ganze grenze jedoch eindeutig an gemeine Irreführung, möchte man zunächst unverblümt meinen, denn im wilden Sturm bist du uns selbst, lieber Fantomas, Hort und Wehr.
Doch gerade Hort und Wehr müssen erst sorgfältig ausgekundschaftet werden; es ist eine zu bedeutende Frage, die zudem das ganze, allzu lockere Gedankengebäude gleich endgültig zum Einsturz bringen könnte, und zudem ist sie viel zu fragil, als dass wir uns allzu große Sprünge in eine unvermeidliche Ungewissheit zu erlauben vermöchten, denn nehmen wir einmal an, wir hätten uns endlich ob allem Singen tapfer bis zur vierten Katastrophe durchgeschlagen, bzw. durchgesungen, also durchgehungert oder durchgerungen: Bereits in der zweiten Zeile der vierten und letzten Katastrophe fiele das ganze Gebäude einfach ein und somit in sich zusammen, stürzte das ganze, fragile Gebilde endgültig um, und der schöne Schweizerpsam zerbrökelte unausweichlich zu Staub und Asche in den schwarzen Gamaschen einer fiktiven Grundsätzlichkeit.
Das möchten wir doch nicht auch noch erleben müssen, nicht wahr? Das möchten wir doch zu verhindern trachten, nicht wahr? Zumal wir stets darauf achten, dass uns alles, was uns Schirm und Hort bringen kann, also Schirm, Scharm und Melone, durchaus willkommen ist, denn der Hort ist eine Einrichtung, in der die Schüler nach der Schule überwacht und betreut werden, bis ihre Eltern von der Arbeit nach Hause zurück kommen, oder eine Stätte, wo etwas ganz Bestimmtes besonders gepflegt wird und gedeiht, und sei es nur der Chorgesang, Freilandschwingen oder populäre Blasmusik, oder z.B. der Hort der Freiheit, der Hort der Stabilität oder der Hort des Wohlbefindens, allesamt positive Eigenschaften, wie sie uns durchaus gefallen.
Das gemeingermanische Wort Hort, mittelhochdeutsch und auch althochdeutsch hort, der Schatz, das Angehäufte, die Fülle, die Menge, gehört im Sinne von das Bedeckte, das Verborgene zur vielfach weitergebildeten und erst noch erweiterten indogermanischen Wurzel keu, bedecken, umhüllen. Mit dem germanischen huzda, Hort, zunächst biblisch, also polyglottbezogen angewendet, wird es endlich auch im Sinne von sicherem Ort, Schutz und Zuflucht genutzt. An diese typische Bedeutung schliesst sich die Zusammensetzung Kinderhort an, und als Ableitung davon kennen wir das Verbum horten für ansammeln, anhäufen.
Horten ist uns bekannt, denn wir horten alles, was uns nützlich erscheint, angefangen mit Essensvorräten, Notvorräten oder Kriegsvorräten, weiter Geldvorräten und Goldvorräten, aber auch mit Munitionsvorräten und Kapitalvorräten, nicht zu reden von Kleidervorräten und sanitären Vorräten, einige sogar mit Benzinvorräten und Heizölvorräten und sogar mit Trinkwasservorräten, denn wir wollen alle genügsame Überlebenskünstler sein und werden und als Letzte die Lichter löschen und die Türen abschließen müssen oder dürfen, je nachdem. Das liegt uns seit unserer Kindheit im Blut.
Einige achten sogar auf die diversen Vorsorgen der Nachbarn, nur um noch etwas Entscheidendes mehr als sie zu horten, worauf der Nachbar vielleicht gar nicht geachtet hat: auf Verbandsmaterial, auf Medikamente oder auf harte Spirituosen, auf antibiotische Entzündungshemmer oder auf grellgelbe Mimosen und auf diverse Dosenhosen, Hosendosen und Mooskonserven, vielleicht aber auch auf Briefmarken und auf Zündhölzer, wenn nicht gar auf geräucherte Dauerwürste und Langzeithormone für die Mormonen auf den Komoren. Manche lassen ihre Spermien