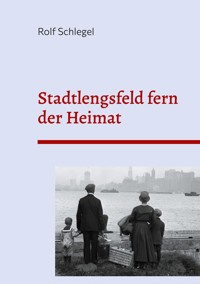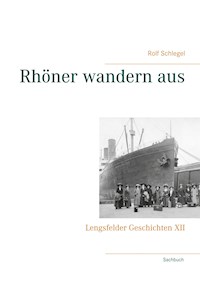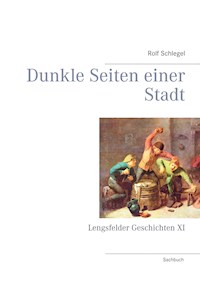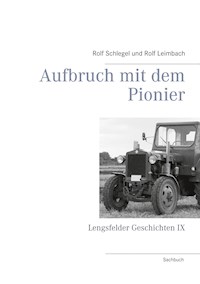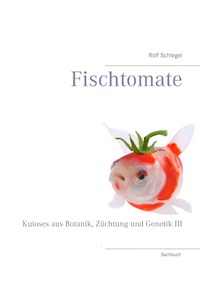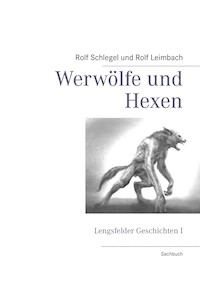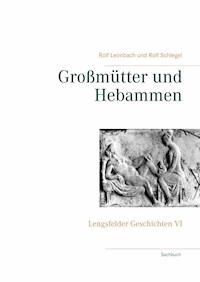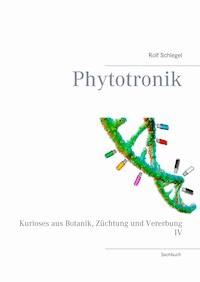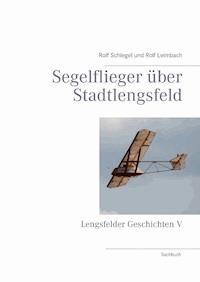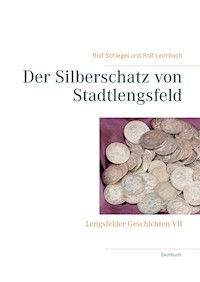
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch ist ein gemeinsames, siebentes Opus von Rolf Schlegel und Rolf Leimbach zur Geschichte ihres Heimatortes Stadtlengsfeld. Viele Ereignisse und Personen wurden berücksichtigt, aufgearbeitet und auf die vorliegende Weise einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Der Inhalt basiert auf einer Fülle historischer Daten, auf persönlichen Lebensläufen sowie auf Gesprächen mit Zeitzeugen. Die populären Darstellungen zielen auf einen großen Leserkreis ab, v. a. auf Bürger von Stadtlengsfeld, Weilar, Gehaus, Kaltennordheim oder Geisa, auf Heimatforscher, auf Lehrer und Schüler. Eintausend Jahre Geschichte eines kleinen Städtchens in der Rhön bieten genügend Stoff für Anekdoten, kuriose Begebenheiten und Intrigen. Sie sind Anlass zum Staunen und Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken! Die souveräne Auswahl der Themen, Sortierung und ihre prägnante Abhandlung lassen Sachverstand und nötiges Einfühlungsvermögen der Autoren erkennen. Dass man schon Mitte des 19. Jahrhunderts in Stadtlengsfeld Sport trieb, dass Verwandte der Familie Vogel in Wien Lokomotiven bauten, August Döring zum Hofgärtner in Wien wurde, dass das Wetter den Lengsfeldern seit Jahrhunderten zu schaffen machte und sogar ein Silberschatz geborgen wurde, sind nur einige von vielen Enthüllungen, die dieser Band enthält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autoren
Prof. Rolf Schlegel, ist Emeritus für Zytogenetik, Genetik und Pflanzenzüchtung, nach über 40 Jahren Erfahrung in Forschung und Lehre. Er ist Autor von mehr als 200 wissenschaftlichen Publikationen und anderen Abhandlungen, Koordinator internationaler Forschungsprojekte und Mitglied mehrerer internationaler Organisationen. Er veröffentlichte bereits erfolgreich fünf Fachbücher in englischer Sprache, herausgegeben von drei amerikanischen Verlagen. Rolf Schlegel diplomierte 1970 auf dem Gebiet der Genetik und Pflanzenzüchtung und promovierte 1973. Die Habilitation (Dr. sc.) folgte 1982. Er war langjährig an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, dem Institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung der Akademie der Wissenschaften, in Gatersleben, dem Institut für Getreide und Sonnenblumen-Forschung,
Dobrich/Varna sowie dem Institut für Biotechnologie der Bulgarischen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, Kostinbrod/Sofia tätig, darüber hinaus an verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen der USA, Brasilien, England, Japan, Russland und anderer Länder. Seit geraumer Zeit hat er die Ahnenforschung seines Heimatortes Stadtlengsfeld zur Freizeitbeschäftigung gemacht. Dabei entstand eine Datei von mehr als 46.000 Personeneinträgen aus der mehr als tausendjährigen Geschichte des Ortes. Die Schicksale der Menschen und deren Leben bieten Stoff für eine Vielzahl von Geschichten und historischen Darstellungen. Diese einem breiten Publikum kundzutun, ist eine Passion des Autors.
Studienrat i. R. Rolf Leimbach war 47 Jahre Lehrer in Stadtlengsfeld. Als Mitglied des Wissenschaftlichen Rates für Unterstufenforschung an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR beteiligte er sich an der Weiterentwicklung von Lehrplänen sowie Lehrmaterialien für das Fach Heimatkunde. Seine Publikationen in der Fachzeitschrift „Die Unterstufe“ befassten sich mit methodischem Experimentieren und der Erziehung zur aktiven Fragestellung. Er veröffentlichte zahlreiche methodische Handreichungen für den Unterricht. Er ist Autor zahlreicher Lehrbücher, Schüler-Arbeitshefte und Unterrichtshilfen für den Heimatkunde- und Sachunterricht. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst intensivierte Rolf Leimbach seine heimatkundlichen Forschungen. Er veröffentlichte Beiträge zur Geschichte des Porzellanwerkes Stadtlengsfeld, zum Schulwesen, über das Kaliwerk am Menzengraben sowie über die Kirche. Weitere Arbeiten befassen sich mit den Hexenprozessen im 17. Jahrhundert, den Ereignissen des Jahres 1848 in der Stadt Lengsfeld, der Brandkatastrophe 1878 und dem Jahr 1945. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Erforschung der einstigen israelitischen Gemeinde im Heimatort, die zu den größten in Thüringen zählte. Rolf Leimbach ist es ein stetiges Anliegen, die facettenreiche Geschichte seiner Heimatstadt vielen Bürgern und Gästen nahezubringen. Deshalb engagiert er sich im Kultur- und Geschichtsverein mit Vorträgen, Führungen und Ausstellungen.
Vorwort
Man muss wohl erst zum älteren Semester gehören, bevor man die Zeit und Muße besitzt, um sich intensiver mit seiner Heimat und seinen Wurzeln zu beschäftigen. Beide Autoren haben neuerdings das Privileg. Obwohl beide in Stadtlengsfeld geboren wurden, aufwuchsen und zur Schule gingen, haben sich ihre Wege durch das Berufsleben verloren. Erst im Jahr 2011 war es soweit, dass sie sich wieder begegneten. Der eine schon länger befasst mit der Geschichte der Rhön, der andere über die Suche nach seinen Ahnen.
Bereits die ersten Gespräche waren von großem Konsens und individueller Begeisterung geprägt. Es brauchte somit nicht allzu lange, um neue Ideen und gemeinsame Pläne zu gebären. Basierend auf dem bereits angehäuften Fundus an geschichtlichen Daten, Personenbeschreibungen, Fotos sowie schriftlichen Belegen bestand die Frage, wie man die Vielzahl von Informationen einem breiteren Publikum, insbesondere aus Stadtlengsfeld nahe bringt.
Eine Möglichkeit sahen die Autoren in monatlichen Kurzgeschichten, die im Lokalanzeiger „Baier-Bote“ veröffentlicht werden. Sehr schnell war aber zu erkennen, dass die schriftstellerische Produktivität der beiden Autoren größer war als man in monatsweisen Publikationen unterbringen kann. Daher rührte der Gedanke, einzelne historische Beiträge in Buchform zu publizieren
Bereits fragmentarische Unterlagen wurden gesichtet, systematisiert und in ein geeignetes Format gestellt. Hinzu kamen eine Vielzahl von persönlichen Kontakten, Recherchen im INTERNET sowie Standesämtern, Kirchenbüchern und alten Gazetten. Das Ergebnis lässt sich sehen. Obwohl es niemals ein Ende gibt, sind bereits mehr als 46.000 Menschen über mehr als tausend Jahre jüngerer Geschichte des Heimatortes in eine elektronische Datenbank eingeflossen. Die dazugehörigen Einzelschicksale bieten Stoff für Generationen.
Die Autoren betrachten ihr Werk als Vermächtnis an die gegenwärtige Generation, Kinder und Enkel. Mögen sie sich ihren Wurzeln bewusst werden, ihren Vorfahren gedenken und die Sammlung eines Tages weiterführen.
Es ist in höchstem Maße interessant zu sehen, woher wir kommen, wie die Geschichte das Wohl und Wehe von Personen beeinflusste sowie Menschen schon immer versuchten, ihre Leben aufzuschreiben und zu dokumentieren.
Nicht die Suche nach LUCA (Last Universal Common Ancestor) trieb uns, sondern die Neugier nach den Wurzeln der Vielzahl von Lengsfelder Bürgern, ihren Familien sowie deren Rolle in der Geschichte. Dabei wird sichtbar wie sich lokale menschliche Populationen vermischen, wie geographische sowie gesellschaftliche Grenzen überschritten werden, wie Kriege Familien auslöschen, wie Stammbäume enden und andere wachsen oder wie sich Berufe und Namen historisch wandeln.
Deutlich wird zugleich, dass die Mobilität in der Neuzeit immer größer wird und die Familien immer kleiner.
Der siebente Band der Serie von „Lengsfelder Geschichten“ ist wiederum eine Auswahl von Artikeln, die neu erstellt wurden. Es war nicht beabsichtigt, eine exakte geschichtliche Abfolge der Beiträge zu gestalten. Es ging vielmehr darum, die Zusammenstellung so zu arrangieren, dass eine möglichst große Aufmerksamkeit erzielt wird. Viele Details sind nicht in die Artikel eingeflossen, weil diese das Leseerlebnis gestört hätten. Diese können aber jederzeit bei den Autoren nachgefragt werden. Abbildungen, Schemata und Fotos dienen einem ähnlichen Zweck. Fußnoten und Quellenangaben wurden auf ein Minimum reduziert. Die Referenzen finden sich in einer an das Ende des Buches verlegten Bibliographie.
Die Autoren
Danksagung
Die Autoren möchten Ingrid Müller, geb. Vogel (Wien), Claudia M. Greifzu (Kaltennordheim), Hartmut Kunath, Manfred Wolfram und Leonore Krug, geb. Maier-Singler (Stadtlengsfeld) für die interessanten Anregungen sowie Beiträge danken.
Frau Dr. Gisela Schlegel sind wir sehr für die kritische Durchsicht des Manuskripts verbunden.
Inhalt
Autoren
Vorwort
Danksagung
Turnunterricht im Jahr 1860
Am Anfang war der Turnverein 1854
Armes Dorfschulmeisterlein
Die Schule ist aus – für immer
Kommunale Selbstverwaltung Stadtlengsfeld
Wie eine Ehe eine Ehe wurde
Lengsfelder Henz Heymricht zahlt an das Kloster Zella
Arme und Armut in Lengsfeld
Restauration der Marktschenke 1940
Ehrenbürger – Sanitätsrat Dr. med. Werner Krug
Demmer baut Lokomotiven in Wien
Die Blaue Pfütze
Klimaverlauf in und um Stadtlengsfeld
Alle Wetter
August Döring – Kaiserlicher Hofgärtner in Wien
Wallenstein in Lengsfeld
Der Silberschatz von Stadtlengsfeld
Bibliographie
Turnunterricht im Jahr 18601
Rolf Schlegel
Schon seit Jahren hatten sich die Lehrer der Bürgerschule von Stadtlengsfeld mit dem Gedanken einer Schulturnanstalt beschäftigt (vgl. Lengsfelder Geschichten II). Die Überzeugung, dass planmäßige, auf allseitige Aus- und Durchbildung des Körpers berechnete Leibesübungen von den wohltätigsten Folgen sein werde, war längst bei ihnen über jeden Zweifel erhaben. Die Stadtlengsfelder Jugendlichen litten noch immer an den körperlichen Folgen der einstigen, harten Arbeit in den Fabriken des Ortes.
Nachdem nun im Publikum für die Idee hinlänglicher Boden gewonnen war, und nachdem auch das hierorts bestehende, sogenannte Besserungs-Comitè sein Interesse für die Turnsache kund gegeben hatte, hielt es das Lehrercollegium für seine Pflicht, zur endlichen Realisierung des lang gehegten Planes, die geeigneten Schritte bei den zuständigen Behörden zu tun. Es gab sogar ein Beschluss des Gemeinderates zum Bau einer Turnanstalt in Lengsfeld (1858). Aus Geldmangel blieb es beim Beschluss.
Unterm 5. Mai 1859 wurden die ersten Anträge bei dem Schulvorstande und von diesem bei dem Gemeinderate gestellt. Von Letzterem wurden auch sofort ein passender Platz für die Anstalt überwiesen und von Ersterem Verhandlungen wegen Deckung der Kosten eingeleitet.
Während sich diese Verhandlungen in die Länge zogen, schenkte ein jugendfreundlich gesinnter hiesiger Bürger, um der Sache neuen Auftrieb zu geben, der Schule für die erste Herrichtung des Turnplatzes die Summe von 61/4 Taler, von welchem Gelde vorläufig einige Barren, einige Recke und eine Kletterstange beschafft wurden, so dass bei Gelegenheit der Feier des zehnjährigen Bestehens der vereinigten Bürgerschule am 7. Oktober 1860 der Platz zum ersten Male zu turnerischen Übungen benutzt werden konnte.
Abbildung 1: Ausschnitt aus einer Landkarte von Stadtlengsfeld, um 1820. Der Stadtlengsfelder Turnplatz von 1860 wurde auf dem früheren sog. Exerzierplatz nahe der Felda und gegenüber der Mühlwiese eingerichtet. Quelle: Archiv R. Schlegel, 2017
Abbildung 2: Bilder vom Stiftungsfest des Leipziger Allgemeinen Turnvereins 1895 (nach einer Zeichnung von A. Liebing). Quelle: Wikipedia, 2017
Zu Anfang dieses Jahres beschloss der Schulvorstand einstimmig die Einrichtung einer förmlichen Schulturnanstalt auf Kosten der Gesamtschulgemeinde.
Er verwilligte auch die Mittel zur Anschaffung der vorerst unentbehrlichen Geräte und das Honorar für den Lehrer, so dass wir die Freude hatten, am Geburtstage Ihrer Königlichen Hoheit, unserer allverehrten frau Herzogin, die Anstalt eröffnen zu können. Seitdem haben die Übungen ihren geregelten, sehr erfreulichen Fortgang.
Lage des Sportplatzes
„Unser Turnplatz liegt unmittelbar an der Stadt, längs der Felda, ist bei einer freundlichen Umgebung und einer gewissen Abgeschlossenheit der Lage hinlänglich geräumig, dabei nicht ohne allen Schutz gegen die heißen Sonnenstrahlen, und bietet außerdem den Vorteil, dass sich mit ihm, ohne sehr erhebliche Kosten, durch einen Ausstich der Felda, zugleich eine Schwimmanstalt leicht in Verbindung bringen lässt“ – ein Plan, der bereits eifrig debattiert wird.
Geräte
An Geräten und Apparaten sind vorläufig auf demselben nur vorhanden: eine Kletterstange, zwei Recke, zwei Barren, ein Springgraben zu Weitsprung, ein Sprunggestell für den Hochsprung, 30 sichtene (= klare, der Autor) 5–6 Fuß lange, dünne Stäbe zu den Freiübungen. In der Herrichtung begriffen ist ein in einem regelmäßigen Fünfecke aufzustellendes Reckgerüst, an welchem gleich eine ganze Anzahl Schüler die betreffenden Übungen unter dem Auge des Lehrers ausführen kann, und ein größeres Stangengerüst, bestehend aus 2 senkrechten, 18 Fuß hohen Stangenreihen und einer daran gelehnten schrägen Reihe nebst Leitern und Strickleitern zu Steig-, Kletter-, Hang-, Schwebe- und mancherlei anderen Übungen, ein Apparat, der viele andere entbehrlich macht.
Nur Jungen
Vorerst ist der Turnunterricht nur auf die männliche Schuljugend berechnet, zu welchem Behufe dieselbe in zwei getrennte Abteilungen gebracht ist: 8–11 Jahre und von 11–14 Jahre. Doch hat sich bereits die Mädchenabteilung für einen Privatkursus im Turnen gebildet, die ebenso, wie jede der beiden Knabenabteilungen allwöchentlich und zwar bis jetzt on 4 bis halbsechs Uhr, zweimal ihre Übungen hat.
Gänzlich ausgeschlossen von den Turnübungen sind die 6- und 7jährigen Kinder, ganz oder nur von einzelnen Übungen, je nach dem ärztlichen Gutachten, die mit einem Leibesschaden behafteten, dagegen ist mehreren konfirmierten Knaben auf ihr ansuchen die Teilnahme am Unterrichte gern erstattet worden.
Turnstunde
Jede Turnstunde beginnt mit Frei- und Ordnungsübungen, an welche sich die Übungen an den Geräten anreihen und schließt in der Regel mit einem Turnspiele. Die Reihenfolge der Übungen ist so berechnet, dass in jeder Stunde der ganze Muskelapparat des Körpers in durchgreifender Weise in Tätigkeit gesetzt wird, und dass diese Übungen selbst in ihrer Aufeinanderfolge ein ebenmäßiges, in sich abgeschlossenes und abgerundetes Ganzes bilden.
Dem Unterrichte liegen die 2 Teile des Turnbuchs für Schulen von Adolph Spieß (Basel, Schweighauser’sche Buchhandlung) zu Grunde, deren Verfasser das Schulturnen in der gegenwärtigen Gestalt erst begründet und ausgebildet hat.
Begeisterung
„Erfreulich ists, mit welchem Eifer und welcher Liebe die Jugend dem Turnunterrichte zugetan ist. Ohne dass bis jetzt ein Zwang hat ausgeübt werden können, werden die Turnstunden sehr regelmäßig von dem sämtlichen Schülerabteilungen und mit sichtlichem Vergnügen besucht“2.
Fast noch erfreulicher ist es, dass von Seiten der Eltern und des Publikums überhaupt fast nicht die mindeste Opposition gegen das Ungewöhnliche und Neue dieses Unterrichts lauf geworden ist. Zu statten kam uns dabei allerdings mehrerlei.
Erstens erhielten wir in der Person des Herrn Lehrer Sander3, welcher an dem Turnkursus in Dresden teilgenommen, einen tüchtig gebildeten Turnlehrer, der durch die vollständige Beherrschung seines Gegenstandes, durch die Umsicht und die Liebe, mit welcher er den Unterricht betreibt, in kurzem das Vertrauen der Kinder und Eltern erworben hat.
Fürs zweite kam uns die Beihilfe des Amtsphysikus Herr Dr. Roßtok hier sehr zu statten, der, selbst ein Freund und tätiger Beförderer des Schulturnens, auf unser Gesuch die sanitätspolizeiliche Beaufsichtigung der Turnübungen übernommen hat und uns mit seinem Rate freundlichst unterstützt. Es kann ängstliche Eltern keine sicherere Garantie gegeben werden, dass das Turnen nicht ein gefährlicher, halsbrechender Zeitvertreib, sondern ein wahres Bildungsmittel für ihre Kinder sei, als die Beteiligung eines geachteten Arztes bei der Sache.
Ich möchte raten, dass man allwärts, wo dies möglich, diese Beteiligung des Arztes zu erwirken suche, und zwar außerdem angeführten Grunde auch noch um deßwillen, weil im Anfange beim Mangel an hinlänglicher Erfahrung ohne den Beirat eines medizinisch gebildeten Auges trotz aller Vorsicht doch leicht dieser oder jener Missgriff getan wird, der im Anfange umso gefährlicher ist, als durch die ganze junge Anstalt leicht wieder auf wer weiß wie lange in Frage gestellt werden kann.
Fürs dritte bildete sich gleich nach Eröffnung der Schulturnanstalt, ohne jegliche Anregung von außen, aus der erwachsenen Jungend des Ortes heraus ein Turnverein4, der insofern für das Schulturnen von Bedeutung wurde, als er das Interesse für die Turnsache im Publikum wach rufen, erhalten und erhöhen half. Der Turnverein benutzt den Schulturnplatz und die Schulturngeräte mit, und gibt dafür einen jährlichen kleinen Beitrag zu Instandhaltung und Erweiterung der Geräte sowie Apparate.
Fazit
Nach alledem darf man sicher Hoffnung hingeben, dass sich aus unseren bescheidenen Anfängen mit der Zeit ein recht reges, frisches und fröhliches Turnleben – zum Heile unserer Jugend – gestalten werde.
Auch in unserer Nachbarstadt Vacha ist reges Interesse für diese Sache vorhanden, ein zweckmäßiger Turnplatz hergerichtet und der Unterricht bereits im Gange.
Möchte diese kurze Mitteilung zum Austausch von Erfahrungen in diesem Blatte und zu gegenseitiger Aufmunterung auch rücksichtlich dieses wichtigen Zweiges unserer schulerzieherischen Tätigkeit einige Veranlassung geben.
Pickel5
Einen Fortsetzungsartikel über die Entwicklung des Sports in Stadtlengsfeld liefert R. Leimbach in den Lengsfelder Geschichten VII. Erfreuen Sie sich auch an jenem Text.
1 Redaktionell bearbeiteter Zeitungsartikel aus dem Jahr 1861 [1]
2 Aus dem von den Lehrern gestellten Gesuch um Aufnahme des Turnens in die Zahl der obligatorischen Unterrichtsgegenstände des Lehrplans.
3 Lehrer Sander organisierte später regelmäßig Schauturnen zu feierlichen Anlässen in Stadtlengsfeld und Umgebung [2]
4 Es muss wohl eine allgemeine Hochstimmung für den Sport in dieser Zeit gegeben haben, denn um das Jahr 1860 wurden zahlreiche Turnvereine in Deutschland gegründet, darunter auch der in Stadtlengsfeld (Autor).
5 Gemeint ist Lehrer Adam Pickel aus Tiefenort, erster Kantor und späterer Rektor der Bürgerschule von Stadtlengsfeld (der Autor)
Am Anfang war der Turnverein 1854
Die Entwicklung der Sportanlagen von Stadtlengsfeld
Rolf Leimbach
Vorbemerkungen
Im Jahr 1919 feiern die Stadtlengsfelder Sportler das 100. Jubiläum der Gründung des Arbeitersportvereins „Eintracht“. Wenn das kein Grund ist, einmal auf die Anfänge des Sports im Ort zu schauen.
In den „Lengsfelder Geschichten II“ wurden bereits die Anfänge des Turnunterrichtes an der vereinigten Bürgerschule in der Stadt Lengsfeld während der Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben. Damals erfasste eine wahre Gründungswelle von Sport- und Turnvereinen die deutschen Länder. Diese Bewegung war natürlich nicht nur der unbestrittenen Einsicht geschuldet: „In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.“ Sehr bald bemächtigten sich auch nationalistische, populistische und militaristische Geister dieser Weisheit. Selbst der „Turnvater Jahn“6 (Abb. 1) war nicht frei von solchem Gedankengut. Das verwundert nicht, war doch die Forderung nach körperlicher Ertüchtigung der Jugend in jenen Jahren eng mit dem Kampf gegen die napoleonische Fremdherrschaft verbunden.
Als in Lengsfeld das Schulturnen entstand, war F. L. Jahn schon acht Jahre tot. Preußen lag zu jener Zeit in Fehde mit seinen Nachbarn und erstrebte die Führungsrolle im Deutschen Bund. Im entscheidenden sogenannten „Deutschen Krieg“ von 1866 spürte Lengsfeld mit der Schlacht am Nebelberg einen Hauch dieses Krieges. Nur vier Jahre später im deutschfranzösischen Krieg 1870/71 wurde auch in Lengsfeld der Nationalismus befeuert (Lengsfelder Geschichten VI).
Abbildung 1: Friedrich Ludwig (17781852). Quelle: Wikipedia, 2017
In der Rhönzeitung – Wochenblatt für die Bewohner des Rhöngebirges und der Angrenzenden Gebiete – insbesondere für sie Städte Vacha, Lengsfeld, Dermbach, Kaltennordheim, Geisa, Tann, Gersfeld und Hilders, Nr. 86, Donnerstag den 21. Juli 1870 war zu lesen:
„Von der Rhön.
In Lengsfeld geht heute folgendes Rundschreiben von Haus zu Haus: Einwohner Lengsfeld’s! Der Erbfeind unseres Landes steht an der Grenze – unsere Heere ziehen ihm entgegen, heiße und blutige Kämpfe sind stündlich zu erwarten.
Unsere, der Daheimbleibenden, Pflicht ist es, Sorge zu tragen, daß die Jugend unseres Volkes, die dem Feind gegenüber uns beschützt, wenn sie im Feld von Wunden und Krankheiten getroffen wird, nicht an dem Mangel leidet, was unter solchen Umständen nothwendig ist.
Ich wende mich deshalb an Euch mit der Bitte, mir zukommen zu lassen, was hier nützt: Leinenzeug, Wäsche, Binden, Charpie, Erfrischungen, Geld.
Abbildung 2: Darstellung eines Turnplatzes, um 1845. Quelle: Wikipedia, 2017
Gern nehme ich Alles in Empfang und befördere es an seine Bestimmung.
Lengsfeld’s vaterländische Gesinnung hat sich oft bewährt und thut es auch hier – 1866 bat ich schon um Unterstützung und weiß, daß sie nützte und willkommen war.
Gedenket unserer kranken und verwundeten Landsleute – unsere Söhne und Brüder – die Herzen auf, die Truhen auf!
Lengsfeld den 19. Juli 1870
Dr. Roßtock“7
Dem Autor liegt fern, die Erben des „Turnvaters Jahn“ in den überall entstehenden Turn- und Sportvereinen mit Chauvinisten oder Militaristen gleichzustellen. Die jungen Männer und Frauen hatten wohl in erster Linie Freude an der Bewegung, am fairen Wettkampf, am Mannschaftsgeist und an der Erprobung der eigenen körperlichen Leistungseigenschaft. Aber frei von der Vereinnahmung des Sportes von politischen Zielen war der Sport auch schon damals nicht.
Abbildung 3: Das Foto ist mit „Turnverein Jahn“ in Lengsfeld benannt. Quelle: Archiv R. Leimbach, 2000
Abbildung 4: Das Foto aus dem Nachlass von G. Biedermann zeigt den „Turn-und Sportverein 1854 e.V.“. Quelle: Archiv R. Leimbach, 2014
Turnunterricht in der vereinigten Bürgerschule
Im Jahr 1860 wurde im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach der Turnunterricht obligatorisch. „Die Lehrziele in den Volksschulen“ gaben die Inhalte vor:
Elementarklasse:
„Die für diese Stufe geeigneten Gemeinübungen und Spiele.“
Mittelklasse:
„Die für diese Stufe angemessenen Ordnungsund Geräthübungen.“
Oberklasse:
„Frei- und Geräthübungen in leichter, rascher und präciser Ausführung.“
Die ersten beiden Klassen (Elementarstufe) hatten in Lengsfeld jedoch keinen Turnunterricht. Ab der Mittelklasse gab es für Jungen und Mädchen getrennt je eine Turnstunde in der Woche, und zwar am Nachmittag. Inhalte der Turnstunden waren z. B.:
Freiübungen: Grundstellung, Vor-, Seit-, Rückstellung, Drehungen am Ort, Armbewegungen, Rumpfbeugen, Beinbewegungen, Hüpfen am Ort, Dauerlauf, Beinspringen mit Armheben und Armschwingen, Armbeugen und Armstrecken mit Kniebeugen und -strecken, mit Beinheben und -senken, Springen in verschiedenen Richtungen, Springen mit Arm- und Rumpfbewegungen in Verbindung, Ausfall vorwärts, schräg vorwärts, seitwärts.
Abbildung 5: Mitglieder des „Turnvereins 1854“ Stadtlengsfeld, 1926. Quelle: Archiv R. Leimbach, 2013
Ordnungsübungen: Richten in Stirn- und Flankenreihen, Taktgehen in diesen Reihen am Ort, Vor-, Rückwärts, Gehen mit Nachstellen des Fußes und Trittwechsel, Gegenzug, Aufmarschieren zu Vierreihen, Auflösen derselben, Aufmarschieren zu Staffeln, Marschieren mit Gesang, mit Trommeln und Pfeifen, Aufmarschieren zu Viererreihen mit Trommeln und Pfeifen, Reihungen
Geräteübungen: am Barren mit Stütz, Sitz, Schwingen, Liegestütz, Kehre, Wende, Reitsitz, Grätschsitz, Armbeugen und Armstrecken im Liegestütz vorlings, und Stützhüpfen; an der Kletterstange mit Kletterschluss, Auf- und Abklettern, Klettern an zwei Stangen mit Kletterschluss an einer Stange sowie Hangeln; am Reck mit Streckhang, Beinbewegungen dabei, Hangeln mit Nach- und Übergreifen, Schwingen im Streckhang, Unterschwung, desgl. mit vorgestellter Schnur; mit der Springschnur (Hüpfseil) Springen mit geschlossenen Füßen, mit drei Anlaufschritten, Weitsprung, Hoch- und Weitsprung mit Drehungen und Dreisprung; mit Stäben Halten des Stabes bei einem Fuße, vor dem Leib, Auf- und Abnehmen, Stabheben und Schwingen vorwärts, aufwärts, desgl. in Verbindung mit Beinbewegungen, Armbeugen und Strecken, Stab hinter einer Schulter, hinter dem Kopf, Heben des einen Beines auf, über den Stab, Bewegungen der Beine mit gleichzeitigen Bewegungen des Stabes, Kniebeuge mit Stabhaltungen verschiedener Art, Stabhaltungen mit Rumpfbeugen und -strecken, Gehen und Laufen mit Stabhaltungen, Ausfallen mit dem Stab, Stabschwingen, diese Übungen mit Trommeln und Pfeifen; an den Ringen mit Schwingen, Umschwung sowie Stütz.
Abbildung 6: Turnergruppe von Stadtlengsfeld u. a. mit Willi Riese (1906-1973, rechts unten). Quelle: B. Riese, 2016
Spiel: „Der Plumpsack geht rum“; Fuchs aus dem Loch; Jacob, wo bist du; Grenzball [1]
Unter „Turnen“, das zeigen die damaligen Lehrinhalte, verstand man die Gesamtheit aller Leibesübungen. Erst später entwickelte sich daraus das „Geräteturnen“.
Abbildung 7: Eine Frauenturngruppe des „Turnvereins 1854“ vor der Turnhalle auf dem Turnrasen von Stadtlengsfeld. Quelle: B. Riese, 2016
In den Unterrichtsplänen der Lehrer der vereinigten Bürgerschule von Stadtlengsfeld werden diese Elemente für die einzelnen Klassenstufen präzisiert. [1] Das Ziel war die „allseitige Aus- und Durchbildung des Körpers“.
Die wirklichen Ergebnisse dürften sich aber bei einer wöchentlichen Sportstunde und Klassenstärken von 50 Kindern in Grenzen gehalten haben.
Weitere Schranken für eine gute körperliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen waren die damals weit verbreitete Armut und der Zwang, durch harte Arbeit zum Broterwerb der Familie beizutragen.
Abbildung 8: Grundstück mit der Flurnummer 18 auf einem Lengsfelder Stadtplan aus dem Jahr 1820 – später der „Turnrasen“. Quelle: [1], modifiziert
Die Akten der vereinigten Bürgerschule und die Polizeiakten jener Jahre sind gefüllt mit Anzeigen gegen Eltern, die ihre Kinder z. B. wegen Feldarbeiten vom Schulunterricht und dem Unterricht in der Fortbildungsschule fernhielten.
Abbildung 9: Der Turnplatz des „Turnvereins 1854 e.V.“ auf dem Lageplan zum Um- und Ausbau des Schützenhauses zur Stadthalle, 1938. Quelle: [1]
Turnrasen und Turnhalle
Dass die vereinigte Bürgerschule in Lengsfeld einen Turnplatz erhielt (Lengsfelder Geschichten VII) war dem damaligen Rektor Adam Pickel eine Eintragung in die Unterlagen des Turmknaufes der evangelischen Kirche von 1862 wert:
„Etwas fehlte uns seither noch, was wir schon lange sehr ungern vermißten, ein Turnplatz mit den nöthigen Turngeräten. Seit vorigen Herbste ist uns ein solcher Platz gegeben und neuerdings ein tüchtiger, geschickter Turnlehrer dazu. Möge uns die Teilnahme des Publikums für diese junge segensreiche Anstalt nicht fehlen … Am 10. November (1860) fand eine Nachfeier (anlässlich des zehnjährigen Bestehens der vereinigten Bürgerschule, der Autor) im Freien statt mit gleichzeitiger Eröffnung der Schulturnanstalt, die aber der vorgerückten Jahreszeit wegen in diesem Jahre nur noch wenig besucht werden konnte.“
Die Anfänge des Turnsportes in Stadtlengsfeld liegen zeitlich im Jahr 1854 und räumlich auf dem Gelände des heutigen „Turnrasen“. Im Jahr 1854 entstand in Lengsfeld der „Turnverein Jahn“. Das jedenfalls legen Fotos aus den Nachlässen einiger Stadtlengsfelder Einwohner wie G. Biedermann, H. Gürtler und K. Freund nahe (vgl. Abb. 3, 4, 5, 6, 7). Urkundliche Belege für Manche Bilder zeigen Gruppenaufnahmen von Mitgliedern des Turnvereines 1854 bzw. des „Turnvereins Jahn“. Der Name des Vereins lässt vermuten, dass auch in Lengsfeld die patriotischen Beweggründe Jahns zur Gründung der Turnbewegung geführt hatten.