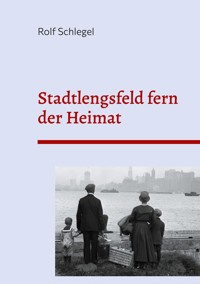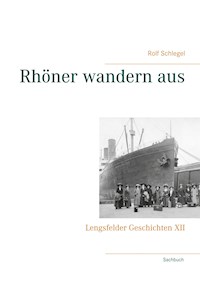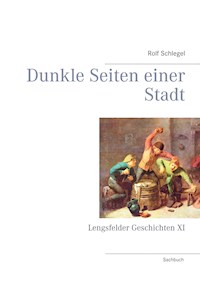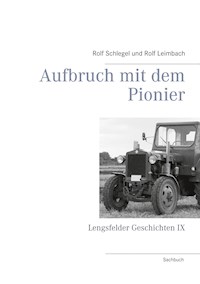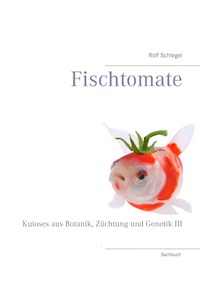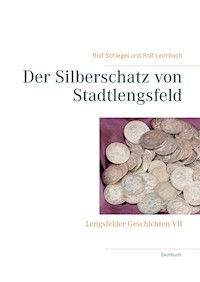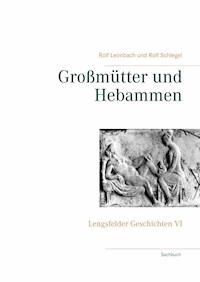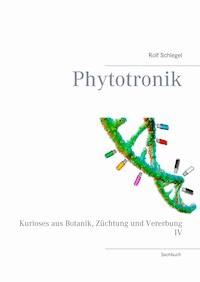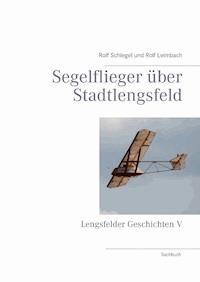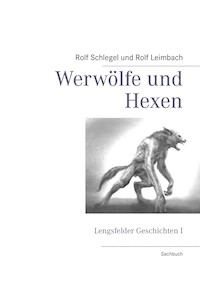
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
876 Jahre sind seit der ersten urkundlichen Erwähnung Stadtlengsfelds vergangen. Die Umwälzungen und Katastrophen, die in diesem Zeitraum über Deutschland und Europa hereingebrochen sind, lassen sich in unzähligen Geschichtsbüchern nachlesen: die Schrecken der Inquisition, die Reformation, der Dreißigjährige Krieg, die Neuordnung Deutschlands unter Napoleon, die Revolution von 1848, der Beginn der Industrialisierung, das Entsetzen des Ersten Weltkriegs, die Notzeit zum Ende der Weimarer Republik und die Schreckensherrschaft des Nazi-Terrors. Aber wie haben die Menschen in Stadtlengsfeld zu jenen Zeiten gelebt? Wie erging es ihren Nachbarn in den Tälern von Felda und Ulster? Darüber gaben die Geschichtsbücher bislang keine Auskunft. Die beiden aus Lengsfeld stammenden Autoren Rolf Schlegel und Rolf Leimbach – Naturwissenschaftler und passionierter Genealoge der eine, Lehrer, Stadtchronist und Heimatforscher der andere – haben jetzt für dieses Buch den Lebens- und Erfahrungsschatz unserer Vorfahren in mühsamer Kleinarbeit aus dem Dunkel der Archive geborgen und aufbereitet. Die große Stärke dieser Arbeit: Die Autoren ersparen den Lesern Datenwust und Faktenhuberei. Stattdessen bleiben sie konsequent bei der lebendigsten Form der Geschichtsschreibung: Sie erzählen für jedermann leicht verständlich Geschichte in Form von Geschichten, deren zeitgeschichtlichen Zusammenhang sie erklären. Und diese Geschichten sind spannend, anrührend, aufregend, abstoßend, absurd und manchmal auch komisch. Nur eins sind sie nie: langweilig. Rolf Schlegel und Rolf Leimbach spürten bei ihren Recherchen vielen Fragen nach: Welche Rolle spielte Graf Popo für die Lengsfelder Frühgeschichte? Warum dauerte der „Hexenprozess gegen Anna Schmidt 21 Jahre? Gab es tatsächlich Werwölfe in der Rhön? Wurde in Stadtlengsfeld Braunkohle gefunden und abgebaut? Welche Rolle spielten die 1848 Lengsfelder Familien Müller, Handschumacher, Xylander, Petermann, Backhaus, Rosenblatt und Tenner beim dramatisch verlaufenen Aufstand der Not leidenden Bürger gegen die Obrigkeit? Welche familiären Beziehungen hatte der weltberühmte Komponist Kurt Weill zu Stadtlengsfeld? Die Antworten gibt‘s im Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autoren
Prof. Rolf Schlegel, ist Emeritus für Zytogenetik, Genetik und Pflanzenzüchtung, nach über 40 Jahren Erfahrung in Forschung und Lehre. Er ist Autor von mehr als 200 wissenschaftlichen Publikationen und anderen Abhandlungen, Koordinator internationaler Forschungsprojekte und Mitglied mehrerer internationaler Organisationen. Er veröffentlichte bereits erfolgreich fünf Fachbücher in englischer Sprache, herausgegeben von drei amerikanischen Verlagen. R. Schlegel diplomierte 1970 auf dem Gebiet der Genetik und Pflanzenzüchtung und promovierte 1973. Die Habilitation (Dr. sc.) folgte 1982. Er war langjährig an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, dem Institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung der Akademie der Wissenschaften, Gatersleben, dem Institut für Getreide und Sonnenblumenforschung, Dobrich/Varna sowie dem Institut für Biotechnologie der Bulgarischen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften tätig, darüber hinaus an verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen der USA, Brasilien, England, Japan, Russland und anderen Ländern. Seit geraumer Zeit hat er die Ahnenforschung seines Heimatortes Stadtlengsfeld zur Freizeitbeschäftigung gemacht. Dabei ist eine Datei von mehr als 24.000 Personeneinträgen aus der mehr als tausendjährigen Geschichte des Ortes zustande gekommen. Die Schicksale von solchen Menschen und deren Leben bieten Stoff für eine Vielzahl von Geschichten und historischen Darstellungen. Diese einem breiten Publikum kundzutun ist eine neue Passion des Autors.
Studienrat i. R. Rolf Leimbach war 47 Jahre Lehrer in Stadtlengsfeld. Als Mitglied des Wissenschaftlichen Rates für Unterstufenforschung an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR beteiligte er sich an der Weiterentwicklung von Lehrplänen sowie Lehrmaterialien für das Fach Heimatkunde. Seine Publikationen in der Fachzeitschrift „Die Unterstufe“ befassten sich mit methodischem Experimentieren und der Erziehung zur aktiven Fragehaltung. Er veröffentlichte zahlreiche methodische Handreichungen für den Heimatkundeunterricht. Er ist Autor zahlreicher Lehrbücher, Schülerarbeitshefte und Unterrichtshilfen für den Heimatkunde- und Sachunterricht.
Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst intensivierte Rolf Leimbach seine heimatkundlichen Forschungen. Er veröffentlichte eine umfangreiche Chronik seiner Heimatstadt, die Geschichte des Porzellanwerkes Stadtlengsfeld, des Schulwesens, des Kaliwerkes Menzengraben sowie der Kirche. Weitere Arbeiten befassen sich mit den Hexenprozessen im 17. Jahrhundert, den Ereignissen des Jahres 1848 in der Stadt Lengsfeld, der Brandkatastrophe 1878 und dem Jahr 1945. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Erforschung der einstigen israelitischen Gemeinde im Heimatort, die zu den größten in Thüringen zählte.
Rolf Leimbach ist es ein stetiges Anliegen, die facettenreiche Geschichte seiner Heimatstadt vielen Bürgern und Gästen nahezubringen. Deshalb engagiert er sich im Kultur- und Geschichtsverein mit Vorträgen, Führungen und Ausstellungen.
Vorwort
Man muss wohl erst zum älteren Semester gehören, bevor man die Zeit und Muse besitzt, um sich intensiver mit seiner Heimat und seinen Wurzeln zu beschäftigen. Beide Autoren haben neuerdings das Privileg. Obwohl beide in Stadtlengsfeld geboren wurden, aufwuchsen und zur Schule gingen, haben sich ihre Wege durch das Berufsleben verloren. Erst im Jahr 2011 war es soweit, dass sie sich wieder begegneten. Der eine schon länger befasst mit der Geschichte der Rhön, der andere über die Suche nach seinen Ahnen.
Bereits die ersten Gespräche waren von großem Konsens und individueller Begeisterung geprägt. Es brauchte somit nicht allzu lange, um neue Ideen und gemeinsame Pläne zu gebären. Basierend auf dem bereits angehäuften Fundus an geschichtlichen Daten, Personenbeschreibungen, Fotos sowie schriftlichen Belegen bestand die Frage, wie man die Vielzahl von Informationen einem breiteren Publikum, insbesondere aus Stadtlengsfeld nahe bringt.
Eine Möglichkeit sahen die Autoren in monatlichen Kurzgeschichten, die im Lokalanzeiger „Baier-Boten“ veröffentlicht werden. Sehr schnell war aber zu erkennen, dass die schriftstellerische Produktivität der beiden Autoren größer war als man in monatsweisen Publikationen unterbringen kann. Daher rührte der Gedanke, einzelne historische Beiträge in Buchform zu publizieren. Eine solche liegt nun vor. Eine derartige Monographie kann ebenfalls periodisch weitergeführt werden.
Bereits fragmentarische Unterlagen wurden gesichtet, systematisiert und in ein geeignetes Format gestellt. Hinzu kamen eine Vielzahl von persönlichen Kontakten, Recherchen im INTERNET sowie Standesämtern, Kirchenbüchern und alten Gazetten. Das Ergebnis lässt sich sehen. Obwohl es niemals ein Ende gibt, sind bereits mehr als 20.000 Menschen über mehr als tausend Jahre jüngerer Geschichte des Heimatortes in eine elektronische Datenbank eingeflossen. Die dazugehörigen Einzelschicksale bieten Stoff für Generationen.
Die Autoren betrachten ihr Werk als Vermächtnis an die gegenwärtige Generation, Kinder und Enkel. Mögen sie sich ihren Wurzeln bewusst werden, ihren Vorfahren gedenken und die Sammlung eines Tages weiterführen.
Es ist in höchstem Maße interessant zu sehen, woher wir kommen, wie die Geschichte das Wohl und Wehe von Personen beeinflusste sowie Menschen schon immer versuchten, ihre Leben aufzuschreiben und zu dokumentieren.
Deutlich wird zugleich, dass die Mobilität in der Neuzeit im größer wird und die Familien immer kleiner.
Der erste Band einer geplanten Serie von „Lengsfelder Geschichten“ ist eine kleine Auswahl von Artikeln, die entweder bereits anderswo veröffentlicht oder neu erstellt wurden. Es war nicht beabsichtigt, eine exakte geschichtliche Abfolge der Beiträge zu gestalten. Es ging mehr darum, die Zusammenstellung so zu arrangieren, dass eine möglichst große Aufmerksamkeit erzielt wird. Viele Details sind nicht in die Artikel eingeflossen, weil diese das Leseerlebnis gestört hätten. Diese können aber jederzeit bei den Autoren nachgefragt werden. Abbildungen, Schemata und Fotos dienen einem ähnlichen Zweck. Fußnoten und Quellenangaben wurden auf ein Minimum reduziert. Sie finden sich in einer an das Ende des Buches verlegten Bibliographie.
Danksagung
Die Autoren möchten Herrn Redakteur Matthias Mayer, Marburg, für die kritische Durchsicht des Manuskripts danken. Seine Hinweise und Anregungen sind wohlwollend in das Buch eingeflossen.
Inhalt
Lengsfeld in den Wirren der Zeit
Der Hexerei angeklagt …
Anna Schmidt – eine Hexe
Ein Werwolf in Lengsfeld
Der Tod ist nicht umsonst
Waldsachsen
Kohl oder Kohle
Holz- oder Braunkohle
Kohlhepp wandert aus
Rebellion
Die Pertermanns
Ein Philosoph in Lengsfeld
Ein Denkmal aus Valparaíso
?
Moritz Goldschmidt und die Lengsfelder Schule
Maestro Zentgraaff
Bergbau in Lengsfeld
Vom Viehhändler zur Industriellen-Dynastie
Bibliographie
Lengsfeld in den Wirren der Zeit
Rolf Schlegel & Rolf Leimbach
Unser Heimatort hat im Laufe seiner Geschichte viele Irrungen und Wirrungen über sich ergehen lassen müssen. Lengsfeld hat wohl seinen Namen daher, dass es „längs der Felda" erbaut worden ist oder – was wahrscheinlicher ist – ein offenes, ebenes Land war, abgeleitet aus dem mittelhochdeutschen „lenges“ (= lang, weit, groß) und dem althochdeutschen „feld“ (= offenes, ebenes Land). In einigen Urkunden wurde es auch als Langhesuelt oder Legesfelt bezeichnet. Obwohl „das menschenleere Buchenlande“ [13], d. h. Buchonia, die Gegend der Rhön, nicht allzu groß ist, war das Land doch mehreren Herrschaften zugehörig. Vor dem Jahr 786 erwirbt das Kloster Hersfeld unter Bischof Lullus (705 - 786) u. a. Besitzungen im villa Salzungun (Salzungen) Lengesfelt (Lengsfeld) durch Schenkung. [11] Bei dem im „Breviarium sancti Lulli“ aufgelisteten Ort könnte es sich aber auch um ein anderes untergegangenes Lengsfeld handeln. [8, 12] Im Jahr 786 wird Thorandorf an der Werra (Dorndorf) ebenfalls in einer Schenkungsurkunde von Kaiser KARL der Große und König der Franken sowie Langobarden erwähnt. [10] Das deutet, dass es zu dieser Zeit bereits Siedlungen in der Region gab, die mit heutigen Orten harmonieren.
Mittelalter
Lengsfeld gehörte im Altertum zum Gau Tulli- oder eher Grabfeld. Schon 897 haben die „Äbte von Fulda für und im Namen der Kirche daselbst unter der Oberlehnherrlichkeit des deutschen Kaisers lehnherrlichen Antheil an Lengsfeld gehabt. Ob die Edlen von Lengsfeld als Ministerialen in ihrem Dienste standen und ihre Angelegenheiten in der Stadt verwalteten, oder ob dieses Geschlecht zu den nobilis gehörte und somit vielleicht einen Theil des Ortes sein Eigen nannte, lässt sich nicht ausfinden“.[15] Eine urkundlich belegte Nennung des Ortes in Form von zwei Adelsnamen (Ludevic de Leingisfeld (= Ludwig von Frankenstein) und Erkenbert de Leingisfeld) als Zeugen bei einer Schenkung zugegen waren) gibt es aus dem Jahr 1137.[19] Explizit erwähnte Friedrich I. Lengsfeld 1155 als er Ludwigo von Lengisfelth als Zeugen benannte.[18] Im Jahr 1186 werden Güter des Klosters Zella in Lengsfeld erwähnt. Von 1155 - 1215 werden Hersfelder Ministerialen als Herren des Ortes genannt, obwohl das Schloss um 1235 als Fuldaer Lehen in den Händen der Frankensteiner war.
1359 verlieh Kaiser Karl IV. das Marktrecht. [16, 17] Karl V. gestattete 1548 das Abhalten von Jahrmärkten (vergleiche nachstehenden Wortlaut).
„…bekennen öffentlich mit diesem Brief wann Uns Unser und des Reiches lieber Getreuer Georg von Boineburg zu Lengsfeld demütiglich angerufen hat, ... daß Wir gnädiglich angesehen solch demütige Bitte, auch angenehme getreue Dienste, die er Uns und dem Heiligen Reich bisher getan hat und darum mit wohlbedachtem Mut... dem genannten Georgen von Boineburg drei Jahrmärkte, als nämlich den ersten auf Sonntag Vocem Jucunditatis, den anderen auf Sonntag nach Galli, den dritten auf Purifloationis Mariae im gedachten Flecken Stadt Lengsfeld aufzurichten und hinfüro ewiglich zu halten gnädiglich genannt und erlaubt.... Gegeben in unserer und des Heiligen Römischen Reiches Stadt Augsburg am 4. Tage des Monats Juni... 1548. Carolus.“ [21]
Selbst sprachlich war die Rhön nicht einheitlich. Lengsfeld lag um das Jahr 900 im Grenzbereich zwischen Franken und Thüringen (vergleiche Abb. 1). Dennoch ist die Mundart hauptsächlich fränkisch geprägt. Hier begann in Richtung Norden und Osten der Westergau. Nach Süden und Westen war die Region dem Grab- und/oder Tullifeld1 beigeordnet. Es war Graf Popo der um das Jahr 810/811 das Tullimit dem Grabfeld vereinigte. Zu dieser Zeit wurde Lengsfeld noch dem Tullifeld zugeordnet. Das geht aus einer Urkunde vom 4. November 819 hervor. [9, 11]
Die Kelten
Aus vorgermanischer Zeit gibt es wenig zu berichten. Bei Stetten und Leimbach wurden Hügelgräber aus der Bronze- (2.200 - 800 vor der Zeitrechnung), bei Ostheim aus der La-Tene-Zeit (500 - 100 vor der Zeitrechung) gefunden. Im Umkreis des Werratals waren es vorrangig Kelten, die Spuren hinterließen. Steinwälle am Baier und umliegenden Anhöhen zeugen davon (vergleiche Abb. 2).
Allerdings fand der Lengsfelder Lehrer und Schulleiter Albert Bönicke in den 1930er Jahren in seinem Garten beim Umgraben ein bronzezeitliches Relikt – namentlich einen massiven Armring mit wechselndem Sparrenmuster und Strichverzierung. [24] Im Jahre 58 nach der Zeitrechnung berichtet der Römer Publius Cornelius Tacitus über eine Schlacht der Hermanduren und Chatten (Hessen) um einen salzreichen Fluss, womit vermutlich die mittlere Werra gemeint ist. Im Laufe der Völkerwanderung könnten auch Slawen das heutige Rhöngebiet durchzogen haben. Ortsnamen wie Föhleritz und Mebritz wären ein Indiz dafür, obwohl jene Namen mit größerer Wahrscheinlichkeit von „Folkradis“ und „Ebenets“ abgeleitet sind. [7] Orte wie Hartschwinden oder Rüdenschwinden verweisen auf Wenden, die hier durch deutsche Herren zwangsangesiedelt wurden.
Abbildung 1: Ausschnitt aus einer Darstellung, unter anderem das Territoriums „Tullifeld“ vor dem Jahr 900 mit Siedlungen, möglicherweise Lengsfeld am Bogen der Felda (siehe Pfeil); Quelle: [4, 9, 11]
Da es zu jener Zeit noch keine Zeitungen, kein Radio und Internet gab, treten Orts- und Gebietsnamen meist im Zusammenhang mit Kauf-, Schenkungs- oder Tauschurkunden zutage. So findet man erste Nennungen von Mittelsdorf (Mitilesdorf) im Jahre 778, Diedorf (Theodorpf) 788, Sundheim, Westheim, Nordheim, Weid (Weitahu) und Wiesenthal (Wisuntaha) 795, Urnshausen (Orentileshus) und Fischbach (Fiscpah) 837, Klings (Clingison) 869, Neidhartshausen (Ithhardeshusun) um 950, Öchsen (Uhsino) 977, Lengsfeld (Lengisfelt) 1137, Alba (Albaha, Unter- und Oberalba gab es noch nicht) und Weilar (Wilere) 1183 (um 1498 gab es noch ein Obernweilar, das westlich von Hartschwinden lag), Dermbach, Brunnhartshausen (Brumanshusen) 1186 etc.[17] Geschrieben hat man in der Regel so wie man die Namen hörte und so wie man gerade sprach. Das bringt uns noch heute ins Grübeln!
Keltische Worte sind noch heute in unserer Sprache zu finden, z. B.:
aballa – Apfel
banna, benna – Berg
bebro, bibros – Biber
bratir, brathair – Bruder
briwa – Brücke
tri – drei
isarno – Eisen
runo – Geheimnis (vgl. raunen)
sakro – heilig
karro – Karren o. Karre
letro – Leder
mori – Meer o. See
roudo – rot
sukko – Schwein (vgl. sucken)
windo – weiß
Im 10. - 12. Jahrhundert breitete die Kirche ihren Machtbereich in der Region aus. Das Stift Fulda schuf sich besonders reichen Besitz, auch über ihre vielen klösterlichen Dependancen. Anfangs hielt die Macht weltlicher Herren dem „geistlichen Besitz“ die Waage. Die alten Gaue hatten sich in der Mitte des 11. Jahrhundert aufgelöst, die Gaugrafen und anderen Edlen waren zu Herrschern größerer und kleinerer Gebiete geworden.
Die „Hundertschaft“, die „Cent“, war ein Instrument der veränderten politischen Verhältnisse. Die Herrschenden besetzten über die Centen ihre Amtsleute (Centgrafen2). Letztere gingen aus verschiedenen Rittergeschlechtern hervor. In dieser Zeit waren die Herren von Neidhartshausen die mächtigsten an der mittleren Felda. Erpho von Neidhartshausen war der Gründer des Klosters Zella (1136). Ihre Macht schwand jedoch langsam. Die Frankensteiner, eine Nebenlinie der Henneberger, kauften 1214 den Centbezirk Dermbach.
Die Frankensteiner haben in Lengsfeld – wo man im 12. Jahrhundert die Edlen von Lengsfeld als Hersfelder Ministerialen findet – von Fulda das Schloss zu Lehen (vergleiche Abb. 3) und besitzen die Cent von Dermbach. Letztere reicht von Urnshausen bis Fischbach, nebst Gütern in Vackenrode (Kaiseroda), Zillbach, den Wildbann bei Fischbach, Geisa und Brotterode. Doch deren Macht verblasste noch schneller als sie sie erlangt haben, nachdem sie sich gegen König Adolf von Nassau (~1250 - 1298) in den thüringischen Kämpfen stellten.
Im Jahr 1317 sowie 1326 verkauften sie sowohl Burg und „Stadt Lengsfeld“ als auch das Gericht Theyrembach (Dermbach) an Fulda (mit Dermbach, Ober- und Unteralba, Urnshausen, Föhleritz, Neiddhartshausen, Zella, Empfertshausen, Brunnhartshausen, Andenhausen, Klings, Diedorf, Fischbach, Mebritz, Glattbach, Lindenau, Steinberg). Offensichtlich gab es schon zu diesem Zeitpunkt die Stadt Lengsfeld! Es ist sogar ein Siegel der Stadt Lengsfeld von 1338 erhalten geblieben. [20] Der große Teil von Recht und Besitz der Frankensteiner ging an die Hauptlinie der Henneberger, die ihre Stammburg südlich vonMeiningen hatte. Ihr Geschlecht geht auf die Gaugrafen des Grabfeldes zurück (<10. Jahrhundert). Zugleich fällt das südliche Tullifeld mit der Cent Kaltensundheim sowie der Vogtei Kaltennordheim in ihren Machtbereich, der um 1583 zerfiel. Bereits 1317 gaben sie die Gerichtsbarkeit der Region an Fulda ab. Graf Heinrich VI. von Henneberg-Aschach verschenkte am 14. Juli 1317 sein Vogteirecht zu Lengsfeld ad novam plantacionem canonie in Slusungen.
Abbildung 2: Vorgeschichtliche Wall- und Grabanlagen rund um den Baier; Quelle: [14]
In der Folge kam es zu einem beinahe chaotischen Wechsel von Besitzständen, meist die Folge von Verpfändungen oder Fehden. Ein Pilger beim Papst äußerte in jener Zeit, dass „ganz Deutschland einem Räubernest gleicht und nur jene Ruhm und Ansehen genießen, die ausreichend Gold besitzen“. Im Jahr 1366 verkaufte Fulda Teillehen an Balthasar von Thüringen. Der verpfändete sie 1409 an das Erzstift Mainz, das sie 1423 an Würzburg verkauft. Teile des Besitzes gingen später durch Berthold von Henneberg-Römhild an seine Schwäger, die Grafen von Mansfeld über. 1555 wurden sie an die Söhne des Johann Friedrich des Grossmüthigen verkauft, wurden also sächsisch. So kamen auch die Vogtei Kaltennordheim und das Gebiet um Dermbach 1583 an sächsische Herzöge.
Abbildung 3: Burg zu Lengsfeld, um 1800; ursprünglich Wasserburg inmitten der Stadt; Bau wurde um 1125 durch die Reichsabtei Hersfeld zum Schutz ihrer Besitzungen veranlasst und mit Herren von Frankenstein besetzt; um 1300 durch die Reichsabtei Fulda erworben; von 1523 bis ca. 1900 im Besitz der Familie von Boineburg, die die Burg 1790 und Anfang des 19. Jahrhundert umgestalteten sowie die Gräben zuschütten ließen; seit 1945 bis dato Nutzung der Burg als Kurklinik; Quelle: Archiv, R. Schlegel, 2013
Aus Geldnöten verpfändete Fulda andere Teile des Amtes an die Herren von Steinau, von der Thann, von Buchenau, an Mainz und den Landgrafen von Hessen. 1454 erwarb Philipp von Herda und seine Frau Else, von seinem Onkel, Abt Reinhard von Fulda, die Hälfte des Amtes, Schloss und Stadt Lengsfeld für 500 Rheinische Gulden. Nach Philipps Tode folgte sein Sohn Raban im Besitz dieses Amts, welcher nur eine Tochter Mechthilde hinterließ.
1455 wurde nahezu die Hälfte des Amtes an den Grafen Georg der I. von Henneberg-Römhild und des Vetter, Graf Wilhelm der III. von Henneberg-Schleusingen versetzt. Durch weitere Käufe und Verkäufe kam schließlich die andere Hälfte des Amtes an die Herren von Hennberg-Schleusingen. Ihnen unterstand nunmehr das Amt Fischberg, allerdings ohne Pfandrecht, das bei Fulda verblieb. Nach 1523 entfremdeten die Herren von Boyneburg die ihnen verpfändete Stadt der Abtei und machten sie zum Sitz einer seit 1701 endgültig von Fulda getrennten, reichsunmittelbaren Herrschaft.
Reformation
Unter diesen Herrschaftsverhältnissen wurde um 1520 die kirchliche Reformation eingeleitet, in deren Folge das Kloster Zella aufgehoben wurde. In Lengsfeld wurde bereits 1536 ein evangelischer Pfarrer erwähnt, nachdem die boineburger Herrschaft bereits 1525 evangelische Gottesdienste gestattete. Schon seit 1546 gab es eine starke Wiedertäufer-Bewegung in der Gegend. Der Anführer wurde in Gotha enthauptet. Die israelitische Kultusgemeinde ist Ende des 16. Jahrhundert in Lengsfeld entstanden.
Fulda versuchte zwischenzeitlich, wieder alte Rechte zu erlangen, doch die hennebergisch-sächsischen Herren (Zeitz, Altenburg, Weimar, Gotha) verhinderten das bis nach dem 30jährigen Krieg.
Die Verwüstungen von Isolanis kroatischen Reitern nach der Schlacht von Nördlingen (6. September 1634) waren grauenhaft. Danach kamen Hunger und die Pest. Der neuernannte Pfarrer von Lengsfeld fand noch 18 Familien vor! Gleich einem trüben Nachspiel muten die danach wieder auflebenden Hexenprozesse an, die mit traurigem Eifer betrieben wurden (vergleiche separate Beiträge).
Bis 1660 führten sächsische Herzöge die Verwaltung des hennebergischen Erbes. Danach wurde geteilt: Weimar erhielt Kaltennordheim und Zillbach. Das Amt Fischbach blieb gemeinschaftlich. Fulda bestand auf ein gerüttelt Maß seines Besitzes. Nach langem Tauziehen traten 1707 die inzwischen neu entstandene Herzogtümer Meiningen und Eisenach das evangelische Amt Fischberg (Fischbach) gegen eine entsprechende Pfandsumme an Fulda ab. Entgegen Zusicherungen gegenüber der reformierten Geistlichkeit, begann sofort eine eifrige katholische Gegenreformation mit Kirchenbauten in Zella und Dermbach.
Abbildung 4: Wappen der von Boineburg, Althessische Ritterschaft; Quelle: [15]
Der Machtkampf zwischen Fulda und den Hennebergern tobte auch im Kleinen, d.h. in Lengsfeld. Er gipfelte in einem Vergleich von 1574. Das Lehnsrecht der Henneberger auf Weilar wurde von den sächsischen Nachfolgern abgelöst. Den frankensteiner Besitz hat Fulda übernommen. Die Fuldaer Amtsleute hatten Schloss, Stadt und Gericht in Verwaltung. Die von Reckerod, von Leupold, von Mansbach, von Herda und der Schwiegersohn einer von Herda, Ludwig von Boineburg zu Gerstungen & Krayenberg (1465 - 1537) vereinigten schrittweise die Güter von Weilar und Gehaus mit denen von Lengsfeld (vergleiche Abb. 4). 1498 erwarb Ludwig die Hälfte aller Pfandschaften, die andere Hälfte wurde ihm durch die Fuldaer in Aussicht gestellt. Neider wie der Abt Balthasar von Dermbach klagten natürlich sofort gegen diese Anmaßungen. In Verträgen von 1594,1685 und 1712 wurden die Besitzverhältnisse geordnet. Die Boyneburger erhielten das Erbrecht. Sie schlossen sich dem Kanton Rhön-Werra der Reichsritterschaft an, ein Bund gegen die Reichsfürsten. Doch schon 1694 verkaufte Christian von Boineburg
Abbildung 5: Zeitgenössische Karte mit dem Gerichtsbezirk Lengsfeld, einschließlich Stadtlengsfeld, Schrammenhof, Baiershof, Hohewart, Altenrode (Altes Rod), Fischbach, Mariengart, Wölferbütt, Kohlgraben, Willmanns, Völkershausen, Gehaus und Weilar mit Papiermühle (Unterwyler und Oberwyler), vor 1700; Quelle: Archiv, R. Schlegel, 2013
wieder seinen Anteil an den Abt Placidus von Fulda, was zu kriegerischen Auseinandersetzungen und schließlich zur Annullierung des Verkaufs führte. Der gleiche Besitz wurde dann 1735 regulär an den Freiherrn Georg Heinrich von Müller (1694 - 1750) veräußert.
Nicht sehr lange währte der Friede. Durch das Aussterben der Eisenacher Herzöge fiel das Fürstentum 1747 an Weimar. Weimar hatte schon früher den fuldaischen Rückkauf hintertrieben. Ernst August von Sachsen-Weimar-Eisenach machte kurzen Prozess und übernahm gewaltsam, d. h. nach fuldaischweimarisch militärischen Scharmützeln, den Besitz. Es kam zu unsäglichen Querelen. 1764 einigte man sich unter Anna Amalia von Weimar, dass Weimar die Dörfer rechts der Felda (Urnshausen, Wiesenthal, Fischbach) erhielt, die dem Amt Kaltennordheim zugeteilt wurden. Die übrigen Dörfer verblieben bei Fulda.
Um das Jahr 1800 gehörte das Amt Lichtenberg und das Amt Kaltennordheim mit Urnshausen, Wiesenthal, Fischbach sowie Zillbach zum Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach; das Amt Fischberg (Dermbach) zu Fulda und Lengsfeld mit Gehaus und Weilar zwei reichsfreien Familien (v. Müller und v. Boineburg).
Napoleon
Die napoleonische Zeit brachte erneut große Änderungen. 1803 wurde die Herrschaft von Hessen mediatisiert, d. h. Fulda verlor seine weltlichen Besitzungen. Diese gingen zusammen mit dem Amt Fischberg (Distrikt Dermbach) an das Großherzogtum Frankfurt, aber das Amt Dermbach (inkl. Wiesenthal, Fischbach, Urnshausen) 1815 wieder an Sachsen-Weimar. 1818 wurde die Klöster Dermbach und Zelle aufgelöst. In der Rheinbundakte von 1806 wurde die „teutsche Reichsverfassung“ aufgelöst. Die Selbständigkeit der Lengsfelder Herren ging verloren, da Reichsritterschaft (Regierungsform aus dem Mittelalter) und der Kanton Rhön-Werra für nichtig erklärt wurden.
Lengsfeld gehörte ab 1805 zum Kurfürstentum Hessen-Kassel. 1807 wurde es dem Königsreich Westfalen zugeschlagen, ein Jahr später fand es sich im Großherzogtum Frankfurt und 1812 erneut im Kurfürstentum Hessen-Kassel wieder. 1813 gehörte es mit der Enklave Fulda zum Königreich Preußen. Und 1815 erhielt es der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach. (vergleiche Abb. 5)
Staatshandbuch für das Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach von 1846 wiese folgende Positionen aus [26]: Der Kanton Rhön-Werra umfasste um 1840 eine Stadt (Lengsfeld, Abb. 6