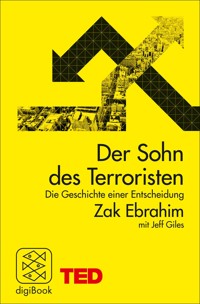
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die beeindruckende Geschichte eines jungen Mannes, der sich gegen den Hass entschieden hat Zak Ebrahim ist sieben Jahre alt, als seine Mutter ihn abends weckt und ihm mitteilt, dass sein Vater verhaftet wurde. Er gilt als Top-Terrorist und plante u.a. den Anschlag auf das World Trade Center. Für Zak bricht eine Welt zusammen: In den folgenden Jahren beginnt für ihn und seine Familie nicht nur eine lange Odyssee unter falschem Namen, sondern auch der schmerzhafte Prozess der Loslösung vom Vermächtnis des fanatischen Vaters. Ein einzigartiger Einblick in die Welt des religiösen Fanatismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zak Ebrahim
Der Sohn des Terroristen
Die Geschichte einer Entscheidung
Über dieses Buch
Zak Ebrahim ist sieben Jahre alt, als seine Mutter ihn abends weckt und ihm mitteilt, dass sein Vater verhaftet wurde. Er gilt als Topterrorist und plante u.a. den Anschlag auf das World Trade Center. Für Zak bricht eine Welt zusammen: In den folgenden Jahren beginnt für ihn und seine Familie nicht nur eine lange Odyssee unter falschem Namen, sondern auch der schmerzhafte Prozess der Loslösung vom Vermächtnis des fanatischen Vaters. Ein einzigartiger Einblick in die Welt des religiösen Fanatismus und die beeindruckende Geschichte eines jungen Mannes, der sich gegen den Hass entschieden hat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Foto: Ryan Lash
Zak Ebrahim, geboren 1983 in Pittsburgh, Pennsylvania, ist der Sohn eines ägyptischen Ingenieurs und einer amerikanischen Lehrerin. Seit er mit seinem Vater gebrochen hat, setzt er sich unermüdlich für Verständigung und Frieden ein.
Jeff Giles ist Journalist und Schriftsteller und lebt in New York.
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBook
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel:
»The Terrorist's Son. A Story of Choice«
bei Simon & Schuster, Inc., New York
© 2014 by Zak Ebrahim
Für die deutsche Ausgabe:
© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403545-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
1 5. November 1990. Cliffside Park, New Jersey
2 Gegenwart
3 1981. Pittsburgh, Pennsylvania
4 1986. Jersey City, New Jersey
5 Januar 1991. Justizvollzugsanstalt Rikers Island, New York
6 21. Dezember 1991. New York Supreme Court, Manhattan
7 26. Februar 1993. Jersey City, New Jersey
8 April 1996. Memphis, Tennessee
9 Dezember 1998. Alexandria, Ägypten
10 Juli 1999. Philadelphia, Pennsylvania
11 Epilog
Dank
Zak Ebrahim sprach 2014 [...]
Kleine Bücher – große Ideen!
[Mehr Information]
Ein Mensch ist nur ein Produkt seiner Gedanken.Er wird, was er denkt.
Gandhi
15. November 1990 Cliffside Park, New Jersey
Meine Mutter rüttelt mich aus dem Schlaf: »Da war ein Unfall«, sagt sie.
Ich bin sieben Jahre alt, ein dicklicher Junge in einem Teenage-Mutant-Ninja-Turtle-Schlafanzug. Ich bin es gewohnt, vor Sonnenaufgang geweckt zu werden, aber nur von meinem Vater, und nur, um auf meinem kleinen Teppich mit den Minaretten zu beten. Niemals von meiner Mutter.
Es ist elf Uhr nachts. Mein Vater ist nicht zu Hause. In letzter Zeit bleibt er länger und länger in der Moschee in Jersey City, bis spät in die Nacht. Aber für mich ist er immer noch mein Baba – lustig, liebevoll, warmherzig. Erst heute Morgen hat er wieder einmal versucht mir beizubringen, wie man sich die Schnürsenkel bindet. Hatte er einen Unfall? Welche Art von Unfall? Ist er verletzt? Oder gar tot? Ich kann die Fragen nicht äußern, weil ich zu viel Angst vor den Antworten habe.
Meine Mutter schüttelt ein weißes Laken – es bauscht sich leicht, wie eine Wolke – und bückt sich dann, um es auf dem Boden auszubreiten. »Schau mir in die Augen, Z«, sagt sie und macht dabei ein so sorgenvolles Gesicht, dass ich sie kaum wiedererkenne. »Du musst dich so schnell wie möglich anziehen. Und dann legst du deine Sachen auf dieses Laken hier und wickelst sie fest darin ein. Okay? Deine Schwester hilft dir dabei.« Sie geht zur Tür. »Yalla, Z, yalla. Mach schnell.«
»Warte«, sage ich. Es ist das erste Wort, das ich herausbringe, seit ich unter meiner He-Man-Decke hervorgekrochen bin.
»Was soll ich in das Laken legen? Was für … Sachen?«
Ich bin ein braver Junge. Schüchtern. Folgsam. Ich will tun, was meine Mutter mir sagt.
Sie bleibt stehen und sieht mich an. »So viel hineinpasst«, sagt sie. »Ich weiß nicht, ob wir zurückkommen.«
Sie dreht sich um und ist weg.
Sobald wir gepackt haben, trotten meine Schwester, mein Bruder und ich hinunter ins Wohnzimmer. Meine Mutter hat den Cousin meines Vaters in Brooklyn angerufen – wir nennen ihn Onkel Ibrahim oder einfach nur Ammu – und telefoniert jetzt aufgeregt mit ihm. Ihr Gesicht ist rot angelaufen. Sie hält den Hörer fest in der linken Hand und zupft mit der rechten nervös ihren Hidschab zurecht, weil er sich am Ohr gelockert hat. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Eilmeldung. Wir unterbrechen unser Programm. Als meine Mutter bemerkt, dass wir hinsehen, schaltet sie schnell ab.
Sie spricht noch eine Weile mit Ammu Ibrahim, mit dem Rücken zu uns. Als sie aufgelegt hat, klingelt das Telefon erneut. Es ist ein schrilles Geräusch mitten in der Nacht: viel zu laut, und als ob es etwas weiß.
Meine Mutter hebt den Hörer ab. Es ist einer von Babas Freunden aus der Moschee, ein Taxifahrer namens Mahmoud. Alle nennen ihn Red, Roter, wegen seiner Haare. Red will offenbar unbedingt mit meinem Vater sprechen. »Er ist nicht hier«, sagt meine Mutter. Dann lauscht sie eine Zeitlang in den Hörer. »Ist gut«, sagt sie endlich und legt auf.
Das Telefon klingelt erneut. Wieder dieses schreckliche Geräusch. Diesmal komme ich nicht dahinter, wer anruft. Meine Mutter sagt: »Wirklich?« Und: »Die Polizei hat euch Fragen gestellt? Über uns?«
Kurze Zeit später erwache ich auf einer Decke auf dem Wohnzimmerfußboden. Irgendwie bin ich mitten in diesem Durcheinander eingenickt. Alles, was wir tragen können – und noch mehr –, liegt auf einem Stapel neben der Tür, der gleich umzufallen droht. Meine Mutter geht herum und wirft immer wieder einen prüfenden Blick in ihre Handtasche. Sie hat von uns allen die Geburtsurkunden eingesteckt: um beweisen zu können, falls jemand danach fragt, dass sie unsere Mutter ist. Mein Vater, El-Sayyid Nosair, ist in Ägypten geboren, meine Mutter in Pittsburgh. Bevor sie dort in einer Moschee die Schahada aufsagte und Muslima wurde – und später den Namen Khadija Nosair annahm –, hieß sie Karen Mills.
»Dein Onkel Ibrahim kommt uns holen«, sagt sie zu mir, als sie sieht, dass ich mich aufsetze und mir die Augen reibe. Die Besorgnis in ihrer Stimme ist jetzt mit Ungeduld gefärbt. »Falls er jemals hier ankommt.«
Ich frage nicht, wohin wir fahren, und niemand sagt es mir. Wir warten einfach. Wir warten länger, als Ammu brauchen dürfte, um von Brooklyn hierher nach New Jersey zu fahren. Und je länger wir warten, desto ungeduldiger geht meine Mutter im Zimmer auf und ab und desto mehr habe ich das Gefühl, gleich zu explodieren. Meine Schwester legt den Arm um mich. Ich versuche tapfer zu sein und lege den Arm um meinen Bruder.
»Ya Allah!«, sagt meine Mutter. »Das macht mich wahnsinnig.«
Ich nicke, als könne ich sie gut verstehen.
Was meine Mutter uns verschweigt, ist Folgendes: Meir Kahane, ein militanter Rabbi und Gründer der Jewish Defense League, wurde nach einer Rede im Ballsaal eines Marriott Hotels in New York City von einem Araber erschossen. Der Attentäter konnte fliehen, schoss dabei aber einem älteren Mann ins Bein. Er warf sich in ein Taxi, das vor dem Hotel wartete, sprang jedoch wieder heraus und rannte mit der Waffe in der Hand die Straße hinunter. Ein Wachmann des U.S. Postal Service, der zufällig vorbeikam, lieferte sich einen Schusswechsel mit ihm. Der Attentäter brach auf der Straße zusammen. Die Nachrichtensprecher kamen nicht umhin, ein grausiges Detail zu erwähnen: Sowohl Rabbi Kahane als auch dem Attentäter wurde in den Hals geschossen. Keinem von beiden wurde eine Überlebenschance eingeräumt.
Jetzt bringen sämtliche Fernsehkanäle die Geschichte fortwährend auf den neuesten Stand. Vor einer Stunde, während meine Schwester, mein Bruder und ich die letzten Sekunden dessen verschliefen, was zumindest entfernt einer Kindheit gleichkam, horchte meine Mutter auf, als sie den Namen Meir Kahane hörte, und schaute in den Fernseher. Das Erste, was sie sah, war ein Beitrag über den arabischen Attentäter, bei dem ihr fast das Herz stehen blieb: Es war mein Vater.
Es ist ein Uhr früh, als Onkel Ibrahim endlich in die Auffahrt biegt. Er hat so lange gebraucht, weil seine Frau und die Kinder sich erst noch anziehen mussten. Er wollte unbedingt, dass sie ihn begleiten, weil er als frommer Moslem nicht allein mit einer Frau im Auto sitzen darf, die nicht seine eigene Frau ist – meine Mutter in anderen Worten. Es warten also schon fünf Personen im Auto. Und nun quetschen sich weitere vier irgendwie dazu. Ich merke meiner Mutter an, dass sie genervt ist: Sie ist genauso fromm wie mein Onkel, nur wozu so viel Zeit verschwenden, da doch ohnehin ihre Kinder mit im Wagen sitzen?
Bald fahren wir durch einen Tunnel, und das kränkliche Neonlicht rauscht über unsere Köpfe hinweg. Der Wagen platzt aus allen Nähten. Wir bilden ein gewaltiges Knäuel aus Armen und Beinen. Meine Mutter muss auf die Toilette. Onkel Ibrahim fragt, ob er irgendwo anhalten soll. Sie schüttelt den Kopf. »Lass uns die Kinder nach Brooklyn bringen«, sagt sie, »und dann zum Krankenhaus fahren. Okay? So schnell es geht. Yalla.«
Es ist das erste Mal, dass jemand das Wort Krankenhaus in den Mund nimmt. Mein Vater liegt also im Krankenhaus. Weil er einen Unfall hatte. Demnach ist er verletzt, aber nicht tot. Allmählich setzen sich die einzelnen Puzzleteile in meinem Kopf zusammen.
Als wir Brooklyn erreichen – Ammu Ibrahim lebt in einem großen Backsteinblock in der Nähe des Prospect Park –, fallen wir alle neun in einem verknäuelten Klumpen aus dem Wagen. In der Lobby dauert es eine Ewigkeit, bis der Aufzug kommt, also nimmt meine Mutter, die dringend auf die Toilette muss, mich an der Hand und zerrt mich zur Treppe.
Sie nimmt immer zwei Stufen auf einmal. Ich habe Mühe, mit ihr Schritt zu halten. Ich sehe undeutlich den ersten Stock, dann den zweiten. Ammu wohnt im dritten. Keuchend biegen wir in seinem Flur um die Ecke. Wir sind begeistert, dass wir es geschafft haben – wir haben den Aufzug besiegt! Und dann sehen wir drei Männer vor der Wohnung meines Onkels stehen. Zwei tragen dunkle Anzüge und gehen langsam auf uns zu, wobei sie ihre Abzeichen in die Höhe halten. Der dritte ist ein Polizeibeamter und hat die Hand an der Pistole im Halfter. Meine Mutter geht auf die drei zu. »Ich muss auf die Toilette«, sagt sie. »Sobald ich fertig bin, spreche ich mit Ihnen.«
Die Männer sehen verdutzt drein, aber sie lassen sie gehen. Erst als sie versucht, auch mich in die Toilette mitzunehmen, hebt einer der dunklen Anzüge die Hand wie ein Verkehrspolizist.
»Der Junge bleibt bei uns«, sagt er.
»Er ist mein Sohn«, sagt meine Mutter. »Er kommt mit mir.«
»Das können wir nicht erlauben«, sagt der zweite dunkle Anzug.
Meine Mutter ist verwirrt, aber nur für einen Moment: »Sie glauben, ich tue mir da drin etwas an? Sie glauben, ich tue meinem Sohn etwas an?«
Der erste Anzug sieht sie ausdruckslos an. »Der Junge bleibt hier«, sagt er. Er wendet sich mir zu und ringt sich ein Lächeln ab. »Du bist« – er wirft einen Blick in seinen Block – »Abdulaziz?«
Ich nicke erschrocken, kann nicht mehr aufhören. »Z«, sage ich.
Ibrahims Familie kommt durch die Wohnungstür und unterbricht das unbehagliche Schweigen. Seine Frau scheucht uns Kinder in das einzige Schlafzimmer der Wohnung und befiehlt uns, zu schlafen. Wir sind zu sechst. Es gibt bunte Schlafkojen, die in die Wand eingebaut sind, wie man es in der Spieleecke bei McDonald’s erwarten würde. Wir legen uns in jede verfügbare Ritze und winden uns wie Würmer, während meine Mutter im Wohnzimmer mit der Polizei spricht. Ich strenge mich an, das Gespräch hinter der Wand zu belauschen. Doch ich vermag nur leises Gemurmel auszumachen und das Scharren von Stühlen auf dem Fußboden.
Im Wohnzimmer stellen die dunklen Anzüge so viele Fragen, dass sie wie Hagelkörner auf meine Mutter niederprasseln. Vor allem an zwei Fragen wird sie sich erinnern: Wie lautet Ihre derzeitige Adresse? Und: Wussten Sie, dass Ihr Mann heute Abend Rabbi Kahane erschießen würde?
Die Beantwortung der ersten Frage ist komplizierter als die der zweiten.
Baba arbeitet für die Stadt New York, er hält die Heizungs- und Klimaanlage in einem Justizgebäude in Manhattan in Schuss, und die Stadt verlangt von ihren Angestellten, dass sie in einem der fünf Stadtbezirke wohnen. Also geben wir vor, in der Wohnung meines Onkels zu leben. Nur wegen dieser kleinen Lüge in den Akten ist die Polizei heute hier aufgekreuzt.
Meine Mutter erklärt es den Polizisten. Und sie sagt ihnen die Wahrheit bezüglich des Anschlags: Sie hatte keine Ahnung. Sie hatte keine Silbe davon erfahren. Nichts. Gerede von Gewalt ist ihr ein Gräuel. Niemand in der Moschee würde es wagen, in ihrer Gegenwart Hetzreden zu halten.
Erhobenen Hauptes, die Hände reglos im Schoß, beantwortet sie einen weiteren Schwall Fragen. Doch unterdessen hämmert in ihrem Kopf immerzu derselbe Gedanke, wie eine Migräneattacke: Sie muss zu meinem Vater. Sie muss an seiner Seite sein.
Endlich platzt meine Mutter heraus: »Im Fernsehen hieß es, Sayyid liege im Sterben.«
Die dunklen Anzüge sehen einander an, doch sie antworten nicht.
»Ich will bei ihm sein. Ich will nicht, dass er allein stirbt.«
Noch immer keine Antwort.
»Bringen Sie mich zu ihm? Bitte? Bringen Sie mich zu ihm, bitte?«





























