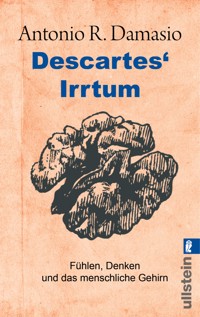14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Inwiefern hat der Frühaufklärer Spinoza mit seinen Ansätzen zur Ethik, Religion und Spiritualität die neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie vorgedacht? Wie kommt es, dass selbst rationale Entscheidungen nicht nur von unseren Gefühlen, sondern auch von körperlichen Empfindungen gesteuert werden? Welche Rolle spielen die »somatischen Marker« als körperliche Schaltstellen zwischen Gefühl und Verstand? Und: Was haben Sozialverhalten und Ethik mit der Neurobiologie zu tun? Im Rückgriff auf Spinoza gelingt Antonio R. Damasio eine faszinierende Zusammenschau von Neurobiologie und Philosophie, mittels derer er neueste wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur mit der Dialektik von Denken, Fühlen und körperlichen Empfindungen, sondern auch mit Spiritualität in Verbindung bringt. Der Spinoza-Effekt ist zudem ein Appell an uns, unseren emotionalen Instinkten und körperlichen Signalen auch in scheinbar vom Verstand gesteuerten Situationen zu vertrauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Inwiefern hat der Frühaufklärer Spinoza mit seinen Ansätzen zur Ethik, Religion und Spiritualität die neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie vorgedacht? Wie kommt es, dass selbst rationale Entscheidungen nicht nur von unseren Gefühlen, sondern auch von körperlichen Empfindungen gesteuert werden? Welche Rolle spielen die »somatischen Marker« als körperliche Schaltstellen zwischen Gefühl und Verstand? Und: Was haben Sozialverhalten und Ethik mit der Neurobiologie zu tun? Im Rückgriff auf Spinoza gelingt Antonio R. Damasio eine faszinierende Zusammenschau von Neurobiologie und Philosophie, mittels derer er neueste wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur mit der Dialektik von Denken, Fühlen und körperlichen Empfindungen, sondern auch mit Spiritualität in Verbindung bringt. Der Spinoza-Effekt ist zudem ein Appell an uns, unseren emotionalen Instinkten und körperlichen Signalen auch in scheinbar vom Verstand gesteuerten Situationen zu vertrauen.
Der Autor
Antonio R. Damasio ist David Dornsife, Professor für Neurowissenschaften, Neurologie und Psychologie und Direktor am Brain und Creativity Institute an der University of Southern California. Er ist außerdem außerordentlicher Professor am Salk Institute und an der University of Iowa. Er wurde vielfach (oft gemeinsam mit seiner Frau, der Neurologin und Neurowissenschaftlerin Hanna Damasio) für sein Werk ausgezeichnet, zuletzt mit dem Price of Austrias Prize für Wissenschaft und Technologie. Damasio ist Mitglied des Institute of Medicine of the National Academy of Sciences und der American Academy of Arts and Science. Seine Bücher wurden in über dreißig Sprachen übersetzt.
Von Antonio R. Damasio sind in unserem Hause außerdem erschienen:
Descartes’ Irrtum
Ich fühle, also bin ich
Antonio R. Damasio
Der Spinoza-Effekt
Wie Gefühle unser Leben bestimmen
Aus dem Englischen von Hainer Kober
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-96048-051-8
Neuausgabe bei Refinery Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch © für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005 © 2003 by Antonio R. Damasio. Titel der amerikanischen Originalausgabe: Looking for Spinoza. Joy, Sorrow and the Feeling Brain (Harcourt, Inc.) Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: FinePic®, München
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Für Hanna
Inhalt
KAPITEL EINS
Auftritt der Gefühle
Den Haag
Auf der Suche nach Spinoza
Vorsicht!
In der Paviljoensgracht
KAPITEL ZWEI
Von Trieben und Emotionen
Auf Shakespeare ist immer Verlass
Emotionen gehen Gefühlen voraus
Das Prinzip der Verschachtelung
Mehr über Reaktionen im Zusammenhang mit Emotionen: Von der einfachen homöostatischen Steuerung zu den eigentlichen Emotionen
Die Emotionen einfacher Organismen
Die eigentlichen Emotionen
Die eigentlichen Emotionen: eine Hypothese in Form einer Definition
Die Hirnmechanismen der Emotion
Emotionen auslösen und ausführen
Aus heiterem Himmel
Ein Schalter im Hirnstamm
Grundloses Lachen
Lachen und noch ein bisschen Weinen
Vom aktiven Körper zum Geist
KAPITEL DREI
Gefühle
Was Gefühle sind
Sind Gefühle mehr als nur die Wahrnehmung von Körperzuständen?
Gefühle sind interaktive Wahrnehmungen
Vermischung von Gedächtnis und Begierde: ein Exkurs
Gefühle im Gehirn: neue Anhaltspunkte
Einige Anmerkungen zu ähnlichen Forschungsergebnissen
Weitere empirische Beweise
Das Substrat der Gefühle
Wer ist zu Gefühlen fähig?
Der Unterschied zwischen Körperzuständen und Körperkartierungen
Reale und simulierte Körperzustände
Natürliche Schmerzlinderung
Empathie
Den Körper halluzinieren
Die Chemie der Gefühle
Die Vielfalt drogeninduzierten Glücks
Auftritt der Skeptiker
Noch mehr Skeptiker
KAPITEL VIER
Seit es Gefühle gibt
Von Freude und Traurigkeit
Gefühle und soziales Verhalten
Im Inneren eines Entscheidungsmechanismus
Was der Mechanismus leistet
Der Ausfall eines normalen Mechanismus
Schädigung des präfrontalen Kortex in sehr jungen Jahren
Was, wenn die Welt …
Neurobiologie und ethisches Verhalten
Homöostase und die Kontrolle des sozialen Lebens
Die Grundlage von Tugend
Wozu dienen Gefühle?
KAPITEL FÜNF
Körper, Gehirn und Geist
Körper und Geist
Den Haag, 2. Dezember 1999
Der unsichtbare Körper
Den Körper verlieren und den Geist verlieren
Die Konstruktion von Körperbildern
Eine Erläuterung
Die Konstruktion der Wirklichkeit
Dinge sehen
Erläuterungen zu den Ursprüngen des Geistes
Körper, Geist und Spinoza
Zum guten Schluss: Dr. Tulp
KAPITEL SECHS
Ein Besuch bei Spinoza
Rijnsburg, 6. Juli 2000
Das Zeitalter
Den Haag, 1670
Amsterdam, 1632
Ideen und Ereignisse
Die Uriel-da-Costa-Affäre
Judenverfolgung und Marrano-Tradition
Exkommunikation
Das Vermächtnis
Jenseits der Aufklärung
Den Haag, 1677
Die Bücherei
Eine fiktive Begegnung mit Spinoza
KAPITEL SIEBEN
Wer da?
Das zufriedene Leben
Spinozas Lösung
Ist Spinozas Lösung brauchbar?
Spinozismus
Happyends?
ANHANG
Vor, während und nach Spinozas Zeit
Die Anatomie des Gehirns
Anmerkungen
Danksagung
Bildnachweis
KAPITEL EINS
Auftritt der Gefühle
Gefühle von Schmerz, Lust und jede Empfindung dazwischen bilden das Grundgefüge unseres Geistes. Häufig übersehen wir diese schlichte Tatsache, weil die Bilder der uns umgebenden Objekte und Ereignisse zusammen mit den Vorstellungen der Wörter und Sätze, die ihrer Beschreibung dienen, einen Großteil unserer überlasteten Aufmerksamkeit beanspruchen. Doch sie sind nicht wegzuleugnen, die unzähligen Emotionen und verwandten Zustände, die ununterbrochene Tonfolge unseres Geistes, das unaufhörliche Summen der allgegenwärtigen Melodien, die erst verklingen, wenn wir einschlafen, ein Summen, das zu einem jubelnden Gesang anschwillt, wenn uns Freude erfasst, oder zu einem düsteren Requiem herabgestimmt wird, wenn wir in Trauer versinken.1
Angesichts der Allgegenwart von Gefühlen sollte man meinen, dass sie schon vor langer Zeit wissenschaftlich untersucht worden sind – was sie eigentlich sind, wie sie funktionieren, was sie bedeuten –, doch davon kann kaum die Rede sein. Von allen beschreibbaren geistigen Phänomenen entziehen sich Gefühle und ihre wichtigsten Varianten – Schmerz und Lust – bislang dem Verständnis der Biologie und speziell der Neurobiologie am hartnäckigsten. Das ist umso überraschender, als hochentwickelte Gesellschaften einen schamlosen Kult mit Gefühlen treiben und sie mit viel Aufwand und großen Mühen manipulieren – mit Alkohol, Drogen, Medikamenten, Nahrung, realer Sexualität, virtueller Sexualität, einer Fülle von Konsumformen, sozialen und religiösen Praktiken, die Wohlgefühl hervorrufen sollen. Wir verarzten unsere Gefühle mit Pillen, Getränken, Kuraufenthalten, Fitnessprogrammen und spirituellen Übungen, doch weder Laien noch Wissenschaftler haben bisher erklären können, was genau Gefühle – biologisch betrachtet – eigentlich sind.
Dieser Stand der Dinge überrascht mich eigentlich nicht, wenn ich mich daran erinnere, mit welchen Meinungen über Gefühle ich aufgewachsen bin. Die meisten waren einfach falsch. Beispielsweise dachte ich, Gefühle ließen sich auf keinen Fall so exakt definieren wie Dinge, die man sehen, hören oder anfassen kann. Im Gegensatz zu diesen konkreten Objekten seien Gefühle nicht greifbar und immateriell. Als ich anfing, mir Gedanken darüber zu machen, wie es dem Gehirn gelingt, den Geist zu erzeugen, übernahm ich kritiklos die herrschende Auffassung, nach der Gefühle jenseits jeder wissenschaftlichen Analyse liegen. Man konnte untersuchen, wie das Gehirn uns dazu bringt, uns zu bewegen. Man konnte sensorische Prozesse – visuelle oder andere – untersuchen und man konnte untersuchen, wie das Gehirn Gedanken zusammenfügt. Man konnte untersuchen, wie das Gehirn lernt und sich erinnert. Man konnte sogar die emotionalen Reaktionen untersuchen, mit denen wir auf verschiedene Objekte und Ereignisse reagieren. Aber Gefühle – die von Emotionen zu unterscheiden sind, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden – entzogen sich dem Zugriff wissenschaftlicher Untersuchungen. Gefühle galten als ewiges Geheimnis. Sie waren privat und unzugänglich. Es ließ sich einfach nicht erklären, wie Gefühle passieren oder wo sie passieren. Mit einem Wort, man kam einfach nicht »hinter« die Gefühle.
Wie das Bewusstsein, so lagen auch die Gefühle jenseits der Grenzen der Wissenschaft – verbannt nicht nur von den Skeptikern, die befürchteten, irgendwelche geistigen Phänomene könnten doch von den Neurowissenschaften erklärt werden, sondern auch von ausgewiesenen Neurowissenschaftlern selbst, die angeblich unüberwindliche Schwierigkeiten als Begründung aufführten. Meine eigene Bereitschaft, diese Auffassung zu übernehmen, wird durch die vielen Jahre dokumentiert, die ich damit zubrachte, alles Mögliche zu untersuchen, nur keine Gefühle. Ich brauchte einige Zeit, um zu erkennen, wie haltlos dieses Verdikt war und dass eine Neurobiologie der Gefühle nicht unrealistischer war als die Neurobiologie des Sehens oder des Gedächtnisses. Doch es gelang mir schließlich in erster Linie deshalb, weil ich mich mit der Realität neurologischer Patienten konfrontiert sah, deren Symptome mich buchstäblich dazu zwangen, ihren Zustand zu untersuchen.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie begegnen einem Menschen, der nach einer Schädigung bestimmter Regionen des Gehirns nicht mehr in der Lage ist, Mitgefühl oder Verlegenheit zu empfinden – in Situationen, in denen Mitgefühl oder Verlegenheit angebracht wären –, der aber noch genauso wie vor seiner Erkrankung glücklich, traurig oder ängstlich sein kann. Würde Sie das nicht nachdenklich machen? Oder nehmen Sie einen Menschen, dem infolge einer Schädigung einer anderen Stelle seines Gehirns die Fähigkeit verloren geht, Furcht zu empfinden, wenn er es müsste, der aber trotzdem noch in der Lage ist, mitleidig zu reagieren. Die Grausamkeit neurologischer Erkrankung mag ein bodenloser Abgrund für die Betroffenen sein – die Patienten und diejenigen von uns, die das Leid mit ansehen müssen. Doch das Skalpell der Krankheit ist auch für das einzige versöhnlich stimmende Merkmal verantwortlich: Dadurch, dass die neurologische Erkrankung die normalen Funktionen des menschlichen Gehirns wegschneidet – häufig mit geradezu unheimlicher Genauigkeit –, verschafft sie uns einen einzigartigen Zugang zur Festung des menschlichen Gehirns und Geistes.
Überlegungen zur Situation dieser Patienten und anderer Menschen mit vergleichbaren Leiden warfen faszinierende Hypothesen auf. Erstens, einzelne Gefühle können durch die Schädigung einer bestimmten Gehirnregion verhindert werden; der Verlust eines bestimmten Abschnitts der Schaltkreise im Gehirn bewirkt den Fortfall von spezifischen geistigen Ereignissen. Zweitens schien klar zu sein, dass unterschiedliche Gehirnsysteme ganz verschiedene Gefühle steuern; die Schädigung eines Hirnareals führt nicht dazu, dass alle Gefühle auf einmal wegfallen. Drittens, und das war am überraschendsten, wenn Patienten die Fähigkeit verlieren, eine bestimmte Emotion zu zeigen, verlieren sie auch die Fähigkeit, das entsprechende Gefühl zu erleben. Doch der Umkehrschluss stimmte nicht: Einige Patienten, die ihre Fähigkeit, bestimmte Gefühle zu empfinden, verloren hatten, konnten durchaus noch die entsprechenden Emotionen zeigen. War es also denkbar, dass Emotion und Gefühl zwar Zwillinge sind, die Emotion aber vor dem Gefühl da ist, sodass Letzteres Ersterem immer wie ein Schatten folgen muss? Trotz der engen Verwandtschaft und scheinbaren Gleichzeitigkeit hatte es den Anschein, als gehe die Emotion dem Gefühl voraus. Die Kenntnis dieser besonderen Beziehung öffnete, wie wir noch sehen werden, ein Fenster zur Untersuchung der Gefühle.
Solche Hypothesen ließen sich mit Hilfe von Neuroimaging-Verfahren testen, sodass wir die Anatomie und die Aktivität des menschlichen Gehirns darstellen konnten. Schritt für Schritt, zunächst bei Patienten und dann bei Menschen ohne neurologische Erkrankungen, kartographierten meine Kollegen und ich die Geographie des fühlenden Gehirns. Unser Ziel war es, das Netzwerk der Mechanismen zu erhellen, das unseren Gedanken ermöglicht, emotionale Zustände auszulösen und Gefühle hervorzurufen.2
Emotion und Gefühl spielten eine wichtige, aber ganz andere Rolle in zwei meiner vorangehenden Bücher. Descartes’ Irrtum beschäftigte sich mit der Rolle von Emotion und Gefühl bei der Entscheidungsfindung. Ich fühle, also bin ich skizzierte die Rolle von Emotion und Gefühl bei der Konstruktion des Selbst. Im vorliegenden Buch geht es jedoch um die Gefühle selbst – was sie sind und was sie bewirken. Die meisten Untersuchungsdaten, die ich heranziehe, standen noch nicht zur Verfügung, als ich die vorhergehenden Bücher schrieb. Wir verfügen heute über eine solidere Basis zum Verständnis von Gefühlen. Daher handelt es sich bei diesem Buch in erster Linie um einen Zwischenbericht über die Fortschritte der Forschung – über das Wesen der Gefühle und ihre Bedeutung für das menschliche Leben, so wie ich sie als Neurologe, Neurowissenschaftler und regelmäßiger »Benutzer« sehe.
Im Wesentlichen bin ich gegenwärtig der Auffassung, dass Gefühle ein Ausdruck menschlichen Wohlbefindens und menschlichen Elends sind, so, wie sie in Geist und Körper auftreten. Gefühle sind nicht einfach bloßer Zierrat, der Emotionen begleitet und auf den man auch verzichten könnte, sondern häufig Enthüllungen einer Verfassung, die den ganzen Organismus betrifft – buchstäblich ein Heben des Schleiers. Da das Leben ein Drahtseilakt ist, bringen die meisten Gefühle das Bemühen um Gleichgewicht zum Ausdruck, geistige Entwürfe für jene feinen Anpassungen und Korrekturen, ohne die – ein Fehler zu viel – der ganze Akt im Sturz endet. Wenn irgendetwas an uns von der Gleichzeitigkeit unserer Kleinheit und Größe zeugt, dann sind es die Gefühle.
Wie diese Enthüllung ins Bewusstsein tritt, wird seinerseits gerade enthüllt. Das Gehirn verwendet eine Anzahl spezifischer Regionen, die in ihrem Zusammenspiel unzählige Aspekte der Aktivitäten unseres Körpers in Form von neuronalen Karten abbilden. Diese Abbildung setzt sich aus vielen Facetten zusammen und stellt den immer währenden Wandel unseres Lebens dar. Die chemischen und neuronalen Kanäle, die die Signale ins Gehirn transportieren, mit denen sich dieses Porträt des Lebens zeichnen lässt, sind ebenso komplex wie die Leinwand, die sie aufnimmt. Das Geheimnis unserer Gefühle hat heute ein wenig von seinem Geheimnis eingebüßt.
Mit gutem Recht lässt sich fragen, ob der Versuch, die Gefühle zu verstehen, mehr verspricht als die Befriedigung der eigenen Neugier. Davon bin ich aus verschiedenen Gründen überzeugt. Die Neurobiologie der Gefühle und der ihnen vorausgehenden Emotionen ist entscheidend für unsere Auffassung vom Leib-Seele-Problem, einem Problem von zentraler Bedeutung für unser Verständnis dessen, was wir sind. Emotionen und alle ihnen verwandte Reaktionen sind dem Körper zugeordnet, Gefühle jedoch dem Geist. Die Untersuchung der Frage, wie Gedanken Emotionen erzeugen und wie körperliche Emotionen zu jenen Gedanken werden, die wir Gefühle nennen, ermöglicht uns einen einzigartigen Einblick in Körper und Geist, diese beiden so offenkundig disparaten Manifestationen eines einzigen und unauflöslich zusammenhängenden menschlichen Organismus.
Doch diese Bemühungen haben auch einen praktischen Nutzen. Wenn wir die Biologie der Gefühle und ihrer eng verwandten Emotionen erklären, tragen wir wahrscheinlich wesentlich zur effektiven Behandlung einiger der wichtigsten Ursachen menschlichen Leidens bei – unter anderem der Depression, der Schmerzen und der Drogenabhängigkeit. Im Übrigen ist das Verständnis der Gefühle, ihrer Funktion und ihrer Bedeutung eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen Entwurf eines Menschenbildes, das genauer ist als die gegenwärtige Auffassung und das die Fortschritte in den Sozialwissenschaften, der Kognitionswissenschaft und der Biologie berücksichtigt. Warum wäre ein solcher Entwurf von praktischem Nutzen? Weil Erfolg und Versagen der Menschheit in hohem Maße davon abhängen, inwieweit sich die Öffentlichkeit und die Institutionen, die die Geschicke des öffentlichen Lebens lenken, dieses revidierte Menschenbild theoretisch und praktisch zueigen machen. Wenn wir die Neurobiologie der Emotionen und Gefühle verstehen, sind wir wahrscheinlich viel besser in der Lage, Grundsätze und politische Ziele zu formulieren, die menschliches Leid lindern und die Entfaltung menschlicher Möglichkeiten fördern. Sogar die Art und Weise, wie Menschen mit den ungelösten Spannungen zwischen einer transzendenten und einer weltlichen Interpretation ihrer Existenz umgehen, könnte dem Einfluss des neuen Wissens unterliegen.
Nachdem ich meine wichtigsten Ziele erläutert habe, sollte ich wohl erklären, warum ich mich im Titel eines Buches über neue Erkenntnisse zur Natur und Bedeutung menschlicher Gefühle ausgerechnet auf Spinoza berufe. Da ich kein Philosoph bin und dieses Buch nicht von Spinozas Philosophie handelt, stellt sich die Frage: Warum Spinoza? Die kurze Erklärung lautet, dass Spinoza von grundlegender Bedeutung für jede Betrachtung menschlicher Emotionen und Gefühle ist. Spinoza verstand Triebe, Motivationen, Emotionen und Gefühle – eine Gesamtheit, die er Affekte nannte – als einen zentralen Aspekt der menschlichen Natur. Freude und Traurigkeit waren zwei wichtige Konzepte seines Versuchs, den Menschen zu verstehen und Vorschläge zu machen, wie er sein Leben besser gestalten kann.
Die lange Erklärung ist viel persönlicher:
Den Haag
1. Dezember 1999. Der freundliche Portier des Hotel des Indes ermahnt mich nachdrücklich: »Sie sollten bei diesem Wetter nicht zu Fuß gehen, Sir. Lassen Sie mich ein Taxi rufen. Der Wind ist stürmisch, fast ein Orkan, Sir. Schauen Sie sich die Fahnen an.« Tatsächlich, die Fahnen stehen senkrecht von den Masten ab, und die Wolken jagen nach Osten. Den Haags Botschaftsviertel scheint abheben zu wollen. Trotzdem lehne ich sein Angebot ab. Ich gehe lieber zu Fuß, sage ich. Es wird schon nichts passieren. Und sieht der Himmel zwischen den Wolken nicht schön aus? Mein Portier hat keine Ahnung, wohin ich gehe, und ich werde es ihm auch nicht sagen. Was hätte er wohl gedacht?
Der Regen hat fast aufgehört, und mit einer gewissen Entschlossenheit kann man dem Wind leicht die Stirn bieten. Tatsächlich komme ich rasch voran und folge der mentalen Karte, die ich von den Örtlichkeiten habe. Am Ende der Promenade vor dem Hotel des Indes nach rechts. Zu meiner Rechten sehe ich das Grafenschloss und das Mauritshuis, das mit Plakaten von Rembrandts Gesicht geschmückt ist – sie zeigen eine Ausstellung seiner Selbstporträts. Hinter dem Museumsplatz sind die Straßen fast ausgestorben, obwohl ich mitten im Stadtzentrum bin und es ein regulärer Arbeitstag ist. Offenbar ist die Bevölkerung gewarnt worden, lieber zu Hause zu bleiben. Umso besser. Ich erreiche die Spui, ohne mich durch eine Menschenmenge drängen zu müssen. Als ich zur Nieuwen Kerk komme, bin ich mir unsicher und zögere eine Sekunde, doch die Entscheidung ist klar: Ich wende mich nach rechts in die Jacobstraat, dann nach links in die Wagenstraat, dann wieder nach rechts in die Stilleverkade. Fünf Minuten später stehe ich in der Paviljoensgracht vor dem Haus Nummer 72–74.
Die Fassade sieht genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe, ein kleines Gebäude mit zwei Stockwerken und je drei Fenstern, das übliche Grachtenhaus, eher bescheiden als wohlhabend. Es ist gut erhalten und dürfte im 17. Jahrhundert nicht wesentlich anders ausgesehen haben. Alle Fenster sind geschlossen, und auch sonst ist kein Anzeichen von Leben zu entdecken. Neben der Haustür, die gut in Schuss und frisch gestrichen ist, hängt eine glänzende Messingglocke. Daneben ist das Wort »Spinozahuis« eingraviert. Entschlossen, aber ohne große Hoffnung drücke ich auf den Knopf. Drinnen rührt sich nichts, kein Vorhang bewegt sich. Als ich vorhin angerufen habe, hat sich niemand gemeldet. Spinoza ist für den Publikumsverkehr geschlossen.
In diesem Haus hat Spinoza die letzten sieben Jahre seines kurzen Lebens verbracht, und hier ist er auch 1677 gestorben. Das Theologisch-politische Traktat hat er bei seinem Einzug mitgebracht und von hier aus anonym veröffentlicht. Die Ethik wurde hier abgeschlossen und nach seinem Tode, fast genauso anonym, publiziert.
Ich habe keine Hoffnung, dass ich das Haus heute noch besichtigen kann, doch ganz vergeblich war mein Kommen nicht. Auf dem bewachsenen Mittelstück, das die beiden Fahrbahnen der Straße voneinander trennt, ein Park mitten in der Stadt, den man hier nicht erwarten würde, entdecke ich Spinoza persönlich. Halbverdeckt vom windgepeitschten Laub sitzt er ruhig und nachdenklich in unerschütterlicher, bronzener Ewigkeit. Er wirkt zufrieden und vollkommen unbeeindruckt von den Turbulenzen des Wetters, was nicht weiter verwunderlich ist, hat er doch zu seiner Zeit weit größere Gewalten überlebt.
Seit einigen Jahren bin ich nun schon auf der Suche nach Spinoza, manchmal in Büchern, manchmal in Städten. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ein merkwürdiger Zeitvertreib, wie Sie sehen, ein Zeitvertreib, dem ich eigentlich nie nachgehen wollte. Dass es doch dazu gekommen ist, ist im Wesentlichen dem Zufall zu verdanken. Zum ersten Mal habe ich Spinoza als Jugendlicher gelesen – es gibt kein geeigneteres Alter, um Spinozas Ideen über Religion und Politik zu lesen –, doch ich muss ehrlich zugeben, dass einige dieser Ideen zwar einen bleibenden Eindruck hinterließen, dass aber die Verehrung, die ich für Spinoza entwickelte, eher abstrakt blieb. Er faszinierte mich und erschien mir zugleich bedrohlich. Später hatte ich nie den Eindruck, dass Spinoza besonders wichtig für meine Arbeit sei, und so blieb meine Bekanntschaft mit seinen Ideen eher flüchtig. Und doch gab es ein Zitat von ihm, das ich seit langem sehr schätzte – es stammte aus der Ethik und betraf den Begriff des Selbst. Als ich es eines Tages zitieren wollte und es daher auf seine Genauigkeit und seinen Zusammenhang überprüfen musste, trat Spinoza wieder in mein Leben. Ja, ich fand das Zitat, und es entsprach wirklich dem auf dem vergilbten Papier, das ich einst an die Wand geheftet hatte, doch dann begann ich von der Stelle, an der ich gelandet war, vorwärts und rückwärts zu lesen und konnte einfach nicht mehr aufhören. Spinoza war noch derselbe wie einst, aber ich hatte mich verändert. Vieles von dem, was mir einst unverständlich erschien, kam mir jetzt vertraut, seltsam vertraut vor, und durchaus von Belang für verschiedene Aspekte meiner derzeitigen Arbeit. Nicht mit allem, was Spinoza geschrieben hatte, war ich einverstanden. Zum einen blieben einige Abschnitte nach wie vor unklar, zum anderen entdeckte ich zwischen einzelnen Ideen Konflikte und Widersprüche, die sich auch nach mehrmaligem Lesen nicht auflösen wollten. Ich war verwirrt und sogar erbost. Meist jedoch befand ich mich in angenehmem Einklang mit den Ideen, ein wenig wie der Held in Bernard Malamuds Der Fixer, der nach ein paar Seiten Spinoza weiterliest, als würde er von einem Hurrikan getrieben: »… Ich habe nicht jedes Wort verstanden, aber wenn man sich mit solchen Gedanken beschäftigt, hat man das Gefühl, eine Hexenjagd mitzumachen.«3 Spinoza untersuchte genau die Themen, die auch mich als Wissenschaftler am meisten beschäftigten – das Wesen von Emotionen und Gefühlen und die Beziehung zwischen Geist und Körper – Themen, die in der Vergangenheit schon viele andere Denker beschäftigt haben. Meiner Ansicht nach scheint Spinoza jedoch Lösungen vorgezeichnet zu haben, die auch heute von der modernen Forschung für viele dieser Probleme vorgeschlagen werden. Das überraschte mich.
Wenn Spinoza beispielsweise sagt: »Liebe ist nichts anderes als Freude, begleitet von der Idee einer äußeren Ursache«, dann unterscheidet er mit großer Klarheit zwischen dem Prozess des Fühlens und dem Prozess, sich eine Vorstellung von einem Objekt zu machen, das eine solche Emotion verursacht.4 Freude ist eine Sache, eine andere das Objekt, das die Freude verursacht. Am Ende kommen Freude oder Traurigkeit sowie die Vorstellung von den Objekten, die beide verursachen, im Geist zusammen, doch anfänglich sind sie gesonderte Prozesse unseres Organismus. Spinoza hat eine funktionelle Organisation entworfen, welche die moderne Wissenschaft heute empirisch bestätigt: Lebende Organismen sind mit der Fähigkeit ausgestattet, auf verschiedene Dinge und Ereignisse emotional zu reagieren. Auf diese Reaktion folgt ein Gefühlsmuster mit einer spezifischen Ausprägung von Lust oder Schmerz.
Nach einer weiteren These von Spinoza ist die Macht der Affekte so groß, dass die einzige Hoffnung, einen nachteiligen Affekt – eine irrationale Leidenschaft – zu überwinden, darin besteht, ihn durch einen stärkeren positiven Affekt, der von der Vernunft ausgelöst wird, zu überwältigen. »Ein Affekt kann nur gehemmt oder aufgehoben werden durch einen Affekt, der entgegengesetzt und der stärker ist als der zu hemmende Affekt.«5 Spinoza empfiehlt mit anderen Worten, eine negative Emotion mit einer noch stärkeren, aber positiven Emotion zu bekämpfen, die durch Vernunft und intellektuelles Bemühen erzeugt wird. Von zentraler Bedeutung für diese Auffassung ist die Annahme, dass wir die Leidenschaften mit Hilfe einer von der Vernunft ausgelösten Emotion und nicht durch die Vernunft allein überwinden müssen. Das ist keinesfalls leicht zu bewerkstelligen, aber Spinoza hielt auch nichts von leichten Vorhaben.
Von großer Bedeutung für die Fragen, mit denen wir uns hier befassen werden, ist Spinozas Auffassung, dass Geist und Körper parallele Merkmale (man könnte auch Manifestationen sagen) derselben Substanz sind.6 Durch die Weigerung, Geist und Körper verschiedenen Substanzen zuzuschreiben, bekundete Spinoza zumindest, dass er sich von der damals herrschenden Auffassung des Geist-Körper-Problems distanzierte. Seine Meinung war eine Insel des Widerspruchs in einem Meer der Konformität. Noch faszinierender ist jedoch die folgende These: »Der Gegenstand der Idee, die den menschlichen Geist ausmacht, ist der Körper.«7 Dieser Gedanke wirft eine interessante Möglichkeit auf. Spinoza hat vielleicht geahnt, welche Prinzipien den natürlichen Mechanismen zugrunde liegen, die für die parallelen Manifestationen von Geist und Körper verantwortlich sind. Wie ich später darlegen werde, bin ich davon überzeugt, dass mentale Prozesse auf den Abbildungen des Körpers im Gehirn beruhen. Diese Ansammlungen neuronaler Muster bilden Reaktionen auf Ereignisse ab, die Emotionen und Gefühle hervorrufen. Nichts konnte mich mehr beruhigen, als auf diese Äußerung von Spinoza zu stoßen und über ihre mögliche Bedeutung nachzudenken.
Das allein wäre schon mehr als genug gewesen, um mich auf Spinoza neugierig zu machen, doch es gab noch andere Aspekte, die mein Interesse weckten. Laut Spinoza streben Organismen natürlich und notwendig danach, ihre Existenz fortzusetzen: Dieses notwendige Bestreben macht ihr eigentliches Wesen aus. Organismen kommen mit der Fähigkeit auf die Welt, ihr Leben zu steuern und auf diese Weise ihr Überleben zu sichern. Ebenso natürlich ist das Bemühen von Lebewesen, eine »größere Vollkommenheit« ihrer Funktionsfähigkeit zu erreichen, einen Zustand, den Spinoza mit Freude gleichsetzt. Alle diese Bestrebungen und Tendenzen geschehen unbewusst.
Nach diesen unsentimentalen und ungeschminkten Sätzen zu urteilen, scheint Spinoza eine Architektur der Lebenssteuerung vorgeschwebt zu haben, die zwei Jahrhunderte später von William James, Claude Bernard und Sigmund Freud aufgegriffen werden sollte. Da Spinoza keinen absichtsvollen Plan in der Natur erkennt und Körper und Geist für ihn aus Elementen bestehen, die in Organismen verschiedener Arten zu verschiedenen Mustern kombiniert auftreten, lassen sich seine Thesen durchaus mit Charles Darwins Evolutionstheorie vereinbaren.
Mit diesem revidierten Konzept der menschlichen Natur bewaffnet schickte Spinoza sich an, die Begriffe von Gut und Böse, Freiheit und Erlösung mit den Affekten und der Steuerung des Lebens zu verknüpfen. Spinoza ging davon aus, dass die Normen, die unser soziales und privates Verhalten bestimmen, geprägt sein müssen von einem tieferen Wissen um den Menschen, einem Wissen, das mit dem Gott oder der Natur in uns in Verbindung stehe.
Einige von Spinozas Ideen sind Bestandteil unserer Kultur, aber soweit ich weiß, beruft man sich bei den modernen Versuchen, die Biologie des Geistes zu verstehen, so gut wie nie auf Spinoza.8 Das ist an sich schon erstaunlich. Spinoza ist ein Philosoph, der zwar bekannt ist, den man aber nicht kennt. Gelegentlich hat es den Anschein, als sei Spinoza in seiner einsamen und unerklärlichen Pracht aus dem Nichts gekommen, doch der Eindruck täuscht – trotz aller Originalität ist er untrennbar mit den geistigen Strömungen seiner Zeit verbunden. Und er scheint genauso plötzlich wieder verschwunden zu sein, ohne Anhänger gefunden zu haben – ein Eindruck, der ebenso falsch ist, da wesentliche Ideen seiner verbotenen Schriften die Aufklärung beeinflusst haben und über sie hinaus bis in die Jahrhunderte nach seinem Tod hineinwirkten.9 Dass Spinoza eine solche unbekannte Berühmtheit ist, erklärt sich zum Teil aus dem Skandal, den er zu Lebzeiten verursachte. Wie wir sehen werden (Kapitel sechs), galten seine Ansichten als Ketzerei und waren jahrzehntelang verboten, mit dem Erfolg, dass sie, von seltenen Ausnahmen abgesehen, nur im Zusammenhang mit Angriffen auf sein Werk zitiert werden durften. Diese Angriffe lähmten die meisten Versuche, die Spinozas Anhänger unternahmen, um seine Ideen öffentlich zu diskutieren. Auf diese Weise wurde die natürliche Kontinuität der intellektuellen Anerkennung unterbrochen, die normalerweise dem Lebenswerk eines Denkers folgt. Zwar wurden einiger seiner Ideen aufgegriffen, ihren Schöpfer nannte man jedoch nicht. Aber damit kann man kaum erklären, warum Spinoza zwar an Ruhm gewann, aber weiterhin unbekannt blieb, als sich Männer wie Goethe und Wordsworth für ihn zu begeistern begannen. Eine bessere Erklärung ist vielleicht, dass es nicht leicht ist, Spinoza kennen zu lernen.
Die Schwierigkeiten beginnen damit, dass es mehrere Spinozas gibt, mit denen es Bekanntschaft zu schließen gilt, nach meiner Zählung mindestens vier. Der erste ist der zugängliche Spinoza, der radikale religiöse Gelehrte, der sich im Widerspruch zur Kirche seiner Zeit befindet, der einen neuen Gottesbegriff entwickelt und einen neuen Weg zur Erlösung des Menschen vorschlägt. Der nächste ist Spinoza, der politische Architekt, der Denker, der die Merkmale eines idealen demokratischen Staates beschreibt, in dem verantwortungsbewusste und glückliche Bürger leben. Der dritte Spinoza ist der schwierigste von allen, der Philosoph, der wissenschaftliche Fakten verwendet, eine Methode geometrischer Beweise und Begriffe, mit deren Hilfe er eine neue Auffassung vom Universum und den Menschen formuliert.
Der Blick auf diese drei Spinozas und ihr Beziehungsgeflecht genügt, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie kompliziert Spinoza sein kann. Doch es gibt noch einen vierten Spinoza: den ersten Biologen. Das ist der biologische Vordenker, der sich hinter zahllosen Lehrsätzen, Axiomen, Beweisen, Folgesätzen und Erläuterungen verbirgt. Angesichts der Tatsache, dass viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse über den Charakter von Emotionen und Gefühlen mit Thesen übereinstimmen, die Spinoza als Erster geäußert hat, ist die zweite Zielsetzung dieses Buches, die Verbindungen dieser am wenigsten bekannten Thesen Spinozas mit einigen der entsprechenden neurobiologischen Erkenntnissen unserer Zeit aufzuzeigen. Doch es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es in dem vorliegenden Buch nicht um Spinozas Philosophie geht. Ich befasse mich nicht mit Spinozas Denken, insoweit es über die Aspekte hinausgeht, die nach meinem Dafürhalten die Biologie betreffen. Mein Ziel ist bescheidener. Zu den Vorzügen der Philosophie gehört, dass sie im Laufe ihrer gesamten Geschichte die naturwissenschaftliche Forschung antizipiert hat. Umgekehrt tut die Naturwissenschaft meiner Meinung nach gut daran, diese historische Leistung anzuerkennen.
Auf der Suche nach Spinoza
Spinoza ist für die Neurobiologie von Bedeutung, obwohl seine Gedanken über den menschlichen Geist aus einem umfassenderen Interesse an den Bedingungen der menschlichen Existenz erwuchsen. Letztlich ging es Spinoza um die Beziehung des Menschen zur Natur. Er versuchte, diese Beziehung zu verstehen, damit er realistische Vorschläge zur Erlösung des Menschen unterbreiten konnte. Einige der vorgeschlagenen Maßnahmen sind individuell und liegen in der Verantwortung des Einzelnen, andere setzen voraus, dass bestimmte Formen sozialer und politischer Organisation dem Einzelnen zu Hilfe kommen. Spinozas Denken leitet sich von Aristoteles ab, hat aber, wie nicht anders zu erwarten, eine solidere biologische Basis. Lange vor John Stuart Mill scheint Spinoza von einer Beziehung zwischen persönlichem und kollektivem Glück einerseits und zwischen menschlicher Erlösung und der Beschaffenheit des Staates andererseits ausgegangen zu sein. Zumindest hinsichtlich der sozialen Konsequenzen seines Denkens scheint ihm eine beachtliche Anerkennung zuteil geworden zu sein.10
Spinoza empfahl einen idealen demokratischen Staat, dessen besondere Kennzeichen sind: Redefreiheit – in dem »jedem das Recht zugestanden wird, zu denken, was er will, und zu sagen, was er denkt«11 –, Trennung von Staat und Kirche und ein großzügiger Gesellschaftsvertrag, der das Wohl der Bürger und die Harmonie der Regierung fördert. Diese Empfehlung gab Spinoza mehr als hundert Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung und dem Ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Dass Spinoza im Zuge seiner revolutionären Überlegungen einige Aspekte der modernen Biologie vorwegnahm, ist besonders faszinierend.
Wer also war der Mann, der über Geist und Körper in einer Weise dachte, die dem Denken seiner Zeit nicht nur prinzipiell zuwiderlief, sondern sich mehr als dreihundert Jahre später auch als bemerkenswert aktuell erweisen sollte? Welche Umstände brachten einen solchen Widerspruchsgeist hervor? Wenn wir versuchen, diese Fragen zu beantworten, müssen wir noch einen weiteren Spinoza betrachten, den Mann hinter den drei verschiedenen Vornamen – Bento, Baruch, Benedictus –, einen Mann, der zugleich mutig und vorsichtig war, kompromisslos und unterwürfig, anmaßend und bescheiden, distanziert und freundlich, bewundernswert und anstößig, mit einem ausgeprägten Sinn für alles Beobachtbare und Konkrete und doch radikal spirituell. Nie offenbart er in seinen Schriften persönliche Gefühle, noch nicht einmal in seinem Stil, daher müssen wir uns aus tausend indirekten Anhaltspunkten ein Bild von ihm machen.
Fast ohne es zu merken, habe ich mich auf die Suche nach dem Menschen hinter der Fremdheit des Werkes gemacht. Ich wollte dem Mann einfach in meiner Phantasie begegnen, ein bisschen mit ihm plaudern und ihn um eine Widmung in meinem Exemplar der Ethik bitten. Der Bericht über meine Suche nach Spinoza und der Geschichte seines Lebens wurden so zum dritten Ziel dieses Buches.
1632 wurde Spinoza in der wohlhabenden Stadt Amsterdam geboren, buchstäblich mitten hinein in Hollands Goldenes Zeitalter. In demselben Jahr malte der dreiundzwanzigjährige Rembrandt van Rijn nur wenige Schritte von Spinozas Geburtshaus entfernt »Die Anatomie des Dr. Tulp«, das Werk, das seinen Ruhm begründete. Rembrandts Gönner Constantijn Huygens, Staatsmann und Dichter, Sekretär des Prinzen von Oranien und Freund von John Donne, war unlängst ein Sohn geboren worden, Christiaan Huygens, der einer der berühmtesten Astronomen und Physiker aller Zeiten werden sollte. Auch der zweiunddreißigjährige Descartes, der führende Philosoph seiner Zeit, lebte damals in Amsterdam, in der Prinzengracht, und fragte sich sorgenvoll, wie wohl seine neuen Ideen über die menschliche Natur in Holland und im Ausland aufgenommen werden würden. Schon bald sollte er den jungen Christiaan Huygens in Algebra unterrichten. Spinoza wurde in eine Welt von bestürzendem geistigen und finanziellen Reichtum hineingeboren, um Simon Schama, einen großen Kenner dieses Zeitalters, zu zitieren.12
Bento war der Name, den Spinoza bei seiner Geburt von seinen Eltern Miguel und Hana Debora erhielt, sephardischen Juden aus Portugal, die sich in Amsterdam niedergelassen hatten. Während er in der wohlhabenden Amsterdamer Gemeinde jüdischer Kaufleute und Gelehrter heranwuchs, hieß er in der Synagoge und bei Freunden Baruch. Den Namen Benedictus nahm er mit vierundzwanzig Jahren an, als er aus der Synagoge verbannt wurde. Spinoza gab die Bequemlichkeit des elterlichen Hauses in Amsterdam auf, um die stille und freiwillige Irrfahrt zu beginnen, deren letzte Station die Paviljoensgracht war. Der portugiesische Name Bento, der hebräische Name Baruch und der lateinische Name Benedictus bedeuten alle dasselbe: »Der Gesegnete«. Was bedeutet schon ein Name? Eine Menge, würde ich sagen. Oberflächlich betrachtet mögen alle drei Wörter die gleiche Bedeutung haben, doch hinter jedem steht ein anderer Begriff.
Vorsicht!
Ich muss in dieses Haus hinein, denke ich, doch im Augenblick ist die Tür geschlossen. So bleibt mir nur die Phantasie. Ich stelle mir jemanden vor, der aus einer vor dem Haus vertäuten Barkasse steigt (die Paviljoensgracht war damals eine breite Gracht, die später wie so viele Kanäle in Amsterdam und Venedig zugeschüttet und in eine Straße verwandelt wurde). Der wunderbare van der Spijk, Besitzer des Hauses und Maler, öffnet die Tür. Liebenswürdig führt er den Besucher in sein Atelier, das hinter zwei Fenstern neben der Haustür liegt, bittet um etwas Geduld und geht, um seinem Mieter Spinoza mitzuteilen, dass er Besuch bekommen hat.
Spinozas Zimmer liegen im zweiten Stock. Er kommt die Wendeltreppe hinunter, eine jener eng gewundenen, furchterregenden Treppen, für die die holländische Architektur berüchtigt ist. Spinoza trägt seine elegante Fidalgo-Tracht – weder neu noch abgetragen, gepflegt, ein weißer gestärkter Kragen, schwarze Kniehose, eine schwarze Lederweste, eine schwarze Kamelhaarjacke, die er gekonnt um die Schultern gelegt hat, glänzende schwarze Schuhe mit Silberschnallen und vielleicht einen Spazierstock aus Holz, um mehr Sicherheit auf der Treppe zu haben. Schwarze Lederschuhe sind ein Tick von Spinoza. Beherrscht wird seine Erscheinung von dem regelmäßigen und glatt rasierten Gesicht mit den schwarzen Augen, die groß sind und glänzen. Auch sein Haar und die langen Augenbrauen sind schwarz. Er hat einen olivfarbenen Teint, ist von mittlerer Statur und relativ zierlich.
Höflich, sogar freundlich, aber mit unmissverständlicher Direktheit wird der Besucher aufgefordert, ohne Umschweife den Grund seines Besuches zu nennen. Während seiner Bürostunden führt dieser hochherzige Lehrer Gespräche über Optik, Politik und Glaubensfragen. Man serviert Tee. Van der Spijk setzt die Arbeit an seinem Bild fort, meist schweigend, aber gelassen und voll demokratischer Würde. Von seinen sieben temperamentvollen Kindern, die sich in den hinteren Räumen des Hauses aufhalten, ist nichts zu hören. Frau van der Spijk näht. Die Magd ist in der Küche beschäftigt. Vermutlich sehen Sie das Bild vor sich.
Spinoza raucht seine Pfeife, deren Aroma sich mit dem Geruch des Terpentins vermischt, während man Fragen bedenkt, Antworten gibt und das Tageslicht schwindet.
Spinoza empfing zahllose Besucher – unter anderem Nachbarn, Verwandte der van der Spijks, eifrige junge Studenten und staunende junge Frauen, Gottfried Leibniz, Christiaan Huygens und Henry Oldenburg, den Präsidenten der neu geschaffenen Royal Society von Großbritannien. Nach seiner Korrespondenz zu urteilen, war er mit einfachen Menschen nachsichtiger als mit Kollegen. Offenbar konnte er bescheidene Narren ertragen, aber keine anmaßenden.
Ich vermag mir auch den Trauerzug am 25. Februar 1677 vorzustellen, einem grauen Tag wie diesem. Spinozas schlichtem Sarg folgen die Mitglieder der Familie van der Spijk und viele »illustre Männer, sechs Kutschen insgesamt«, ein Zug, der sich langsam zur Nieuwen Kerk bewegt, die nur wenige Minuten entfernt liegt.
Ich gehe zurück zur Nieuwen Kerk und folge dabei dem Weg, den sie damals wahrscheinlich genommen haben. Ich kenne Spinozas Grab auf dem Kirchhof. So begebe ich mich vom Heim des lebenden zu dem des toten Spinozas.
Tore umgeben den Kirchhof, doch sie stehen weit offen. Eigentlich ist es kein Friedhof, nur Büsche, Gras, Moos und schlammige Wege zwischen hohen Bäumen. Das Grab befindet sich dort, wo ich es erwartet habe, im hinteren Teil der Anlage, hinter der Kirche, in südöstlicher Richtung, ein flacher, liegender Stein und ein stehender Grabstein, verwittert und schmucklos. Neben der Inschrift seines Namens steht das Wort »Caute«, lateinisch für »gib Acht«. Wie eine unheimliche Mahnung, die daran erinnert, dass sich Spinozas sterbliche Überreste nicht in dem Grab befinden, dass sein Leichnam von Unbekannten gestohlen wurde, als er nach den Begräbnisfeierlichkeiten in der Kirche aufgebahrt lag. Spinoza hat uns gesagt, dass jedermann das Recht habe, zu denken, was er wolle, und zu sagen, was er denke, aber nicht zu schnell und nicht unbedacht. Achtung, pass auf, was du sagst (und schreibst), sonst finden noch nicht einmal deine sterblichen Überreste Ruhe.
Spinoza verwendete das Wort caute auch in seiner Korrespondenz. Es war unter der Zeichnung einer Rose abgedruckt. Während der letzten zehn Jahre seines Lebens schrieb er tatsächlich sub rosa, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Im Tractatus gab er einen fiktiven Drucker und einen falschen Erscheinungsort (Hamburg) an. Die für den Autorennamen bestimmte Seite blieb leer. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen und obwohl das Buch auf lateinisch und nicht auf holländisch geschrieben war, verboten die holländischen Behörden es 1674. Wie nicht anders zu erwarten, setzte der Vatikan es auf seinen Index der gefährlichen Bücher. Die Kirche betrachtete das Buch als einen fundamentalen Angriff auf die institutionalisierte Religion und ihre politische Machtstruktur. Danach publizierte Spinoza gar nicht mehr. Was nicht weiter überrascht. Seine letzten Schriften befanden sich am Tage seines Todes noch in der Schublade seines Schreibtisches, doch van der Spijk wusste, was zu tun war: Er lud den gesamten Schreibtisch auf einen Lastkahn nach Amsterdam, wo er an John Rieuwertz, Spinozas eigentlichen Verleger, ausgeliefert wurde. Die Sammlung seiner posthumen Manuskripte – die häufig revidierte Ethik, eine Hebräische Grammatik, der zweite und unvollendete Teil des Politischen Traktats und die Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes – wurde noch im selben Jahr anonym veröffentlicht. Diese Situation sollten wir nicht ganz vergessen, wenn wir die holländischen Provinzen als Hort geistiger Toleranz preisen. Zweifellos waren sie das, aber auch diese Toleranz hatte ihre Grenzen.
Die meiste Zeit von Spinozas Leben war Holland Republik, und in den reifen Jahren des Philosophen beherrschte der Ratspensionär Johan de Witt das politische Leben. De Witt war ehrgeizig und autokratisch, aber auch aufgeklärt. Es ist nicht ganz klar, wie eng sein Verhältnis zu Spinoza war, aber bestimmt kannte er Spinoza und hat ihn vermutlich vor dem Zorn besonders konservativer calvinistischer Politiker in Schutz genommen, als der Tractatus zum Skandal wurde. Seit 1670 besaß de Witt ein Exemplar der Schrift. Es heißt, er habe die Meinung des Philosophen zu politischen und religiösen Fragen eingeholt, und Spinoza habe sich von der Wertschätzung, die ihm de Witt erwiesen habe, geschmeichelt gefühlt. Selbst wenn die Gerüchte falsch sein sollten, steht wohl außer Frage, dass de Witt an Spinozas politischen Gedanken interessiert war und seinen religiösen Ansichten zumindest wohlwollend gegenüberstand. Und Spinoza durfte sich zu Recht in de Witts Obhut sicher fühlen.
1672, in einer der dunkelsten Stunden von Hollands Goldenem Zeitalter, fand die relative Sicherheit Spinozas ein jähes Ende. Infolge einer plötzlichen Wendung der Ereignisse, wie sie für diese politisch so wankelmütige Epoche charakteristisch war, wurden de Witt und sein Bruder von einer Volksmenge erschlagen, weil sie fälschlich in den Verdacht geraten waren, im Krieg mit Frankreich die holländische Sache an den Feind verraten zu haben. Der Pöbel bearbeitete die beiden de Witts mit Knüppeln und Messern, während man sie zum Galgen schleifte, und als man dort angelangt war, brauchte man sie nicht einmal mehr zu hängen. Daraufhin entkleidete die Mengen die Leichen, hängte sie wie Tiere im Schlachthof mit dem Kopf nach unten auf und vierteilte sie. Unter widerwärtigstem Gelächter wurden ihre Überreste als Souvenirs verkauft und roh oder gekocht gegessen. All das fand nicht weit von der Stelle entfernt statt, an der ich jetzt stehe, buchstäblich bei Spinoza um die Ecke. Vermutlich war es auch Spinozas dunkelste Stunde. Die Ausschreitungen schockierten viele Denker und Politiker seiner Zeit. Leibniz war genauso entsetzt wie der unerschütterliche Huygens in der Sicherheit seines Pariser Exils. Spinoza aber war zutiefst verstört. Die grausame Tat enthüllte die schlimmsten Seiten der menschlichen Natur und raubte ihm den so mühsam erworbenen Seelenfrieden. Er bereitete ein Plakat vor, das er Ultimi Barborum (»Die Schlimmsten der Barbaren«) nannte und am Schauplatz der schrecklichen Ereignisse anschlagen wollte. Glücklicherweise war auf van der Spijks Lebensklugheit Verlass. Er schloss einfach die Tür ab und rückte den Schlüssel nicht heraus. So verhinderte er, dass Spinoza das Haus verließ und in den sicheren Tod lief. Spinoza weinte öffentlich – das einzige Mal, heißt es, dass andere ihn im Griff unkontrollierter Emotionen sahen. Der sichere Hort geistiger Freiheit war verloren.
Noch einmal betrachte ich Spinozas Grab und erinnere mich an die Inschrift, die Descartes für den eigenen Grabstein bestimmt hatte: »Wer verborgen gelebt hat, hat gut gelebt.«13 Nur siebenundzwanzig Jahre liegen zwischen den Todesdaten dieser beiden Männer, die einen Teil ihres Lebens Zeitgenossen waren. (Descartes starb 1650.) Beide verbrachten die längste Zeit ihres Lebens im holländischen Paradies, Spinoza aufgrund seiner Geburt, Descartes aus freier Entscheidung – Descartes war schon früh in seiner philosophischen Laufbahn zu der Erkenntnis gekommen, dass seine Ideen wahrscheinlich zum Konflikt mit der katholischen Kirche und der Regierung in seinem Geburtsland Frankreich führen würden, und hatte sich in aller Stille nach Holland abgesetzt. Doch beide sahen sich zu Heimlichkeiten und Verstellungen gezwungen, Descartes sogar zur Verfälschung des eigenen Denkens. Der Grund dürfte klar sein. 1633, ein Jahr nach Spinozas Geburt, wurde Galilei von der Römischen Inquisition verhört und unter Hausarrest gestellt. Im selben Jahr hielt Descartes die Veröffentlichung seiner Schrift Über den Menschen zurück und sah sich trotzdem heftigen Attacken gegen seine Ansichten über die menschliche Natur ausgesetzt. 1642 postulierte Descartes im Widerspruch zu seinen früheren Auffassungen eine unsterbliche Seele, die unabhängig vom vergänglichen Körper existiere, möglicherweise um weiteren Angriffen vorzubeugen. Falls dies seine Absicht war, hatte die Strategie zwar letztlich Erfolg, wollte aber zu seinen Lebzeiten nicht so recht greifen. Später verschlug es ihn nach Schweden, wo er als Mentor der Königin Christina wirkte, einer bekannten Freidenkerin. Während seines ersten Stockholmer Winters starb er, erst vierundfünfzig Jahre alt. Über der Dankbarkeit für den Umstand, in so ganz anderen Zeiten zu leben, sollten wir nicht die Gefahren vergessen, die den hart erkämpften Freiheiten noch immer drohen. Vielleicht ist Spinozas caute auch heute noch angebracht.
Als ich den Kirchhof verlasse, kreisen meine Gedanken um die merkwürdige Bedeutung dieser Begräbnisstätte. Warum wurde Spinoza, der als Jude geboren wurde, im Schatten dieser mächtigen protestantischen Kirche begraben? Die Antwort ist so kompliziert wie alles, was Spinoza betrifft. Vielleicht hat er hier seine letzte Ruhestätte gefunden, weil das Christentum, nachdem ihn seine jüdischen Glaubensgenossen verstoßen hatten, eine Art Notlösung für ihn war. Natürlich konnte er nicht auf dem jüdischen Friedhof in Ouderkerk bestattet werden. Aber so wirklich zu Hause ist er auch hier nicht, denn ein echter Christ – katholisch oder protestantisch – ist er nie geworden. Für viele war er ein Atheist. Wie das alles ins Bild passt! Spinozas Gott ist weder jüdisch noch christlich. Spinozas Gott ist überall, kein Gott, mit dem man reden kann, der antwortet, wenn man zu ihm betet, ein Gott, der sich in jedem Teilchen des Universums manifestiert und ohne Anfang und Ende ist. Begraben oder nicht begraben, jüdisch oder nicht, Portugiese, aber kein richtiger, Holländer, aber nicht ganz – Spinoza war überall und nirgends zu Hause.
Als ich ins Hotel des Indes zurückkehre, ist der Portier froh, mich heil und unversehrt wiederzusehen. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen und erzähle ihm, dass ich auf der Suche nach Spinoza bin, dass ich sein Haus aufgesucht habe. Der brave Holländer ist sprachlos. Verblüfft mustert er mich und sagt nach einer Weile: »Sie meinen … den Philosophen?« Natürlich weiß er, wer Spinoza war, schließlich hat Holland eines der besten Bildungssysteme der Welt. Aber er hat keine Ahnung, dass Spinoza seine letzten Lebensjahre in Den Haag verbrachte, dass er hier den wichtigsten Teil seines Werks vollendete, starb, begraben wurde und dass nur einige Straßen entfernt ein Haus, ein Standbild und ein Grab von ihm zeugen. Gerechterweise muss ich hinzufügen, dass nur wenige Menschen davon wissen. »Heutzutage spricht man nicht mehr viel über ihn«, sagt mein freundlicher Portier. Wie wahr.
In der Paviljoensgracht
Zwei Tage später kehre ich in die Paviljoensgracht 72 zurück, wo freundliche Menschen mir die Besichtigung des Hauses ermöglichen. Das Wetter ist heute noch schlechter, ein Orkan fegt von der Nordsee her über die Stadt.
In van der Spijks Atelier ist es kaum wärmer und mit Sicherheit dunkler als draußen. Eine Mischung aus Grau und Grün bleibt mir im Gedächtnis. Es ist ein kleiner Raum, den man sich leicht einprägen kann, um später in der Phantasie mit ihm zu spielen. In der Vorstellung rücke ich die Möbel um, lasse Licht herein und mache Feuer im Kamin. Ich bleibe lange genug sitzen, um mir die Bewegungen von Spinoza und van der Spijk auf dieser kleinen Bühne vorstellen zu können. Am Ende komme ich zu dem Schluss, dass alle Bemühungen meiner Phantasie diesen Raum nicht in den bequemen Salon verwandeln können, den Spinoza verdient hätte. Er ist eine Lektion in Bescheidenheit. In diesem kleinen Zimmer hat Spinoza seine zahllosen Besucher empfangen, unter anderem Leibniz und Huygens. Hier hat er seine Mahlzeiten eingenommen – wenn er nicht zu vertieft in seine Arbeit war und das Essen ganz vergessen hat – und hier unterhielt er sich mit van der Spijks Frau und ihren lärmenden Kindern. In diesem kleinen Zimmer vernahm er außer sich vor Entsetzen die Nachricht von der Ermordung der De Witts.
Wie konnte Spinoza in dieser Enge leben? Zweifellos, indem er in die unendlichen Weiten seines Denkens entkam, eine Landschaft, die viel größer und nicht weniger prächtig war als Versailles und seine Gärten, in denen sich zu jener Zeit Ludwig XIV., kaum sechs Jahre jünger als Spinoza, aber dazu bestimmt, ihn um dreißig Jahre zu überleben, mit seinem großen Gefolge erging.
Emily Dickinson hat wohl Recht, wenn sie sagt, dass ein einziges Gehirn weiter als der Himmel sei, könne es doch mühelos die Gedanken eines klugen Mannes fassen und nebenbei noch die ganze Welt.
KAPITEL ZWEI
Von Trieben und Emotionen
Auf Shakespeare ist immer Verlass
So viel ist sicher – alles steht schon bei Shakespeare. Im letzten Akt von Richard II., als die Krone verloren ist und der Kerker unausweichlich erscheint, erläutert Richard Bolingbroke unwissentlich den Unterschied zwischen dem Begriff der Emotion und dem des Gefühls.1 Er lässt einen Spiegel bringen, hält ihn sich vor das Gesicht und betrachtet die Spuren der Verwüstung. Dann erklärt er, »diese äußern Weisen der Betrübnis« seien »Schatten bloß vom ungesehnen Gram«, einem Gram, »der schweigend in gequälter Seele schwellt«. Von diesem Gram sagt er noch, er liege »innen ganz«. In lediglich vier Zeilen erläutert Shakespeare, dass sich der einheitliche und scheinbar einzigartige Prozess des Affekts, den wir häufig so leichthin und gleichgültig entweder als Emotion oder Gefühl bezeichnen, in einzelne Elemente zerlegen lässt.
Diese Unterscheidung mache ich mir bei meiner Untersuchung der Gefühle zunutze. Bei der üblichen Verwendung des Wortes Emotion ist der Begriff des Gefühls in der Regel mit eingeschlossen. Doch bei unserem Versuch, die komplexe Ereigniskette zu verstehen, die mit einer Emotion beginnt und mit einem Gefühl endet, hilft uns die grundlegende Unterscheidung zwischen dem Teil des Prozesses, der gezeigt wird, und dem Teil, der verborgen bleibt. Im Rahmen meiner Arbeit nenne ich den ersten Teil Emotion und den zweiten Teil Gefühl, wobei ich jene Bedeutung des Wortes »Gefühl« zugrunde lege, die ich oben skizziert habe. Der Leser ist gebeten, mir in der Wahl dieser Worte und Begriffe zu folgen, da wir mit ihrer Hilfe möglicherweise etwas über die ihnen zugrunde liegende Biologie erfahren. Ich verspreche, dass ich am Ende des dritten Kapitels Emotion und Gefühl wieder vereinen werde.2
Im Kontext dieses Buches sind Emotionen also Akte oder Bewegungen, die größtenteils öffentlich und sichtbar für andere sind, während sie sich im Gesicht, in der Stimme und in bestimmten Verhaltensweisen manifestieren. Natürlich sind einige Bestandteile des emotionalen Prozesses für das bloße Auge nicht sichtbar, sondern lassen sich nur durch moderne wissenschaftliche Mittel wie Hormontests und elektrophysiologische Messungen der Hirnwellenmuster erfassen. Dagegen sind Gefühle immer verborgen, wie es nun einmal alle Vorstellungen sind, nur erkennbar für ihren rechtmäßigen Besitzer, das persönlichste Eigentum des Organismus, in dessen Gehirn sie sich abspielen.
Die Emotionen treten auf der Bühne des Körpers auf, die Gefühle auf der Bühne des Geistes.3 Wie wir sehen werden, sind Emotionen und die Vielzahl verwandter Reaktionen, die ihnen zugrunde liegen, Teil der automatischen und grundlegenden Mechanismen der Steuerung unseres Lebens; jedoch tragen auch Gefühle zu dieser Steuerung bei, wenn auch auf einer höheren Ebene. In der Lebensgeschichte scheinen Emotionen und verwandte Reaktionen den Gefühlen vorauszugehen. Emotionen und verwandte Phänomene bilden die Grundlage für Gefühle, für die mentalen Ereignisse, die das Fundament unseres Geistes bilden und deren Beschaffenheit wir hier klären möchten.
Emotionen und Gefühle sind im Zuge eines kontinuierlichen Prozesses so eng miteinander verknüpft, dass wir verständlicherweise dazu neigen, sie als ein einziges Phänomen wahrzunehmen. Doch selbst in normalen Situationen können wir verschiedene Abschnitte dieses kontinuierlichen Prozesses ausmachen, und unter dem Mikroskop der kognitiven Neurowissenschaft ist es legitim, die beiden Teile voneinander zu trennen. Mit bloßem Auge und einer Vielzahl wissenschaftlicher Methoden kann ein Beobachter die Verhaltensweisen, die eine Emotion ausmachen, objektiv untersuchen. Und wirklich lässt sich das Vorspiel zum Prozess des Fühlens analysieren. Wenn wir Emotion und Gefühl als zwei gesonderte Forschungsobjekte betrachten, können wir leichter entdecken, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir fühlen.
In diesem Kapitel möchte ich die Hirn- und Körpermechanismen erklären, die für die Auslösung und Ausführung einer Emotion verantwortlich sind. Dabei geht es um die inneren »Mechanismen der Emotion«, nicht um die Umstände, die zu der Emotion führen. Wenn wir uns Klarheit über die Emotionen verschafft haben, werden wir hoffentlich leichter verstehen, wie Gefühle zustande kommen.
Emotionen gehen Gefühlen voraus
Lassen Sie mich bei der Überlegung, warum erst die Emotionen und dann die Gefühle da sind, auf eine Doppeldeutigkeit hinweisen, die Shakespeare in den zitierten Zeilen aus Richard dem Zweiten unterläuft. Sie betrifft das Wort Schatten und die Möglichkeit, dass Emotion und Gefühl zwar unterschiedlicher Natur sind, aber Letzeres Ersterem vorausgehen könnte. Die äußere Betrübnis sei ein Schatten des unsichtbaren Grams, sagt Richard, eine Art Spiegelbild des Hauptgegenstandes – des Gefühls des Grams –, so wie Richards Gesicht im Spiegel die Hauptperson des Stückes, Richard, widerspiegelt. Diese Doppeldeutigkeit entspricht unserer intuitiven Vorstellung. Wir alle neigen zu der Annahme, das Verborgene sei die Ursache des Sichtbaren. Abgesehen davon wissen wir alle, dass für den Geist allein das Gefühl wirklich zählt. »Da liegt sein Wesen«, sagt Richard und meint den verborgenen Gram – und wir pflichten ihm bei. Gefühle verursachen uns Trauer oder Freude. Im engeren Sinn sind Emotionen Äußerlichkeiten. Doch »hauptsächlich« bedeutet nicht »zuerst« und auch nicht »ursächlich«. Die Hauptrolle, die Gefühle spielen, verschleiert die Frage, wie sie entstehen, und fördert die Auffassung, irgendwie wären da zuerst die Gefühle, die anschließend in Gestalt der Emotionen zum Ausdruck gebracht werden. Diese Auffassung ist falsch und zumindest teilweise dafür verantwortlich, dass eine plausible neurobiologische Erklärung der Gefühle so lange auf sich warten ließ.
Wie sich herausstellt, sind weit eher die Gefühle die Schatten der äußeren Manifestationen von Emotionen. Richard hätte also viel eher sagen müssen – Shakespeare möge mir verzeihen –: »Oh, wie diese äußern Weisen der Betrübnis einen ungesehnen Schatten tiefen Grams ins Schweigen der gequälten Seele werfen.« (Was mich an James Joyce erinnert, wenn er in Ulysses sagt: »Shakespeare ist der glückliche Jagdgrund für alle Geister, die ihr Gleichgewicht verloren haben.«4)
Hier stellt sich nun die Frage, warum Emotionen den Gefühlen vorausgehen.
Die Antwort ist ganz einfach: Zuerst sind da die Emotionen und dann die Gefühle, weil die Evolution zuerst die Emotionen und dann die Gefühle hervorgebracht hat. Emotionen bestehen aus einfachen Reaktionen, die auf simple Art und Weise für das Überleben eines Organismus sorgen und sich daher in der Evolution leicht durchsetzen konnten.
Kurzum, wen die Götter erretten wollten, den machten sie schlau – zumindest könnte man das annehmen. Es hat den Anschein, als sei die Natur, lange bevor die Lebewesen so etwas wie eine kreative Intelligenz besaßen, sogar noch bevor sie ein Gehirn besaßen, zu der Auffassung gelangt, dass das Leben kostbar und gefährdet sei. Wir wissen natürlich, dass die Natur nicht planvoll vorgeht und keine Entscheidungen nach Art von Künstlern oder Ingenieuren trifft, doch dieses Bild trifft die Sache ganz gut. Alle lebenden Organismen, von den primitiven Amöben bis zum Menschen, sind von Geburt aus mit Mechanismen ausgestattet, die dazu bestimmt sind, die Grundprobleme des Lebens automatisch, ohne Denkprozesse im eigentlichen Sinne, zu lösen. Zu diesen Problemen gehören: die Suche nach Energiequellen, die Aufnahme und Verwertung von Energie, die Aufrechterhaltung eines inneren chemischen Gleichgewichts, das mit dem Lebensprozess vereinbar ist, die Erhaltung des Körperbaus durch die Reparatur von Abnutzungserscheinungen und die Abwehr äußerer Verursacher von Krankheit und körperlichen Verletzungen. Die Gesamtheit dieser Steuerungen und das gesteuerte Leben, das dadurch entsteht, lässt sich in einem einzigen Begriff zusammenfassen: Homöostase.5
Im Laufe der Evolution wurden die angeborenen und automatischen Fähigkeiten zur Steuerung der Lebensprozesse – die homöostatischen Mechanismen – immer raffinierter. Auf der untersten Ebene der homöostatischen Organisation finden wir einfachste Reaktionen: der gesamte Organismus nähert sich einem Objekt oder meidet es; er verstärkt seine Aktivität (Erregung) oder verringert sie (Ruhe oder Stille). Auf höheren Ebenen der Organisation finden wir kompetitive oder kooperative Reaktionen.6 Wir können die homöostatischen Mechanismen als einen großen Baum mit vielen Ästen darstellen, die den automatischen Steuerungen der Lebensvorgänge entsprechen. Für mehrzellige Organismen liefert uns der Baum von unten nach oben das folgende Bild.
AUF DEN NIEDRIGSTEN ZWEIGEN
Der Stoffwechselprozess. Dazu gehören chemische und mechanische Komponenten (zum Beispiel endokrine/hormonale Sekretion; Muskelkontraktionen des Verdauungsapparats und so fort), die dazu dienen, das Gleichgewicht des inneren chemischen Haushalts aufrechtzuerhalten. Diese Reaktionen bestimmen zum Beispiel Herzfrequenz und Blutdruck (der für die richtige Verteilung des Blutflusses im Körper sorgt); der Ausgleich von Säure und Alkalität im inneren Milieu (der Flüssigkeiten in der Blutbahn und den Zellzwischenräumen); die Speicherung und Ausschüttung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten, die erforderlich sind, um den Organismus mit Energie zu versorgen (notwendig für Bewegung, Herstellung chemischer Enzyme und Erhaltung und Erneuerung des Körperbaus).
Abbildung 2.1: Ebenen automatischer homöostatischer Steuerung, vom Einfachen zum Komplexen
Grundreflexe. Dazu gehören die Schreckreaktion, die Organismen bei plötzlichen Geräuschen oder Berührungen zeigen, und die Tropismen oder Taxes, die Organismen veranlassen, extreme Hitze und extreme Kälte zu meiden oder sich aus der Dunkelheit ins Licht zu bewegen.
Das Immunsystem. Es hat die Aufgabe, Viren, Bakterien, Parasiten und giftige chemische Stoffe abzuwehren, die von außen in den Organismus eindringen. Merkwürdigerweise ist es auch in der Lage, chemische Stoffe zu bekämpfen, die auch in gesunden Körperzellen enthalten sind, aber gefährlich werden können, wenn sie von sterbenden Zellen ins innere Milieu freigesetzt werden (z. B. Glutamat). Kurzum, das Immunsystem ist eine erste Verteidigungslinie des Organismus, wenn seine Unversehrtheit von außen oder von innen bedroht wird.
AUF DEN MITTLEREN ZWEIGEN
Verhaltensweisen, die normalerweise mit dem Konzept von Lust (und Belohnung) oder Schmerz (und Bestrafung) verknüpft sind. Dazu gehört eine hochinteressante Gruppe von Mechanismen, die Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten des gesamten Organismus in Reaktion auf ein spezifisches Objekt oder eine bestimmte Situation hervorrufen. Vom Menschen, der sowohl fühlen als auch über das Gefühlte berichten kann, werden solche Reaktionen als schmerzhaft oder lustvoll, als Belohnung oder Bestrafung beschrieben. Wenn beispielsweise eine Funktionsstörung mit drohender Schädigung von Körpergewebe vorliegt – wie bei lokalen Verbrennungen oder Infektionen –, senden die Zellen in der betroffenen Region chemische Signale aus, die als nozizeptiv bezeichnet werden (sich also ihrer Wortbedeutung nach auf die »Wahrnehmung eines Schmerzreizes« beziehen). Darauf reagiert der Organismus automatisch mit Krankheits- oder Schmerzverhalten. Das sind deutlich sichtbare oder versteckte Handlungspakete, mit der sich die Natur automatisch gegen den Angriff wehrt. Dazu gehören der vollständige oder partielle Rückzug des Körpers von der Störungsquelle, wenn diese Quelle äußerlich und erkennbar ist; Schutz des betroffenen Körperteils (Halten einer verwundeten Hand; Umfassen von Brust oder Unterleib) und ein Mienenspiel, in dem sich Schrecken oder Schmerz ausdrückt. Ferner gibt es eine Vielzahl von Reaktionen, die für das bloße Auge nicht erkennbar sind und vom Immunsystem organisiert werden. Dazu gehören die vermehrte Produktion bestimmter Typen weißer Blutkörperchen, die Entsendung dieser Zellen in die gefährdeten Körperregionen und die Herstellung bestimmter chemischer Stoffe wie der Zytokine, die dem Körper helfen, das anstehende Problem zu lösen (eindringende Mikroben abzuwehren, geschädigtes Gewebe zu reparieren). Die Gesamtheit dieser Handlungen und die chemischen Signale, die an ihrer Entstehung beteiligt sind, bilden die Grundlage dessen, was wir als Schmerz empfinden.
Genauso wie das Gehirn auf ein Problem im Körper reagiert, reagiert es auch, wenn der Körper vorbildlich funktioniert. Arbeitet der Körper reibungslos, stößt er auf keinerlei Schwierigkeiten, und wandelt er die Energie mühelos um und verbraucht sie, verhält er sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise: Er tendiert zur Annäherung an andere, ist entspannt und gelöst, bringt im Mienenspiel Selbstvertrauen und Wohlgefühl zum Ausdruck und produziert eine bestimmte Klasse von chemischen Stoffen, wie zum Beispiel die Endorphine, die für das bloße Auge ebenso unsichtbar sind wie einige Reaktionen des Krankheits- und Schmerzverhaltens. Die Gesamtheit dieser Handlungen und der mit ihnen verknüpften chemischen Signale bilden die Grundlage für das Empfinden von Lust.
Schmerz oder Lust werden durch viele Ursachen hervorgerufen – von Störungen bestimmter Körperfunktionen und der optimalen Funktion der Stoffwechselregulation oder durch äußere Ereignisse, die den Organismus schädigen oder beschützen. Doch das Empfinden von Schmerz oder Lust ist nicht die Ursache des Schmerz- oder Lustverhaltens und keineswegs eine notwendige Voraussetzung für das Auftreten dieses Verhaltens. Wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, können einige sehr einfache Lebewesen etliche dieser emotiven Verhaltensweisen ausführen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Verhaltensweisen fühlen, gering oder gleich null ist.
AUF DER NÄCHSTHÖHEREN EBENE
Eine Anzahl von Trieben und Motivationen. Beispiele sind in erster Linie Hunger, Durst, Neugier und Erkundungsdrang, Spiel und Sexualität. Spinoza fasst sie unter der treffenden Bezeichnung Trieb (appetitus) zusammen und verwendet sehr scharfsinnig ein anderes Wort, Begierde (cupiditas), für die Situation, in denen vernunftbegabte Wesen sich dieser Triebe bewusst werden. Das Wort »Trieb« bezeichnet den Zustand eines Organismus, der dem Einfluss eines bestimmten Triebs unterliegt; das Wort »Begierde« setzt voraus, dass der Trieb sowie seine mögliche Erfüllung oder Nichterfüllung bewusst erlebt wird. Diese spinozistische Unterscheidung ist ein hübsches Gegenstück zur Unterscheidung zwischen Emotion und Gefühl, mit der wir dieses Kapitel begonnen haben. Natürlich sind im Menschen Triebe und Begierden genauso unauflöslich verknüpft wie Emotionen und Gefühle.
FAST, ABER NICHT GANZ AN DER SPITZE
Die eigentlichen Emotionen. Hier finden wir das Kronjuwel der automatischen Steuerung von Lebensprozessen: Emotionen im engeren Sinn des Wortes – von Freude und Traurigkeit über Furcht und Stolz bis hin zu Scham und Mitgefühl. Und falls Sie sich fragen, was es ganz oben zu entdecken gibt, so ist die Antwort einfach: die Gefühle, mit denen wir uns im nächsten Kapitel beschäftigen werden.