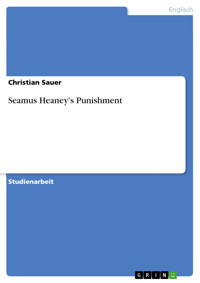Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk zeigt, wie die Stellvertreterrolle souverän gemeistert und als Chance genutzt wird! - Sicher auftreten und innerhalb bestimmter Grenzen kraftvoll führen - Saubere Rollenklärung und Arbeitsteilung mit dem Chef hinkriegen - Teams überzeugen, motivieren und mitnehmen - Eigene Karriere voranbringen - Mit konkreten Tipps, Checklisten, Übungen und Reflexionsaufgaben Stellvertreter müssen Führungsarbeit unter erschwerten Bedingungen leisten. Ohne Disziplinargewalt und mit einer oft diffusen Aufgabenbeschreibung sollen sie den Chef in Abwesenheit vertreten und ihn ansonsten loyal unterstützen. Dabei stehen die Stellvertreter unter besonderer Beobachtung der Mitarbeiter und des Managements, denn Stellvertretungen werden häufig gezielt als Testfeld für Nachwuchs-Führungskräfte genutzt. Dieses Buch vermittelt kompakt und knapp das nötige Wissen und Handwerkszeug für die Stellvertreteraufgabe. Dazu gehören beispielsweise eine klare Rollendefinition und Arbeitsteilung mit dem regulären Chef, die Motivation der Mitarbeiter, aber auch die eigene Karriereplanung und die Entwicklung einer Zukunftsstrategie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Sauer
Survival-Handbuch Führung
Erfolgreich führen aus der zweiten Reihe
Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autoren und Verlag übernehmen infolgedessen keine juristische Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht.
Ebenso übernehmen Autoren und Verlag keine Gewähr dafür, dass beschriebene Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt deshalb auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen und MarkenschutzGesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2017 Carl Hanser Verlag Münchenwww.hanser-fachbuch.de
Lektorat: Lisa Hoffmann-Bäuml Herstellung: Thomas Gerhardy Umschlaggestaltung: Stephan Rönigk
ISBN 978-3-446-44959-6 E-Book ISBN 978-3-446-45069-1
Verwendete Schriften: SourceSansPro und SourceCodePro (Lizenz) CSS-Version: 1.0.1
Inhalt
Titelei
Impressum
Inhalt
Vorwort
Schnelleinstieg: Die sieben wichtigsten Tipps für erfolgreiche Stellvertreter
1 Grundwissen zur Stellvertretung
1.1 Vor- und Nachteile der Position
1.2 Aufgaben des Stellvertreters
1.2.1 Handeln anstelle des Chefs: in Vertretung (i. V.)
1.2.2 Handeln im abgesprochenen Rahmen: im Auftrag (i. A.)
1.2.3 Weisungsbefugnis des Stellvertreters
1.3 Formeller Handlungsrahmen des Stellvertreters
1.4 Informeller Spielraum des Stellvertreters
1.5 Stellvertretung als Interaktion
2 Faktoren für einen guten Start
2.1 Einstieg und Einarbeitung
2.2 Klärung der Stellung des Stellvertreters
2.3 Startbedingungen von Nesthockern und Nestflüchtern
2.3.1 Klärungsgespräch mit dem Chef
2.3.2 Klärungsphase und Mitarbeiter
2.3.3 Grundregeln für Klärungsgespräche
2.3.4 Sichere Gesprächsführung mit dem V-Modell
2.4 Fit für den Alltag
3 Umgang mit Chef und Team
3.1 Dos and Don’ts für Stellvertreter
3.2 Umgang mit Wissenslücken und Unsicherheiten
3.3 Umgang mit Überlastungssituationen
3.4 Strategieplanung mithilfe der Stellvertretermatrix
4 Moderieren und Motivieren
4.1 Teambesprechungen
4.1.1 Teambesprechungen in Anwesenheit des Chefs
4.1.2 Finden des richtigen Rollenverständnisses mit dem Spielmachermodell
4.1.3 Teambesprechungen in Abwesenheit des Chefs
4.1.4 Stellvertreter als Spielmacher
4.2 Motivation von Mitarbeitern
5 Souverän Führen und Delegieren
5.1 Umgang mit Meinungsdifferenzen und Widerstand
5.1.1 Mit Fragen führen
5.1.2 Gesprächsführung aus dem V-Modus
5.2 Delegieren von Aufgaben
5.3 Stellvertreter als Empfänger von Delegationen
5.4 Stellvertretung als gute Schule der Führung
6 Langfristige Strategie entwickeln
6.1 Vergütung von Stellvertretern
6.1.1 Stellvertretung und Unternehmenskultur
6.1.2 Kosten einer Stellvertretung
6.2 Wege zur Zufriedenheit
6.2.1 Tücken des Kaminaufstiegs
6.2.2 Gefahren von Putschfantasien
6.2.3 Stellvertreter und die dunklen Seiten der Macht
7 Special: Handwerkszeug für Stellvertreter in Changeprozessen
7.1 Phasen eines Changeprozesses
7.2 Aufgaben des Stellvertreters in Changeprojekten
7.3 Rolle des Stellvertreters im Changeprozess
7.4 Stellvertreter und agiles Projektmanagement
7.5 Laterale Führung in Changeprojekten
7.6 Führen von Mitarbeitern in Veränderungsprojekten
Epilog
Literatur
Autor
Vorwort
Stellvertreterinnen und Stellvertreter gibt es in großer Zahl ‒ fast so viele wie Führungskräfte. Nicht immer tragen sie auch offiziell diesen Titel. Aber in Unternehmen, Behörden und Verbänden haben die meisten Chefs jemanden, der sie vertritt, wenn sie selbst einmal krank, verhindert oder im Urlaub sind.
Das ist auch gut so. Denn wo es keine Stellvertreter gibt, bleiben schon kleine Entscheidungen liegen. Oder es befassen sich Leute damit, die nicht wissen, worum es geht und was sie entscheiden dürfen. Manchmal sind das Mitarbeiter, manchmal Führungskräfte aus der Nachbarabteilung. Immer fehlt es an Klarheit und sehr oft an Kompetenz.
Es ist so: Wo Stellvertreter fehlen, verlangsamen sich Arbeitsprozesse und sinkt die Qualität der Ergebnisse. Es gibt auch keinen Ansprechpartner, wenn in Abwesenheit des Chefs ein erwartbares Unglück passiert: Projektkrise, Beschwerden, Großkunde droht mit Eilauftrag. Ohne Stellvertreterin oder Stellvertreter ist eine Abteilung oder ein Betrieb nicht voll handlungsfähig, praktisch wie rechtlich, so lange, bis der Chef wieder auftaucht.
Aber Stellvertreter können noch mehr als Lücken schließen. Wenn es gut läuft, dann sind sie Teil der Führung. Sie übernehmen dauernd Mitverantwortung, nicht nur in Abwesenheit des Vorgesetzten. Sie bilden Tandems mit ihren Chefs und teilen die Aufgaben sinnvoll auf. Sie denken voraus, wenn der Chef gerade im Kleinkram feststeckt, und schaffen den Kleinkram weg, wenn der Chef gerade in einer Strategieklausur sitzt. Arbeitsteilige Stellvertretung nennt man das ‒ und die ist ein Schlüssel zu guter Führung und zu guten Ergebnissen, zu Qualität und Ertrag.
Das wäre Grund genug, Stellvertretungspositionen in Unternehmen, Behörden, Verwaltungen, Kreativbetrieben zu schaffen und jene, die sie besetzen, sorgfältig aus- und fortzubilden. Es kommt aber noch etwas Wesentliches hinzu: Hierarchische Führung, wie sie heute vorherrscht, weicht Stück für Stück einem neuen Führungskonzept, dem Führen ohne Macht.
Die hoch qualifizierten Wissensarbeiter, von denen so viel abhängt, lassen sich nicht mehr von Chefs herumscheuchen. Führung verliert zunehmend den Charakter von Kontrolle und Disziplinierung. Führung dreht sich zunehmend um die Frage: Was braucht ein Mitarbeiter, damit er motiviert und effizient arbeiten kann? Führungskräfte werden so zu Prozessunterstützern und Dienstleistern. Sie sollen nicht mehr von oben herab führen, sondern von der Seite. Das nennt man dann laterale Führung.
Wer praktiziert diese Art der Führung jeden Tag und lernt sie täglich ein bisschen besser? Das sind die Stellvertreter. Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als freundlich, sachlich und mit Argumenten zu führen. Den Hammer, um einmal auf den Tisch zu hauen, mögen sie sich manchmal wünschen. Sie haben ihn nicht und müssen lernen, ohne Machtdemonstrationen auszukommen. Genau darin liegt die besondere Bedeutung der Stellvertreterpositionen: Sie sind ein Trainingscamp für die Führung der Zukunft. Denn die wird ‒ zumindest zu einem großen Teil ‒ eine Zukunft ohne Führung sein, also ohne eine hierarchiebetonte Führung, wie sie heute noch vorherrscht.
Umso erstaunlicher ist es, dass es bisher keinen Ratgeber für Stellvertreter gibt und nur wenige spezielle Weiterbildungsangebote. Man erwartet von Stellvertreterinnen und Stellvertretern offenbar, dass sie sich aus dem Fundus des allgemeinen Führungswissens bedienen, sich also das heraussuchen, was für sie passt. Aber da passt ‒ bei genauem Hinsehen ‒ gar nicht so viel. Auf viele Grundfragen der Führung brauchen Stellvertreter eine andere Antwort als Linienführungskräfte, vor allem auch in Bezug auf das alltägliche Führungsgeschehen: Fast immer wird der oder die Vorgesetzte anders zu Werke gehen als eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter. Ob man mit der vollen Verantwortung und Macht eines Chefs oder der eingeschränkten eines Stellvertreters führt, das macht einen enormen Unterschied.
Höchste Zeit, endlich einen Spezialratgeber für Stellvertreterinnen und Stellvertreter anzubieten. Ihre besondere Perspektive verdient es, ernst genommen zu werden. Dieses Buch ist eine Einführung in Führungswissen und Führungstechniken, die sich von der ersten bis zur letzten Zeile auf Stellvertreter ausrichtet. Es vermittelt kompakt und knapp alles nötige Know-how und Handwerkszeug für die Stellvertreteraufgabe. Das Buch zeigt in Übungen und Checklisten einen konkreten Weg zur Klärung akuter Praxisprobleme. Zugleich bietet es den Lesern ein Strategiecoaching an: Es führt Stellvertreter über mehrere Stufen durch den üblichen Verlauf ihrer Amtszeit, vom Start bis zu der Frage, wie es nach ein paar Jahren erfolgreicher Stellvertretung denn weitergehen soll.
Ein Grundgedanke ist dabei, dass Stellvertretung deutlich komplizierter ist als jede klassische Führungsaufgabe (Teamleitung, Abteilungsleitung, Bereichsleitung). Sich ohne klassische Disziplinargewalt und mit oft unklaren Kompetenzen im Führungsalltag zu bewähren, ist manchmal ein Höllenjob. Konflikte mit den Mitarbeitern und mit dem Chef bringt die Stellvertreterrolle automatisch mit. Umgekehrt ist Stellvertretung aber auch eine hervorragende Schule, für fortgeschrittene Führungsaufgaben und für die persönliche Weiterentwicklung.
Ich selbst habe einen solchen Ratgeber in meinen sieben Jahren als Stellvertreter vermisst ‒ teilweise schmerzlich. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesem Buch und viel Erfolg als Stellvertreter!
Hamburg, Herbst 2016
Christian Sauer
P.S.: Es bläht den Text unnötig auf, wenn ich dauernd „Stellvertreterinnen und Stellvertreter“ schreibe oder Schrägstriche einarbeite („Stellvertreter/innen“). Im Buchtext halte ich mich an die männliche Schreibweise, denke aber Sie, liebe Leserin, immerzu mit und bitte Sie um Verständnis.
Klären Sie Ihre Rolle, Ihren Auftragund Ihre Vollmacht. Was will der Chef von mir? Was will ich von ihm? Ebenso: Was will das Team von mir? Was will ich vom Team?
Seien Sie ein guter Mittler zwischen den Interessen und Anliegen der Leitung sowie denen des Teams.
Finden Sie sich damit ab, dass Sie nicht Kapitän sind, sondern bestenfalls Steuermann und/oder Maschinist. Es bringt nichts, sich ständig an Einzelentscheidungen des Chefs zu reiben, die man selbst anders getroffen hätte. Respektieren Sie seine Leitungsrolle.
Verzichten Sie auf zu große Nähe zum Team. Ein Kuschelkurs oder gemeinsames Jammern über den Chef oder „die Verhältnisse“ verschaffen Ihnen keinen Respekt.
Sichern Sie sich eigene Arbeitsbereiche in der Teamleitung, zum Beispiel bestimmte Planungsaufgaben, die Steuerung einzelner Prozesse, Projekte oder Besprechungen.
Schärfen Sie Ihr Profil, indem Sie auch einmal öffentlich abweichende Meinungen vertreten. Das verschafft Ihnen Standfestigkeit gegenüber dem Chef und Autorität gegenüber dem Team.
Verbessern Sie kontinuierlich Ihre Kommunikationsfähigkeit (differenzierte Gesprächsführung, Diplomatie, Verhandlungssicherheit). Denn das Gespräch ist Ihr wichtigstes Führungsinstrument.
Sie erfahren hier:
was Stellvertreterpositionen attraktiv macht,
welche Vorteile und welche Nachteile Stellvertreterpositionen haben,
wie man die Befugnisse von Stellvertretern definieren kann,
warum Stellvertretung eindeutig ein Führungsjob ist, und zwar ein ziemlich komplizierter.
Was Sie konkret für Ihre Praxis brauchen:
Sie machen sich klar, in welchem Rahmen Sie als Stellvertreter handeln dürfen,
Sie analysieren, welchen informellen Spielraum Sie als Stellvertreter haben,
Sie entwickeln eine Strategie für Ihre Rolle als Stellvertreter.
Der Job eines Stellvertreters ist begehrt. Wer den Chef vertritt, erfährt interessante Details, kann Entscheidungen beeinflussen und sich mindestens ab und zu einmal in der Führungsrolle ausprobieren. Das motiviert. Und mehr Renommee bringt diese Zusatzfunktion auch mit sich.
Beispiel: Julie Zeller, 29, arbeitet in einem großen Software-Unternehmen. Sie hat sich in ihrem Programmierteam durch Fleiß, Organisationsgeschick und gute Ideen ausgezeichnet. Als der bisherige Stellvertreter des Abteilungsleiters in Ruhestand geht, wird sie gefragt, ob sie dessen Funktion übernehmen möchte. Frau Zeller denkt kurz nach und spricht mit guten Kollegen und Freunden:
Welche konkreten Aufgaben kommen auf sie als neue Stellvertreterin zu?
Wie werden andere im Team, speziell die Älteren, die Nachricht aufnehmen?
Kann sie sich vorstellen, noch enger mit ihrem Chef zusammenzuarbeiten?
Frau Zeller bittet ihren Chef um ein zweites Gespräch. Sie holt sich Infos zur Aufgabenverteilung und bittet ihn um seine Einschätzung zur Reaktion des Teams. Der sagt: „Gut, dass Sie sich solche Gedanken machen, aber das wird schon alles glatt gehen.“ So ganz sicher ist sich Frau Zeller da nicht, dennoch gibt sie ihm am nächsten Tag das Signal: „Ich mach das!“ Ein mulmiges Gefühl bleibt, aber sie freut sich auf die neue Aufgabe und denkt sich, dass sie vielleicht dauerhaft einmal selbst eine Abteilung leiten möchte. Da wird sie doch als Stellvertreterin viel lernen können!
Kein Wunder, dass Frau Zeller zusagt. Sie hat den Reiz und die Chance sofort erfasst. Aber sie hat auch kurz innegehalten und sich ein paar wichtige Fragen gestellt. Ihr ist klar, dass der Stellvertreterjob kein reines Zuckerschlecken ist.
1.1 Vor- und Nachteile der PositionTatsächlich handelt es sich bei der Stellvertretung um eine besonders ausgeprägte Sandwichposition: Viele Stellvertreter fühlen sich regelrecht eingequetscht zwischen den Ansprüchen von oben (zum Beispiel: „Sorg dafür, dass die Mitarbeiter tun, was ich will!“) und denen von unten (zum Beispiel: „Bring dem Chef bei, dass es so nicht geht!“). Die Arbeit als Stellvertreter oder Stellvertreterin hat eben Vorteile und Nachteile.
Vorteile der Stellvertreterposition:
mehr Renommee,
mehr Informationen über Strategien und Entscheidungen der Leitungsebene,
Teilnahme an wichtigen Besprechungen,
mehr Macht, zumindest in Abwesenheit des Chefs, und generell mehr Einfluss,
Teilhabe an der Führung, ohne selbst die volle Verantwortung zu tragen.
Nachteile der Stellvertreterposition:
mehr Verantwortung und Stress als in der Mitarbeiterrolle, oft verbunden mit Zeitproblemen,
Sonderstellung im Team und deshalb teilweise Misstrauen seitens der Mitarbeiter,
Abhängigkeit vom Verhalten und vom Wohlwollen des Chefs,
Klagemauerfunktion, weil die Mitarbeiter beim Stellvertreter ihre Sorgen abladen,
eigene Leistung als Stellvertreter ist nach außen kaum sichtbar.
Wer eine Stellvertreterposition angeboten bekommt, sollte abwägen: Wie wahrscheinlich ist es, dass sich die Vorteile wirklich so einstellen? Können Sie mit den möglichen Nachteilen leben?
Frau Zeller befürchtet, dass manche Teammitglieder auf Distanz zu ihr gehen könnten, weil sie ja als Stellvertreterin sozusagen auf der Seite des Chefs steht. Bisher hatte sie zu praktisch allen im Team ein gutes Verhältnis. Sie fragt sich: „Würde ich auf Dauer mit Kritik, Misstrauen und vielleicht sogar Anfeindungen klarkommen?“ Ein Freund sagt ihr dazu: „Willst du dir von irgendwelchen Neidhammeln deine Karriere verbauen lassen?“ Eine andere Ratgeberin meint: „Das ist ja bis jetzt nur Fantasie. Geh doch erst einmal davon aus, dass die Kollegen dich auch weiterhin akzeptieren.“ Beides leuchtet Frau Zeller ein. Letztlich ist die Aussicht auf Teilhabe an einer Führungsposition für sie zu reizvoll, als dass sie ihren Befürchtungen nachgeben möchte.
Es ist richtig und wichtig, sich etwas Zeit für die Entscheidung über eine Stellvertreterfunktion zu nehmen. Wie Sie im Laufe dieses Buches sehen werden, ist die Aufgabe eines Stellvertreters komplizierter, als man zunächst denkt. Mag auch nicht jede Befürchtung vom Anfang später so eintreffen, die Stellvertreterrolle bringt doch Probleme mit sich, die man anfangs nicht überschauen kann. Sie ist genau genommen sogar schwieriger als etwa die eines Abteilungsleiters, also einer sogenannten Linienführungskraft. Denn die Linienführungskraft weiß, wo ihre Entscheidungsverantwortung anfängt und aufhört und sie hat die sogenannte Weisungsbefugnis gegenüber den Mitarbeitern. Beides trifft auf einen Stellvertreter so klar nicht zu.
Das sollte aber niemanden reflexartig zurückzucken lassen. Stellvertreter zu sein, kann eine spannende und erfüllende Aufgabe sein. Es ist eine verantwortungsvolle Rolle, die viel zum Teamerfolg beitragen kann. Und es ist oft tatsächlich der Einstieg in weitere Führungsaufgaben ‒ schon deshalb, weil man als Stellvertreter auf dem Radar der nächsthöheren Managementebene erscheint.
Mehr noch: Ein engagierter Stellvertreter bereitet sich nebenbei auf viele Aspekte einer „normalen“ Führungsposition vor. Manche, die diesen Karriereschritt später wirklich vollziehen, erleben den Aufstieg zum Abteilungsleiter oder Bereichsleiter dann als Entlastung: Endlich eindeutig Chef sein! Das geht ja ganz leicht! Aber das ist für frischgebackene Stellvertreter wie Frau Zeller noch weit weg. Ihr steht eine anstrengende Zeit bevor, in der sie allerdings auch große Lern- und Entwicklungsschritte machen kann.
1.2 Aufgaben des StellvertretersWarum gibt es eigentlich Stellvertretungen? Die wichtigste Begründung: Damit der Betrieb reibungslos weiterläuft, wenn der Chef einmal krank oder im Urlaub ist. Genauer bedeutet das: In einer Abteilung oder einer Organisation müssen zu jedem Zeitpunkt Entscheidungen fallen können. Gemeint sind hier zunächst kleine Entscheidungen. Jeden Tag gibt es organisatorische Fragen oder dringende Probleme (zum Beispiel Fehler und Beschwerden), die möglichst sofort geklärt werden müssen. Stellvertretung bedeutet zuallererst, diese kleinen Steine aus dem Weg zu räumen, wenn der Chef es gerade nicht kann.
Aus der Sicht des Teams heißt Stellvertretung also: „Wir können weiterarbeiten, wenn der Boss nicht da ist.“ Aus der Sicht des Chefs: „Ich kann ruhig einmal weg sein. Der Laden läuft weiter.“ Aus der Sicht der Gesamtorganisation oder der externen Partner und Kunden: „Die Abteilung ist jederzeit ansprechbar und funktioniert.“
Die zentrale Aufgabe aller Stellvertreter ist es, den Betrieb am Laufen zu halten, wenn die zuständige Führungskraft abwesend ist.
Das ist eine recht enge Definition der Stellvertreteraufgaben. Im Umkehrschluss würde das ja bedeuten: Die Zuständigkeit des Stellvertreters endet automatisch, sobald der Chef anwesend ist, und sie berührt auch nur kleinere Entscheidungen im Alltag. Denn mit allem anderen, etwa mit Richtungsentscheidungen, haben Stellvertreter nichts zu schaffen.
Doch das wäre zu schwarz-weiß gemalt. Jeder kennt Stellvertreter, die auch in Anwesenheit des Chefs eine hervorgehobene Rolle spielen und die mitentscheiden, wenn es um große Projekte und die künftige Ausrichtung geht. Manche scheinen gar eine Art Generalbefugnis zu haben und machen zu können, was sie für richtig halten. Sie sind eine Art Chef-neben-dem-Chef. Tatsächlich müssen wir den Merksatz durch einen zweiten ergänzen:
Stellvertreter können sehr weitgehende Zuständigkeiten und Befugnisse innehaben. Das ist jedoch Verhandlungssache zwischen Chef und Stellvertreter oder bildet sich in gelebter betrieblicher Praxis heraus.
Und daraus ergibt sich automatisch ein dritter Merksatz:
Eine allgemeingültige Definition, wie die Aufgaben und die Rolle eines Stellvertreters zu verstehen sind, gibt es nicht.
Für Sie als amtierende oder künftige Stellvertreter bedeutet das: Alles ist möglich. Der Normalfall wäre, dass Chef und Stellvertreter die Befugnisse des Stellvertreters miteinander aushandeln und dies schriftlich festhalten, in einem sogenannten Geschäftsverteilungsplan. Tun sie das aber aus irgendwelchen Gründen nicht, dann stellt sich trotzdem mit der Zeit heraus, welche Befugnisse der Stellvertreter hat. Die praktische Zusammenarbeit von Tag zu Tag und Monat zu Monat wird es zeigen. Auch das ist eine Rollenklärung.
Die Rollenklärung gehört also zu jeder Stellvertreterposition dazu. Sie verläuft jedes Mal anders und selten konfliktfrei. Kein Wunder, denn beim Thema Stellvertretung geht es ja um lauter Reizthemen: um Macht, Ansehen, Wertschätzung, um die Arbeitsbelastung und sogar um Geld (in Form von Zulagen). Es wäre schon sehr erstaunlich, wenn Chef und Stellvertreter sich rasch, geräuschlos und auf Dauer über die Details ihrer Zusammenarbeit einig würden. In der Praxis zeigt sich, dass eine solche Einigung meist nicht reibungsfrei zustande kommt und nicht allzu lange hält. Dann steht wieder eine neue Klärungsrunde an.
1.2.1 Handeln anstelle des Chefs: in Vertretung (i. V.)Die betriebliche Organisationslehre liefert uns keine klare Definition der Stellvertretung, aber es lassen sich doch Orientierungspunkte finden. Einer davon ist die Rechtslage. Juristisch gesehen bedeutet Stellvertretung zunächst einmal: Da wandern für eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Zweck die Befugnisse einer Person A zu einer Person B. Person B handelt dann anstelle von Person A. „In Vertretung (i. V.)“ sagen die Juristen. Es ist so, als würde B tatsächlich an die Stelle von A treten und auf dessen Stuhl Platz nehmen, wodurch sich As Befugnisse auf B übertragen. Bs Entscheidungen haben in dieser Situation rechtlich etwa den gleichen Stellenwert wie die von A.
Diese Stellvertretung i. V. ist die sogenannte Primäraufgabe eines Stellvertreters. In dieser Funktion vertritt er tatsächlich den Chef, wenn dieser krank, in Urlaub oder die Chefstelle vakant ist. Hier hat der Stellvertreter tendenziell weite Befugnisse. Jedoch sollte er, wenn der Chef einmal drei Tage auf Fortbildung ist, keine Personalentscheidungen treffen, keine Abmahnungen verteilen oder Verträge über Riesensummen unterschreiben. Disziplinarische Angelegenheiten sowie die juristische Außenvertretung sind in solchen Fällen fast immer tabu. Fällt der Chef aber drei Monate komplett aus, können sogar eine Neueinstellung oder ein Vertragsabschluss sinnvoll und richtig sein.
Grundsätzlich ist der Stellvertreter i. V. befugt und manchmal sogar verpflichtet, alles Notwendige zu tun, damit der laufende Betrieb der Abteilung oder des Unternehmens gesichert ist. Wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn bei Nichthandeln böse Nachteile drohen, können das Entscheidungen von sehr großer Tragweite sein. Der Stellvertreter hat i. V. eine bedingte Generalbefugnis.
1.2.2 Handeln im abgesprochenen Rahmen: im Auftrag (i. A.)Die zweite Art der Stellvertretung, welche die Juristen kennen, heißt „i. A.“, also „im Auftrag“. Sie hat eine kleinere Dimension und sie ist der Normalfall, denn meist ist der Chef nicht allzu lange weg oder für wichtige Entscheidungen per Smartphone greifbar. Handelt der Stellvertreter i. A., dann geschieht dies in einem gewissen Rahmen, der vorher abgesprochen wurde; zumindest erscheint der Rahmen aus dem Zusammenhang klar.
Normalerweise gehören i. A.-Aktionen eines Stellvertreters nicht zum allerengsten Führungshandeln des Chefs. Der Stellvertreter darf i. A. nicht disziplinarisch gegen Mitarbeiter vorgehen ‒ jedenfalls nicht ohne sehr enge Absprache mit dem Chef. Ebenso darf er keine Verträge mit externen Partnern unterzeichnen. Denn der Chef ist ja nicht längere Zeit außer Gefecht. Es droht auch keine Gefahr. Also soll der Chef solche wichtigen Rechtsgeschäfte bitte selbst vollziehen.
Ausnahme wäre, dass ein Chef auch solche Dinge, zum Beispiel Vertragsverhandlungen und -abschlüsse, komplett an seinen Stellvertreter delegiert hätte. Aber das kommt in der Praxis so gut wie nie vor. Vielmehr geht es i. A. meist um Organisationsaufträge („Sorgen Sie dafür, dass …“), Informationsbeschaffung („Kriegen Sie einmal raus, wer …“) oder Projektaufgaben („Erarbeiten Sie dazu einmal ein Konzept und stellen Sie es mir und dem Team vor.“). Es versteht sich von selbst, dass der Stellvertreter den i. A.-Rahmen nicht ohne Weisung oder ohne besonderen Anlass überschreiten darf, denn sonst drohen Konflikte mit dem Chef und schlimmstenfalls sogar juristischer Ärger mit dem Unternehmen. Er würde sich damit selbst sozusagen haftbar für die Folgen seiner Entscheidung machen. Was nicht klug wäre, denn ansonsten genießt der Stellvertreter bei i. A.-Handlungen das Privileg, nur eingeschränkt rechtlich haftbar zu sein.
Der Unterschied zwischen i. A. und i. V. ist zentral für einen Stellvertreter, auch wenn diese Bezeichnungen im Alltag so gut wie nie eine Rolle spielen. Kaum ein Stellvertreter würde etwa E-Mails oder Briefe mit i. A. oder i. V. zeichnen. Dennoch sollte er wissen: In einer i. V.-Situation ist sein Spielraum größer als in einer i. A.-Situation.
Wenn man selbst nicht so genau weiß, welche Funktion man gerade mehr ausübt, sollte man Rat beim Chef oder notfalls beim nächsthöheren Vorgesetzten suchen. So vermeidet man, den üblichen Handlungsrahmen zu verlassen und Entscheidungen zu treffen, die der Situation nicht angemessen sind.
Wer als Stellvertreter handelt, sollte sich fragen, ob er gerade i. V. oder i. A. tätig ist. Manchmal lohnt es sich, das mit Hilfe anderer zu klären. Das gibt dem Stellvertreter wichtige Hinweise auf seinen Handlungsrahmen.
Im Normalfall gilt i. A. und besteht folglich ein eher enger Handlungsrahmen. Bei längerer Abwesenheit des Chefs und bei Dringlichkeit gilt grundsätzlich i. V. Sich das immer wieder bewusst zu machen, sollte einen Stellvertreter allerdings nicht dazu veranlassen, sich selbst dauern auszubremsen. Solange er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich seinen Handlungsrahmen überschreitet, solange er also plausibel begründen kann, warum er eine Entscheidung getroffen hat, kann ihm rechtlich nicht viel passieren. Weil der rechtliche, der formale Handlungsrahmen nicht hundertprozentig klar definierbar ist, kann ein Stellvertreter seinen informellen Spielraum meist eher offensiv interpretieren. Genaueres dazu in den beiden folgenden Abschnitten.
1.2.3 Weisungsbefugnis des StellvertretersVorher aber noch ein Wort zu einer Gretchenfrage, die Stellvertreter häufig stellen: „Bin ich eigentlich weisungsbefugt gegenüber den Mitarbeitern meines Teams“? Darauf gibt es zwei richtige Antworten. Zum einen: Ja, wenn Sie i. V. handeln oder i. A. in einem Rahmen, den Sie sauber mit Ihrem Chef geklärt haben, dann dürfen Sie Anweisungen erteilen und die Mitarbeiter sind gehalten, diesen Folge zu leisten. Zum anderen jedoch: Ein kluger Stellvertreter reizt diese eher theoretische Befugnis nicht aus, oder wenn, dann nur nach ausführlicher Rücksprache mit dem Chef oder anderen Ratgebern und nur im Ausnahmefall.
I. V. mag ein solcher Fall etwas häufiger vorkommen als i. A., letztlich aber tut ein Stellvertreter gut daran, es nicht darauf ankommen zu lassen. Schriftliche Anweisungen oder gar Abmahnungen taugen nicht für den Führungsalltag. Sie sind Eskalationsstufen für Konflikte, die anders nicht mehr lösbar erscheinen. Das gilt für Linienvorgesetzte, aber umso mehr für Stellvertreter.
Ein Stellvertreter, der schriftliche Anweisungen verteilt, hat ein Problem mit der Akzeptanz im Team ‒ oder er wird es sehr bald bekommen. Die Weisungsbefugnis mag also eine wichtige Karte im eigenen Blatt sein, aber man gewinnt das Spiel eher, wenn man sie nicht auf den Tisch legt. Das gilt besonders vor dem Hintergrund des Trends zur kooperativen und zur kollegialen Führung (auf den wir am Ende dieses Buches zu sprechen kommen): Selbstbewusste Mitarbeiter, die sich ihre Arbeitgeber aussuchen können, lassen sich ungern mit Drohungen und Anweisungen disziplinieren.
1.3 Formeller Handlungsrahmen des StellvertretersSchauen wir uns einmal an, welchen formellen Handlungsrahmen Stellvertreter in ihren Betrieben oder Behörden ganz praktisch von den Chefs eingeräumt bekommen. Formell heißt hier: Das ist so besprochen oder zumindest allen Beteiligten aus der Praxis klar. Hier lassen sich fünf Stufen unterscheiden:
Stellvertretung ohne Benennung und Befugnis:
Dieser Stellvertreter ist eigentlich keiner. Der Chef hat ihm einmal unter vier Augen gesagt, er solle „einmal ein Auge auf alles haben“, während er selbst, also der Chef, im Urlaub ist. Sonst weiß davon offiziell niemand. Der Chef ruft aus dem Urlaub täglich an und trifft sogar kleine Entscheidungen selbst. Der inoffizielle Stellvertreter versteht dann meist selbst nicht, was er eigentlich soll und darf.
Stellvertretung ohne klare Befugnis:
Dieser Stellvertreter ist zwar dem Team gegenüber benannt worden, aber wenn man ihn etwas fragt, sagt er recht oft: „Da muss ich einmal den Chef fragen.“ Mit dem war nie zu klären, welchen Handlungs- und Entscheidungsrahmen es gibt. Einmal beschwert sich der Chef, dass der Stellvertreter nichts entschieden hat, dann wieder, dass er zu viel entschieden hat ‒ und macht dann alles rückgängig.
Stellvertretung in Abwesenheit:
Dieser Stellvertreter tritt nur bei längerer Abwesenheit des Chefs in Erscheinung, also bei Krankheit und Urlaub. Für diesen Fall allerdings weiß er, welchen Handlungsrahmen er hat. Das haben sein Chef und er vorher besprochen und im Idealfall sogar schriftlich festgehalten.
Stellvertretung bei Verhinderung: