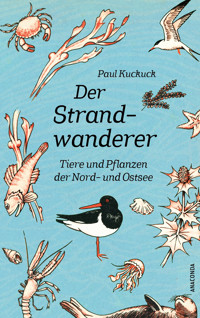
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ist das ein Seehund oder eine Robbe? Wie heißt diese Muschel? Was sind das für Gräser da auf der Düne? Wer dieses Buch mit sich führt, wird darüber verlässlich ins Bild gesetzt: mit detailliert gearbeiteten Schautafeln und exakten Beschreibungen. Seit seinem Erscheinen vor über einhundert Jahren war dieses Buch lange ein Standardwerk unter den Bestimmungsbüchern. Und seinem Zweck, wissbegierigen Menschen am Strand ein Begleiter und Ratgeber zu sein, dient es noch heute. Die Bildtafeln entfalten dabei den Reiz eines liebevoll gestalteten Wimmelbuchs im Vintage-Look.
- »An Sachlichkeit, Schärfe und Genauigkeit sind seine Zeichnungen unübertrefflich.« R. Pilger
- Der Bestimmungsbuch-Klassiker für Nord- und Ostsee mit sorgfältig und naturgetreu gearbeiteten Bildtafeln
- Die kostbare Flora und Fauna deutscher Küstenregionen erkennen: Von der Weißen Pfeffermuschel bis zur Becherqualle, von der Nordischen Meerestraube bis zum Prachttaucher
- »Das vorliegende kleine Werkchen soll allen denen, die im Sommer in den deutschen Seebädern Erholung suchen, ein Begleiter und Ratgeber sein.« Paul Kuckuck
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dr. Paul Kuckuck
Der Strandwanderer
Die wichtigsten Strandpflanzen, Meeresalgen und Seetiere der Nord- und Ostsee
Mit 24 farbigen Tafeln von J. Braune,3 nach F. Murr, 1 nach E. Weber-Leskin und 4 schwarzen Tafelnnach Zeichnungen von Dr. E. Ziegelmeier und F. Murr
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie the Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschütztenInhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach§ 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermitausgeschlossen.
Die erste Auflage dieses Werks erfolgte 1905 durch den Autor, Kustos fürBotanik an der Biologischen Anstalt auf Helgoland, Prof. Dr. Paul Kuckuck,im J. F. Lehmanns Verlag München. Der Text wurde behutsam überarbeitetund auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2025 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
Umschlagmotiv: Motive aus »Der Strandwanderer«, 1957
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-32436-0V002
www.anacondaverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Was können wir an der Meeresküste beobachten und finden?
1. Das Seewasser
2. Das Leben im freien Wasser
3. Das Angespül
4. Der Gezeitengürtel
5. Vorstrand und Klippen
6. Die deutsche Seefischerei
Strandpflanzen
Meeresalgen
Blaugrüne Algen, Cyanophyceen
Grünalgen, Chlorophyceen
Braunalgen,Phaeophyceen
Rotalgen, Rhodophyceen oder Florideen
Wirbellose Seetiere
Schwämme (Spongien, Porifera)
Stamm der Hohltiere(Coelenterata)
Klasse Korallentiere (Anthozoa)
Scheibenquallen und Becherqualle (Klasse Scyphozoa)
Kamm- oder Rippenqualle (Ctenophora)
Borstenwürmer (Polychaeta)
Krebse (Crustacea)
Weichtiere (Mollusca)
Muscheln(Bivalvia)
Schnecken (Gastropoda– Bauchfüßer)
Ordnung Nacktkiemer (Nudibranchiata) der Hinterkiemer
Kopffüßer (Cephalopoda)
Sterntiere oder Stachelhäuter (Echinodermata)
Moostierchen (Bryozoa)
Seescheiden (Ascidiacea)
Wirbeltiere des Meeres
Fische (Pisces)
Hundsrobben(Phocidae)
Wale (Cetacea)
Die Vogelwelt am Strand und auf dem Meer
Bestimmungsschlüssel der Vögel
Register
Vorwort
»Der Strandwanderer« soll kein Lehrbuch der marinen Biologie sein, sondern es dem Anfänger und dem Laien ermöglichen, die Namen der gefundenen Arten kennenzulernen und etwas über ihre Lebensweise und ihren Körperbau zu erfahren. Für die erste Bekanntschaft mit den kleinen und großen Wundern des Lebens sind gerade biologische Tatsachen erforderlich. Schließlich wird auch in der Einführung wie bei einzelnen Arten auf die Wichtigkeit des Meereslebens für die menschliche Ernährung hingewiesen. So erfolgte die Überholung des alten Büchleins, das nun bald 50 Jahre seine Dienste anbietet. Dem Verlag danken wir bestens für die bereitwillige, gute Ausstattung des Werkes.
Die künstlerisch wertvollen farbigen Originale des Porzellanmalers Julius Braune wurden im 2. Weltkrieg vernichtet, die Druckstöcke blieben jedoch erhalten bis auf Tafeln 3, 11, 13, 15 und 19; diese wurden von Dr. Ziegelmeier-List kopiert und zum Teil korrigiert (15 und 19). Sie bilden auch heute noch die Grundlage für Kuckucks Strandwanderer, den die Biologische Anstalt Helgoland nach dem Tode von Prof. Kuckuck (1918) seit 1922 neu herausgegeben hat. Der Text wurde sorgfältig durchgesehen und nach dem neuen Stand der Meeresbiologie überholt. Die Abbildungen der Muscheln und Schnecken wurden durch zwei Schwarz-Weiß-Tafeln nach Zeichnungen von Dr. E. Ziegelmeier ergänzt. Neu hinzu kamen drei bunte und zwei schwarze Tafeln über die Vogelwelt unserer Küsten, die der Tiermaler Franz E. Murr, Bad Reichenhall, geschaffen hat. Ferner wurden zwei Abbildungen von Borstenwürmern von Dr. E. Ziegelmeier aufgenommen. Die Einführung wurde neu bearbeitet. Die Durchsicht des botanischen Teiles übernahm der Botaniker der Anstalt, Prof. Dr. P. Kornmann, den ornithologischen Text Prof. Dr. Drost Wilhelmshaven. Für wertvolle Hinweise bei der Ergänzung und Verbesserung des Textes danke ich den Herren Dr. Linke-Norderney und Dr. Lundbeck-Bremerhaven bestens.
z. Zt. List/Sylt, Dezember 1952.
Dr. A. Hagmeier
Not. Die erste Auflage erfolgte 1905 durch den Autor, Kustos für Botanik an der Biologischen Anstalt, Prof. Dr. P. Kuckuck (1866–1918). Er erwähnte im Vorwort die Mithilfe von den Professoren F. Heincke (1852–1929), Cl. Hartlaub (1858–1928) und E. Ehrenbaum (1861–1942) und gab einen Nachruf für den Hersteller der farbigen Tafeln, den Porzellanmaler Julius Braune (1879–1903).
Die 3. Auflage erschien 1922, herausgegeben von der Biologischen Anstalt. An ihr wirkten mit Prof. Mielck (1878–1933), Prof. Nienburg (1882–1932), Dr. Hagmeier, Dr. Weigold und Prof. H. Wachs.
Auch die 5. Auflage (1933) wurde von der Biologischen Anstalt herausgegeben unter Mitwirkung der Professoren Mielck, Hagmeier, Schreiber, Drost und Hertling (1891–1942). Die Tafel der Meeressäugetiere stammte von dem Maler E. Weber-Leskin, Berlin. Die Zeichnung der Wollhandkrabbe lieferte A. Holtmann-Helgoland.
Mittlerer Tidenhub für einige Orte der Deutschen Bucht in Metern (aus Hoch- und Niedrigwasserzeiten, Deutsches Hydrogr. Institut 1952)
b) Salzgehalt und Temperatur
Gewöhnlich gibt man den gesamten Gehalt des Meerwassers an Salzen in Gramm an, die in einem Liter aufgelöst sind, also in Promille. Die Nordsee ist ein Randmeer des Nordatlantischen Ozeans; sie steht durch den Ärmelkanal und durch den breiten Zugang zwischen Schottland und Südnorwegen mit diesem in Verbindung. Namentlich im Winter dringt das etwa 35 ‰ Salzgehalt aufweisende Ozeanwasser in einer breiten nördlichen und einer schmalen südlichen Zunge in die Nordsee vor, im übrigen Jahr ist der Zustrom zwar auch vorhanden, macht sich aber weniger bemerkbar, die freie Nordsee zeigt dann etwa 34 ‰ Salzgehalt. Dieser ist somit für die meisten Ozeantiere kein Hindernis, in der Nordsee weiterzuleben, wenn sie als fertige Tiere oder als Larven mit der Strömung hereingekommen sind. Ausschlaggebend ist dabei aber wahrscheinlich die Temperatur, und zwar der in der Nordsee mit etwa 10° Celsius bedeutende Unterschied zwischen Sommer- und Wintertemperatur des Seewassers. Im Küstengebiet selbst finden wir einen Salzgehalt von etwa 30–33 ‰, und in den Mündungstrichtern tritt durch das Frischwasser eine weitere Aussüßung ein, wobei örtlich große Schwankungen je nach Tide und Windrichtung vorkommen. Die Temperaturen nähern sich den Landtemperaturen mit ihren erheblichen Unterschieden zwischen Sommer und Winter. Es bleiben dann nur solche Arten im Gedeihen, denen die genannten Schwankungen in ihren Extremen nichts schaden.
Die Ostsee ist ein Mittelmeer, das durch die engen und flachen Belte und den Sund über Kattegat und Skagerrak mit der Nordsee in Verbindung steht. Das Ostseewasser ist durch die einmündenden Ströme stark ausgesüßt und fließt in der Oberschicht zur Nordsee. Ein Gegenstrom von Nordseewasser dringt wohl in der Tiefe, namentlich durch den Sund, ein, doch stagniert dieses Tiefenwasser in den Ostseemulden oft lange Zeit, eine Durchmischung und Durchlüftung tritt nur im westlichen Teil der Ostsee mehr oder weniger stark ein. Nach Osten zu nimmt der Salzgehalt ständig ab, wir finden z. B. bei Kiel 13–20 ‰, bei Rügen 8 ‰, bei Gotland 6–7 ‰ im Oberflächenwasser. Im Bottnischen und Finnischen Meerbusen sinken diese Werte dann bis auf 3 ‰ und darunter. Brackwassertiere und einige Süßwasserarten nehmen allmählich immer mehr den Platz der echten Meerestiere ein. Bemerkenswert sind eine Anzahl von Bodentieren in dem erwähnten Muldenwasser, die der Nordsee fehlen und erst in den subarktischen und arktischen Gewässern wieder reichlich vorkommen: Riesenassel, Astarte-Muscheln (17 I/5–7)2, Macoma calcarea (17 I/17). Auch die Ringelrobbe (25/3) hat ihre Heimat im Norden. Diese Arten sind Überbleibsel (Relikte) aus der eiszeitlichen Ostsee.
2Die Zahlen hinter den Tier- und Pflanzennamen geben Tafel und Fig. an.
2. Das Leben im freien Wasser
Das Meerwasser ist durch seinen ausgeglichenen Gehalt an gelösten Salzen, darunter den für das Pflanzenwachstum notwendigen Stickstoff- und Phosphorverbindungen, ein idealer Lebensraum für die Organismen. Die kleinen und kleinsten haben keine starke Eigenbewegung, sie schweben oder trudeln mit Schwebeorganen oder Wimpern, sind aber den Bewegungen des Wassers ganz ausgeliefert. Man bezeichnet sie als Plankton, das Umhergetriebene.
Da sind zunächst mikroskopisch kleine, einzellige Pflanzen, Kieselalgen und Farbstoff tragende Einschlüsse besitzende Geißelträger (Flagellaten). Sie sind imstande, im Sonnenlicht durch Aufnahme von Kohlensäure organische Stoffe aufzubauen und sie mithilfe der Nährsalze zur Bildung ihrer Körpersubstanz zu verwenden. In einem ccm Meerwasser leben z. B. im Küstenwasser der Nordsee 1000 bis 2000 einzellige Pflanzen, im freien Wasser bei Helgoland immer noch bis zu 50 Stück. In rascher Folge entsteht eine Generation nach der anderen, ein Werden und Vergehen, das abklingt, wenn die Nährsalze oder auch nur eines davon erschöpft sind. Kommt von den Flüssen her oder aus der Tiefe neue Zufuhr der wichtigen Salze, so beginnt eine neue Entwicklung des Pflanzenplanktons.
Wie überall auf der Erde ist auch im Meer alles Tierleben auf organische Nahrungsstoffe angewiesen, die letzten Endes von den Pflanzen herkommen, auf der Hochsee ausschließlich von den kleinen und kleinsten einzelligen Algen des freien Wassers. Einzellige Tiere und ganz kleine Krebschen, neben mancherlei Larven größerer Tiere, sind die ersten Nutznießer dieser Produktion. Sie leben unmittelbar von den winzigen Planktonalgen, werden aber selbst wieder von größeren Tierchen gefressen. In der Stufenleiter geht es nun weiter bis zum Fisch und dem Säugetier, das sich von Fischen ernährt. Bei der starken Produktion der Pflanzen in der beleuchteten Oberflächenschicht bleiben noch große Mengen übrig, die eines natürlichen Todes sterben und nun in tiefere Schichten, teilweise auch bis zum Meeresboden, absinken. Sie werden unterwegs oder erst am Boden von den Tieren als Nahrung genutzt. Im freien Wasser und am Boden treten gleichzeitig Bakterien auf, von denen die organischen Stoffe wieder zersetzt und abgebaut werden. Dabei werden anorganische Pflanzennährsalze wieder frei, im Wasser gelöst. Sie ermöglichen neues Pflanzenwachstum, sobald sie wieder in die beleuchtete Oberflächenschicht kommen.
Nur der schmale Küstengürtel, soweit das Sonnenlicht bis zum Meeresboden dringt, hat in den Bodenpflanzen noch weitere Produzenten organischer Stoffe. Soweit die Pflanzen nicht selbst von Weidegängern verzehrt werden, leben viele Tiere, auch Planktontiere, von dem feinen Zerreibsel, das alljährlich beim Zerfall der Pflanzen entsteht und teils abgelagert, teils als Wassertrübe aufgeschwemmt wird.
Viele Planktontiere vollführen ihren ganzen Lebenskreislauf im freien Wasser (Einzeller, Kammquallen, Ruderfußkrebschen, Pfeilwürmer u. a.). Die große Mehrzahl in unseren gemäßigten Meeren verbringt nur bestimmte Zeiten im freien Wasser und zwar als Eier oder Larven. Die Letzteren treten zeitweise in riesigen Mengen auf, sodass sie das Aussehen des Planktons bestimmen. Ihre Elterntiere leben am Meeresboden wie Würmer, Muscheln, Seeigel, Seesterne und Schlangensterne, oder sind auf Felsboden oder festen Körpern festgewachsen. Zur Fortpflanzungszeit entlassen sie ihre Eier oder bereits schwimmfähige Larven ins freie Wasser. Mehrere Wochen leben nun die Larven als Plankter und entwickeln sich weiter. Sie sind oft mit besonderen Einrichtungen für das Schweben versehen, ihre Gestalt hat oft einen großen Reibungswiderstand, der das Absinken vermindert oder verhindert. Daher sehen sie in den meisten Fällen, namentlich bei den Stachelhäutern, ihren Eltern am Boden überhaupt nicht ähnlich und machen am Ende ihrer Schwärmzeit eine Umwandlung durch, bevor sie als fertige Jungtiere zum Bodenleben übergehen. Die meisten Fische machen es nicht anders, auch ihre Eier und Larven gehören dem Plankton an.
Alle Planktontiere sind den Wasserbewegungen hilflos preisgegeben, die Larven werden also durch die Wasserströmungen verfrachtet, entfernen sich von ihrem Geburtsort und werden auch in oft sehr weiter Entfernung davon umwandlungsreif, um das Bodenleben aufzunehmen. Das Plankton-Stadium dient also der Ausbreitung der Art. Neue Wohngebiete können infolge des Larventransportes auch von einem unbeweglichen Bodentier erobert werden.
Die formschönen Medusen und die großen, durch ihre nesselnden Fangfäden gefürchteten Quallen gehören dem Plankton bis zur Geschlechtsreife an. Aus ihren Eiern entstehen dann wieder Larven, die sich am Boden zu den verschiedenen Polypenstöcken und Polypenrasen entwickeln.
Eine weitere auffallende Erscheinung im Plankton ist das bekannte Meerleuchten. Es sind bei uns hauptsächlich geißeltragende Einzeller, die bei Berührungsreiz helles Licht ausstrahlen. In der Nordsee ist es besonders das Leuchtbläschen, etwa 1 mm Durchmesser; es ist leichter als Seewasser und sammelt sich bei ruhigem Wetter an manchen Stellen in solchen Massen an, dass das Wasser rötlich wie eine Tomatensuppe gefärbt erscheint.
In der Ostsee können mikroskopisch kleine Panzergeißler (Peridineen) ebenfalls in Massen auftreten und Meerleuchten verursachen.
Das freie Wasser ist außerdem noch von kräftigen Schwimmern, dem sogenannten »Nekton«, bewohnt, die ihre Wege auch unabhängig von den Strömungen verfolgen können. Es sind größere und große Tiere wie Kalmare und Fische, auch einige Krebse. Gerade die größten heute lebenden Tiere, die Wale, gehören dem Nekton an. Auf die an treibenden Körpern im freien Wasser lebenden festsitzenden Tiere kommen wir im Abschnitt »Angespül« zurück. Das Leben im freien Wasser spielt also im Haushalt des Meeres eine große Rolle und ist entscheidend für die Ernährung und Verbreitung der meisten Tiere, ebenso für die Besiedelung des Meeresbodens in verschiedenen Tiefen.
3. Das Angespül
Am leichtesten zugänglich sind dem Strandwanderer die Auswürfe des Meeres am Strand. Sie fehlen nur selten bei wochenlang ruhigem Wetter. Nach Stürmen sind sie am mannigfaltigsten, besonders an der offenen Seeküste. Im Angespül liegt nun oft alles durcheinander; eine gewisse Anordnung der Streifen nach der Schwere der angespülten Gegenstände ist jedoch oft zu erkennen, auch kommen »monotone« Strandstreifen vor, die nur aus einer Tier- oder Pflanzenart bestehen. Zum Beispiel können die kleinen Wattschnecken Hydrobia (17 II/14) oft kilometerlange Streifen bilden; im inneren Wattenmeer können die Panzer von kleinen Strandkrabben oder die Klappen von jungen Herzmuscheln in kürzeren Strandsäumen antreiben, aber meistens besteht ein Angespülstreifen an der Landseite aus kleinen Holzstückchen oder Schilfstängeln, gemischt mit leichten Muschelklappen, Seemoosstöckchen, Moostierstöckchen, zuweilen auch vereinzelten Bernsteinstückchen. Weiter nach See zu liegen dann Häufchen und Streifen von größeren Algen, die zum Teil mit ihren Ansatzkörpern, Schalen und Steinchen, angespült sind, gemischt mit größeren Tieren oder Teilen von Tieren. Große, kompakte Strandwälle von Ledertangen schließlich können bei Helgoland, am Sandstrand der Düne oder am Rand der Steilküste auf der Abrasionsterrasse auftreten; hier sind dann oft mit den Algen größere Steine mit dem Haftwurzelgeflecht vorhanden und der Reichtum an kleinen Algen und an Tieren, die sich in den Schlupfwinkeln des Haftapparates oder auf den Algen und Tangen aufhalten. Wir haben also die Gelegenheit, am Strand bereits Pflanzen und Tiere zu finden, die man sonst nur vom Schiff aus mit Netzen und Geräten vom ständig mit Wasser bedeckten Grund hochholen muss. Andere Organismen des Angespüls wieder haben einen langen Weg als Treibsel im freien Wasser zurückgelegt, bevor sie an unserer Küste strandeten, während viele aus der unmittelbaren Umgebung, aus dem Gezeitengürtel stammen. Es sind aber in allen Fällen keine »Gemeinschaften«, die wir am Strand finden, sondern durch physikalische Kräfte (Wind, Wellen, Strömungen) zusammengebrachte und aussortierte Ansammlungen. Einige Beispiele mögen angeführt werden, um dem Beobachter am Strand die Einordnung seiner Funde zu erleichtern.
a) Wattenmeer
An der Wattküste finden wir außer den bereits genannten Säumen größere und kleinere Haufen von Fucus mytili, die mitsamt ihrem »Anker« von den Muschelbänken losgerissen wurden und an den Strand rollten. Die Tange sind noch mit den Miesmuscheln und dem Schill, oft auch mit kleinen Steinchen versponnen und in dem Genist halten sich Flohkrebse (Gammarus locusta) und verschiedene Würmer auf. Liegt solch ein Klumpen längere Zeit am Strand, so verfaulen die Tange und die Tiere sterben ab, sodass schließlich nur ein Klümpchen aus Schill und Steinen übrig bleibt, das durch die zähen Byssusfäden der Miesmuscheln noch zusammengehalten wird. An anderen Stellen liegt ein Band von Seegras (jetzt nur Zostera nana), je nach der Jahreszeit aus kurzen oder längeren Einzelblättern bestehend. Hochliegendes, angespültes Seegras wird oft von Sand überdeckt und ermöglicht dann verschiedenen Strandpflanzen (Meersenf, Salzkraut, Wegerich, Salzmiere u. a.) das Gedeihen. Weitere Geniste liefern die vom brackigen Uferrand losgerissenen Wurzelstöcke des Schilfes, zuweilen auch die des von Abbruchkanten stammenden Helmes oder Torfstückchen vom Abbruch von unterseeischen Torflagern. An anderen Stellen wieder finden wir zuweilen die aufgerollten oder zerfetzten Decken von Wattalgen, das sogen. Wattenpapier (Vgl. 5/7). Am besten erkennbar sind die Weichtiergehäuse, die Schneckenhäuser und Muscheln; Letztere finden wir meistens in einzelnen Klappen, noch zusammenhängende Doppelklappen oder »Dosen« sind nur dann anzutreffen, wenn die Muscheln lebend an den Strand spülten und dort abstarben, sodass der Weichkörper verfaulte. Auch mit Schlick gefüllte vollständige Gehäuse von Muscheln können angespült werden.
Fast alle Arten der Watten-Muscheln und -Schnecken können wir am Strand finden. Aus verschiedenen Bodenarten, von der unteren Gezeitenzone an abwärts stammt die Rote Bohne, Macoma baltica (17/10), vom weichen Schlick der oberen Gezeitenzone die Pfeffermuschel (17 I/20), vom zähen Klei die amerikanische Bohrmuschel (17 I/16), eben unterhalb der Gezeitenzone, vom schlickigen Sand der oberen Gezeitenzone die Klaffmuschel (17/12 und 17 II/7), von ähnlichem Grund im tieferen Wasser die abgestutzte Klaffmuschel (17 II/8), die Teppichmuschel (17 I/14), und zuweilen die weiße Pfeffermuschel, Abra alba (17/8 und 17 I/21). Vom lockeren Sand in verschiedenen Tiefen stammt die Herzmuschel (17/4), deren Gehäuse und Klappen oft in riesigen Mengen zusammengeschwemmt werden, nicht nur am Strand, sondern auch in den Rinnen und Prielen. (Gewinnung des Muschelschills mit Saugbaggern.) Als Seltenheit finden wir am Wattstrand zuweilen die im feinen, reinen Sand lebende dünne Plattmuschel Angulus tenuis (17 I/18). Austernschalen sind selten, oft massenhaft sind jedoch die Schalen der anderen auf dem Boden lebenden Muschel, der Miesmuschel.
Dazu kommen die Gehäuse der Schnecken, von denen die Strandschnecke (18/9) die häufigste ist. Manchmal tritt auch die durch ihre Gestalt auffallende Pantoffelschnecke (17 II/12), zahlreich auf. Mehr vereinzelt finden wir Wellhornhäuser (18/2) und Netzreusenschnecken (18/4). Der sorgfältige Sammler kann zuweilen auch die hornigen Deckel der genannten Vorderkiemer im Schillgrus am Strand finden. Von Krebspanzern sind zunächst die Seepocken (15/8 u. 9) zu erwähnen, oft sind Miesmuschelklappen und Strandschneckenhäuser oder Herzmuschelklappen dicht mit den Kratern der Seepocke besetzt, die Deckelstücke sind nach dem Tod der Krebschen abgefallen. Kopfbrustpanzer und Gliedmaßen der Strandkrabbe (15/2) sind häufig, seltener die Scheren von Einsiedlern, zuweilen auch Panzer und Scheren des Taschenkrebses (15/1). Im Gezeitengebiet der Flussmündungen finden wir Überreste von Wollhandkrabben. Vom Strandigel (20/8) liegen ganze Kapseln, abgefallene Stacheln oder einzelne Kalkplatten herum, Seesterne bleiben infolge ihrer derben Kalkhaut heil und sind zu Trockenpräparaten geworden, sie stammen von den tieferen Stellen des Wattenmeeres und lebten auf den Austern- und Muschelbänken. An wenigen Tagen Mitte April enthält das Angespül oft große Mengen der stattlichen Seeringelwürmer Nereis virens, die nach ihrem Ausschwärmen zur Laichabgabe tot oder sterbend angespült werden. Andere Borstenwürmer liefern ihre Wohnröhren zum Angespül, so vereinzelt der Köcherwurmund manchmal der Bäumchenröhrenwurm, dessen bei Oststürmen und sehr tiefem TNW losgerissene Wohnröhren dicke Angespülbänder bilden können. Sandrollen des Pümpwurms (14/5) sind oft vorhanden.
Die hier von der Wattküste genannten Arten waren an ihrem natürlichen Standort alle Mitglieder der Küstengemeinschaft des Meeresbodens, die man nach der hier überall zu findenden Muschel die »Macoma baltica-Gemeinschaft« nennt. Sie bewohnt an der Nordsee die Gezeitenzone und darunter den Küstenstreifen bis etwa 15 m Tiefe. In der Ostsee ist die Küste ebenfalls von dieser Muschel und den mit ihr gemeinsam lebenden Arten bewohnt, doch kommt sie in der Ostsee bis 140 m Tiefe vor. Die Artenzahl der Gemeinschaft nimmt ab, je weiter wir nach Osten kommen; auch die Größe der einzelnen Tiere bleibt geringer, je geringer der Salzgehalt wird.
b) Angespül am Sandstrand der offenen See
Der offene Seestrand ist der Einwirkung der Wellen viel stärker ausgesetzt als der Wattstrand. Er kann bei auflandigem Sturm umgelagert und reingefegt werden; dieselben Sturmwellen bearbeiten dabei auch in größeren Entfernungen von der Strandlinie den Bodengrund und bringen viele auf dem Boden lebende Pflanzen und Tiere zum Treiben. Auch der lockere Boden selbst wird dabei aufgewühlt und seine Bewohner werden mitgeführt. Dabei geraten auch schwere Körper ins Treiben, wenn sie durch aufsitzende Hydroidenbüsche oder Algen und Tange einen »Auftrieb« erhalten. Auch durch Aufnahme von Luft oder bei toten Tieren durch die Entstehung von Fäulnisgasen in geschlossenen Hohlräumen (Gehäusen, Kapseln, Panzern), kann dieser Auftrieb entstehen.
Sobald nun der Sturm abflaut oder eine andere Richtung annimmt, kommt das »Treibsel« an den Strand und wir finden ein mannigfaltiges Angespül: Lange Streifen von Meeresalgen, deren Arten zeigen, dass sie nicht von der Nähe stammen, sondern wahrscheinlich von der englischen oder schottischen Felsküste. Auffallend sind z. B. die großen Brauntange wie Ledertange (7/8–10), Riementang (8/4), zuweilen mit den Schüsselchen und den Haftwurzeln, Knotentang (8/3) und Blasentang (8/1). Dazwischen liegen die oft aufgewachsenen zierlichen Rotalgen in vielen Arten; Grünalgen sind meist nur wenig vertreten. Zusammen mit den Algen sind eine ganze Anzahl von Tieren angetrieben, die als Mitglieder der Epifauna, d. h. der auf dem Meeresboden lebenden Tiere, von den Wellen mitgenommen wurden. Dazu gehören Schwämme (11/1–3), ferner alle Tierstöcke der Hohltiere, z. B. Hydroidpolypen (12/4–9), die Lederkoralle (11/8) und zuweilen auch Seerosen. Von den Weichtieren sind es die Auster, Miesmuschel, große Miesmuschel Modiolus modiolus (17 I/4), die Kammmuscheln, die Strandschnecken (18/9), Wellhornschnecke (18/2), selten die nordische Purpurschnecke (18/3), Napfschnecken (18/15 u. 16), Kreiselschnecken (18/13) und die kleine Lora turricula (17 II/15). Auch Käferschnecken (18/17) werden zuweilen gefunden. Auffallend sind die Eikapselklumpen der Wellhornschnecke (18/2), ferner die Büschel von Moostierchen, namentlich der beiden Flustra-Arten (21/3 u. 4) und von Crisia (21/5), zuweilen finden wir auch die derben, verzweigten Stämmchen des Gallertmoostierchens (21/6) und die hautartigen Überzüge auf Pflanzen und Schill der Membranipora (21/1 u. 2). Von Röhrenwürmern sind auf Schill und Steinen die Kalkröhren des Dreikantwurmes (14/7) und die Sandröhren der Sandkoralle (14/5) leicht zu erkennen, ebenso auf Tangen die kleinen Spiralen des Posthörnchen-Röhrenwurms (14/8). Von Krebsen seien die Seepocken (15/8 u. 9) erwähnt und die Panzer von Krabben (15/1 u. 16/5 u. 6), Einsiedlern (15/3) und Garnelen (15/6).
Bei dem aus dem lockeren Boden ausgespülten Material, das von Mitgliedern der Infauna stammt, interessieren am meisten die Weichtier-Gehäuse. Sie bestehen aus einem dauerhaften Stoff (in organischer Grundmasse, Conchin, dicht eingelagertem kohlensaurem Kalk), sind formschön, oft auch farbig und mannigfaltig gestaltet. Daher werden sie von vielen Küstenbewohnern zur Anlage von Sammlungen gesucht. Es ist tatsächlich möglich, im Laufe der Zeit die meisten Muscheln und Schnecken der Nordsee und Ostsee am offenen Seestrand zu finden. Zunächst treffen wir hier die meisten Muscheln vom Wattstrand wieder, denn die Küstengemeinschaft erstreckt sich ja auch ein Stück in die offene See.
Weitere Lebensräume treten indes dazu: Der breite Sandgürtel der südlichen Nordsee, der die Küste etwa von der 15- bis zur 30-m-Tiefenlinie umsäumt, enthält weite, sandige Flächen und kleinere Vertiefungen, in denen der Sand mit Schlick gemischt ist, ferner niedrige Kuppen mit grobem Sand oder Kies, die sogenannten Riffe. Die den Sandgürtel bewohnende Fauna im Boden wird nach der überall, wenn auch nur in geringer Stückzahl vorkommenden Venusmuschel (17/6) als Venus gallina-Gemeinschaft bezeichnet. Die verschiedenen erwähnten Sedimente beherbergen Varianten dieser Gemeinschaft, Herzigel (20/9) und Nucula nitida (17 I/1), in den Senken, die dickschalige Trogmuschel (17/7) und Thracia (17 II/11) im Riffgrund, während die Mehrzahl den feineren Sand bewohnt.
Vor den Flussmündungen und vor einigen Seegatten ist der Sandgürtel durch kleinere Flächen mit weichem Schlick unterbrochen, in dem dann neben Nucula nitida (17 I/1) hauptsächlich Abra alba vorkommt (17/8), nach der in den dänischen Gewässern die Abra alba-Gemeinschaft beschrieben wurde. Von hier aus wird auch, allerdings selten, der große Borstenwurm, die Seemaus, Aphrodite (14/1), angespült, ferner der Köcherwurm.
Seewärts an den Sandgürtel schließen sich Senken, Löcher und Rinnen an, die, mit Schlickablagerungen versehen, eine reiche Fauna von Würmern, Stachelhäutern, Flohkrebsen und meist kleinen, dünnschaligen Muscheln beherbergen, zu denen noch lang gestreckte Gehäuseschnecken kommen. Als Charaktertier dieser »Schlickbodengemeinschaft der offenen See« wird der Schlangenstern mit der weichen Scheibe und den sehr langen, bestachelten Armen bezeichnet, Amphiura filiformis (20/6). Diese Art wird wohl infolge ihrer Hinfälligkeit kaum im Angespül gefunden werden, sie lebt aber am natürlichen Standort in großer Stückzahl, eingegraben im weichen Schlick. Weitere auf die Amphiura-Gemeinschaft beschränkte Arten sind die Turmschnecke (18/7) und die unechte Wendeltreppe (18/8).
Es gibt eine Reihe von Arten, die in allen drei Gemeinschaften vorkommen, die übrigen sind in bestimmten Gemeinschaften am zahlreichsten. Auch gibt es keine scharfen Grenzen zwischen den Gemeinschaften, wenn nicht die Bodenbeschaffenheit selbst der Umgebung gegenüber scharf abgegrenzt ist, wie an den Rändern der Bänke oder Steinkanten, Riffe oder Schillpflaster.
Eine der häufigsten Muscheln im Angespül ist die gedrungene Trogmuschel (17 II/5) aus der Küsten- und Sandgürtel-Gemeinschaft, deren zeitweise vorkommenden Massenentwicklungen große Schillmengen hinterlassen. Von den Riffgründen des Sandgürtels stammen die größere, dickschalige Trogmuschel (17/7), die gebänderte Dreieckmuschel (17/9) und die Sandkorn-Astarte, ferner Thracia papyracea (17 II/11), die nur vereinzelt gefunden wird.
Aus den reinen Sandböden des Sandgürtels stammen die kleinen Angulusarten, tenuis mit glatten Klappen und fabula, deren rechte Klappe außen fein schräg gestreift ist, und die großen Messerscheiden (17/11), zuweilen auch Abra prismatica (17 I/23). Die schlickhaltigen Senken des Sandgürtels können die seltenen Arten Psammobia, (17 II/1) und Dosinia (17 I/13), ferner in größeren Mengen die kleine Montacuta bidentata (17 I/9) und die mit dem Herzigel zusammenlebende Montacuta ferruginosa (17 I/8) liefern, ferner im tieferen Wasser Cardium fasciatum (17 I/11) und Aloidis gibba(17 II/6). Von Schnecken leben hier namentlich die glänzende Nabelschnecke (17 II/13). Hier ist auch der Wohnort der schönen Strahlenkorbmuschel (17 II/4) und der bereits erwähnten glänzenden Nussmuschel (17 I/1). Schlicksand und Schlick beherbergen die kleine Messerscheide, Phaxas pellucidus (17 II/2).
Die große Nussmuschel (17 I/2) und die ovale Venusmuschel (17 I/15) kommen nur von der Helgoländer Tiefen Rinne, während die stachlige Herzmuschel (17 I/10), die große Nabelschnecke (18/6), der Pelikanfuß (18/5) und die kleinen Muscheln Abra nitida (17 I/22) und Nucula tenuis (17 I/3), die schwere große Muschel Cyprina islandica (17/5) im ganzen Gebiet der Amphiura-Gemeinschaft verbreitet sind.
Fossile Gehäuse
Bei den Muscheln und Schnecken ist noch zu bemerken, dass nicht nur rezente, das heißt zur Jetztzeit lebende Arten angespült werden, sondern auch Gehäuse aus Ablagerungen wieder ausgewühlt und an den Strand gebracht werden. Als Beispiel sei die öfters gefundene große Teppichmuschel Paphia senescens genannt, die in der Eem-Nordsee lebte. Auch Gehäuse von Muscheln und Schnecken der heutigen Nordsee können aus Jahrtausende zurückliegender Zeit stammen, als die Nordseeküste weiter seewärts lag, das sind zum Beispiel Herzmuscheln und Austern, die heute am offenen Sandstrand liegen, nachdem sie aus alten Strandablagerungen wieder ausgespült wurden.
Von den Stachelhäutern finden wir am häufigsten die Kapsel des Herzigels, der in den Senken des Sandgürtels und in der Amphiura-Gemeinschaft in großen Mengen vorkommt. Seltener ist der auf Schillgrund lebende Purpur-Herzigel, Spatangus purpureus. Zuweilen treten die starken kleinen Kapseln des Zwerg-Schildigels, Echinocyamus pusillus auf; von Schlangensternen finden wir zuweilen die beiden Ophiura-Arten (20/5). Die futteralähnlichen hornigen Eikapseln von Rochen (24/3) werden häufig leer angespült, selten die vom Katzenhai (24/2). Zuweilen liegen Mengen von Sepiaschulpen (19/5) auf dem Strand.
Anderes Strandgut der offenen Küste stammt aus dem freien Wasser, es sind drei Gruppen: Planktontiere, die keine ausgiebige Eigenbewegung haben, sondern dem Transport durch die Wasserströmungen ausgesetzt sind; Nektontiere,das sind aktive, kräftige Schwimmer, die bei außergewöhnlich hohen Wasserständen oder bei Sturm auf den Strand verschlagen wurden und schließlich auf leichten, im Wasser treibenden Gegenständen aller Art festgewachsene Tiere und Pflanzen, die zusammen mit ihrer Unterlage antrieben.
Zur ersten Gruppe gehören neben vielen kleinen Medusen, Krebschen u. a., die dem Beobachter meistens entgehen, z. B. die Seestachelbeeren (Pleurobrachia) (13/5) und die großen auffallenden Quallen (13/1–4), die namentlich im Herbst ganze Spülsäume bilden können. Alle vier in der südlichen Nordsee vorkommenden Arten kann man auf dem Strand finden, die meisten im Spätsommer, wenn zu den Ohrenquallen und Haarquallen noch die Kompassqualle und die Blumenkohlqualle hinzugekommen sind.
Zur zweiten Gruppe gehören verschiedene Fische; die in dichten Schwärmen ziehenden jungen Heringe und Sprotten werden zuweilen von Makrelen gejagt und stoßen auf der Flucht weit gegen den Strand vor. Liegen sie einmal auf dem Sand, so können sie sich nicht mehr ins Wasser retten. Selten stranden auf ähnliche Weise auch größere Schwimmer, wie etwa ein Tümmler (25/4) oder ein anderer, kleinerer oder größerer Wal, der sich in die flachen Küstengewässer verirrte. Kalmare (19/4), die schnellen Schwimmer unter den Tintenfischen, können im Jagdeifer selbst auf den Strand geraten, aber auch Krebse wie die Schwimmkrabbe (16/6) kommen zuweilen ins Angespül.
Die dritte Gruppe liefert wohl die meisten interessanten Funde am Strand, losgerissene Glas- oder Metallkugeln von Fischernetzen, Korkstücke, Holzstücke (Kisten, Bretter und Balken), Fender, Rettungsringe, leere Flaschen u. a. mehr, die irgendwann und irgendwo ins freie Wasser kamen, zuerst frei von Organismen. Freischwimmende Schwärmsporen von Algen, Larven von Hydroidpolypen (12/1–9) oder von Medusen, ansatzreife Larven von Seepocken und Entenmuscheln (15/7) oder von Muscheln und Würmern setzten sich auf den zunächst sauberen, schwimmenden »Ansatz«-Körper. Je nach der Jahreszeit und dem Gewässer sind es einmal nur eine oder sehr wenige Arten, die sich den neuen Wohnort erobern und nun prächtig gedeihen, da sie in der obersten Wasserschicht reichlich Nahrung finden. In kurzer Zeit wachsen hier Hydroidpolypen zu großen Kolonien heran, die oft den ganzen Treibkörper mit einem zierlichen lebenden Gespinst überziehen. Andere Körper werden mit Entenmuscheln bewachsen, andere wieder mit Seepocken. Im Laufe der Zeit treten nun in dem Bewuchs Änderungen ein durch Ansiedlung neuer Larven, z. B. von den Feinden der Hydroidpolypen, den Nacktschnecken, oder den Gespenstflohkrebsen. Selbst Tiere, die für gewöhnlich frei am Boden leben, können sich an Treibkörpern festsetzen oder zwischen den Erstsiedlern guten Unterschlupf finden. So sitzen in treibenden Kisten zuweilen junge Kammmuscheln (17/2), kleine Seesterne (20/1), Seeigel (20/7), Schlangensterne (20/4) (Ophiothrix); selbst die in der Nordsee nicht vorkommenden Haarsterne sind schon an Treibholz zwischen anderem Aufwuchs gefunden worden. Sie hatten wohl eine lange Reise aus nördlichen Gewässern hinter sich. Holzkörper werden in unseren Breiten auf See in der Regel sehr bald von Bohrmuscheln der Gattung Teredo (17/14) befallen, oft so stark, dass das Holz ganz durchlöchert ist von den mit Kalk ausgekleideten Bohrgängen dieser Tiere. Weiches Holz und Torf enthält oft die krause Bohrmuschel (17 II/10).
In den flachen Küstengewässern sind es auch Pflanzen, die einen Treibkörper bewachsen können, meistens die an starkes Licht angepassten Grünalgen, auch festsitzende Kieselalgen (Diatomeen) stammen aus diesen Gewässern. Bemerkenswert ist es, dass die Grünalgen oft, aber nicht immer, auf einem tierischen »Erstsiedler« angewachsen sind, z. B. auf den Kalkgehäusen von Seepocken, wobei diese dann in der Regel schon abgestorben sind und nur der Krater und die Grundplatte des Gehäuses übrig blieb. Es entstehen also nacheinander





























