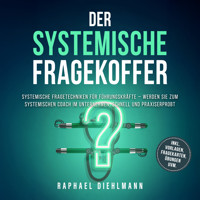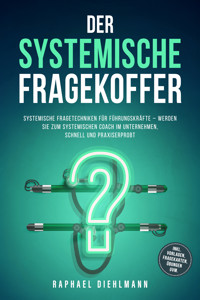
Der systemische Fragekoffer: Systemische Fragetechniken für Führungskräfte – werden Sie zum systemischen Coach im Unternehmen, schnell und praxiserprobt - inkl. Vorlagen, Fragekarten, Übungen uvm. E-Book
Raphael Diehlmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Lunerion
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Systemische Fragetechniken: Mit den effektiven Methoden systemischer Fragen komplexen Problemen auf den Grund gehen und für langfristige Erfolge im Unternehmens-, Beratungs- und Coaching-Kontext sorgen Sie interessieren sich dafür, als systemischer Coach tätig zu werden? Haben Sie eine Führungsposition inne und möchten konstruktiver an Schwierigkeiten arbeiten? Oder wollen Sie grundsätzlich lernen, Probleme in Beruf und Alltag wirklich an der Wurzel zu packen? Dann zeigt dieser Ratgeber Ihnen, wie das mit dem systemischen Ansatz gelingt! Scheint ein Problem auf den ersten Blick klar umgrenzt, heißt das meist: Ein zweiter Blick ist dringend geboten, denn Schwierigkeiten entstehen meist innerhalb des Geflechts eines Systems wie Familie, Arbeitsteam, Unternehmen oder Freundeskreis. Um nicht nur oberflächliche Korrekturen vorzunehmen, die das eigentliche Problem schnell wieder zurückkehren lassen, ist deshalb ein systemischer Ansatz nötig – und dabei sind systemische Fragen eine unschlagbare Allzweckwaffe. Dieses Buch macht Sie zunächst mit den Grundlagen der Systemtheorie sowie des systemischen Coachings vertraut und führt Sie anschließend detailliert in die verschiedenen Fragetechniken ein: zirkuläre Fragen, hypothetische Fragestellung, Skalierungsfragen und viele weitere Varianten lernen Sie mit zahlreichen Praxisbeispielen sowie ergänzenden Übungen selbst anwenden und erwerben die Kompetenz, Beratungsgespräche unter systemischen Gesichtspunkten aufzubauen und abzuhalten. Sie haben noch keinerlei Erfahrung? Kein Problem! Denn mit den einfachen und leicht verständlichen Grundlagen steigen Sie auch als Anfänger mühelos in die Thematik ein und erarbeiten sich Schritt für Schritt alle Fähigkeiten, die Sie für eine erfolgreiche systemische Intervention benötigen. Systemtheorie-Basics: Lernen Sie die wichtigsten Grundlagen rund um Systemtheorie und systemische Fragestellung kennen und werden Sie in kürzester Zeit zum Theorieexperten. Praktische Umsetzung: Erfahren Sie, wie Sie systemische Ansätze im Coaching, in der Beratung und im beruflichen Kontext nutzen können und wie Sie Interventionen konkret vorbereiten, durchführen und auswerten. Handwerkszeug: Offene Fragen, lösungsorientierte Fragen, zirkuläre Fragen, Wunderfragen, internalisierende Fragen – erlernen Sie mit Übungen und Anwendungsbeispielen gezielt den Einsatz und die Auswertung verschiedener Fragetechniken. Systemischer Methodenkoffer: Mit aktivem Zuhören, gewaltfreier Kommunikation und Methoden systemischer Gesprächsführung erarbeiten Sie sich die Fähigkeit, komplexe Gespräche systemisch lösungsorientiert zu leiten. Mit diesem Buch halten Sie den Schlüssel zu langfristiger und nachhaltiger Problemlösung in der Hand und können jede Kommunikationssituation konstruktiv gestalten. Mit dem zusätzlichen Bonusteil "Übung zur Formulierung systemischer Fragen" trainieren Sie besonders effektiv die praktische Anwendung und entwickeln schon bald Routine und Souveränität. Also worauf warten Sie noch? Klicken Sie nun auf "Jetzt kaufen mit 1-Click" ermöglichen Sie sich und anderen ab sofort einen ganz neuen und lösungsorientierten Blick auf Probleme aller Art!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2025 www.edition-lunerion.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Fragen und Anregungen:
Auflage 2025
Inhalt
„Klug fragen können, ist die halbe Wahrheit!“1
Die Grundlagen der Systemtheorie2
Exkurs: Über die Geschichte der Systemtheorie4
Systemische Ansätze – die Bedeutung des Begriffs „systemisch“8
Systemische Beratung – die Grundlagen10
Der systemische Beratungsansatz – die Umsetzung11
Systemische Beratung – die Methodik12
Systemische Beratung im Business-Umfeld22
Systemisches Coaching23
Systemisches Fragen30
Die Grundlagen für die erfolgreiche Anwendung systemischer Fragetechniken32
das systemische Fragen vorbereiten32
Das Handwerk des systemischen Fragens37
diese Arten des systemischen Fragens sollten Sie kennen37
Systemische Fragestellungen – diese Fehler sollten Sie vermeiden62
Praxisbeispiele für die Anwendung systemischer Fragen64
Systemisches Fragen als Frage der Kommunikation75
Systemisches Fragen in Führungs-, Coaching- und Beratungskontexten innerhalb von Unternehmen78
Werkzeuge des systemischen Methodenkoffers81
Die KÖNIGSDISZIPLIN – das aktive Zuhören81
Systemische Kommunikation – die Methode der gewaltfreien Kommunikation83
Methoden der systemischen Gesprächsführung87
Regeln im Umgang mit systemischen Fragetechniken91
Schlusswort93
Bonus: Praxisübung zur Formulierung systemischer Fragetechniken95
„Klug fragen können, ist die halbe Wahrheit!“
So lauteten die Worte des englischen Philosophen, Juristen und Staatsmann Francis Bacon (1561-1626). Bereits in dieser Äußerung zeigt sich die Relevanz systemischer Frageformen. Wer nicht fragt, generiert keine Erkenntnisse und gelangt auch nicht zu Lösungen. Das liegt vor allem daran, dass Fragen ein essenzieller Bestandteil des zwischenmenschlichen Zusammenlebens sind. Sie gehören zu den Werkzeugen der Kommunikation und sind daher nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext ein zentrales Mittel.
Dass Fragen wichtig für das Erkennen der Welt sind, zeigt sich auch in der Tatsache, dass Kinder, wissenschaftlichen Studien zufolge, im Vergleich zu Erwachsenen bis zu 500 Fragen am Tag stellen. Das Stellen dieser Fragen unterstützt sie dabei, die Welt zu verstehen und Erkenntnisse über selbige zu sammeln. Auch wenn sich einige Menschen mit dem Stellen von Fragen unwohl fühlen, da dies allgemein als Unwissenheit gedeutet wird, ist das Vorgehen dennoch wichtig, wenn es darum geht, Informationen zu erhalten und diese sinnvoll umzusetzen. Dies kann insbesondere Führungskräften, Coaches und Beratern oder Beraterinnen im Alltag hilfreich sein. Werden in diesem Kontext Fragen eingesetzt, generieren diese Wachstum und ermöglichen dem Gegenüber den Blick über den Tellerrand. Hier sind die systemischen Frageformen ein beliebtes und allgemein bewährtes Mittel.
Damit auch Sie lernen, wie Sie die systemischen Methoden sinnvoll einsetzen können, erhalten Sie innerhalb dieses Ratgebers wichtiges Grundlagenwissen zur Systemtheorie sowie einen Einblick in systemische Ansätze. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen über die Grundlagen der systemischen Beratung, die Umsetzung systemischer Beratungsansätze sowie den Einsatz der systemischen Beratung innerhalb des Business-Umfelds. Außerdem liefert Ihnen dieser Ratgeber Einblicke in das systemische Coaching.
Im weiteren Verlauf des Handbuchs werden Ihnen die Techniken des systemischen Fragens erläutert. Hier erfahren Sie, wie Sie das systemische Fragen vorbereiten, welche unterschiedlichen systemischen Frageformen existieren und wie diese funktionieren. Nebstdem liefert Ihnen das Buch Hinweise dazu, welche Fehler Sie im Umgang mit systemischen Fragen vermeiden sollten und welche Werkzeuge Sie für die Umsetzung systemischer Methoden verwenden können.
Die Grundlagen der Systemtheorie
Die Methoden der systemischen Beratung und Befragung basieren auf den Grundlagen der Systemtheorie. Diese beschreibt eine interdisziplinäre Betrachtungsweise, die zentrale Aspekte und Vorgehensweisen von Systemen nutzt, um die Handlungsweisen von Systemteilnehmern zu beschreiben. Innerhalb der Systemtheorie basiert daher jedes soziale Gefüge und jede Beziehung, die in diesem Gefüge existiert, auf bestimmten Voraussetzungen. Bereits seit vielen Jahrzehnten beschäftigen sich daher unterschiedliche Disziplinen wie die Psychologie, die Soziologie und die Biologie mit den Denkansätzen der Systemtheorie, um mehr über die Zusammenhänge der Funktionsweise von Systemen zu erfahren.
Die auf dieser Basis gesammelten Erkenntnisse beeinflussen das Denken und Handeln des Einzelnen und wirken sich dabei auch auf die Methoden der systemischen Beratung, des systemischen Coachings sowie des systemischen Fragens im Allgemeinen aus.
Um die Grundlagen der Systemtheorie zu verstehen, soll diese zunächst definiert werden.
Definition: Systemtheorie
Mit dem Begriff der Systemtheorie wird eine allgemein durch den Biologen Ludwig von Bertalanffy (1901-1971) in den 50er-Jahren begründete Theorie beschrieben, die lebende Organismen als selbstgesteuerte Systeme beschreibt. Im Bereich der Psychologie sind darüber hinaus die Ergebnisse von Kurt Lewin (1890-1947), die er im Rahmen der Gestaltungs- und Feldtheorie verankert hat, entscheidend. Er gilt als Vorläufer des systemischen Denkens.
Grundsätzlich werden Systeme im Kontext der systemtheoretischen Ansätze als von der Umwelt abgrenzbare Strukturen verstanden, die in sich strukturiert sind. Dabei stehen die unterschiedlichen Elemente der Systeme jeweils in Wechselwirkung zueinander. Auf soziologischer Ebene gilt Niklas Luhmann (1927 - 1998) als einer der bekanntesten Begründer der systemischen Theorien.
Insgesamt verfolgen Systemtheorien die Absicht, den Aufbau von Systemen sowie die damit verbundene Dynamik zu untersuchen. Hierbei nehmen die Theorien auch die Dynamik und die Verhaltensweisen unterschiedlicher Systeme in den Blick, indem unterschiedliche Systemebenen unterschieden werden.
Beispiele für unterschiedliche Systeme:
das Familiensystemdas Rechtssystemdas Zellsystemdas Sonnensystemeine Organisation / ein UnternehmenProzesse, die auf das Erkennen und Problemlösen zurückgehen und auf die Konzepte der Systemtheorie Bezug nehmen, werden häufig auch unter dem Begriff des systemischen Denkens zusammengefasst. Anwendung findet die Systemtheorie heute in vielen komplexen Gegenstandsbereichen. Hierzu zählen beispielsweise Organisationen, biologische Zellen, die Ordnung von Computernetzwerken sowie innerhalb von Familien. Bei der Umsetzung verfolgt die allgemeine Systemtheorie dabei das Ziel, exakte Verhaltensvorhersagen über das behandelte System zu liefern. So versucht die soziologische Systemtheorie zum Beispiel, die Formen von Sozialität zu beschreiben, die sich innerhalb von Beziehungsgeflechten wie Paarbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, Großfamilien, Organisationen oder aber der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergeben. Neben Niklas Luhmann zählt hier Talcott Parsons (1902 - 1979) als einer der wichtigsten soziologischen Vertreter der Systemtheorie. Im psychologischen Kontext ist das systemtheoretische Denken vor allem im Bereich der Familientherapie und Psychologie relevant. Daneben wird es in den Bereichen der Arbeits- und Organisationspsychologie sowie in der Umweltpsychologie eingesetzt.
Für alle Disziplinen gilt im Hinblick auf die Systemtheorie, dass jede Disziplin für sich als auch im heterogenen Diskurs betrachtet werden kann. Hierin liegt begründet, dass sich die jeweiligen Systembegriffe in ihren Definitionen innerhalb der unterschiedlichen Disziplinen unterscheiden oder gar widersprüchliche Eigenschaften aufweisen können. Im Laufe der Zeit haben sich jedoch für die Systemtheorie feste Theorien herausgebildet, die einer stetigen Weiterentwicklung unterliegen und in ihrer Aktualität immer wieder neu diskutiert werden. Die wichtigsten Theorien sollen hier nachfolgend für die Grundlagen der systemischen Beratung, des Coachings sowie des systemischen Fragens kurz erläutert werden.
Exkurs: Über die Geschichte der Systemtheorie
Während die allgemeine Systemtheorie, wie bereits erwähnt, auf unterschiedlichen Ansätzen beruht, die sich unabhängig voneinander herausgebildet haben, haben sich im Verlauf der Zeitgeschichte feste Theorieansätze entwickelt, die für die Systemtheorie grundlegend sind.
Hier ist zunächst der Begriff der Kybernetik zu benennen, der im Jahr 1948 durch den US-amerikanischen Mathematiker und Philosophen Norbert Wiener (1894 - 1964) geprägt wurde.
Definition: Kybernetik
Der Begriff Kybernetik geht auf den griechischen Wortstamm kybernetes zurück und bedeutet so viel wie Steuermann. Die Theorie der Kybernetik beschreibt die dynamischen Systeme und beschäftigt sich dabei besonders mit der Informationsverarbeitung selbiger. Hierbei untersucht die Theorie die Eigenschaften, durch die dynamische Systeme geprägt sind. Ihr Fokus liegt dabei auf der Steuerung der innerhalb der Systeme stattfindenden Kommunikationsprozesse.
Bei der Entwicklung des Begriffs sowie der damit verbundenen Theorie greift Wiener dabei auf die mathematischen Grundlagen zurück und bedient sich der Begrifflichkeiten der Mathematik und Technik, um kommunikative Prozesse zu beschreiben. Systeme werden auf der Basis der Kybernetik als Modell beschrieben, deren Kommunikationsprozesse anhand von Ist- und Sollwerten beschrieben werden. Auf der Basis von Ist- und Sollwerten erfolgt dann im Anschluss eine Aussage über den Zustand. Häufig wird die Kybernetik daher auch als die „Kunst des Steuerns“ beschrieben.
Beispiel für ein kybernetisches System: Ein einfaches technisches Beispiel für ein kybernetisches System stellt die Drehzahlregelung einer Dampfmaschine dar. Die Dampfmaschine wird hier auf der Basis eines Fliehkraftreglers oder der allgemeinen Temperaturregelung über ein Raumthermostat gesteuert.
Fast zeitgleich zu Wiener tauchte zu Beginn der 1950er-Jahre erstmals der Begriff der Systemtheorie auf, der durch Ludwig von Bertalanffy geprägt wurde. Er war der Überzeugung, dass die bloße Kybernetik für die Beschreibung von Systemen nicht ausreiche, um Leben zu beschreiben. Auf der Basis dieser Annahme entwickelte er den Begriff der organisierten Komplexität. Im Sinne der organisierten Komplexität stellen Systeme den Zusammenhang von Interaktionen und Funktionseinheiten dar.
Diese Zusammenhänge grenzen Systeme von ihrer Umwelt ab, die ihrerseits ebenfalls aus komplexen Interaktions- und Funktionszusammenhängen bestehen. Nach Bertalanffy sind Systeme daher selbstorganisierte Einheiten, die für Bestehen nicht nur selbst organisieren, sondern dieses auch produzieren. Die Art und Weise, wie diese Systeme in sich organisieren, heben sie durch die Ausprägung besonderer Eigenschaften von der Umwelt ab.
Beispiel für eine organisierte Komplexität von Systemen: Ein Beispiel für eine organisierte Komplexität stellen abgelegene Inselgruppen dar. Hier können die Galapagos-Inseln angeführt werden. Sie beherbergen einzigartige endemische, also allein auf dieser Insel existierende, Pflanzen- und Tierarten. Durch das Einwirken von Seefahrern in früheren Zeiten sowie von Touristen heute wird das System gestört (beispielsweise durch das Einführen von Tier- und Pflanzenarten, die dem System bisher fremd waren).
Innerhalb der Annahmen von Bertalanffy wurde der Austausch von Systemen innerhalb ihrer Umwelt erstmals als feste theoretische Bestandteile etabliert. Zudem sprach sich Bertalanffy ausdrücklich gegen eine Vermischung seiner Theorie mit den Theorien der Kybernetik aus.
Etwa im Jahr 1970 wurden die systemtheoretischen Überlegungen durch die Katastrophentheorie des englischen Mathematikers Erik Christopher Zeemann (1925-2016) ergänzt. Diese Theorie betrachtete die unstetigen und sprunghaften Veränderungen von kontinuierlichen dynamischen Systemen.
Im Jahr 1975 wurden die Theorien um die Autopoiesis nach Humberto Maturana (1928-2021) und Francisco Varela (1946-2001) erweitert. Mit dem Begriff der Autopoiesis wird dabei die Selbsterschaffung beziehungsweise Selbsterhaltung von Systemen beschrieben. Sie bezieht sich auf biologische Systeme. Für die theoretischen Ausführungen greifen Maturana und Varela dabei auf die Systemlehre von Bertalanffy zurück und erweiterten diese um die Inhalte der Kybernetik. Innerhalb der Theorien der Autopoiesis rückt der Prozess der Systemerschaffung in den Fokus der Beobachtung der Theoretiker. Biologische Systeme werden hier daher nicht mehr anhand einzelner Merkmale beschrieben, sondern über den Erhaltungsprozess charakterisiert. Die hier erschaffene Beschreibung des Lebens hat sich im weiteren Verlauf auch auf die soziologischen Theorien ausgewirkt.
Beispiel für Systeme im Sinne der Autopoiesis: Als Beispiel für ein autopoietisches System kann eine Zelle angeführt werden. Innerhalb der Biologie wird diese als reproduzierendes System verstanden, das einen Zellkern aufweist. Dieser Zellkern organisiert für das Bestehen der Zelle die Steuerung des Stoffwechsels. Die Zellmembran der Zelle stellt dabei die Grenze zur Umwelt des Systems Zelle dar.
Ebenfalls relevant für die Herausbildung fester systemtheoretischer Ansätze stellt der sogenannte Strukturfunktionalismus dar. Der Begriff des Strukturfunktionalismus geht auf den Anthropologen Alfred Radcliffe-Brown (1881 - 1955) zurück. Dieser theoretische Ansatz ist ebenfalls zu Beginn der 1950er-Jahre entstanden und ging der Frage nach, in welcher Weise Strukturen das Verhalten von Individuen innerhalb einer Gesellschaft beziehungsweise eines Systems bestimmen. Im Rahmen der Theorie wurden die Funktionen von gesellschaftlichen Strukturen untersucht. Dabei konnte Radcliffe-Brown zusammen mit seinen Kollegen feststellen, dass gesellschaftliche Strukturen ausschließlich durch die Einwirkung von externen Faktoren gewandelt werden können. Innerhalb dieser Theorie werden daher Institutionen als Schlüssel zum Erhalt einer globalen und sozialen Ordnung von Systemen verstanden. Hierbei fördern insbesondere soziale Institutionen den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Im weiteren Verlauf entwickelte der US-amerikanische Soziologe Talcott Parsons (1902-1979) eine handlungstheoretische Systemtheorie. Dabei sprach er sich deutlich gegen eine Zuordnung zum Strukturfunktionalismus aus. Parsons gilt daher bis heute als wichtigster Begründer eines soziologischen Systembegriffs. Innerhalb seiner Theorie geht er davon aus, dass Systeme durch den Zusammenhang der Gemeinschaft beschrieben werden. Innerhalb dieser Systeme bildet die Interaktion der einzelnen Systemmitglieder die Struktur. Dabei geht er davon aus, dass die jeweiligen Strukturen in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander zu betrachten sind. Innerhalb der Theorie von Parsons wird dieses Vorgehen auch als Interdependenz beschrieben. Die Art und Weise, wie die einzelnen Systemteilnehmer ihre Handlungen aufeinander beziehen, wird im Rahmen der Handlungstheorie auf der Grundlage von Verhaltenserwartungen beschrieben. Diese ergeben sich für den Einzelnen auf der Basis eines spezifischen Rollenverständnisses. Ein fester Bestandteil von Systemen sind dabei auch Regeln, nach denen die einzelnen Systemmitglieder agieren. Für die Beschreibung der Struktur eines Systems entwickelte Parsons dabei ein Schema, das der Analyse von Funktionen innerhalb eines Systems dienen soll. Vier Funktionen bilden dabei die Basis des sogenannten AGIL-Schemas:
Erläuterung: Die Anpassung beschreibt die Fähigkeit von Systemen, auf Veränderungen innerhalb des Systems zu reagieren.
Goal Attainment → Zielerreichung
Erläuterung: Mit dem Begriff der Zielerreichung wird die Fähigkeit von Systemen beschrieben, Ziele nicht nur zu definieren, sondern auch verfolgen zu können.
Integration → Eingliederung
Erläuterung: Der Begriff der Integration beschreibt die Fähigkeit von Systemen, die Mitglieder eines Systems zusammenzuhalten sowie deren Einschluss sicherzustellen.
Latency → Strukturerhaltung
Erläuterung: Mit dem Begriff der Strukturerhaltung wird die Fähigkeit von Systemen beschrieben, sowohl Strukturen als auch Wertmuster am Leben zu halten.
Innerhalb der handlungstheoretischen Systemtheorie sind Handlungen daher nicht nur der Ursprung, sondern auch das Ergebnis der Funktionsweise von Systemen.
Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts haben die Ausführungen von Talcott Parsons durch Niklas Luhmann eine weitere Ausführung erfahren. Er erweiterte die bestehende Theorie und tauschte den Begriff der Handlung aus. In Luhmanns Theorie werden demnach Handlungen durch Operationen beschrieben. Sie stellen die Grundlage eines jeden Systems dar und werden synonym für jede Form von Kommunikation innerhalb eines Systems eingesetzt. Luhmann beschreibt Kommunikation dabei als einen Vorgang, der sich aufeinander bezieht, auf andere Kommunikationen führt oder auf sich selbst verweist. Kommunikation findet innerhalb von Systemen demnach immer und überall statt. Statt das Individuum als Einzelnes zu beobachten, wird im Rahmen der Luhmannschen Theorie sein Handeln vor dem Gesamtzusammenhang betrachtet.
Ebendiese systemtheoretische Haltung hat sich bis heute gehalten und wird im Rahmen des systemischen Fragens, der systemischen Beratung sowie des systemischen Coachings bis heute eingesetzt. Hier unterstützt die Systemtheorie dabei, soziale Zusammenhänge zu erfassen und für bestehende Probleme Lösungsansätze zu finden.
Systemische Ansätze – die Bedeutung des Begriffs „systemisch“
Systemische Ansätze bauen auf den modernen Konzepten der systemtheoretischen Konzepte der unterschiedlichen Disziplinen auf. Vermutlich werden Sie sich in diesem Zusammenhang gefragt haben, was der Begriff „systemisch“ in diesen Ansätzen bedeutet. „Systemisch“ bedeutet in diesem Kontext dieser Ansätze, dass sich selbige auf ein Gesamtsystem beziehen und dieses ganzheitlich betrachten.
Die jeweiligen Ansätze der Beratung, des Coachings sowie des systemischen Fragens rücken dabei die Wechselwirkungen der psychischen Eigenschaften sowie der Lebensbedingungen innerhalb des sozialen Kontextes in den Fokus der Betrachtung. Dieses Vorgehen soll dabei dazu dienen, den Einzelnen innerhalb seines Systems und den auf ihn wirkenden Bestandteilen des selbigen zu verstehen. Innerhalb der systemischen Arbeit in der Beratung und dem Coaching sowie bei der Anwendung der Formen des systemischen Fragens ist dabei eine systemische Haltung erforderlich, an der sich der systemische Berater, Coach, Fragenstellende bei der Umsetzung der systemischen Methoden orientieren sollte.
Diese lässt sich unter fünf Schwerpunkten zusammenfassen und ist für eine effiziente systemische Arbeitsweise unabdingbarer Bestandteil.
Beziehungsneutralität: Hier wird von den Beratern und Beraterinnen erwartet, dass sie sich gegenüber abwesender Mitglieder einer Familie oder eines Systems (zum Beispiel Familie, Ehepartner, Arbeitsteam oder Unternehmen) neutral verhalten. In diesem Kontext wird demnach von Ihnen erwartet, dass Sie keine Partei ergreifen.
Problemneutralität: Auch gegenüber den beschriebenen Problemen des Klienten sollten Sie einen neutralen Standpunkt einnehmen. Das bedeutet, Sie werten das Problem nicht. Vielmehr bestärken Sie Ihre Klienten darin, die Aufgabe beziehungsweise den Sinn des Problems zu erkennen. Auf diese Basis entwickeln Sie im Nachgang gemeinsam eine Lösung auf der Basis der Ressourcen des Klienten.
Konstruktneutralität: