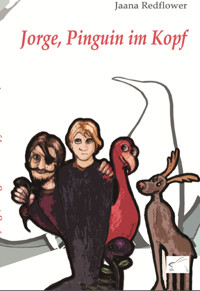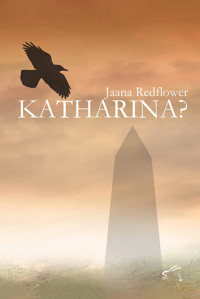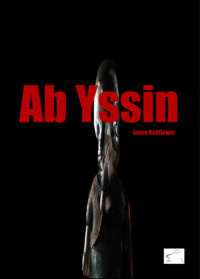4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nordamerika, nahe Zukunft. Eines Tages ist es soweit: Die Sirenen heulen, eine Katastrophe ist über die Menschen hereingebrochen. Die Regierung fordert sie auf, in den Keller zu gehen. Bis jemand sie befreit. Was würdest du tun, wenn die Welt untergeht? Doch niemand klopft an. Denn oben gibt es nur noch Überreste der alten Welt. Zwischen verdorbenen Pflanzen und mutierten Tieren beginnt ein erbitterter Kampf ums Überleben. Ein postapokalyptisches Endzeit-Szenario erwartet Sie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edition Paashaas Verlag
Autor: Jaana Redflower
Originalausgabe August 2018
Covermotiv: Jaana Redflower
© Edition Paashaas Verlag
www.verlag-epv.de
Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-030-7
Die Handlung ist frei erfunden, Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Tag, an dem die Vögel schwiegen
Tag Z
Ich saß vorm Fernseher und aß Popcorn aus einer Tüte. Schaute die Nachrichten. Abgesehen vom Brief, der einige Tage zuvor angekommen war, deutete nichts auf eine Katastrophe hin. Es gab nur das Übliche im Fernsehen: Einen Krieg im fernen Osten, Probleme mit Russland. Danach kamen die Nachrichten über Sport und Kultur, ein wenig Klatsch und Tratsch, zum Schluss das Wetter.
Als der Sprecher bei einem Tiefdrucksystem angekommen war, das – wie er betonte – aus dem Osten aufzog, begann das Heulen der Sirene.
Mein Mann kam aus dem Computerzimmer geschossen.
„Schnell, in den Keller!“, rief er, „mir nach!“
Beinahe riss er mich hinab, als ich den Fernseher ausstellen wollte.
„Dafür ist keine Zeit!“
Wir stolperten die Kellertreppe hinunter.
Unten angelangt, verrammelte Birk die Tür. Er schlug einen Nagel nach dem anderen in die Bretter, verstärkte das Ganze mit Metall. Das hatte er ausgetüftelt, im Vorfeld.
Ich drehte an den Reglern des Radios. Es knirschte – mehr als sonst. Ein Sturm kam, aber es war nicht der von der Ostküste. Er zog über unsere Köpfe und brüllte lauter als alles, was ich zuvor kannte.
Ich probierte sämtliche Sender durch, stellte mehrmals die Antenne um und versuchte es aufs Neue. Mit dem gleichen Ergebnis: Außer einem Rauschen empfingen wir rein gar nichts.
Da wusste ich, dass etwas schiefgelaufen war.
Tag 2
Wir waren schon viel zu lange unten – zwei Tage. Zwei Tage mögen nicht lang sein, wenn man sie gemütlich in seiner Wohnung verbringen kann – irgendwo pendelnd zwischen Sofa und Bett und mit der größten Herausforderung, den Fernseher richtig einzustellen. Dazu wärmt man ab und zu ein Fertiggericht auf oder bestellt etwas. Was für ein Luxus!
Im Keller hatte es nur das Radio gegeben. Vor zwei Tagen war es verstummt.
Ich lese normalerweise nicht viel. Jetzt las ich: Konservendosen. Davon gab es hier reichlich. Manche hatten wir gekauft, einige stammten von der Regierung. Die hatten das schon länger geplant, zumindest etwas geahnt! Sonst hätten sie keine offiziellen Rationen ausgeteilt – im Vorfeld. Und sonst hätte es DIESEN BRIEF nicht gegeben, zwei Tage vor den Rationen. Das gab uns etwa fünf Tage um zu grübeln. Und drei Tage, um den Berg von Lebensmitteln zu begutachten, die man uns überreichte: Dosen in allen Größen, Eingeschweißtes, Gallonen von Wasser. Wenn es kälter war, genügten zwei Liter pro Tag. Wenn man nur diese zwei Liter zur Verfügung hat, dazu kein Leitungswasser – wir wurden im Vorfeld gewarnt, davon zu trinken –, wünscht man sich, mehr als diese vier Gallonen erhalten zu haben. Vier Gallonen pro Kopf – das sind insgesamt zwanzig Liter. Bei zwei Litern pro Tag hieß das: Wir konnten zehn Tage unten durchhalten, bevor wir anfingen zu verdursten. Oder bevor wir die Barrikade aufbrechen und nach oben steigen mussten. Dorthin, wo die meiste Zeit über Stille herrscht – die Ruhe nach dem Sturm. Ein solcher war am ersten Tag über uns hinweggezogen.
Bevor ich allzu viel grübelte, las ich weiter die Etiketten der Konserven im Regal: Gewürzgurken, eingelegt. Soleier, ebenfalls eingelegt. Der eingeschweißte Pumpernickel stammte natürlich aus dem Rationspaket der Regierung. Wir mögen beide keinen Pumpernickel; den hätten wir niemals gekauft! Aber an dieser Stelle ging es darum, möglichst haltbare Lebensmittel einzulagern. Brot, das innerhalb kürzester Zeit verschimmelt, hat keinen Platz in einer solchen Kammer.
Ich fühlte mich selber wie durchweichter Pumpernickel: kurz vorm Verderben und unerwünscht. Die Kälte kroch mir über die Haut; die Feuchtigkeit überzog sie mit einem Film, auf dem etwas zu wachsen begann. Das ewige Neonlicht stach mir in die Augen. Ich wollte die Lampen an der Decke ausknipsen, entschied mich jedoch dagegen. Im Dunkeln herrschte die Gefahr, über etwas zu stolpern – und damit auf sich aufmerksam zu machen! Die Aufmerksamkeit desjenigen oder derjenigen erregen – was auch immer dort oben unterwegs war –, das wollten wir nicht. Wir wussten nur: Da war etwas. Was es war, wussten wir nicht. Noch nicht.
Im Vorfeld war nicht viel verraten worden. Nicht einmal Andeutungen hatte man gemacht. Ein Politiker war vors Mikrofon getreten und hatte minutenlang das erklärt, was ein weniger rhetorisch geschulter Mensch in einem Satz gesagt hätte: Mit den Rationen in den Keller gehen, dort das Radio anstellen. Dass das Radio dann nicht mehr funktionierte, überraschte alle.
Neben dem Pumpernickel lag eine Packung Kekse. Es waren diese dicken, trockenen Kekse, die das Militär an seine Soldaten verteilt. Man bekommt davon Verstopfung und vielleicht noch andere Dinge. Aber die Verstopfung war der Nebeneffekt, der allgemein bekannt war und bei uns auch eintrat. Wenn man in einem Keller haust – in einer Vorratskammer ohne Tageslicht und ohne Zugang zu sanitären Anlagen –, stellt dies einen recht angenehmen Nebeneffekt dar.
Zu Pumpernickel, Soleiern, Gewürzgurken und besagten Keksen gab's für uns: eingelegte Aprikosen – halbiert und entkernt –, Dosenfisch in verschiedenen Varianten, Gepökeltes, Nussschokolade und Paprika. Die Schokolade benötigte ich, um meine Nerven zu beruhigen. Sowohl Nüsse als auch Kakao sollen ja Substanzen enthalten, die diesbezüglich helfen. Was es nicht gab: warmes Mittagessen. Nicht einmal Tütensuppen oder Ravioli aus der Dose. Wir hatten im Keller keinen Wasserkocher; im Nachhinein betrachtet wäre dieses laute Ding ohnehin nicht zu gebrauchen gewesen.
Wir mussten still sein.
Sie hatten an DAS DA OBEN wohl nicht gedacht. Wir konnten uns nicht einmal unterhalten, solange draußen diese schlurfenden Schritte waren! Manchmal kamen sie ganz nah ans Haus, mussten direkt neben der Wand sein ... Doch nein! Meine Gedanken wollten diesen Teil der Eindrücke im Keller nicht aufnehmen! Ich blickte stattdessen auf die Mauer neben dem Regal. Der Putz war grau, hellgrau, und die Mauer keine wirkliche Mauer, sondern sie bestand aus Beton.
Nach den Konserven gab es nur noch eine einzige Sache zu lesen: Brenda + Birk, darum ein Herz. Das hatte Birk in der vergangenen Nacht für mich gemalt, als das Schnüffeln und Scharren begann. Um mich zu beruhigen. Um mir zu sagen, dass wir auch in einer solchen Krise zusammenhielten. Am Vortag hatte seine Fürsorge gewirkt und ich mich einfach in seine Arme gekuschelt, mich so in den Schlaf geweint. Da hatte ich noch gedacht, das Schnüffeln ginge bald vorbei.
Hatte das Vieh da oben unsere Fährte aufgenommen? Roch es uns – unten, neben dem Pökelfleisch und den Salamis? Für ein Tier war ein Keller voller Essen etwas Verlockendes. Vielleicht wartete es aber auch darauf, dass wir das Haus verließen – verlassen mussten.
Und dann? Würde es uns auflauern? Direkt hinter der nächsten Ecke, hungrig – so hungrig, dass es sofort nahm, was es bekam?
Am Vortag hatte ich noch geschafft, mir einzureden, dass es nur ein Hund war. Natürlich machte das Sinn! Nicht wenige hatten ihre Tiere ausgesetzt. Und ausgesetzte Hunde schnüffeln oft herum. Das war eine absolut logische Erklärung.
Nur, dass ich nicht daran glaubte.
Die logische Erklärung kam aus meinem Kopf; mein Gefühl sagte mir jedoch, dass etwas mit diesem Hund nicht stimmte. Diese Art zu schnüffeln ... Wie er seine Pfoten auf den Boden setzte ... Als habe er fünf davon, keine vier. Oder als hüpfe das Tier manchmal derart, dass es den Boden ganz kurz zweimal hintereinander berührte. Vor meinem inneren Auge formte sich das Bild einer Hyäne – eines dieser gefleckten Viecher, die den Schwanz immer leicht eingezogen halten und so laufen, dass es aussieht, als seien sie verkrüppelt. Ich hatte wirklich keinen Bedarf, diesen Hund zu sehen!
Ich hoffte, er sei nicht mehr da, wenn das Militär uns den Ausgang öffnete. Vielleicht hörten wir dann Gewehrschüsse – zwei, drei, vier oder auch ein Dutzend. Dann war's das mit dem Schlurfen und wir hätten nur noch ein weißes Laken über dem leblosen Körper gesehen! Das Militär hätte es zugedeckt, damit niemand das Grauen zu Gesicht bekam. Sonst hätte sich einem der Anblick in die Gehirnrinde eingebrannt. Und da würde er dann nie mehr wegzubekommen sein.
Ich nahm den Bleistift vom Regal; er lag ganz rechts, neben der letzten Dose, in Griffhöhe. Dann machte ich einen weiteren Strich. Es war Abend, der zweite Tag vergangen. Wir zählten die Tage ebenso, wie Gefangene es tun. Wir waren eingesperrt, obwohl wir nichts verbrochen hatten. Jemand anderer hatte anderswo etwas getan. Oder es war einfach etwas passiert.
Mit diesem Gefühl der Ungewissheit, dem Schlurfen und Schnüffeln über mir schlief ich ein.
Tag 5
Der fünfte Tag war auch nicht besser als die vorangegangenen. Um genau zu sein: tausendmal schlimmer! Und es wurde mit jeder Stunde, mit jeder Minute, mit jeder Sekunde zunehmend abscheulich, in diesem Loch zu verweilen. Es war unerträglich!
Ich kratzte mit den Nägeln meiner rechten Hand den Dreck unter den Nägeln meiner linken Hand weg und schnipste die Überreste in eine dunkle Ecke hinter dem Regal mit den Konserven. Ich musste mich immer wieder daran erinnern, wieso ich die Barrikade vor der Tür nicht niederreißen konnte: Wir hatten die Anweisung bekommen, diesen Ort nicht zu verlassen. Von der Regierung. Und einen Code. Beides hatten sie uns per Post geschickt. Den Inhalt DES BRIEFES kannte ich auswendig. Als hätte ich eine Fotokopie davon gemacht und in meinem Kopf abgespeichert:
Sehr geehrte Frau Gunner,
bitte halten Sie den Code jederzeit bereit. Für den Fall, dass „Aktion Kellerraum“ eintritt (mit diesem Begriff wurde dafür geworben, ins kalte, feuchte Loch hinabzusteigen!), nehmen Sie den Code mit und halten Sie ihn griffbereit.
Sorgen Sie unter allen Umständen dafür, dass der Inhalt dieses Schreibens niemandem sonst bekannt wird. Es ist strengstens untersagt, den Code weiterzugeben.
Im Übrigen ist den Anweisungen des Hörfunks Folge zu leisten.
Mit freundlichen Grüßen
(An dieser Stelle kam eine vollkommen unleserliche Unterschrift).
Mit einer Heftklammer – in der linken oberen Ecke, das Metall leicht kupferfarben und etwas verbogen – war an dieses erste offizielle Schreiben eine Liste geheftet, auf der die Dinge aufgeführt waren, die man als gehorsamer Bürger in seinen Keller zu transportieren hatte. Gehorsame Bürger waren wir. Zumindest versuchten wir es zu sein. Einzig die Zeile‚ dass der Inhalt dieses Schreibens niemandem sonst bekannt wird, fiel der Unfolgsamkeit anheim.
Diese Anweisung befolgte niemand. Dazu waren wir zu aufgewühlt. Und wir sahen ja, dass ein jeder einen solchen Zettel in der Hand hielt, dort stand in der Straße – im Sonnenlicht! –, den Kopf schüttelte und sich wunderte. Da lag es auf der Hand, hinüberzugehen und den Schicksalsgenossen darauf anzusprechen. Niemals zuvor hatte es in der Nachbarschaft derart viele Gespräche und Zusammenkünfte gegeben. Und derart viele Spekulationen.
In der rechten Hand eine Zigarette, in der linken Hand einen Müllsack – als Vorwand, um vor die Tür zu gehen – war Clara Jenson am Ende sieben Mal täglich auf die Straße gelaufen. Auch als klar gewesen war, dass sie in die Müllsäcke nur notdürftig Klopapier gestopft hatte.
Da fiel mir etwas ein: Der Code, den sie auf den Zettel gedruckt hatten, lag im Mülleimer. Verwendet als Ersatz fürs Klopapier. Was war, wenn ich den Code vergaß? Wollte man uns dann erschießen? Stünde dann vor der Tür eine wichtige Amtsperson, flankiert von Mitgliedern des Militärs – die Hosen khakifarben gefleckt, daneben ein biederer Anzugträger – mit der Behauptung, unser Personalausweis habe nichts mehr zu sagen, sei nun ungültig, es gelte der Code und wer den nicht wisse, dem jage man eine Kugel durch den Kopf? Das hatte ich Birk bereits vor DEM TAG gefragt – damals, als wir noch miteinander reden konnten. Er hatte gemeint, das würden die niemals tun, dagegen gäbe es Gesetze. Nur, ob das immer noch so war – ob wir noch Gesetze, Moral oder Regeln hatten –, das wussten wir nicht. Vielleicht glaubte Birk selbst nicht mehr daran. Das alte Leben, das schöne, rückte immer weiter in die Ferne. Bis ich mich eines Tages gar nicht mehr erinnern und nur noch Schatten der Vergangenheit sehen würde. Aus einem Schatten lässt sich kein Code rekonstruieren.
Alles in allem kann ich nun sagen: Wir haben uns nicht besonders sorgfältig vorbereitet. Trotz aller Gerüchte, aller nachbarschaftlichen Diskussionen. Niemand hatte erwartet, dass „Aktion Kellerraum“ wirklich eintreten würde. An so etwas möchte niemand denken, solange er noch anders glauben kann.
Tag 8
Das Essen neigte sich dem Ende zu. Ich kratzte Reste aus dem Einmachglas. Die Gurken darin hatte ich schon vor einer Stunde verspeist. Dann ging es an die Paprika: kleine, rote Fetzen, die in einer Brühe aus Essig und Wasser schwammen. Dazwischen Gewürze – Dill, Senfkörner, ein paar Silberzwiebeln. Und Undefinierbares. Schließlich hatte ich begonnen, die Brühe selbst aus dem Glas zu holen. Löffel um Löffel führte ich die grüne Flüssigkeit an den Mund, schloss meine Lippen um das Esswerkzeug, leckte schließlich mit der Zunge darüber.
Wehmütig erinnerte ich mich weiter: Als ich oben war, hatte ich viele Dokus gesehen. Eigentlich wahllos: über die alten Ägypter – die Pharaonen –, über Napoleon, über die Sterne und auch über die Ursuppe. Manchmal war etwas Interessantes dabei, manchmal starrte ich nur auf den Bildschirm und stopfte Chips in mich hinein.
Chips! Bei dem Gedanken daran lief mir das Wasser im Mund zusammen. Selbst über eine weggeworfene, zusammengeknüllte Chipstüte hätte ich mich gefreut! Bestimmt hätte ich darin noch ein paar Krümel gefunden, ein wenig Fett, ein wenig von etwas, das nach der vergangenen Zivilisation schmeckte.
Ich seufzte. Da hörte ich von oben ein Hecheln. Das Seufzen war viel zu laut gewesen! Ich begann zu zittern, zitterte zusammen mit meinem Löffel und dem Einmachglas mit dem Rest Essigwasser. Ich blickte nach oben, zur Decke. Obwohl es dort rein gar nichts zu sehen gab; der Keller hatte keine Fenster. Birk blickte ebenfalls hoch. Natürlich sagte er nichts – das wäre unklug gewesen – aber ich konnte sehen, wie sein Unterkiefer mahlte. Er mahlte immer, wenn er etwas sagen wollte, es aber gerade nicht konnte. Birk mahlte gewissermaßen das zu Sagende klein, raspelte die Worte, bis sie nur noch aus kleinen Stücken bestanden, die er dann hinunterzuschlucken vermochte. So zerkaut, schadeten sie seinem Magen weniger; schwer genug lagen sie darin.
Das Hecheln drang durch die Wand, als würde jemand direkt dagegenlehnen. Dann wieder: ein kurzes Hüpfen.
Ich rückte näher an Birk heran – wollte Schutz bei ihm suchen, so etwas wie Geborgenheit. Doch als ich seine Haut berührte, zuckte ich zurück. Sie war mit eben jenem feuchten Film überzogen, der sich über alles im Keller gelegt hatte. Er warf mir einen Blick zu, den ich nicht zu deuten wusste. Seine Augen versuchten, mir etwas mitzuteilen. Die Botschaft löste sich auf, ehe sie mich erreichte. So kauerten wir beide, nah beieinander und doch vollkommen isoliert, in einer Ecke und sahen in Richtung des Hechelns.
Dann begann das Scharren.
Nun kannte ich von den letzten Tagen bereits Scharren, Schlurfen, Hecheln – kurzum, alle Geräusche, die zu einem hyänenartigen Tier passen. Dieses Scharren war anders! Es klang, als wisse das Tier nun, dass wir hier unten waren – aneinandergeklammert, in ängstlicher Erwartung dessen, was dort kommen mochte. Das Scharren wurde zum Graben. Das Wesen buddelte; es versuchte, die Erde fortzuschaffen, um zu uns zu gelangen. Freilich lag dazwischen noch eine dicke Betonmauer, die ein Hund – oder eine Hyäne –, gleich wie feste er, sie oder es grub, niemals hätte durchdringen können. Aber vielleicht war das Tier dort oben doch etwas anderes? Etwas, das auch durch eine Mauer kam? Es buddelte mit einer Zielstrebigkeit, die mich erschreckte. Und es hörte nicht auf.
Je mehr Erde es abtrug, desto deutlicher konnte ich es hören. Es knurrte. Das klang, als habe es eine poröse Kehle: Da pfiff etwas; da entwich mehr Luft, als sein durfte. Dazu schnaufte es. Schleim rasselte in dem Tier. Es blubberte. Dort, wo Organe sein sollten, klang es nach Flüssigkeit, als hätte man die Haut der Hyäne genommen und willkürlich Innereien hineingekippt.
Mir wurde übel. Ich starrte auf die Deckenlampe. Die schwang hin und her. Ein kleines Stück nach links, ein kleines Stück nach rechts. Vollkommen lautlos. Es kam mir so vor, als erschüttere das schnaufende Ding dort oben unser Haus bis in seine Grundfesten.
Jetzt nahm Birk meine Hand. Wieder zuckte ich zusammen. Das fühlte sich so feucht an, so sehr nach Amphibie – nach einem Frosch etwa oder einem Molch! –, doch diesmal ließ ich ihn gewähren. Ich konnte jede Hilfe brauchen. Alles, was verhinderte, dass mich die Angst übermannte, war mir recht. Fast stimmlos tönte es von oben, irgendwo zwischen einem Husten und einem Bellen, stieß gegen die Wände unserer Zuflucht, verwandelte die Lampe an der Decke in das Pendel aus Edgar Allan Poes Fantasie. Ich schrie auf! Ich musste! Ich konnte mich nicht mehr beherrschen!
Birk drückte mich fester an sich. Es wurde eine feuchte und enge Umarmung. Ich roch seinen Schweiß. Ungezähmt. Das Deo hatten wir ebenso vergessen wie das Toilettenpapier. Ich roch das Ungesunde darin, die Keime, die auf uns wuchsen.
Erst dann bemerkte ich, dass es still geworden war. Wir alle hielten inne: Birk, ich, das Ding dort oben. Selbst die Lampe an der Decke kam zur Ruhe. Wie lange die Ruhe uns beherrschte? Vielleicht drei, vier Sekunden. Das lässt sich nicht so genau sagen, wenn man in einer Zeitblase im Keller gefangen ist. Drei, vier Sekunden, in denen es kein Schnaufen, Hecheln, Graben, keinen rasselnden Atem gab.
Dann heulte das Tier! Es war ein pfeifender, quietschender Laut, als würde sich eine Tür öffnen, die mangels Öl in den Angeln um Hilfe ruft, begleitet von einem zweiten, tieferen Ton – einem Röhren, das aus dem Inneren des Wesens kommen musste, wo die verflüssigten Innereien dem ersten Laut antworteten. Es klang vollkommen anders als das Heulen eines Wolfs, auch wenn es dieselbe Funktion erfüllte: das Rudel zusammenzutrommeln.
Der Ruf hallte von den Gebäuden wider. Der Ton reflektierte – mal lauter, dann wieder leiser –, sodass wir ein Vielfaches des ursprünglichen Geräusches vernahmen: Zwanzigmal Geheul, zwanzigmal ging es uns durch Mark und Bein. Als es verklungen war, herrschte wieder Stille. Diese eigentümliche Stille, die wir bereits nach meinem Schrei vernommen hatten, schwebte zwischen uns wie ein Leichentuch. Kündigte an: Da kommt noch was.
Und sie kamen.
Erst antwortete ein Tier – diesmal war es kein Echo, sondern etwas, das von jenseits des Vororts kam. Von den Wäldern am See. Dachte ich. Dann stimmte noch ein weiteres Tier ein, schließlich zwei, drei, ein ganzes Dutzend. Ich hörte sie über den Boden laufen: Das fünfbeinige Hopsen der Wesen vermischte sich, bis daraus ein pausenloses Trappeln wurde. Es mussten viele sein, sehr viele!
In der Straße hörte ich Scheppern: Umgekippte Mülltonnen, Blech. Das war die Mülltonne von Clara Jenson; die übrigen Anwohner besaßen Eimer aus Plastik. Ob diese blecherne Tonne immer noch voller Klopapier war? Wohl kaum, denn dann wäre das Scheppern nicht so laut gewesen.
Die ersten Tiere kamen an unserem Haus an. Ich hörte, wie der Holzstapel – der, den Birk mühsam aufgeschichtet hatte, um im Winter genug Feuerholz zu haben – zusammenbrach. Holzscheit stieß an Holzscheit. Einige davon krachten gegen die Hauswand.
Die Lampe an der Decke schwang wieder – schneller als zuvor.
SIE liefen an der Hauswand entlang. Ich hörte ihr Fell schaben, hörte, wie es über den Putz kroch, als scheuere jemand die Fassade mit einer Drahtbürste. Das Hecheln wurde lauter; zwischendurch bellte eines der Tiere. Schließlich sprang das erste gegen die Wand.
Der Aufprall war derart heftig, dass Putz herunterrieselte. Die Lampe – das Pendel – schwang nun so heftig, dass sie beinahe oben gegen die Decke stieß. Ich konnte einen weiteren Aufschrei nur mit Mühe und Not unterdrücken. Mein Herz pochte so heftig, dass es mir die Tränen in die Augen trieb. Mein Schädel – die graue Masse darin – schlug im Takt, die Ader an meiner Schläfe zuckte. Sie hatten uns umzingelt!
Dann hörte ich, wie eines der Fenster im Erdgeschoss zerbrach, Scherben fielen klirrend zu Boden. Ich überlegte, welcher Raum direkt über dem Keller lag. Es musste das Wohnzimmer sein, sofern mich mein Aufenthalt in der verlorenen Zeit nicht bereits zu sehr verwirrt hatte. Das Wohnzimmer: Das war dort, wo der Fernseher stand und das weiche, mit Wildleder bezogene Sofa. Alles liebevoll eingerichtet, gut gepflegt – worauf man in seiner wohlgeordneten Welt so Wert legt.
Jetzt drangen sie in unser Heim ein. Und das Geräusch, das sich daran anschloss? Sie mussten den Teppich gefunden haben, daran herumkauen! Ein Gefühl von Elend begann sich in meinem Körper breitzumachen – etwas, das nichts mit meinem Ekel vor den Geräuschen, die diese Dinge verursachten, zu tun hatte. Es war ein Gefühl, das unseren Untergang signalisierte, den Untergang der Zivilisation, zumindest unserer eigenen – der, wie wir sie kannten.
Wir lagen in einem Loch, in dem wir erst verdursten, dann verfaulen würden. Wir hörten, wie sie all das zerstörten, was wir uns in jahrelanger Arbeit aufgebaut hatten. Unser Lebenswerk. Das, was bis zu unserem Tod hatte halten sollen – am besten noch darüber hinaus. An die Enkel weitergereicht, von Generation zu Generation vererbt – so hatte ich es mir erträumt. Ein Traum ... Kein zu hoch gegriffener, wie mir schien. Und doch: zu viel, um in Erfüllung zu gehen.
Binnen Sekunden musste ein Pesthauch um die Möbel, die Einrichtung wehen, um unsere Sachen, die nun – nachdem das Radio verstummt war – ohnehin wertlos geworden waren.
Ich spürte, wie mir eine Träne die Wange hinunterlief. Sie vermischte sich mit dem feuchten Film auf meiner Haut, und dort, wo sie ihn beiseiteschob, begann das Jucken. Zunächst legte ich nur meinen Finger darauf, beinahe beiläufig – vielleicht auch, damit Birk nicht sah, dass die Träne meinem Auge entkommen war. Dann begann ich, mit dem Finger leicht darüber zu fahren. Nichts half! Das Jucken wurde stärker. Ich erhöhte den Druck auf die Stelle, fuhr schneller darüber, biss meine Zähne zusammen. Immer noch keine Linderung. Schließlich gab ich auf und bohrte mir den Nagel ins Fleisch.
Ich sah aus dem Augenwinkel, wie Birk sich mir zuwandte ob der heftigen Bewegungen. Ich ignorierte ihn, blickte weiter starr zur Decke. Oben tobten sie nun, unten kratzte ich mir das Gesicht blutig. Blut war besser als Tränen. Besser ein verletzter Körper als eine verletzte Seele!
Plötzlich durchbrach ein Schuss das Treiben. Birk und ich zuckten zusammen. Dann: ein weiterer Einschlag! Eines der Wesen in unserem Wohnzimmer begann zu winseln. Hatte eine Kugel seinen Leib durchbohrt? Der dritte Schuss tönte so laut, dass mir die Ohren schmerzten.
Das Vieh stieß einen Schrei aus. Im nächsten Moment plumpste sein Körper schwer auf den Boden. Der Aufprall war direkt über uns; die Konserven im Schrank vibrierten. Es atmete ein letztes Mal aus, lang und flach und rasselnd.
Als es geendet hatte, betrat jemand unsere Wohnung. Der Schütze?
Schwere Stiefel dröhnten auf dem Parkett. Wieder peitschte Schrot durch die Luft. Ein paar Meter weiter zerschlug er unser Porzellan, prallte von den Schränken in der Küche ab.
Dann herrschte Stille.
Jemand musste noch immer in der Wohnung sein, doch kein Laut war von oben zu hören. Als sei er erstarrt. Ich stellte mir das Bild vor: zweidimensional, als hätte jemand eine scharfe Klinge genommen und sei damit durch unser Haus geglitten, bis man von der Seite hineinblicken konnte. Und da saßen wir nun, unten im Keller, vorm Regal, auf dem nur noch wenige Dosen glänzten, und oben stand er, mit seinem Gewehr. Alle waren reglos, bewegten sich nicht, atmeten kaum. Verkommen zu einem Abbild unseres Selbst, verbannt in ein Bild, gedruckt auf Pappe, weit von der Wirklichkeit entfernt.
Ein Kribbeln weckte mich aus meinen Gedanken. Hinten in der Nase kitzelte mich etwas. Verdammt! Ich verzog das Gesicht. Da war was zwischen meinen Nasenhaaren! Staub? Schimmel? Etwas, das vom Aufprall eben aufgewirbelt worden war? Ich durfte nicht niesen! Wir konnten nicht wissen, ob der Mensch dort oben uns freundlich gesinnt war. Ob das überhaupt noch ein normaler Mensch war, wie wir ihn aus unserer Erinnerung kannten? Und er hatte ein Gewehr!
Wir besaßen nichts, das als Waffe zu gebrauchen gewesen wäre. Allenfalls die Dosen. Die waren hart genug, um jemandem die Nase zu brechen – sofern man nah genug an ihn herankam, ehe er einem Schrot durch die Eingeweide jagte!
Aber das Kribbeln war nicht aufzuhalten. Ich hatte bereits die Kontrolle über meinen Körper verloren. Zweimal sog ich stoßartig Luft ein, dann platzte es aus mir heraus.
Als Antwort darauf drang ein weiterer Laut an mein Ohr. Der da oben lud sein Gewehr durch – Metall rutschte über Metall, rieb aneinander, dann ein Klicken. Wie viel Schuss sich wohl im Magazin befanden? Noch mal vier? Jedenfalls hatte er genug dabei, um Birk und mir die Gehirne aus den Schädeln zu blasen.
Ich hielt die Luft an. So lange ich konnte. Und wenn ich atmete, dann nur ganz flach, so leise wie möglich. Das war ein Fehler. Gerade deswegen strichen mir die Staubkörner und Schimmelsporen und was da sonst noch durch den Kellerraum flog, an den Schleimhäuten vorbei. Ich legte den Zeigefinger meiner rechten Hand unter die Nase. Ich zitterte – vor Anstrengung. Und vor Angst! In meinem Hinterkopf stieg ein Gefühl hoch, kroch die Wirbelsäule entlang, dann von hinten über den Schädel und von der Stirn wieder hinab in mein Gesicht. Schließlich brach mein Widerstand und ich nieste ein zweites Mal. Ich riss die Augen weit auf, traute mich nicht einmal, die Tropfen von meiner Oberlippe abzuwischen.
Diesmal stand der da oben nicht still. Er begann, über unsere Dielenbretter zu laufen. Seine Stiefel quietschten. Metall klapperte. Meine Augen folgten dem Pfad aus Lärm über uns. Der Schütze ging auf die Tür zu. Sollte er sie nicht sofort finden, würde er nach dem Zugang suchen. Jetzt wusste er, dass sich jemand im Untergeschoss aufhielt – eine oder mehrere Personen, die hier in ihren Kellern ausharrten.
Wer weiß, wie viele Häuser er bereits durchstöbert hatte? Über wie vielen Köpfen er bereits so entlang geschritten war – mit quietschenden Stiefeln, mit klapperndem Gewehr und Kugeln, welche die Stille zerfetzten? Wenn er uns zu Gesicht bekam, waren wir für ihn gewiss nur eines von vielen Paaren. Vor der Tür angelangt, klopfte er zweimal dagegen. Ein schweres Klopfen, kraftvoll, als stamme es von einem Menschen mit absolutem Selbstvertrauen. So jemand musste man sein, um durch die Welt über den Kellern laufen zu können, da war ich mir sicher. Auch wenn ich diese Welt noch nicht gesehen hatte.
Als wir nicht antworteten, klopfte er ein drittes Mal. Dann dröhnte er – dröhnte so tief wie ein Braunbär, den man aus dem Schlaf weckt: „Hallo, ist da jemand?!“ Ein paar Sekunden legte sich wieder das Tuch der Stille über uns, als sei nichts geschehen.
Ich wollte nicht antworten – vielleicht zog der Bär wieder ab, ließ uns in Frieden dahinvegetieren.
Birk jedoch rief: „Wer sind Sie?“
Der Mann lachte.
„Als ob das noch eine Rolle spielt!“
„Mir ist es wichtig!“
Birk ließ nicht locker.
Der Kerl draußen schnaubte.
„Meinetwegen! Jeff Barker heiße ich. Sie waren wohl noch nicht oben? Seit dem Zwischenfall, meine ich?“
Birk schüttelte den Kopf: „Nein. Wir verlassen unsere Zuflucht erst, wenn das Militär kommt. Sind Sie vom Militär?“
Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie der Mann vor der Tür Birk einen Vogel zeigte.
Er lachte wieder, ehe er antwortete: „Vom Militär hat seit geraumer Zeit niemand etwas gehört. Gibt ja keine Nachrichten mehr. Kein Radio, kein Fernsehen. Alles tot! Nicht einmal die Funkgeräte funktionieren. Aber ...“ Ich hörte, wie der Kerl draußen auf den Boden spuckte – mitten auf unsere Kellertreppe, „… das mit dem Radio müssen Sie ja wissen, wenn Sie so hörig sind. Ich meine, unserer Regierung treu ergeben. Nicht?“
„Das Radio funktioniert bereits nicht mehr seit ...“ Birk warf einen Blick auf die Striche an der Wand, „seit acht Tagen. Haben Sie einen Code?“
Mr. Barker fing schallend an zu lachen. Seine Stimme hallte quer durch die Straßen. Ob die Viecher davon angelockt wurden? War er nicht ein wenig zu selbstsicher? Oder hatte er sie alle abgeknallt?
Ich versuchte, mir ein Bild von Mr. Barker zu machen: braune Haare, kurz geschoren, dazu ein ebenso brauner Schnäuzer, die Nase zu einer Knolle verkommen und gerötet, die Haut grobporig. Er mochte sich vorkommen wie ein verwegener Gendarm, der für Recht und Ordnung sorgt. Kein Mensch, mit dem ich mich gerne angefreundet hätte!
Schließlich fing sich der Kerl wieder und antwortete: „Codes gibt's nicht mehr! Wenn Sie diesen Wisch meinen, den die Regierung uns geschickt hat: Verbrennen Sie ihn, putzen Sie sich damit den Arsch ab! Zu was Besserem taugt der eh nicht mehr! Den Scheiß, der da drinsteht, können Sie getrost vergessen. Ihre Wohnzimmereinrichtung übrigens auch; da liegt jetzt ein toter Morog und blutet den Teppich voll. Falls Sie das noch interessiert!“
Morog? Damit musste er die hüpfenden Bestien meinen, die um unser Haus geschlichen waren! Das klang ganz nach etwas, das auf fünf Beinen durch die Gegend hüpfte, schlurfte und schnüffelte!
„Wir müssen aber einen Code haben, bevor wir die Tür öffnen“, meinte Birk. „Sonst könnte ja jeder kommen! Immerhin haben Sie ein Gewehr dabei. Woher wissen wir, ob Sie uns nicht erschießen?“
Mr. Barker grunzte.
„Wenn Sie mir nicht glauben, kann ich Sie natürlich nicht zwingen! Aber wissen Sie was? Wir haben hier in der Nähe einen Stützpunkt, beim Meadow Hue Pond. Am See, der östlich von hier liegt. In der alten Jugendherberge. Das Quartier gibt's immer noch, auch wenn es nun größtenteils voll Schlamm ist. Kommen Sie vorbei, sobald Ihnen danach ist. Immer vorausgesetzt, Sie schaffen es, sich bis dorthin durchzuschlagen!“
„Wegen der Morogs, sagen Sie?“, fragte Birk.
„Unter anderem.“ Der Kerl stieß einen Seufzer aus. „Die Herberge liegt recht nah – ist aber ein weiter Weg, wenn man die Strecke unter freiem Himmel bewältigen will. Zumindest, seit es diese Viecher gibt!“
Birk drehte sich zu mir um. Er sprach leise, aber immer noch so laut, dass Mr. Barker uns hören konnte: „Wir sollten doch mitgehen; die Vorräte sind bald aufgebraucht. Wir haben kaum noch etwas zu trinken. Bald müssen wir hinauf. Ist es nicht besser, jemanden dabei zu haben, der einem alles erklärt?“
Die Wahrheit war: Ich wollte die neue Wirklichkeit nicht sehen. Solange es irgendwie ging, wollte ich damit nichts zu tun haben. Lieber fraß ich noch ein paar Tage lang Kaltes aus Konserven und spülte es mit abgestandenem Wasser hinunter. Lieber kratzte ich noch die Feuchtigkeit aus den Fugen unseres Lochs! Unsere schwindenden Vorräte erschreckten mich nicht so sehr wie das, was oben lauerte.
Ich schüttelte den Kopf. Oben, das war Gefahr. Mr. Barker, mit seinem Gewehr, war mir ebenfalls nicht geheuer. Ich flüsterte Birk ins Ohr – so leise, dass der Kerl es auch mit gespitzten Ohren unmöglich mitbekommen konnte: „Ich traue ihm nicht! Was, wenn er nur auf unsere Essensreste und das verbliebene Wasser aus ist?“
Dieser Gedanke musste Birk ebenfalls gekommen sein. Er warf mir einen langen, ernsten Blick zu. Schließlich rief er: „Mr. Barker, wir danken Ihnen für Ihr Angebot! Und dafür, dass Sie diesen ... Morog ... erschossen haben!“
„Keine Ursache!“, schnaufte der Kerl. Er schlug noch ein letztes Mal vor die Eisentür. „Ich muss jetzt wieder los; meine Leute erwarten mich. Wenn ich länger für meine Patrouille brauche als ausgemacht, denken sie nachher, eines dieser Viecher hätte mich zwischen die Zähne bekommen!“
Er lachte, als hätte er einen besonders originellen Witz gemacht.
Ich hörte seine Kleidung rascheln; wieder klimperte etwas. Er lief die Treppe hinauf.
Und wir blieben unten, in unserem Loch.
Tag 11
Als das Essen aufgebraucht war, begann der Hunger. Am zehnten Tag öffnete ich die letzte Konserve – ein Glas voller eingelegter Pflaumen. Nachdem die letzte violette Frucht in meinem Mund verschwunden war, aß mein Körper sich selbst. Etwas, das früher als ‚Abnehmen‘ bekannt und durchaus positiv bewertet war. In unserem reichen Land zumindest.
In den Zeitschriften gab es Tipps dazu: Eine Diät ohne Kohlehydrate, eine, in der die Nahrungsmittel nach einem System getrennt konsumiert wurden und eine ohne alles. Nur Suppe durfte man dann und wann schlürfen, mit Gewürzen verfeinert, bloß nicht zu dick eingekocht. Dazu wurde gezählt: Kalorien. Joule und Kilojoule. Im Luxus schwelgend lebte ich in eisiger Disziplin – zumindest von Zeit zu Zeit.
Nun kroch ich hinters Regal, auf dem Boden entlang, ins Feuchte, und sammelte mit dem Finger Reste des von mir verhassten Pumpernickels auf. Die Krümel schmeckten mehr nach Schimmel als alles andere; doch da, war das nicht ein Hauch von Geschmack? Etwas wie Brot, das ich in meinem Mund spürte? Mein Mund – die Lippen rissig geworden, an Stellen aufgeplatzt – verzog sich zu einem Grinsen. Was ein Unterschied zu damals!
Ich versuchte, mir die Leute aus den Illustrierten vor die Netzhaut zu zaubern: Da waren sie, überlagerten das Grau-in-Grau des Kellers, liefen in hochhackigen, goldenen Schuhen über rote Teppiche, hielten ihre Handtaschen, die derart kurze Henkel hatten, dass sie unmöglich alltagstauglich sein konnten. Das Meiste von dem, das die Leute auf den Fotos trugen, war so gemacht, dass es im normalen Leben keinen Platz hatte. Vielleicht, um zu demonstrieren, dass diese Leute sich erlauben konnten, unpraktische Dinge zu besitzen, weil jemand anderer die körperliche Arbeit für sie erledigte?
Jetzt beschäftigte mich eine andere Frage: Wo waren diese Prominenten nun? Hatte jemand sie vorher gewarnt? Eher als uns? Lebten sie in luxuriös eingerichteten Luftschutzbunkern und inszenierten dort weiterhin ihre Partys? Bei einem König oder einer Königin konnte ich mir dies durchaus vorstellen, oder bei jemandem, der wirklich berühmt war – Wissenschaftler, Musiker, Schauspieler ... Aber diese ganzen Stars, IT-Girls und was mir da noch alles präsentiert worden war, die mussten doch mittlerweile genau wie Birk und ich in einem Loch hausen. Schließlich gab es einfach nicht genug Bunker und unterirdische Anlagen. Dazu bevölkerten entschieden zu viele Menschen diesen Planeten. Oder hatten ihn bevölkert.