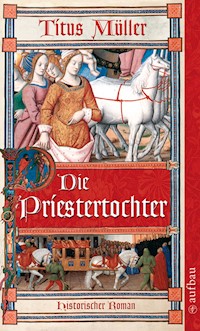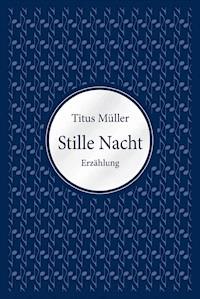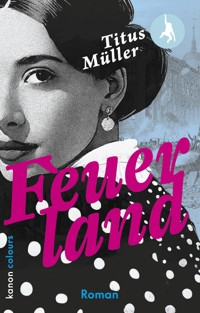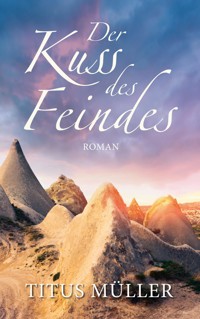10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Roman über den Aufstand am 17. Juni 1953, als 24 Stunden alles möglich schien
Das Leben der Gymnasiastin Nelly Findeisen wird mit jedem Tag komplizierter. Es reicht nicht, dass sie ihren Vater, der vor sieben Jahren nach Russland abkommandiert wurde, nie mehr sieht, auch ihre Mutter wird ihr zusehends fremder. Hinzu kommt ihr Engagement in einer kirchlichen Jugendorganisation, was im Frühjahr 1953 zum Rauswurf aus der Schule führt. Trost könnte sie bei dem jungen Uhrmacher Wolf Uhlitz finden, der sich in sie verliebt hat. Er will ihr helfen, legt sich dafür sogar mit seinem Vater an, entwendet staatliche Dokumente und landet im Gefängnis. Was Wolf nur vage ahnt: Die junge Nelly steht in einer geheimnisvollen Verbindung mit einem russischen Spion namens Ilja, der sie mit Nachrichten über ihren verschleppten Vater versorgt und den Austausch von Briefen mit ihm vermittelt. Wie Wolf träumt auch Ilja von einem Leben mit Nelly – aber als sich in Berlin und Halle die Unzufriedenheit mit dem Regime in Massendemonstrationen entlädt, hängt ihrer aller Leben an seidenen Fäden.
Titus Müller erzählt eindringlich und packend vom Leben der Aufbegehrenden und entfaltet authentisch und detailgenau das Panorama eines Aufstandes, der beispielhaft wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Das Leben der Gymnasiastin Nelly Findeisen wird mit jedem Tag komplizierter. Es reicht nicht, dass sie ihren Vater, der vor sieben Jahren nach Russland abkommandiert wurde, nie mehr sieht. Auch ihre Mutter wird ihr zusehends fremder, hat sie sich doch umstandslos mit einem neuen Mann eingelassen, dem Arbeiter Lutz, den Nelly einfach nicht als Ersatzvater akzeptieren kann. Obendrein wird sie jetzt auch noch kurz vor dem Abitur von der Schule geworfen. Man hält ihr, wie zahlreichen anderen Schülern und Schülerinnen im Land, das Engagement in der Jungen Gemeinde, der Jugendorganisation der Kirche, vor. Sie soll sich öffentlich in einer Art Schauprozess in der Schule davon distanzieren, weigert sich jedoch.
Immerhin hat sie jetzt am Müggelsee eine recht aufregende Bekanntschaft gemacht: ein junger Uhrmacher, der sich ganz offen von ihr fasziniert zeigt. Doch als Nelly ihn in seinem eigenen Laden aufsucht, kommt er ihr verschlossener und auch verschrobener vor als vermutet. Aber so leicht lässt sich Wolf Uhlitz nicht abwimmeln. Er findet ihre Adresse heraus, geht mit ihr aus. Ja, er begleitet sie sogar zu einem Treffen der Jungen Gemeinde, der engagierten Christen, obwohl ihm das Christentum zutiefst fremd und suspekt ist und bleibt. Er weiß nicht recht, ob er diese Leute für ihre offenen Worte, ihre kritische Einstellung zum SED-Staat, bewundern oder verachten soll.
Als er Nelly wieder besuchen will, wird er von einem Russen zurückgehalten, der ihn eindringlich warnt, sich ja von Nelly fernzuhalten. Warum, das erfährt er nicht. Aber er spürt, das der Fremde die Warnung todernst meint – und dass es in Nellys Vergangenheit ein Geheimnis geben muss, von dem er keine Ahnung hat.
Der Autor
Titus Müller, geboren 1977 in Leipzig, schreibt Romane und Sachbücher. Er ist Mitglied des PEN-Clubs und wurde u. a. mit dem C.-S.-Lewis-Preis, dem Sir-Walter-Scott-Preis und dem Homer-Preis ausgezeichnet.Weitere Informationen unter www.titusmueller.de
Lieferbare Titel
Der Kalligraph des Bischofs – Die Brillenmacherin – Die Todgeweihte – Die Jesuitin von Lissabon – Tanz unter Sternen – Nachtauge – Berlin Feuerland – Der Tag X – Die goldenen Jahre des Franz Tausend Die Spionin Trilogie: Die fremde Spionin – Das zweite Geheimnis – Der letzte Auftrag
TITUS MÜLLER
DER TAG X
ROMAN
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Titus Müller
Copyright © 2017 by Karl Blessing Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München
Coverabbildungen: Getty Images/Archive Photos/FPG; akg-images/Gert Schütz
Kartografie: Astrid Fischer-Leitl, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-21155-4V004
www.blessing-verlag.de
Gewidmet meinem Lektor Dr. Edgar Bracht,
der diese Geschichte mit der ruhigen Liebe eines Gärtners
aufgezogen und in die Sonne gestellt hat.
BERLIN,22.OKTOBER1946
Als Faustschläge gegen die Tür donnerten, richtete das Mädchen sich im Bett auf und lauschte in die Dunkelheit. Sie hörte ihren eigenen Atem. Jetzt dröhnten Männerstimmen von der Straße herauf, und im Zimmer nebenan knarzte das Bett der Eltern. Nelly erhob sich leise und schlich auf nackten Füßen zum Fenster.
Vor dem Haus stand ein Militärlastwagen, und Soldaten, die mit Maschinengewehren bewaffnet waren, blickten aufmerksam an der Fassade hoch. Ein Offizier rauchte, sie sah die Zigarettenspitze aufglimmen, bevor er die Zigarette auf die Straße schnippte und in russischer Sprache einen Befehl erteilte.
Wieder erbebte die Tür unter Fausthieben. Nellys Brust schnürte sich zu, sie bekam kaum noch Luft.
»Ich komme«, rief der Vater.
Sie hörte das Flüstern der Eltern im Wohnungsflur, dann die Schritte ihres Vaters und das Aufschließen der Tür. Schwere Stiefel polterten in die Wohnung. Hastig sah das elfjährige Mädchen sich um. Schreibtisch? Bett? Schrank? Armselige Verstecke! Der Vorhang am Fenster?
»Wer gibt Ihnen das Recht, hier einzudringen? Es ist drei Uhr in der Früh!« Vaters Protest ging in russischen Befehlen unter.
Die Tür zum Kinderzimmer wurde aufgerissen, und ein Militärpolizist schaltete das Licht ein. Er rief zwei Uniformierte heran und zeigte auf Nellys Schrank. Sie nahmen Nägel aus einer kleinen Schachtel und nagelten mit groben Hammerschlägen die Schranktür zu. Zwei andere trugen den Schreibtisch hinaus. Sahen sie Nelly gar nicht?
Sie lief zur Mutter, die aber auch nur ungläubig auf die Uniformierten starrte, die ihre Wohnzimmerschränke zunagelten. Vater redete leise mit dem Offizier. Der musste etwas Schlimmes gesagt haben, denn Vater wurde blass und sagte zu Mutter und ihr: »Zieht euch an.«
Der Schrank, der Nellys gesamte Kleidung enthielt, wurde gerade hinausgetragen, und sie spürte, wie ihr Herz heftiger schlug. Sie würde die Sachen von gestern anziehen müssen, die über der Stuhllehne hingen. Die Badezimmertür schloss sich. Kurz darauf hörte Nelly ihre Mutter im Bad schluchzen.
»Schnell«, sagte Vater, schob Nelly in ihr Zimmer zurück und schloss von draußen die Tür.
Wo der Schreibtisch und der Schrank gestanden hatten, lagen jetzt Staubflusen. Nelly löschte das Licht, damit man sie nicht durch das Fenster sah, schlüpfte aus dem Pyjama und zog sich an. Anziehen bedeutete, man würde sie von hier wegbringen. Durften sie nicht länger in diesem herrschaftlichen Haus in der schönen Sternallee wohnen? Wurden sie gar ins Gefängnis gesteckt? Was hatten sie denn verbrochen?
Sie zog die Kiste mit der Laterna magica unter dem Bett hervor. Ihre Traummaschine. Wenn für ein Kind eine Ausnahme gemacht wurde und sie die Laterna magica mitnehmen durfte, würden die leuchtenden Bilder ihr in der kalten Zelle Trost spenden. Aber gab es überhaupt Strom in Gefängniszellen? Notfalls musste sie sich die Bilder eben ohne künstliches Licht anschauen und sie einfach vor das vergitterte Fenster halten. Hoffentlich zerbrachen nicht unterwegs die Glasplatten.
Zum letzten Mal sah sie sich ihr Kinderzimmer an. Sie nahm Abschied von der hohen, stuckverzierten Decke, die ihr das Gefühl gegeben hatte, in einem Schloss zu wohnen und eine Prinzessin zu sein, und nickte dem Puppenhaus zu, das auf dem blank gebohnerten Parkettboden stand. Dann schleppte sie die Kiste in den Flur. Zwei Uniformierte rollten gerade den Teppichläufer ein, schulterten ihn und gingen nach draußen. Aus der Küche trug ein Soldat eine Obstkiste voller Geschirr so achtlos heraus, dass die Tassen schepperten.
Der Offizier, der draußen geraucht hatte, stand jetzt im Flur und warf Vater einen strengen Blick zu. »Der Wagen wartet.«
Dass Vater nichts erwiderte, machte Nelly Angst. Sie stolperte ihm hinterher Richtung Haustür.
Mutter stellte sich ihr in den Weg: »Was willst du mit dem alten Ding?«
Ein junger Soldat, der mit seiner Maschinenpistole den Abtransport überwachte, lächelte. »Laterna magica? Schön«, sagte er in gebrochenem Deutsch.
Mutter nahm ihr die Kiste aus der Hand. »Nelly«, sagte sie leise, ihr verheultes Gesicht kam ganz nah, »wir werden nach Russland verschleppt. Womöglich nach Sibirien. Du brauchst warme Kleidung, kein Spielzeug.« Sie stellte die Kiste auf den Boden. »Halt die Arme auf.«
Nelly gehorchte.
Mutter legte ihr die Wolljacke quer darüber und lud ein zweites Paar Schuhe darauf und den Schal, der an der Garderobe gehangen hatte. »Geh raus zum Auto«, sagte sie und verschwand in der Küche.
Trotzig legte Nelly die Last ab. Sie öffnete die Kiste der Laterna magica und suchte ihre liebsten Glasbilder heraus: die Eisbären am Nordpol, den Dschungel und die Pyramiden in Ägypten. Die wickelte sie in die Wolljacke ein, ergriff die Schuhe und den Schal und ging zur Haustür.
Der junge Soldat lächelte schon wieder. Er bückte sich zur Kiste hinunter und trug Nelly die Laterna magica hinterher.
Vor dem Haus warteten zwei Armeelastwagen. Der eine war bis oben mit Möbeln gefüllt, darunter auch die von Nelly. Sie und ihre Eltern wurden zum zweiten Lastwagen geschickt.
An beiden Seiten der Ladefläche waren Bänke angeschraubt. Darauf mussten sie Platz nehmen. Der junge Soldat reichte ihr die Laterna magica hinauf. Er blickte sie für einen Moment nachdenklich an, als würde Nelly ihn an jemanden erinnern.
Vater nickte den anderen Leuten zu, unter denen sich einige Nachbarn befanden, die auch Nelly kannte: der nette Junggeselle und Physikprofessor Stolzing, der Ingenieur Polster, dessen Frau immer so hochnäsig an ihr vorbeiguckte und wenn überhaupt nur missmutig grüßte, und zwei, drei weitere Ehepaare, deren Gesichter ihr vage vertraut waren. Alle wirkten sie geschockt.
Jetzt kam auch Mutter, begleitet von einem Soldaten. Sie trug ein Brot in der Hand und hatte die Manteltaschen voller Äpfel. Als sie auf den Lastwagen kletterte, fiel einer hinaus und rollte über die Straße, bis er im Dreck liegen blieb. Mutter starrte die Familien an, die dicht gedrängt auf den Bänken saßen. Jetzt heulte sie wieder auf, was Nelly wütend machte, und rief: »Das können die nicht machen!«
»Doch«, sagte ein Mann trocken, »können die.«
Der Ingenieur Polster warf einen erschrockenen Seitenblick auf die Militärpolizisten. Er machte eine beschwichtigende Geste. »Man hat uns versprochen …«
»Versprochen?«, fuhr Mutter, die immer noch stand, dazwischen. »Was denn? Dass wir in Sibirien zu essen bekommen? Dass die Kinder zur Schule gehen dürfen? Und was ist mit den Versprechen, die wir letztes Jahr bekommen haben? Kapieren Sie doch! Die haben uns die schönen Häuser nur gegeben, um uns zusammenzupferchen, der Hirschgarten mit seinen schönen Villen war in Wahrheit unser Ghetto, die ganze Zeit!«
Einer der Militärpolizisten stieg zu ihnen auf die Ladefläche. Er tippte auf die Maschinenpistole vor seiner Brust und sah Mutter aus kalten Augen an.
Vater klammerte sich an sie, auch Nelly nahm ihren Arm und zog sie auf die Bank herunter. Wenn sie Mutter jetzt hochreißen und vom Lastwagen stoßen würden …
Der Lastwagen fuhr an. Der Militärpolizist stand noch eine Weile, als könnte ihn die polternde Fahrt nicht im Geringsten aus dem Gleichgewicht bringen. Schließlich setzte er sich an das Ende der Bank. Die Gefangenen wichen furchtsam vor ihm zurück. Keiner von ihnen würde es wagen, während der Fahrt abzuspringen und zu fliehen.
Auf allen Kreuzungen sah Nelly Militärjeeps und Wachposten. Der gesamte Hirschgarten war von Truppen der Roten Armee abgeriegelt worden. Ein Mann rannte über die Straße, drei Soldaten jagten ihm nach, holten ihn ein und knüppelten ihn nieder. Wie ein Sack Mehl wurde er in einen wartenden Jeep geworfen. Im Schein der Straßenlaternen wirkte das Geschehen wie ein gespenstisches Nachtstück, aufgeführt, während die Stadt Berlin schlief.
Alle auf den Bänken im Lastwagen hatten das gesehen, was Nelly soeben beobachtet hatte, und versanken doch in Stille.
Draußen hingen noch Werbeplakate von den Berliner Magistratswahlen, bei denen die SED eine schwere Niederlage erlitten hatte und von SPD und CDU auf den dritten Rang verwiesen worden war, womit laut Vater niemand gerechnet hatte. Am allerwenigsten die Machthaber in der Sowjetischen Besatzungszone. Aber in Berlin konnten sie die Wahlen nicht so stark wie anderswo beeinflussen, ganz Berlin wählte gemeinsam, die Menschen in der östlichen mit denen in den westlichen Besatzungszonen. Seit der Wahl lastete eine bleierne Schwere auf der Stadt, man hatte geahnt, dass etwas kommen würde, in der Schule hatte Nelly den Ernst der Lage an den Gesichtern der Lehrer ablesen können. Und jetzt wurde der Albtraum, vor dem sich alle gefürchtet hatten, Wirklichkeit.
Als der Lastwagen am Bahnhof Köpenick hielt, presste Nelly ihre Laterna magica an sich. Hier in der Nähe, im Erpetal, hatte sie manches Mal mit ihren Freundinnen am Mühlenfließ gespielt, auch wenn sie danach ausgeschimpft wurde, weil sie sich so weit vom Haus fortgestohlen hatte.
»Aussteigen!«, befahl der Militärpolizist.
Sie kletterten von der Ladefläche.
Der Bahnhof war abgeriegelt, es wimmelte von bewaffneten Rotarmisten. An eine Flucht war nicht zu denken. Die Gleise standen voller Eisenbahnwaggons, obwohl es mitten in der Nacht war. Soldaten luden Stühle und Schränke in die Güterwaggons, sogar einen Vogelkäfig, in dem ein Wellensittich hin und her flatterte. An den Waggons für Passagiere stauten sich Trauben von Familien. Um diese Zeit lagen sie sonst in ihren Betten und schliefen friedlich.
»Da bekommen Sie noch was zu essen«, sagte der Militärpolizist.
Vor einer Suppenkanone hatte sich eine lange Schlange gebildet. Mutter sagte: »Ich kriege jetzt nichts runter.«
Nelly ging es genauso, sie pflichtete ihr bei.
»Aber die Fahrt wird sehr lang werden.« Vater sah bekümmert aus. »Bitte.«
Also stellten sie sich ihm zuliebe an. In die einfachen Blechnäpfe wurde jeweils eine Kelle Kartoffelsuppe hineingeklatscht. Seltsamerweise konnten sie alle essen, selbst Mutter. Ein Offizier mit einer Liste in der Hand rief fragend Vaters Namen. Als er sich meldete, sagte der Offizier: »Kommen Sie mit, ich bringe Sie zum Zug.«
Mutter stutzte. »Unsere Namen haben Sie nicht auf der Liste?«
Der Offizier sagte: »Frauen und Kinder fahren einfach so mit.«
»Obwohl wir nicht auf der Liste stehen?«
»So ist es«, sagte er.
»Das heißt, wir könnten hierbleiben.«
Der Offizier sah zu Vater. »Klären Sie das mit Ihrem Mann. Ob wir die Putzfrau mitnehmen oder die Geliebte und ob die Kinder dabei sind, spielt keine Rolle für uns.« Er sprach tadellos deutsch. Aber er trug eine Maschinenpistole, und das vergiftete seine Worte.
Die Leute wurden in die Züge getrieben, Mutter schluchzte: »Nelly war vier, als der Krieg losging, das ist ihr erstes Friedensjahr. Wir können uns doch jetzt nicht nach Russland verschleppen lassen!«
»Wir haben keine Wahl, Julia«, sagte Vater. »Irgendwann werden sie uns wieder zurückkehren lassen.«
»Dann warte ich lieber hier auf dich. Nelly und ich werden warten.«
Vater verstummte. Er sah plötzlich aus wie ein kleiner Schuljunge. Sein Blick flehte.
»Ich liebe dich, Peter«, schluchzte sie, »bitte, du musst mich verstehen. Ich kann das nicht!«
»Nein, Mama«, sagte Nelly, »wir müssen zusammenbleiben, wir können Papa doch nicht allein wegfahren lassen, wann werden wir ihn denn wiedersehen? Vielleicht nie!« An der Suppenkanone stand schon niemand mehr, überall stiegen die Letzten ein. Jetzt kamen Soldaten und befahlen auf Russisch etwas, das nur bedeuten konnte, dass Papa einsteigen musste. Allmählich verlor auch der Offizier mit der Liste die Geduld.
Vater und Mutter fielen sich in die Arme, umklammerten sich kurz, dann küsste Papa sie, Nelly, auf die Stirn. Er war plötzlich um Jahre gealtert, aschfahl geworden, als wäre er todkrank. Die Soldaten drängten ihn in den Zug, unter ihnen der Soldat, der Nelly im Haus lächelnd die Laterna magica nachgereicht hatte. Als er Nelly für einen Moment wieder wahrnahm, blickte sie ihn bittend an.
Ein greller Pfiff ertönte, und die Lokomotive setzte sich schnaufend in Bewegung. Vater beugte sich aus dem Fenster und rief mit Tränen in den Augen: »Nelly, mein Liebling, ich komme wieder, sobald ich kann. Vergesst mich nicht!«
Sie sah ihm nach und presste die Kiste an sich, weil sie eigentlich Vater an sich drücken wollte.
1
MOSKAU,5.MÄRZ1953
Die dünne, verharschte Schneedecke knirschte unter seinen Schuhsohlen, während Ilja Kolschetow das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagerte und sich fröstelnd die Hände rieb. Er blies warmen Atem auf die Finger.
Eine Packard-Limousine mit silbern blitzender Stoßstange rollte heran. Der Fahrer lenkte sie an den Straßenrand. Die schwache Märzsonne spiegelte sich in der Kühlerfigur auf der schwarzen Motorhaube, einem Pelikan. Die hintere Tür öffnete sich. »Steigen Sie ein.«
Ilja gehorchte. Er setzte sich neben Beria auf die Rückbank und zog die Tür hinter sich zu. Sie war schwer und schloss mit einem satten Klang, sicher war das Fahrzeug gepanzert. Die Sitze waren mit rotem Leder bezogen, das sich unter seiner Hand weich anfühlte und noch ganz neu roch. Die Fensterheber waren verchromt.
Die Limousine glitt wie ein Schiff über die Straße.
»Sind Sie Stalin schon einmal begegnet?« Beria kam gleich zur Sache. Dass sie sich seit Jahren nicht gesehen hatten, spielte für ihn keine Rolle. Niemand begrüßte ein Werkzeug, man nahm es zur Hand und arbeitete damit.
»Nein«, sagte Ilja.
Beria sah kühl nach vorn. »Ich werde Sie als meinen neuen Leibwächter vorstellen. So können Sie überall dabei sein, ohne dass jemand Fragen stellt.«
Sie folgten der Staatsstraße nach Westen, hinaus aus Moskau. Nach einer halben Stunde hielten sie an einem Kontrollpunkt mit Schranke. Man ließ sie passieren, und sie bogen nach links ab. Kunzewo stand auf einem Schild.
Als sie sich einem Fichtenwäldchen näherten, fragte Ilja: »Weiß Stalin, dass Sie Ihr eigenes Agentennetzwerk weiterführen?« Offiziell unterstanden die Geheimdienste Beria nicht mehr. Flog er mit seinen Machenschaften auf, würde das nicht nur seinen Tod bedeuten.
»Erstens könnte Stalin das gar nicht verhindern, weil niemand außer mir meine Agenten kennt, und zweitens ist es ihm recht. Er schätzt Parallelstrukturen. Sie erzeugen Konkurrenz unter seinen Untergebenen. Er wusste auch zu meinen Zeiten als NKWD-Chef, dass ich zusätzlich ein eigenes Netzwerk von Agenten führe.« Beria sah kurz zu ihm hinüber. »Hören Sie auf, sich meinen Kopf zu zerbrechen, und konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgaben.«
Sie passierten einen weiteren Kontrollpunkt und durchfuhren das Tor zu Stalins Landhaus. Vor dem khakigrün gestrichenen Gebäude parkten weitere Staatskarossen, ein Cadillac, ein Buick, ein Mercedes, ein ZiS 110. Geschickt steuerte der Fahrer den Packard in eine Lücke am hinteren Ende der Limousinenreihe. Sie waren im Zentrum der Macht angekommen. Von hier aus regierte der Vater der Industrialisierung und Befreier Europas den größten Staat dieser Welt – vom ewigen Eis im Norden bis zu den Wüsten in Zentralasien, von der Ostsee bis zum Pazifischen Ozean, elf Zeitzonen weit, ein Sechstel der Erde. Gerade erst hatte Stalin den XIX. Parteitag geleitet, eine Verschwörung jüdischer Ärzte aufgedeckt, Moskau mit Luftabwehrraketen umgeben und einen Gefangenenaustausch im Koreakrieg auf den Weg gebracht.
»Stalin hat sowieso andere Sorgen«, sagte Beria und öffnete die Tür an seiner Seite des Wagens. »Er ist damit beschäftigt zu sterben.«
Die Worte trafen Ilja Kolschetow wie ein Hieb mit dem Vorschlaghammer. Benommen stieg er aus und folgte Beria in das Haus. Wenn Stalin starb – standen sie dann nicht am Rande eines Dritten Weltkriegs? Er war eine Urgewalt, die Menschen nach ihrem Willen formte. Wie konnte er sterben?
Am Ende der Diele hing eine Weltkarte. Auch die Revolution hatte ihre Landkarten. Den Nazis war es um Gebiete gegangen, sie dagegen führten den Klassenkampf, den Kampf der sozialen Schichten, und nicht überall auf der Welt war die Arbeiterklasse an der Macht. Wie sollte, wie konnte es ohne Väterchen Stalin weitergehen? Sie passierten die Karte und betraten ein weitläufiges Esszimmer mit Kronleuchtern und einem langen Tisch, an dem etwa dreißig Stühle standen. An der Seite, hinter den Stühlen, befand sich ein Sofa.
Ilja erschrak. Stalin lag auf diesem Sofa und war mit einer einfachen Decke zugedeckt worden. Sein pockennarbiges Gesicht war bleich und glich dem einer Mumie. Ärzte nahmen mit dünnen Zangen schwarze, sich windende Blutegel aus einem Glas und setzten sie ihm hinter die Ohren. Stalin wehrte sich nicht. Eine Krankenschwester flößte ihm mit dem Teelöffel eine gelbliche Flüssigkeit ein. Sauerstoffzylinder wurden herangerollt und neben das Klavier gestellt. Durch die hohen Fenster schien die bläuliche Sonne hinein.
»Lassen Sie ihn jetzt ruhen«, befahl Beria.
»Wir haben alles versucht«, sagte einer der Ärzte, »wie Sie befohlen haben. Das amerikanische Gerät für künstliche Beatmung konnten wir wegen der ungewöhnlichen Voltzahl erst in Gang bringen, nachdem wir ein Aggregat herbeischaffen ließen. Das Aggregat aber macht einen Höllenlärm. Wir haben es wieder abgeschaltet.«
»Gehen Sie.«
Die Schwester und die Ärzte zogen sich zurück.
»Sie bleiben«, sagte Beria zu dem Arzt, der den Bericht gegeben hatte. Dann trat er in einen Nebenraum, Ilja folgte ihm. In diesem zweiten, kleineren Esszimmer saßen auf dem rosa gestreiften Sofa Malenkow und Chruschtschow, auf Stühlen Mikojan, Molotow und Bulganin.
Molotow fragte streng: »Haben Sie ihm Gift gegeben?« In den Tagen der Revolution gegen das russische Kaiserreich hatte man ihn Molot, den »Hammer«, genannt. Seitdem war er nicht wieder zu seinem bürgerlichen Namen Skrjabin zurückgekehrt. Aber schließlich hatte sich auch Stalin seinen Namen »der Stählerne« selbst gegeben. Diese Regierungsmitglieder waren Agenten wie er, Ilja, sie hatten ihre Tarnnamen aus der Zeit der Revolution nie abgelegt. Und sie predigten immer noch, als stünden sie auf den Barrikaden wie einst. Zumindest wenn sie vor das Volk traten. Hier, im inneren Zirkel, wurde offenbar anders gesprochen.
»Ich weiß genau, dass Sie so was beim Geheimdienst haben«, insistierte Molotow. »Sie verabreichen es dem Opfer, es krepiert, und am Ende lautet die Diagnose Herzinfarkt.«
»Sie sprechen von Rizin«, sagte Beria ruhig. »Aber Sie vergessen, dass ich die Geheimdienste längst nicht mehr leite. Und selbst wenn ich es könnte: Ich habe den Genossen Stalin nicht vergiftet.«
Malenkow, den man hinter vorgehaltener Hand »Melanie« nannte wegen seiner Birnenstatur mit weiblich anmutenden breiten Hüften, sagte: »Selbst das Leben eines großen Mannes wie Stalin ist irgendwann einmal zu Ende.«
Unfassbar, dass dieser Weichling mit der Fistelstimme für den Tod von zigtausend Menschen verantwortlich sein sollte. Mit seinem aufgedunsenen Mondgesicht über dem bartlosen Doppelkinn wirkte Malenkow wie ein Höfling, ein Speichellecker. Eine störrische schwarze Schmalzlocke fiel ihm in die Stirn. Hinter den Fettschichten musste sich noch eine andere Person verbergen. Sah man etwas davon in den wachsamen schwarzen Mongolenaugen? Malenkow war intelligent. Es hieß, er schreie nicht herum, wenn Untergebene das Büro betraten, sondern stehe höflich auf. Er las seinen Kindern abends Gedichte vor, das wusste ganz Moskau. Bevor er eine Ausbildung zum Elektroingenieur absolvierte, hatte er auf dem Gymnasium Französisch und Latein gelernt, was ihn in der Runde der Kommunisten zu einem gebildeten Mann machte.
Neben ihm wirkte Chruschtschow wie ein Räuberhauptmann, robust, geradezu quadratisch gebaut und von Ehrfurcht gebietender Statur. Vor seiner politischen Karriere war er Bergarbeiter gewesen. Es hieß, er trinke Weinbrand wie Wasser.
Chruschtschow schien Iljas neugierigen Blick bemerkt zu haben. Er erwiderte ihn und fragte: »Wer ist das?«
»Ein zusätzlicher, neuer Leibwächter«, sagte Beria.
Nun musterten ihn auch die anderen. Fürchteten sie, Beria wolle einen seiner Zöglinge mit ins Rennen schicken, einen weiteren Konkurrenten um die Macht?
Nebenan würgte Stalin, doch niemand hier scherte sich darum.
»Die Lage ist klar«, sagte Beria. »Wir können uns entweder sofort einigen, wie wir Stalins Nachfolge regeln, oder es wird einen großen Kampf im Kreml geben, bei dem Köpfe rollen.«
Sicher verstanden sie, wie er das meinte. Beria war berüchtigt dafür, dass er über die Menschen in seinem Umfeld Akten anlegte und ihre Vergehen festhielt. Versagt hatten sie alle einmal. Wenn Beria jemanden ausschalten wollte, musste er nur die Beweise ans Licht holen, die in seinem geheimen Archiv lagerten.
Stalin ächzte im Nebenzimmer, es klang, als hätte er Krämpfe.
»Was schlagen Sie vor?«, fragte Chruschtschow.
»Malenkow übernimmt Stalins Ämter als Premier und Sekretär«, sagte Beria.
Ausgerechnet Malenkow? »Melanie«? Dann war klar, wer wirklich die Fäden in der Hand halten würde: Beria. Er selbst konnte als Georgier Stalin nicht beerben, ein Russe musste das machen. Stalin war zwar auch Georgier, aber er war der russischste Georgier, den man sich vorstellen konnte. So sehr hatte er das betont und durch sein Regierungshandeln untermauert, dass man seine Nationalität längst vergessen hatte. Von Beria dagegen hieß es oft, er habe seinen georgischen Landsleuten systematisch Vorteile verschafft, sei es einen schnelleren Aufstieg beim NKWD, dem Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, sei es unbehelligtes Schalten und Walten auf dem Schwarzmarkt in Moskau.
Beria fuhr fort: »Ich werde die Staatssicherheit und das Innenministerium leiten, als Vizepräsident.«
Molotow nickte. »Dann übernehme ich das Außenministerium.«
»Und ich das Handelsministerium«, sagte Mikojan.
Chruschtschows Gesicht rötete sich immer mehr. Er stand kurz vor einem Wutausbruch.
Der Arzt rief nebenan: »Er erbricht Blut!«
Beria brüllte rüber: »Ergreifen Sie alle Maßnahmen, um den Genossen Stalin zu retten. Er wird noch gebraucht.«
Natürlich, sie mussten zuerst die Macht aufteilen, um das Zentralkomitee vor vollendete Tatsachen zu stellen. Noch wusste niemand im Kreml, dass Stalin im Sterben lag.
»Ist das nicht ein Zeichen für eine Vergiftung, wenn man Blut erbricht?«, fragte Molotow.
»Ich habe ihn nicht vergiftet«, wiederholte Beria. »Aber wir werden es aus der Krankenakte streichen lassen, damit keine Gerüchte aufkommen.«
»Und welchen Platz haben Sie für mich in Ihrem hübschen Plan auserkoren?« Chruschtschow legte seine großen Hände auf die Sofakante, bereit, jederzeit aufzuspringen. Er schien kurz davor zu sein, auf Beria loszugehen.
Ungerührt antwortete Beria: »Sie, Chruschtschow, werden zwar nicht der Regierung angehören, aber Sie übernehmen die Parteiführung der KPdSU. Allerdings wird sich die Partei künftig nicht mehr überall einmischen, sondern sich auf Ideologie, Bildung und Kultur beschränken. Die Ministerien steuern von nun an die Landwirtschaft, die Industrie und alle anderen Belange eigenständig.«
»Das wird das Zentralkomitee nicht akzeptieren«, wandte Mikojan ein.
»Jede Veränderung hat ihre Gegner.«
Aus Chruschtschows Kehle rollte ein tiefes Grollen. »Nur dass in diesem Fall zu den Gegnern jeder zählt außer Ihnen!«
»Wir werden außerdem die Zensur lockern«, fuhr Beria fort. »Bisher ist unsere Zensur derart idiotisch, dass im politischen Bereich nur kriecherische, dumme Bücher veröffentlicht werden. Die sind so unlesbar, dass man ihr Papier besser gleich dazu verwendet hätte, auf dem Markt Fisch darin einzuwickeln. Ich werde die Regeln der Zensur verändern. Wir werden Bücher britischer Wirtschaftswissenschaftler veröffentlichen und politische Bücher aus dem Ausland, wir werden bedeutende Werke über die Geschichte übersetzen lassen und bei uns herausbringen, um unseren Intellektuellen die Scheuklappen von den Augen zu nehmen. Ich habe bereits einige Leute an der Hand, mit deren Hilfe wir die Geschichte der UdSSR neu schreiben werden. Es muss Debatten geben dürfen, ohne dass einem gleich vorgeworfen wird, britischer Spion oder Agent des Imperialismus zu sein.«
»Mit Verlaub, Genosse, haben Sie nicht als NKWD-Chef genau diese Argumente ins Feld geführt, wenn Sie politische Gegner haben einlochen und foltern lassen?«
»Wir alle haben Blut an den Händen, Chruschtschow.« Berias Gesicht bekam etwas Insektenhaftes. Mit kalter Neugier musterte er durch den nickelgerahmten Zwicker seinen Kontrahenten. »Sie zum Beispiel haben vor siebzehn Jahren die Erschießung von fünfzigtausend Menschen angeordnet. Wurde das je untersucht? Sie haben die Kulaken gequält und die ukrainischen Nationalisten ausgeschaltet. Sie haben die Bischöfe der Ukraine ermorden lassen und fast eine Million Menschen in die Gulags verschleppt. Dafür habe ich Beweise.«
Chruschtschows Augenlid zuckte.
Ilja fragte sich, ob es klug von Beria war, seinem Widersacher so unverhohlen zu drohen. Wenn er künftig der Parteichef war, würde Chruschtschow eine ernsthafte Gefahr darstellen. Andererseits – vielleicht drohte Beria ihm gerade deswegen, um ihn von vornherein in eine defensive Haltung zu drängen.
Beria sagte: »Ohne Privateigentum wird unsere Sowjetunion nie auf einen grünen Zweig kommen. Stalin hat gesagt, wir würden den Kommunismus schon zu seinen Lebzeiten erreichen. Tja, ich glaube nicht, dass es in den nächsten Stunden passieren wird. Die Menschen brauchen Privateigentum, um sich zu engagieren. Im Übrigen ist das, was wir hier pflegen, kein Sozialismus, sondern Staatskapitalismus. Der Staat kontrolliert alles und beutet die Menschen aus. Unsere Kolchosen, unsere Fabriken, da bekommen die Menschen doch bloß ein Hundertstel dessen, was sie produzieren. Den Rest sackt der Staat ein. Und was tun wir mit dem Geld? Wir bauen Panzer und Flugzeuge. Ist Ihnen klar, dass drei Viertel der sowjetischen Bevölkerung an ihre Kolchosen gefesselt sind? Die dürfen nicht einmal umziehen ohne staatliche Genehmigung.«
Chruschtschow runzelte die Stirn. Auch Molotow war nun sichtlich verärgert.
Wenn Stalin diese Lästerungen hören würde! Könnte er aufstehen, hätte er die Diskussion längst mit einem einzigen Manöver seiner Tabakpfeife beendet. Seine Rauchzeremonien waren legendär. Zuerst brach er einige Zigaretten der Marke Herzegowina Flor auf und stopfte den Tabak in seine Pfeife. Strich er sich dann mit dem Mundstück über den Bart, gefiel ihm etwas. Rauchte er die Pfeife aber kalt, war er wütend. Und legte er sie gar ab, erwartete die Anwesenden ein Donnerwetter. Als ihm der Schriftsteller Scholochow vorwarf, man betreibe um ihn einen Personenkult, hatte er geantwortet: »Was soll ich machen? Die Leute brauchen einen Gott.«
Wenn Stalin eine Rede hielt und ein Wort falsch aussprach – als Georgier beherrschte er kein makelloses Russisch –, so taten es ihm alle Redner nach, die auf der Tribüne folgten, sie betonten das Wort genauso falsch, damit er nicht etwa dachte, sie würden ihn berichtigen wollen. So sehr hatte man ihn gefürchtet.
Und jetzt lag er nebenan auf dem Sofa und rang mit dem Tod. Stalin würde nie wieder die Wolfspelzmütze mit den Ohrenklappen tragen, nie wieder die Wildlederstiefel oder die Uniform. Er würde nie wieder sechzehn Stunden am Tag arbeiten, nie wieder nächtelange Besäufnisse mit dem sogenannten innersten Kreis der Macht abhalten, nie wieder mit Charme widerstrebende Genossenen gefügig machen. Seine schönen Augen, von denen die Frauen schwärmten, würden stumpf werden und brechen. Noch sahen Hunderttausende Moskauer in der U-Bahn sein überlebensgroßes Porträt als freundliches Väterchen, die sechsjährige Gelija Markisowa auf dem Arm – deren Eltern er längst hatte umbringen lassen, Ilja wusste das von einem MGB-Offizier. Noch bauten die Menschen der Sowjetrepubliken darauf, dass Stalin sie versorgte und beschützte. Die Nachricht seines Todes würde über sie hereinbrechen wie die Apokalypse.
»Die Zwangsarbeit von Häftlingen muss ebenfalls ein Ende haben«, sagte Beria. »Das Gulag-System ist nicht nur ungerecht, sondern auch ökonomisch dumm. Freie Menschen arbeiten um Längen produktiver als Sklaven. Wir werden einen Amnestieerlass des Obersten Sowjets auf den Weg bringen und die Inhaftierten aus den Lagern holen. Wir halten da Millionen Menschen fest, teilweise wegen belangloser politischer Äußerungen.«
»Sie, lieber Beria, haben jahrelang die Gulags verwaltet«, sagte Chruschtschow.
»Ja. Deshalb weiß keiner so gut wie ich, wie nutzlos und ungerecht sie sind. Wenn Sie sich die Ökonomie unseres Landes ansehen, wird jedem von Ihnen klar, dass wir etwas tun müssen. Viel zu lange haben wir die nötigen Reformen gescheut. Ich sehe auch nicht ein, wieso der wichtigste Platz unseres Landes ein Friedhof sein soll. Das Mausoleum und die Gräber müssen vom Roten Platz entfernt werden.«
Die Politiker saßen völlig konsterniert da, während Beria ihnen die Zukunft vorstellte.
Unterdessen ließen sie den Mann, dem sie jahrelang ohne Widerspruch gedient hatten, nebenan allein sterben. Bis vor ein paar Tagen waren sie um ihn herumgeschwirrt wie fleißige Bienen. Jetzt röchelte er einsam auf dem Sofa, während sie im Nachbarzimmer über eine neue Politik sprachen.
Die Frage war: Warum hatte Beria ihn, Ilja, hierherbestellt? Sorgte er sich, dass sie ihn aufzuhalten versuchten, und er brauchte jemanden, der ohne zu zögern die höchsten Amtsträger des Landes tötete? Beria tat nichts ohne Grund. Als Stalin ihm nach acht Jahren die Geheimdienste wegnahm, weil er zu mächtig und eine Gefahr für ihn geworden war, hatte er die Leitung der Schwerindustrie und der Waffenproduktion übernommen, den Bau der ersten Atombombe überwacht und herrschte seitdem über Erdöl, Kohle und Stahl. Ohne ihn und seine Spionagenetzwerke in den USA hätte die UdSSR vermutlich immer noch keine Atombomben. Auf eigenen Wunsch führte er außerdem die Uhrenproduktion des Landes – alles, was mit Mechanik zusammenhing, faszinierte ihn.
Ilja beobachtete ihn. Er trug einen einfachen grauen Rollkragenpullover und darüber ein leichtes Jackett, das wagte sonst keines der Politbüromitglieder, die anderen trugen Hemden und maßgeschneiderte Anzüge. Trotz seines untersetzten Körpers war Lawrenti Pawlowitsch Beria agil, die Augen hinter den Brillengläsern seines altmodischen Kneifers erfassten prüfend die Lage. Würde er in den Vereinigten Staaten leben, wäre er sicher Geschäftsführer eines Konzerns geworden.
Es hieß, er liebe den Konkurrenzkampf und den Sport. In der georgischen Fußballnationalmannschaft hatte er als linker Verteidiger gespielt. Er beherrschte Jiu Jitsu. Den Kampf mit den anderen mächtigen Männern des Landes aufzunehmen, schien ihm Freude zu bereiten.
»Fahren wir zum Kreml«, sagte er. »Wir sollten Tatsachen schaffen, ehe es jemand anderem einfällt.«
Molotow kniff die Augen zusammen. »Er ist noch nicht gestorben.«
»Dazu braucht er uns nicht.«
»Wollen Sie gehen, ohne sich zu verabschieden?«
»Selbstverständlich nicht. Kommen Sie.« Beria ging voran, die anderen erhoben sich und folgten ihm. Sie stellten sich vor dem Diwan auf. Stalins Gesicht war kaum wiederzuerkennen, die Lippen hatten sich schwarz gefärbt, die Gesichtszüge waren entstellt. Beria sagte: »Genosse Stalin, die Mitglieder des Politbüros sind bei Ihnen. Können Sie sprechen?«
Stalin reagierte nicht. Seine Augen waren geschlossen.
Beria beugte sich über ihn und gab ihm die Hand. Stalins rechter Arm, der von Geburt an kürzer als sein linker war, schien bereits gelähmt zu sein. Die anderen folgten Berias Beispiel. Gelegentlich schlug Stalin einmal die Augen auf. Doch nun geschah etwas Merkwürdiges, womit Ilja nach den kritischen Auslassungen, die er erst vor wenigen Minuten gehört hatte, nicht gerechnet hätte. Chruschtschow schluchzte und jammerte wie ein ukrainisches Klageweib. Mikojan fiel vor Stalins Diwan auf die Knie, weinte und schlug sich gegen die Brust. Molotow rief verzweifelt, er müsse sich betrinken. Und es schien alles ernst gemeint zu sein.
Als Malenkow an der Reihe war, Stalins schlaffe Hand zu schütteln, sagte Beria: »Sie sehen, Stalin hat dem Genossen Malenkow durch diesen Händedruck die Führerschaft übertragen. So werden wir es auch dem Zentralkomitee berichten.«
Er verließ so eilig den Raum, dass Ilja Mühe hatte, ihm zu folgen. Für einen Moment schien es ihm, als habe Stalin kurz, kaum merklich, den linken Arm wie drohend gehoben, und Ilja las in diesem Moment auf dem Gesicht des Arztes das gleiche Entsetzen, das ihn selbst durchfuhr. Es war wie ein Menetekel. Aber die Politiker schienen nichts davon bemerkt zu haben. Sie traten nach draußen. »Starten Sie den Motor«, befahl Beria dem Chauffeur. »Wir haben keine Zeit zu verlieren, Chrustaljow.« Es war deutlich: Er traute denen da drinnen keinen Fingerbreit über den Weg.
Sie stiegen in die schwarze Limousine, und Chrustaljow steuerte den Wagen aus der Parklücke. Während sie an den anderen Staatskarossen vorbeizogen, sah Ilja, dass auch Chruschtschow, Malenkow, Molotow, Bulganin und Mikojan zu ihren Chauffeuren in die Wagen stiegen.
Sie fuhren vom Gelände, an den Wachposten vorbei. »Wohin geht es?«, fragte der Chauffeur.
Beria sagte: »In den Kreml.«
Bald waren sie auf der Staatsstraße nach Moskau.
»Sie haben große Veränderungen vor«, sagte Ilja. »Das wird nicht jedem gefallen. Werden Sie den Marxismus-Leninismus vollständig abschaffen?«
Beria sah aus dem Fenster. »Zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf. Ich habe andere Aufgaben für Sie.«
Ilja schwieg.
Nach einer Weile sagte Beria, ohne sich ihm zuzuwenden: »Wir geben dem Ministerrat und dem Obersten Sowjet die neue Machtverteilung bekannt. Währenddessen vernichten Sie Material in Stalins Büro. Alles, was sich gegen mich oder Malenkow richtet. Material über Chruschtschow bringen Sie mir. Sollten Sie Stalins Letzten Willen finden, verbrennen Sie ihn. Ungelesen.«
»Verschaffen Sie mir Zutrittspapiere? Oder habe ich einen offiziellen Auftrag vom Parteipräsidium, den ich als Vorwand einsetzen kann?«
Berias Spinnenfinger nahmen den Kneifer vom Gesicht. »Dann hätte ich jeden Lakaien schicken können. Was Sie tun, darf nicht auf mich zurückfallen. Sie sind auf sich allein gestellt.«
»Nasse Arbeit also.«
»Sie meinen, wenn die Kremlwache versucht, Sie aufzuhalten? Sie haben alle Freiheiten. Aber häufen Sie nicht zu viele Leichen an. Das Ganze darf nicht nach einem Staatsstreich aussehen.«
Stumm zog Ilja die Brieftasche heraus, entnahm dem Geheimfach die Natriumthiosulfat-Tablette und schluckte sie. Er steckte die Brieftasche wieder ein. Ein Glas Wasser wäre jetzt hilfreich gewesen. Die Tablette kühlte durch die chemische Reaktion seinen Speichel ab, bald fühlte es sich an, als habe er Eiswasser im Mund. Er schluckte noch einige Male. Schwefelgeschmack stieg ihm in die Nase.
»Ihr mitleidiger Gesichtsausdruck vorhin«, sagte Beria, »hat mir nicht gefallen. Sie kennen Stalin nicht. Und er ist auch nicht allein. Seine einfältige Hausangestellte, die alte Matronja Petrowna, war bei ihm, außerdem seine Lieblingstochter Swetlana Allilujewa und sein Sohn, der Luftwaffenoffizier Wasili, bis ich die drei telefonisch hinausbeordert habe, bevor wir eintrafen, das ging nicht vor den Genossen. Wasili betrinkt sich wahllos und beschimpft die Ärzte. Was das Gift angeht: Die Ärzte sprechen von einem Schlaganfall, von arterieller Gehirnblutung. Stalins Puls liegt bei achtundsiebzig, der Blutdruck liegt bei hundertzehn zu hundertneunzig, und das Herz schlägt nur noch schwach. Man könnte also sagen, ich habe die Sitzung aus Mitgefühl beendet, damit er im engsten Familienkreis sterben kann.«
Ilja wusste nicht, ob er ihm glauben sollte. Zumindest der letzte Satz war gelogen. Aber es spielte keine Rolle. Jemand in Berias Position konnte sich die Wirklichkeit formen, so wie er sie haben wollte.
Im Kreml empfing man sie bereits voller Aufregung. »Das Präsidium, der Ministerrat und der Oberste Sowjet haben sich versammelt, Genosse Beria. Sie sind in äußerster Unruhe. Ist es wahr, liegt Stalin im Sterben?«
Jemand musste gezwitschert haben.
Sie stiegen aus. Beria gab Ilja einen Wink.
Er orientierte sich einen kurzen Moment lang, dann verließ er die Gruppe. Stalins Büro befand sich in der Ecke des Senatsgebäudes, die dem Nikolski-Turm zugewandt war. Sicherlich war der Zugang zum Gebäude überwacht. Er begann mit einer kleinen Regelüberschreitung, um glaubwürdiger zu wirken: Er überquerte den Platz.
Wie erwartet, schnitt ihm ein Mann der Kremlwache den Weg ab. »Sie dürfen sich hier nicht aufhalten«, sagte er. »Wissen Sie nicht, dass es nur bestimmten Personen gestattet ist, den Mittelplatz zu betreten?«
»Oh, Entschuldigung.« Ilja sah sich um, als wäre er verwirrt. »Ich suche Stalins Büro.«
Der Wachmann streckte die Schultern durch. »In welcher Angelegenheit?«
»Das sage ich dem Kanzleipersonal vor Ort.«
In Begleitung des Wachmanns gelangte er in das Senatsgebäude. Am Fuß der Treppe, die im Gebäude hinaufführte, wurden sie aufgehalten. »Papiere!«, forderte ein Posten.
»Ich habe keine.« Ilja sah sich um, als fürchtete er Lauscher, und sagte dann leise: »Die Kameradin Ljudmila schickt mich.«
Skeptisch sahen ihn die beiden Wachleute an. Der eine legte die Hand an die Pistolentasche. »Und wer soll das sein?«
»Seine … Also, sie hat ihn während der vergangenen Wochen als Kameradin begleitet. Wenn Sie wissen, was ich meine.«
Ein Lächeln spielte um die Mundwinkel der beiden. »Soso. Und warum kommt sie nicht selbst?«
»Sie ist bei ihm«, log er. »Der Woschd liegt im Sterben.«
Ihr Lächeln gefror. »Das kann nicht stimmen, Sie lügen. Stalin erfreut sich bester Gesundheit!«
Er beschloss, die Sache zu beschleunigen. »Ich gehe jetzt da rauf und hole die persönlichen Sachen von Ljudmila. Telefonieren Sie währenddessen mit dem Kommandanten des Kreml, wenn Sie wollen.«
»Niemand betritt Stalins Büro«, protestierte der Wachmann.
Aber er war mit einem beherzten Schritt schon an ihm vorbei und stieg die Treppe hinauf.
»Stehen bleiben!«
Er hörte, wie sie ihre Pistolen aus dem Halfter nestelten. Zügig nahm er die Stufen und öffnete oben die Tür.
Verdammt. Im Vorzimmer befanden sich drei weitere Wachen, jeder mit einer 9-mm-Makarow am Gürtel. Der Leutnant griff sofort zur Waffe. Er würde Schwierigkeiten machen.
»Verzeihen Sie die Störung, die Herren«, sagte er. »Ljudmila, Stalins Kameradin, hat mich gebeten, aus seinem Büro etwas Persönliches zu holen.«
Der Leutnant richtete die Pistole auf ihn und entsicherte sie. Er befahl den Soldaten: »Durchsuchen!«
Sie tasteten ihn ab. Außer der Brieftasche fanden sie nichts. Sie übergaben sie dem Leutnant, und der Leutnant entnahm ihr seinen Ausweis. Laut las er vor: »Boris Schischliannikow.« Er sah prüfend hoch. »Und Sie behaupten, in Stalins Büro liege etwas von dieser Ljudmila?«
»Es ist persönlicher Natur. Stalin wäre erzürnt, wenn jemand anderes die Sache zu Gesicht bekäme.«
Der Leutnant kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. »Halten Sie mich für dumm? Sie denken doch nicht im Ernst, ich lasse Sie da allein hinein.«
Ilja gab sich eingeschüchtert. »Ich wollte nur …«
»Los!«, befahl der Leutnant. Er hielt immer noch die Pistole auf ihn gerichtet. »Gehen Sie voran, durch die Tür da. Wenn sich Ihre Geschichte als Lüge entpuppt … In der Lubjanka wird man Ihnen das Lügen aberziehen, das verspreche ich Ihnen.«
Die Soldaten lachten. Sie schlossen sich an, aber der Leutnant blaffte: »Sie bleiben hier! Vielleicht ist das genau, was er bezweckt: dass wir den Zugang zum Trakt freigeben.«
Ilja wurde der Lauf der Waffe in den Rücken gestoßen. Er öffnete die Tür, zu der ihn der Leutnant schob, und sie traten in einen hohen, weiten Flur. Der Boden glänzte, es roch nach Bohnerwachs. Mehrere Bürotüren zweigten vom Flur ab. Es war still hier, offenbar waren alle Funktionäre in der Versammlung, in der Beria die neue Regierung bekanntgab.
»Ljudmila hat gesagt, ich soll mich an den Leiter der Geheimkanzlei wenden, der wisse Bescheid.«
»Ist nicht da. Und jetzt gehen Sie durch diese Tür.« Er gab ihm erneut einen Stoß mit der Waffe.
Ilja öffnete. Das weitläufige, dunkel getäfelte Büro roch verraucht. Bücher standen in offenen Regalen. Auf einem Konferenztisch stand ein Globus.
»Also?«, fragte der Leutnant.
Eine Standuhr tickte laut. Wie hatte Stalin bei diesem Ticken arbeiten können? Lenins Totenmaske aus Gips war in einer Glasvitrine ausgestellt. An der Wand hing ein Lenin-Porträt neben einem Bild von Karl Marx.
Er ging auf den klobigen Schreibtisch zu, der den Raum beherrschte, und zog zum Schein an der Schublade. Er tat, als wäre sie verschlossen, rüttelte an ihr.
»Ich habe den Schlüssel, Ljudmila hat ihn mir gegeben.« Er griff nach der Brieftasche in seiner Jacke.
»Nehmen Sie die Hände hoch«, befahl der Leutnant. »Haben die Amerikaner Sie geschickt? Was sollen Sie hier stehlen?«
Betont langsam zog er die Hand heraus und mit ihr die braune Brieftasche. »Ihre Leute haben mich doch schon abgetastet, ich habe keine Waffe. Das ist meine Brieftasche, dort habe ich den Schlüssel.« Er legte den Finger an den verborgenen Mechanismus, löste den Abzug aus und drückte den Arm des Leutnants weg. Mit einem leisen Puffen explodierte die Treibladung, die Ampulle zerbarst, und die Säure verdampfte im Gesicht des Leutnants zu Zyanidgas. Seine Augen weiteten sich, er begann zu hyperventilieren. Es dauerte nicht lange, bis er bewusstlos zusammenbrach. Ilja fasste ihn unter die Achseln und ließ ihn behutsam zu Boden gleiten. Die Blausäurevergiftung hatte bereits den Atemstillstand ausgelöst.
Bittermandelgeruch lag in der Luft. Hatte die Tablette gewirkt, die er eingenommen hatte, auch wenn er kein Wasser dazu trinken konnte? Er ging zwei Schritte zur Seite, riss fahrig seine Brieftasche auf und drückte die zweite Ampulle aus ihrem Versteck. Er zerbrach sie und inhalierte das Amylnitrat.
Jetzt hieß es, schnell zu sein. Er öffnete die Schubladen und Schranktüren des Schreibtischs. Alles, was obenauf lag, räumte er beiseite, und die Ordner, die vorn standen, ebenfalls. Er griff tief in die Schreibtischschränke hinein und tastete an den Eckkanten entlang. War da nicht ein feiner Grat? Er entdeckte eine kleine Vertiefung, steckte den Finger hinein und zog. Jetzt löste sich eine Holzplatte. Dahinter entdeckte er mehrere dünne Mappen. Er legte sie auf den Schreibtisch. Lawrenti Pawlowitsch Beria, stand auf der einen. Neben weiteren Mappen fand er welche über Chruschtschow und Malenkow. Er steckte sie sich hinten in den Hosenbund, wo der Mantel alles verdeckte. Die übrigen Mappen verbarg er wieder im Schreibtisch und fügte die Holzplatte ein.
Gab es ein Testament? Er betastete die Unterseite des Schreibtischs. Nichts. Er nahm das Porträt Lenins von der Wand und danach das von Marx. An der Hinterseite der Bilder war ebenfalls nichts verborgen. Die Wachtposten konnten jeden Augenblick hier sein, um nach dem Rechten zu sehen, viel Zeit blieb ihm nicht. Er zog die Schreibtischschublade vollständig heraus und setzte sie auf der Tischplatte ab. Nun befühlte er den Tisch von unten. Er fand einen Umschlag, den man mit Heftpflaster daran befestigt hatte, riss ihn ab, sah kurz hinein und steckte ihn befriedigt zu den Mappen an seinen Rücken.
Nachdem er die Schublade wieder eingesetzt hatte, kauerte er sich noch einmal neben den Leutnant. Prüfend sah er das Gesicht an. In der Regel verhinderte eine feine Gaze, dass beim Explodieren der Treibladung und dem anschließenden Zerplatzen der Ampulle Splitter ins Gesicht des Opfers flogen und ihm dort verräterische Verletzungen zufügten. Heute war es nahezu perfekt gelungen. Nur an der linken Wange gab es einen winzigen Schnitt. Er nahm ein Blatt Papier aus der Schublade und näherte sich vorsichtig mit einer Ecke der Wunde und entfernte den feinen Glassplitter. Dann trug er ihn zum Fenster, öffnete es und schüttelte ihn hinaus.
Er ließ das Fenster offen stehen, damit keine Gasreste im Raum blieben, und legte das Blatt zurück. Eilig verließ er das Büro und platzte ins Vorzimmer der Wachen, die ihn misstrauisch ansahen.
»Wo ist der Leutnant«, fragten sie.
»Genossen, ich habe Ihnen eine schreckliche Nachricht zu überbringen. Soeben haben wir durch einen Telefonanruf erfahren, dass Stalin, der Befreier Europas und Jünger Lenins, in seiner Datscha in Kunzewo gestorben ist.«
Sie schluckten. »Und wo ist Leutnant Martemjanow?«
»Er ist bei Erhalt der Nachricht bewusstlos geworden. Ich habe die Fenster geöffnet und versucht, ihn zu wecken, aber es ist mir nicht gelungen.«
Man würde bei der Autopsie des Leutnants Herzversagen feststellen, nichts weiter. Solange nicht das Lungengewebe auf einen möglichen Blausäuregehalt untersucht wurde, konnte auf ihn kein Verdacht fallen.
Alles war bedingungslos dem Staat untergeordnet, verkörpert durch die Partei und ihre Führer. Der Staat hatte das Recht, jedes Opfer von seinen Bürgern zu verlangen, auch ihr Leben. Weiter zu denken, an Familienmitglieder, Kinder, eine trauernde Witwe, erlaubte sich Ilja nicht. Er hatte seinen Dienst getan wie immer.
2
BERLIN,4.MÄRZ1953
Durch den Tränenschleier sah der Müggelsee aus wie ein Bild ihrer Laterna magica. Der See wird morgen Nachmittag noch da sein, dachte sie. Was auch passiert, der See bleibt. Auch die Parkbank würde noch da sein. Sie fuhr mit der Hand über das abgenutzte, verwitterte Holz. Wer über die Jahre hin alles hier gesessen haben mochte! Mütter, deren Kinder zu Hause ausgezogen waren. Pärchen, die sich innig liebten, oder solche, die ihre Liebe verloren hatten.
Der Wind strich Nelly sanft um die Nase. Die Wintermonate waren endgültig vorüber. Es schien ihr, als wollten der See und der Wind und die Schneeglöckchen am Ufer sie trösten.
Das Knirschen von Schritten auf dem Weg kam näher. Jemand setzte sich ans andere Ende der Bank, sie spürte, wie die Bretter sich unter ihr bewegten. Nelly blinzelte die Tränen fort. Ein Mann. Er blickte auf den See. Sie überlegte, wie lange sie sitzen bleiben musste, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie seinetwegen die Bank verließ.
»Herrlich heute, oder?«
Sie nickte.
»Ich bin Wolf«, sagte er.
»Nelly.«
»Ein Engelsköpfchen mit roten Locken und strahlend blauen Augen«, sagte er. »Und dann so traurig. Was ist los?«
Sie wischte sich die letzten Tränen aus dem Gesicht. »Nichts Besonderes.«
Er lächelte. »Sag bitte du zu mir, ich bin achtundzwanzig, da will man noch gern jung sein.«
»Jeder will doch jung sein.«
»Weiß nicht. Mein Vater wäre lieber älter, glaube ich.«
Das Gespräch begann, ihr auf die Nerven zu fallen. »Will er in Rente gehen?«, sagte sie, und erschrak, weil man ihr Desinteresse so deutlich hörte.
»Er liebt seinen Beruf. Aber er wäre gern der weise Mann, zu dem alle aufschauen.«
»Dann ist er vermutlich Lehrer.«
Der Mann schwieg. Schließlich sagte er: »Ich kann nichts dafür.«
Jetzt wurde sie gegen ihren Willen doch ein wenig neugierig. »Wofür?«
»Er ist ein hohes Tier bei der SED. Der erste Sekretär der SED-Kreisleitung.«
»Das hat aber doch sicher Vorteile.«
»Genau die will ich nicht haben.«
Sie musterte ihn. Die Ballonmütze war abgetragen, und das Haar wuchs ihm über die Ohren, er brauchte einen Haarschnitt. Seine Jacke hatte auch schon bessere Tage gesehen. Ein eigenartiger Kerl wie er hätte gewisse Vergünstigungen durchaus gebrauchen können.
»Also, was macht dich traurig?«, fragte er.
Sie stand auf. »Ich hab noch zu tun. Machen Sie’s gut.«
»Das hätte jetzt ein x-beliebiges Mädchen gesagt. Aber du doch nicht.«
Eine Frechheit, wie er mit ihr redete. Das kecke Blitzen in seinen Augen entschärfte die Worte etwas, trotzdem, was sie beschäftigte, ging diesen Kerl nichts an. Sie sah auf den See und horchte in sich hinein. Zu ihrem eigenen Erstaunen interessierte sie, was er sagen würde. »Die veranstalten morgen ein Tribunal in der Schule, um mich fertigzumachen.«
»Weil du Christin bist.«
Verblüfft sah sie ihn an. »Woher weißt du das?«
»Du trägst ein Kreuz um den Hals.«
Dieses winzige silberne Kreuz hatte er gesehen?
»Hast du Lust, etwas auszuprobieren? Dauert nur fünf Minuten.«
»Was?«
»Ich hab mal gehört, wenn man sich fünf Minuten lang in die Augen sieht und sich dann noch drei persönliche Dinge erzählt, verliebt man sich ineinander. Wüsste gern, ob es wahr ist.«
»Niemals. Das würde ja heißen, jeder kann sich in jeden verlieben, wenn er nur lange genug hinguckt.«
»Du glaubst nicht daran?«
»Nee. Und ich muss jetzt wirklich.«
»Dann hast du nichts zu verlieren, oder?« Er drehte sich etwas und saß ihr nun fast gegenüber. »Probieren wir’s aus. Komm, setz dich noch mal.«
»Auf keinen Fall.«
»Also denkst du doch, dass es funktionieren wird.«
Nein. Aber das hieß noch lange nicht, dass sie Lust hatte, diesem Wildfremden fünf Minuten lang in die Augen zu sehen.
»Im Gegenzug repariere ich alle Uhren umsonst, die dir je kaputt gehen, dein Leben lang. Und es bringt dich auf andere Gedanken, du vergisst mal deine Sorgen wegen der Schule.«
Dieses Lächeln. Er schaute sie an, als würden sie sich schon Jahre kennen. Der Wind zerzauste die dunkelblonden Haare, die unter seinem Mützenrand hervorlugten. Dieser schlechte Haarschnitt machte ihn irgendwie putzig, als bräuchte er jemanden, der sich um ihn kümmerte. Wenigstens musste man sich vor diesem Mann nicht fürchten. »Fünf Minuten, drei Dinge, und dann gehe ich.« Sie setzte sich und sah auf die Uhr. Ihre Gedanken hatten seit Stunden Kreise gezogen. Es würde ihr tatsächlich guttun, mal an etwas anderes zu denken.
Schweigend sahen sie sich an. Sie kam sich vor, als wäre sie unvorbereitet in ein fernes Land gestolpert.
Für einen Mann hatte Wolf ungewöhnlich schöne gebogene Wimpern. Und in den braunen Augen lag eine große Wachheit, aber auch Güte, so schien es ihr.
Was sah er bei ihr? Plötzlich machte ihr dieses sonderbare Spiel Angst. Waren die Augen nicht Fenster zur Seele? Was ging diesen Fremden ihre Seele an? Sie wollte es abbrechen, wollte sagen: Das ist doch idiotisch! Aber die Haut um seine Augen zuckte etwas, und daraus wurde ein nervöser Zug um seinen Mund. Er war genauso verunsichert wie sie. Sofort fühlte sie sich stärker.
Sie bemühte sich, gleichmäßig zu atmen und sich nichts von ihrer Unruhe anmerken zu lassen. Wie verwundbar man war, wenn man längeren Blickkontakt hielt. So nah war ihr selten jemand auf die Pelle gerückt.
Er sagte: »Ich glaube, die fünf Minuten sind um.«
Sie sah auf die Uhr. Sieben Minuten waren verstrichen. Erleichtert atmete sie auf.
»Jetzt die drei persönlichen Sachen«, sagte er. »Ich fange an, ja?« Er sah auf seinen Schoß. Seine Hände bewegten sich, er schien angespannt nachzudenken. »Ich habe oft Fernweh. Dann laufe ich raus aus der Stadt, bei Wind und Wetter, ich folge einfach einer Straße, bis die Häuser aufhören, und noch weiter. Viele haben Angst vor der Zukunft. Sie sehnen sich nach einer festen Stelle, in Lohn und Brot zu sein, das ist für sie alles. Ich sehne mich aber nach der Weite. Ich wär gern auf einem Schiff, das die Häfen der verschiedenen Kontinente anfährt.«
»Waren das schon drei Sachen?«
»Nein. Das war eine.« Er rieb sich den Nacken. »Jetzt bist du dran.«
»Ich schlafe nachts bei Licht. Ich kann’s nicht ertragen, wenn es im Zimmer dunkel ist.«
Erstaunt sah er sie an, aber er sagte nichts.
»Du bist wieder dran.«
»Ich liebe Landkarten«, sagte er. »Ich kann stundenlang Afrika, Russland oder eine Südseeinsel betrachten, ihre Küstenlinien, ihre Flüsse, Berge und Seen. Ich denke dann über die Menschen nach, die dort leben und nichts von uns wissen, die ihren Alltag haben, ihre Arbeit, ihre Mühen und Sorgen. Ich frage mich, welche Bäume dort wachsen, sind es Palmen? Zedern? Und was es da für Tiere gibt.«
Das Spiel fing an, ihr Spaß zu machen. »Ich stelle mir manchmal Katastrophen vor. Nicht, dass ich sie mir wünschen würde, es ist, als wollte ich mich darauf vorbereiten, dass es passieren könnte. Das läuft dann wie ein Film in meinem Kopf ab. Beim Busfahren stelle ich mir vor, wie wir zu weit links fahren und der entgegenkommende LKW uns erfasst und der Bus sich überschlägt. Und beim Schwimmen denke ich daran, wie ich einen Krampf bekomme und ertrinke.«
»Bist du mal von etwas Schlimmem überrascht worden?«
Sie zuckte innerlich zusammen. »Ich bin ein fröhlicher Mensch, ich will keine Schwarzseherin sein. Aber irgendwie rutsche ich da manchmal rein.«
Er räusperte sich. »Ein Punkt fehlt noch, richtig? Lass mich nachdenken.« Er sah hoch in die Baumwipfel hinter ihr. Dann sagte er, ohne den Blick von dort abzuwenden: »Manchmal rede ich mit den Uhren, während ich sie repariere. Ehrlich gesagt, rede ich immer mit ihnen. Ich begrüße sie schon, wenn ich den Laden betrete.«
Er blickte sie erwartungsvoll an, und während sie innerlich darüber schmunzelte, dass dieser Mann scheinbar mit seinen Uhren sprach, fiel ihr die Laterna magica wieder ein. Sie erzählte, dass sie seit ihrer Kindheit die Bilder liebe, die man mit ihr erzeugen könne, und dass sie manchmal so lange eines anschaue, bis sie das Gefühl habe, in der dargestellten Landschaft herumzuspazieren. Beinahe hätte sie ihm gesagt, dass ein russischer Soldat ihr diesen Apparat in einer brenzligen Situation hinterhergetragen habe, aber das behielt sie dann doch lieber für sich.
Er lächelte kurz und nickte.
Dann verfielen sie in Schweigen. Eben noch hatten sie sich minutenlang in die Augen gesehen, jetzt hielten sie es keine drei Sekunden mehr aus.
»Danke, dass du mitgemacht hast«, sagte Wolf leicht verlegen.
Sie nahm ihre Tasche und stand auf. Weil es sich eigenartig angefühlt hätte, einfach zu gehen, drückte sie seine Hand. Sie war warm. »Mach’s gut, Wolf.«
»Mach’s gut.«
Auf dem Weg nach Hause fragte sie sich, ob das Experiment gescheitert oder geglückt war. Empfand sie etwas für ihn? Er war ihr vertrauter geworden, so viel stand fest. Aber Verliebtheit? Nein, das war es nicht. Auf gewisse Art war sie sogar froh, von der Parkbank und von Wolf wegzugehen.
Dennoch, das Gespräch hatte ihr gutgetan. Erst als sie die Wohnungstür aufschloss, fielen ihr wieder ihre Sorgen ein.
Aus der Küche drang kaltes weißes Licht, sie hasste die Leuchtstäbe an der Decke. Lutz hatte sie voller Stolz anmontiert. Er wollte jeden Tag hören, wie großartig es war, dass er sie beschafft hatte. Und Mutter tat es, sie lobte ihn: »Hundertmal besser als diese trüben Fünfzehn-Watt-Lampen, die alle anderen haben.«
Mutter schnitt Zwiebeln, der beißende Geruch hatte sich in der ganzen Wohnung verbreitet. Lutz, Nellys Stiefvater, trat in den Flur: »Na, harten Tag gehabt?«
Das war das Schlimme. Er war freundlich. Aber sie wollte nicht, dass er freundlich war. »Ja«, sagte sie knapp, streifte sich die Schuhe von den Füßen und ließ sie da fallen, wo sie stand. Auf Socken ging sie in ihr Zimmer und schloss unsanft die Tür hinter sich. Sie wusste: Er würde milde seufzen und ihre Schuhe aufräumen.
Sie setzte sich aufs Bett.
Wolf wartete, bis sich der Pulk von Schülern am Eingang der Aula aufgelöst hatte. Dann überquerte er den Schulhof und versuchte ein möglichst gleichgültiges Gesicht zu machen.
Ein Mann, vermutlich ein Lehrer, versperrte ihm den Weg zur Aula. »Eltern ist der Zutritt nicht gestattet.«
»Ich bin noch etwas jung für Kinder, meinst du nicht?« Er hielt dem verdutzten Lehrer die Hand hin. »Genosse Uhlitz. Du bist …?«
»Fricke, Mathematik und Physik.« Der Blick des Lehrers wanderte zum Revers von Wolfs grauem Anzug, wo das Parteiabzeichen prangte.
Wolf folgte seinem Blick. »Mein Vater ist hier SED-Kreisleiter. Er hat mich gebeten, einmal zu schauen, wie ihr das Problem löst.«
»Wir geben unser Bestes.«
»Das glaube ich. Du hast sicher nichts dagegen, wenn ich mir die Sache ansehe und meinem Vater dann berichte?«
Der Lehrer machte Platz. »Wir haben nichts zu verbergen.«
»Danke, Genosse.« Er hasste es, von der Position seines Vaters und vom Kaderdenken Gebrauch zu machen. Vater wäre stolz, ihn hier im grauen Anzug zu sehen, die weinrote Krawatte ordentlich gebunden, die Anstecknadel mit der roten Fahne und den ineinandergreifenden Händen am Revers. Ja, er spürte förmlich, wie er ihm anerkennend auf die Schulter klopfte. Mit diesem kleinen, blinkenden Stück Blech an der Brust bist du für sie ein anderer, einer, der Ansagen macht, ein Macher. Gut so, Wolf. Hab’s dir doch immer gesagt.
Die Schüler hatten klassenweise auf den Bänken Platz genommen. Hier saßen die Neuntklässler, dort die zehnten, auf einer anderen Bank die elften, zwölften Klassen. Fast alle trugen blaue Hemden mit Schulterklappen und dem Emblem einer aufgehenden Sonne am Ärmel, es war ein Heer von blauen Hemden.
Nelly saß bei den Achtzehnjährigen des Abiturjahrgangs in der ersten Reihe. Er erkannte sie gleich an ihren rotblonden Haaren. Auch sie trug das FDJ-Hemd. Aber sie saß am Rand, und ihr Sitznachbar war etwas von ihr abgerückt, als würde sie eine ansteckende Krankheit verbreiten.
Wolf ging an den Sitzreihen vorbei zur Bank für die Lehrer. LERNTUNDARBEITET FÜR DENAUFBAUDESSOZIALISMUS, stand in großen Lettern über der roten Fahne, die an die Stirnseite des Saals geheftet worden war. Darunter befand sich die Bühne mit einem stoffüberspannten Tisch wie ein Richterpult. Zwei Männer und eine Frau saßen daran. Einer der Männer stand jetzt auf. »Liebes Kollegium, liebe Jugendfreunde. Eröffnen wir die FDJ-Vollversammlung der Gerhart-Hauptmann-Oberschule mit dem Gruß der Freien Deutschen Jugend.« Er reckte die Faust in die Höhe. »Freundschaft!«
Die Schüler im ganzen Saal antworteten müde: »Freundschaft.« Einige von den Älteren vorne rechts antworteten mit betonter Lässigkeit etwas später, der Mann, womöglich der Schuldirektor, warf ihnen einen tadelnden Blick zu. Er sagte: »FDJ-Sekretärin Niedermayer wird uns in das Thema des heutigen Nachmittags einführen. Ich erwarte Ihre volle Aufmerksamkeit.«
Die FDJ-Sekretärin trug eine Herrenuhr, eine Kienzle, die ihr überhaupt nicht stand. Für dieses schmale Handgelenk wäre eine Junghans besser gewesen, J58, Ankerhemmung mit Steinpaletten, fünfzehn Steine, Brückenwerk. Die Frau begann ihre Ansprache. »Ihnen allen muss klar sein: Es gibt zwei Lager auf dieser Welt, das Lager des Imperialismus, an dessen Spitze die USA stehen, und das Lager der Demokratie und des Sozialismus, an dessen Spitze die UdSSR steht. Es ist die Aufgabe jeder demokratischen Schule, auch der Gerhart-Hauptmann-Oberschule, feindliche Elemente in ihren Reihen zu enttarnen und zu entfernen. Eine Ihrer Mitschülerinnen« – sie warf einen Eulenblick auf Nelly – »gehört der Jugendorganisation der Evangelischen Kirche an, der sogenannten Jungen Gemeinde.«
Ein kaum unterdrücktes Raunen ging durch den Raum. Wolf spürte, wie sich ihm die Nackenhaare aufstellten. Die FDJ-Sekretärin schämte sich nicht, Nelly vor allen anderen bloßzustellen, dabei musste sie doch wissen, wie man mit jungen Menschen umging.
»Ich vermute, aus Unwissenheit. Deshalb möchte ich Sie, Nelly, und alle anderen Schüler aufklären. Die Junge Gemeinde ist eine illegale Organisation. Sie ist nicht beim Innenministerium registriert. Für die Jugendlichen der DDR gibt es nur eine Jugendorganisation: die FDJ.«
Sie isolierte Nelly, um sie zu schwächen, sie ließ es erscheinen, als sei sie allein die Abweichlerin und alle anderen im Saal stünden gegen sie. Durchschaute das niemand? Was sagten die Lehrer dazu? Er blickte sich um. Aber die Gesichter wirkten wie versteinert und verrieten keinerlei innere Beteiligung an dem Geschehen.
»Die Junge Gemeinde wird von westlichen Geheimdiensten unterwandert und betreibt unter dem kirchlichen Deckmantel Spionage und Hetze gegen die DDR. Die Junge Gemeinde spioniert für die Amerikaner und sabotiert Maschinen in den Fabriken. Viele Kirchenmitarbeiter sind Agenten der CIA. Sicher wollen Sie, Nelly, nicht einer Verbrecherorganisation angehören, die als amerikanische Agentenzentrale Volksfeinde sammelt, um der DDR zu schaden, und die antidemokratische Hetzschriften aus Westberlin einführt, unter der Tarnung christlicher Pressearbeit. Deshalb rufe ich Sie auf, die Machenschaften der Jungen Gemeinde hier vor allen Ihren Mitschülern und dem Lehrkörper zu bestätigen und sich davon zu distanzieren. Sonst fällt Ihr Verhalten nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Eltern zurück. Nelly Findeisen, ich fordere Sie auf, durch eine deutliche Stellungnahme zu beweisen, dass Sie eine würdige Schülerin einer demokratischen Oberschule sind.«
Es wurde still. Die FDJ-Sekretärin nickte Nelly aufmunternd zu.
Nelly stand auf. Sie trug eine Hose, wie Wolf erst jetzt auffiel. Die schwarze Hose stand ihr gut – aber war ihr nicht klar, dass sie damit erst recht den Zorn der Lehrer und Parteifunktionäre auf sich zog? Alle anderen Mädchen im Saal trugen einen Rock zur FDJ-Bluse.
»Ich glaube das nicht«, sagte Nelly. Ihre Stimme war leiser als die der FDJ-Sekretärin.
Die Funktionärin fragte mütterlich: »Was glauben Sie nicht?«
»Dass die Junge Gemeinde für den westlichen Geheimdienst arbeitet. Ich gehöre seit über einem Jahr dazu. Wir haben in dieser Zeit nur Lieder gesungen, gebetet, Ausflüge gemacht und Spiele gespielt. Und in der Bibel gelesen.«
Das Gesicht der Niedermayer wurde hart. »In der Mahlsdorfer Straße ist ein Funktionär der FDJ von der Jungen Gemeinde mit Messern überfallen worden! Behaupten Sie doch nicht, davon nichts zu wissen! Nachts habt ihr ihm aufgelauert, angestiftet von einem amerikanischen Offizier.«
»Das ist nicht wahr.«
»Haben Sie die Presseberichte nicht gelesen? Ein ›Diakon‹ wurde als US-Spion enttarnt. Wollen Sie etwa sagen, unsere sozialistisch-demokratische Presse würde lügen? Dann hätten wir hier nicht nur die Frage, ob Sie aus der FDJ ausgeschlossen werden, dann hätten wir den Strafbestand der Boykotthetze!«
»Ich …«
»Oder meinen Sie, das Präsidium würde lügen?«