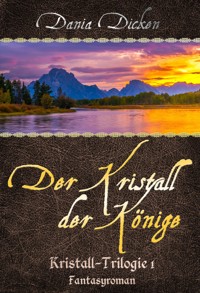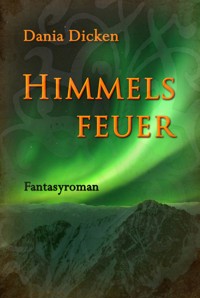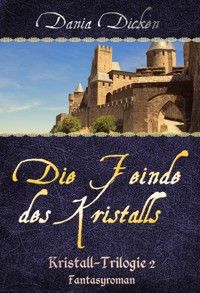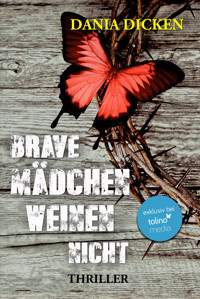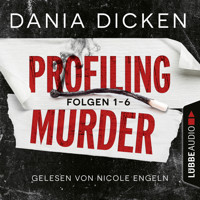4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
FBI-Profilerin Libby Whitman hat das Gefühl, angekommen zu sein. Mit ihrem Mann Owen freut sie sich auf das Baby, das sie in einigen Monaten erwarten. Dessen ungeachtet ermittelt Libby zusammen mit ihrer Kollegin Julie wegen einer Vergewaltigungsserie in Baltimore. Sie erstellen ein Profil für die beiden Täter, die schon mehrere Frauen in eine perfide Falle gelockt und teilweise brutal zugerichtet haben.
Gleichzeitig bearbeitet Owen den Fall eines jungen Krankenpflegers und seiner Freundin, die ohne erkennbaren Grund regelrecht hingerichtet wurden. Als kurz darauf der Diebstahl von radioaktivem Cäsium aus dem Krankenhaus bekannt wird und ein TV-Moderator Symptome der Strahlenkrankheit aufweist, begreift Owen, dass alles miteinander zusammenhängt. Libby unterstützt ihn mit einem Täterprofil, denn die unbekannten Täter haben immer noch Cäsium in ihrem Besitz – und drohen mit weiteren nuklearen Anschlägen auf die amerikanische Hauptstadt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Tod, den niemand sehen kann
Libby Whitman 16
von
Dania Dicken
Was man zu verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht mehr. Marie Curie
Prolog
Er versuchte, seine Todesangst zu ignorieren. Er durfte sie nicht zulassen. Wenn er jetzt den Kopf verlor, würde das übel ausgehen – nicht nur für ihn, sondern auch für Katrina.
Mit Herzrasen versuchte er, sich auf den Verkehr zu konzentrieren und den Mann mit der Waffe auf dem Beifahrersitz neben sich zu ignorieren. Einfach nicht dran denken. Er würde tun, was man ihm befahl, und dann würden sie ihn und Katrina schon laufen lassen. Das hatten sie gesagt – und er wollte es gern glauben. Er musste einfach.
Angespannt hatte er die Hände ums Lenkrad gelegt, klammerte sich regelrecht daran fest. Seine Hände waren eiskalt und schweißnass. Nervös starrte er auf die rote Ampel.
„Tu einfach, was wir gesagt haben. Du gehst da gleich rein und holst das Zeug. Nichts weiter. Du gibst es mir und dann war es das auch schon – und du und deine Freundin könnt weiterleben.“
Neil schluckte und starrte weiter auf die Ampel. Angst schnürte ihm die Kehle zu.
„Hast du verstanden?“
Jetzt nickte Neil hastig. Ja, er hatte verstanden. Er würde es einfach tun. Das war er Katrina schuldig.
Katrina ... Er versuchte, nicht daran zu denken, wie sie ihn angesehen hatte. Flehend, voller Furcht. Sie hatte etwas sagen wollen, es aber nicht gekonnt.
Dieses Bild würde er niemals wieder vergessen – seine Freundin an einen Stuhl gefesselt, geknebelt und in Tränen aufgelöst. Sie hatte ängstlich gewimmert, aber das konnte er verstehen. Schließlich hatte dieser andere Typ ihr die ganze Zeit über eine Waffe an den Kopf gehalten.
Er hätte einfach die Tür nicht öffnen dürfen. Warum hatte er das getan?
Die Ampel sprang auf Grün und er bog ab auf den Parkplatz des Krankenhauses. Dort hielt er unweit des Seiteneingangs und atmete tief durch.
„Alles klar? Nicht vergessen – du holst es und verschwindest wieder. Und du verrätst niemandem ein Sterbenswort, sonst ...“ Mit der linken Hand hob der Mann sein Handy, um ihm zu verdeutlichen, dass er dann seinen Partner anrufen würde, der noch bei Katrina war. Neil glaubte ihm und nickte hastig. Sein Blick fror auf der Waffe fest, die der Mann in der rechten Hand hielt.
„Bin gleich wieder da“, sagte Neil und stieg aus. Zu Hause hatte er schon seine Arbeitskleidung angezogen, um hier nicht weiter aufzufallen, und betrat das Krankenhaus. Er ging am Empfang der Notaufnahme vorüber, grüßte die Kolleginnen mit einem Nicken und versuchte, keine zu hastigen Schritte zu machen. Er öffnete eine Brandschutztür, folgte einem langen Gang und bog zur radiologischen Abteilung ab. Blieb jetzt bloß zu hoffen, dass der Sicherheitscode des Materialraumes zwischenzeitlich wirklich nicht geändert worden war ...
In der Radiologie war um diese Zeit kein Betrieb, nicht einmal der Empfang war besetzt. Ein Schild über einem Klingelknopf besagte, dass man ihn drücken sollte, wenn man Hilfe benötigte. Neil ging daran vorüber und öffnete die Tür zum nächsten Gang. Unruhig schaute er sich noch einmal um, aber er war allein. Niemand zu sehen. Einzig die Kamera über der Tür nahm ihn auf, aber damit musste er jetzt leben. Vielleicht war das auch gar nicht so schlecht.
Er zog seine Karte durch das Lesegerät neben der Tür und gab anschließend den Sicherheitscode ein. Bitte, Gott, lass ihn noch stimmen ...
Ein Piepen verriet, dass die Tür entriegelt wurde. Neil öffnete sie und betrat den Materialraum. Hier lagerten mehrere Bleibehälter, die mit Warnhinweisen versehen waren: radioaktives Material – Lebensgefahr. Seine Hände zitterten wie Espenlaub, als er vor dem Regal stand und die Bleikapseln zögerlich ansah. Er sollte eine nehmen, hatten die Männer gesagt. Eine von weiter hinten, damit das Fehlen nicht gleich so auffiel.
Die Warnhinweise ließen ihn nervös werden. Er wusste, in den Bleikapseln war das radioaktive Material sicher verwahrt – aber er würde gleich einem Mann mit einer Schusswaffe eine dieser Kapseln aushändigen. Aushändigen müssen.
Verkaufte er hier gerade seine Seele?
Er griff seitlich in das Regal und nahm eine der Kapseln heraus. Auch diese trug einen Aufkleber mit dem Warnzeichen und außerdem die Bezeichnung 137CS für Cäsium-137. Hoch radioaktiv. Beta- und Gammastrahler mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren und einer Aktivität von über drei Milliarden Becquerel.
Bitte, lieber Gott, hilf mir.
Neil nahm die Kapsel mit beiden Händen und steckte sie in den mitgebrachten Rucksack. Vorsichtig öffnete er die Tür und spähte hinaus. Niemand zu sehen. Er straffte die Schultern und machte sich auf den Weg zum Ausgang, den Rucksack über eine Schulter gehängt.
Sollte er wirklich nicht die Polizei verständigen?
Doch er hatte die Männer gehört. Wenn er nicht wiederkam und sie das Gefühl hatten, dass etwas schief lief, würde Katrina sterben – und das konnte er nicht zulassen. Das ging einfach nicht. Sie hatte doch nichts damit zu tun – und er liebte sie so sehr ...
Ungehindert verließ er mit dem Rucksack das Krankenhaus und kehrte zu dem Auto zurück, in dem der Mann mit der Waffe auf ihn wartete. Neils Schritte verlangsamten sich, als er sich dem Auto näherte, doch schließlich öffnete er die Fahrertür und stieg ein. Sofort riss der Mann ihm den Rucksack aus den Händen und schaute hinein. Beim Anblick des Bleibehälters stahl sich ein Lächeln auf seine Lippen.
„Gab es Schwierigkeiten?“
„Nein, gar nicht“, erwiderte Neil tonlos und räusperte sich. „Bitte, rufen Sie Ihren Partner an und sagen ihm, dass er meine Freundin gehen lassen soll.“
„Augenblick. Immer mit der Ruhe. Runter vom Parkplatz. Fahr los.“
Neil resignierte innerlich, aber er tat es. Er startete den Motor und fuhr los. Im Augenwinkel sah er, wie der Mann nach seinem Handy griff und eine Nachricht schrieb, aber Genaueres konnte er nicht erkennen.
„Fahren wir zum Treffpunkt“, sagte er. „Ich habe meinem Partner Bescheid gesagt, dass er mit deiner Freundin herkommen soll.“
„Okay“, erwiderte Neil leise. „Wohin?“
„Da vorne links.“
Neil bog ab und folgte dem Straßenverlauf auf den Highway 1. Sein Beifahrer sagte nichts. Neil hatte Herzrasen, denn noch war die Gefahr nicht gebannt.
„Gleich rechts auf die Saratoga Avenue“, sagte der Mann nach einer Weile. Neil setzte den Blinker, bog ab und fuhr auf Anweisung auch an der nächsten Kreuzung rechts. Sie durchquerten ein Industriegebiet, zu ihrer Linken erhob sich ein Baumarkt. Neil fuhr einfach weiter, vorbei an einem riesigen Depot des United States Postal Service, als der Mann plötzlich sagte: „Hier links.“
Sie bogen ab und folgten dem Straßenverlauf um eine scharfe Kurve. Jetzt war die Straße nur noch einspurig und verlief parallel zu Bahngleisen. Sie näherten sich einer Brücke, als der Mann sagte: „Hier anhalten.“
Neil bremste und blieb vor der Brücke stehen, die sich über die Straße und die Gleise spannte. Oranges Licht von der Straßenbeleuchtung in der Nähe hüllte die Unterführung in eine gespenstische Atmosphäre.
„Wo sind sie denn?“, murmelte der Mann und stieg aus. „Komm.“
Neil wunderte sich zwar, aber er war froh, dass auch er aussteigen durfte. Hoffentlich kam dieser Kerl mit Katrina bald ... Er hatte ja seinen Teil erfüllt und ihnen das Cäsium gebracht.
Der Mann schaute sich um, immer noch die Waffe in der Hand. Neil verschränkte fröstelnd die Arme vor der Brust. In der Nähe kreischten die Schienen, als ein Zug vorüber fuhr. Ansonsten war es still.
„Auf die Knie, Hände hinter den Kopf“, befahl plötzlich die Stimme des Mannes. Neil konnte ihn nur im Augenwinkel sehen und erstarrte.
„Was soll das? Was haben Sie vor?“
„Hast du ernsthaft geglaubt, wir lassen Zeugen am Leben?“, fragte der Mann. „Auf die Knie!“
Neil konnte sich nicht rühren. Er wollte schon etwas sagen, wollte um sein Leben flehen, um Katrinas – doch er hörte, wie die Waffe entsichert wurde. Der Mann trat vor ihn und baute sich hünenhaft vor ihm auf. Tränen brannten in Neils Augen, Panik wallte in ihm auf. Sein letzter Gedanke, bevor es knallte und alles schwarz wurde, galt Katrina.
Sonntag, 28. Mai
Im Licht der untergehenden Sonne erstrahlten nicht nur die halbrunden Horseshoe Falls, sondern auch die kleineren Niagarafälle auf amerikanischer Seite. Libby konnte sich überhaupt nicht sattsehen. Am Fuß der Fälle hatte sich ein kleiner Ausflugsdampfer der Maid of the Mists seitlich gedreht, um den Fahrgästen die beste Sicht auf den breiten Wasserfall zu gewähren.
Ein feuchtfröhlicher Spaß, wie Libby jetzt wusste. Je nachdem, wie nah das Schiff heranfuhr, konnte man ziemlich nass werden – ungeachtet der Schutzkleidung, die vor Fahrtantritt verkauft wurde. Aber es war ein schöner, warmer Tag, deshalb hatte es sie nicht gestört, im Anschluss an die Bootsfahrt mit feuchter Jeans und nassen Haaren über die Promenade am Niagara River entlang zu laufen.
Freitags waren sie mittags zum Flughafen gefahren und nach Toronto geflogen. Es war das erste Mal, dass Libby Kanada besuchte, und die Metropole am Ontariosee gefiel ihr gut. Sie waren den CN Tower hinaufgefahren, hatten das Path-Tunnelsystem mit unterirdischen Geschäften erkundet und am Ufer des Ontariosees gesessen.
Am Morgen hatten sie die einstündige Fahrt nach Niagara Falls in Angriff genommen und auf kanadischer Seite die Wasserfälle erkundet. Die Bootsfahrt hatte beiden großen Spaß gemacht. Inzwischen waren sie wieder trocken und saßen in dem Restaurant auf den Klippen gleich an den Horseshoe Falls. Libby war froh darüber, sich rechtzeitig um eine Tischreservierung gekümmert zu haben. Die Aussicht war einmalig, aber sie wusste, sie hatte auch ihren Preis. Doch darüber dachte sie jetzt nicht nach.
„Das war eine großartige Idee“, sagte Owen. „Ein tolles Geschenk, vielen Dank. In ein paar Tagen werde ich mich revanchieren.“
Libby grinste. „Musst du nicht. Wir hatten ein schönes Wochenende. Nur wir zwei ... Wer weiß, wann wir das nächste Mal die Gelegenheit haben?“
Die Blicke der beiden trafen sich und wieder hatte Owen diesen seligen Ausdruck, den Libby gar nicht von ihm kannte – bis er bei ihrer Frauenärztin auf dem Ultraschallmonitor den Herzschlag ihres Babys gesehen hatte. Da hatte sich etwas bei ihm verändert, was er auch selbst bestätigt hatte.
Im ersten Augenblick hatten sie sich kaum darüber freuen können, denn die Entführung durch Thomas Smith und seine Helfer hatte alles überschattet. Deshalb hatte der Besuch bei ihrer Ärztin auch für Libby einen Unterschied gemacht. Zwar hatte sie zu diesem Zeitpunkt schon gespürt, dass etwas anders war, aber es zu sehen machte es real.
Sie versuchte, sich etwas bequemer hinzusetzen. Wenn sie wieder zurück waren, musste sie sich unbedingt andere Hosen kaufen. Inzwischen fand sie die Bundweite ihrer normalen Jeans schon fast unerträglich, auch wenn sie noch nicht zugenommen hatte und nur eine minimale Rundung ihres Bauches zu sehen war. Sie war jetzt Anfang des vierten Monats, gerade erst waren die kritischen ersten zwölf Wochen vorbei. Seit einer guten Woche fühlte sie sich so, als wäre überhaupt nichts, weshalb sie fast ein wenig besorgt gewesen war. Keine Übelkeit mehr, keine Müdigkeit, nichts dergleichen.
„Wann kann man das Geschlecht bestimmen?“, fragte Owen.
„Beim nächsten Ultraschall vermutlich. Hast du ein Wunschgeschlecht?“
Owen schüttelte unbekümmert den Kopf. „Nein, gar nicht. Das spielt für mich keine Rolle. Für dich?“
„Nein ... ich meine, wir können es sowieso nicht beeinflussen. Beides hat seine Vor- und Nachteile.“
„Ich bin so gespannt! Byron hat es gut, er weiß ja schon, dass es ein Junge wird.“
„Jasmine ist ja nun auch schon bedeutend weiter als ich“, sagte Libby. Sie hatten Byron und seine Freundin vor einigen Tagen noch gesehen, als sie ihnen geholfen hatten, Umzugskartons und Möbel in ihre neue Wohnung zu bringen. Bei der Suche hatte es sehr geholfen, dass Owen bereit gewesen war, für sie zu bürgen. Mit dieser Sicherheit hatten sie schließlich eine größere Wohnung gefunden – gerade rechtzeitig, damit alles bis zur Geburt ihres Sohnes Ende August fertig war. Libby beneidete sie nicht um diesen Stress, aber Jasmine freute sich so sehr, dass sie alles gleichmütig hinnahm. Auch Byron hatte sich mittlerweile an den Gedanken gewöhnt, Vater zu werden, und freute sich ebenfalls darauf.
„Ich versuche schon die ganze Zeit, mir vorzustellen, wie es wird, wenn wir erst mal ein Kind haben. Bei unseren Jobs wird das sicher kein Spaziergang“, sagte Owen.
„Auch da bin ich wieder froh, dass Nick mein Chef ist. So sehr ich die familienfreundliche Gesetzgebung in Kalifornien auch vermisse – ich weiß, dass Nick mir keine Steine in den Weg legen wird“, sagte Libby.
„Sei froh. Ich werde nie vergessen, wie Correll mich angeguckt hat, als ich ihm gesagt habe, dass ich nächstes Jahr sechs Monate freinehmen möchte. Er dachte, ich nehme ihn auf den Arm.“
„Kennt er das denn nicht von Benny?“
Owen schüttelte den Kopf. „Nein, Benny hat sich nur zur Geburt seiner Kinder Urlaub genommen. Sie sind aber auch schon früh von einer Tagesmutter betreut worden.“
„Dafür ist immer noch Zeit, wenn unser Kind erst mal ein Jahr alt ist“, sagte Libby. „Hat bei Hayley damals auch gut funktioniert.“
„Und jetzt ist sie schon zwölf“, sagte Owen.
„Ja, kaum zu fassen. Es hat mir immer Spaß gemacht, mich mit um sie zu kümmern. Und jetzt ein eigenes Baby ...“
Libby wusste, es hatte auch viel mit den Hormonen zu tun, dass sie so gut gelaunt und zuversichtlich war. Im Augenblick war sie immer fröhlich und hatte das Gefühl, ganz in sich zu ruhen. Das hatte Michael ihr auch bei einer ihrer letzten Sitzungen bestätigt.
„Noch so lange“, sagte Owen und seufzte dramatisch, bevor er wieder aus dem Fenster schaute und beobachtete, wie die tosenden Wassermassen des Niagara River in die Tiefe stürzten. Libby leerte ihren Teller und als sie fertig war, sagte sie: „Ich habe mir etwas überlegt.“
„Jetzt bin ich gespannt“, sagte Owen.
„Es geht um die Geburt“, begann sie. „Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, wie das ablaufen soll, und ich würde mir wünschen, dass unser Kind bei uns zu Hause zur Welt kommt.“
Owen war sichtlich überrascht. „Eine Hausgeburt?“
Libby nickte. „Für mich ist das etwas ganz Normales. Ich habe in meiner Familie damals in Yucca Valley einige miterlebt – nur am Rande, aber das war nicht weiter ungewöhnlich. Hayley ist ja auch nicht im Krankenhaus zur Welt gekommen und den Grund dafür habe ich nie so gut verstanden wie jetzt.“
„Okay, aber ... ist das denn nicht unsicher?“
„Ist es nicht“, sagte sie kopfschüttelnd. „Bei einer Hausgeburt hätte ich eine durchgehende Betreuung durch dieselbe Hebamme, die mich auch schon durch die Schwangerschaft begleitet hat. Sie wäre keine Fremde für mich. Und sollte die Unterstützung durch ein Krankenhaus notwendig werden, sieht die Hebamme das so rechtzeitig, dass man noch ganz bequem selbst dorthin fahren kann.“
Owen lehnte sich zurück. „Ich habe noch gar keine Meinung dazu, muss ich gestehen.“
Libby starrte auf ihre Finger und knetete sie. Es fiel ihr nicht leicht, ihr Empfinden in Worte zu fassen, aber sie wollte, dass Owen ihre Beweggründe verstand.
„Ich hasse Krankenhäuser“, sagte sie. „Ich war immer dann in Krankenhäusern, wenn ich etwas Schlimmes erlebt hatte. In einem Krankenhaus würde mich eine Hebamme betreuen, die mich und meine Vorgeschichte nicht kennt, und sollte ein Schichtwechsel anstehen, noch eine andere. Das kann ich nicht. Allein bei der Vorstellung ...“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich habe mal mit Sadie darüber gesprochen, das ist aber schon eine Weile her. Ich brauche ein sicheres und geschütztes Umfeld. Zu Hause ist mir alles vertraut und wenn dann eine Hebamme kommt, die ich kenne, nimmt mir das die Angst vor dem Kontrollverlust.“
„Kann ich verstehen“, sagte Owen.
„Hättest du ein Problem damit? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, in ein Krankenhaus zu gehen. Bei dem Gedanken daran mache ich dicht. Das ist nicht gut.“ Libby atmete tief durch. „Durch Sadie weiß ich, dass ich das trotz meines Traumas schaffen kann. Du weißt, wie ich darauf reagiere, wenn ... wenn mich jemand auf eine bestimmte Weise berührt. Das hast du erlebt. Das bleibt aber bei einer Geburt nicht aus.“
Sie konnte sehen, dass diese Worte bei Owen etwas bewirkten. „Okay ... Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, aber du hast Recht. Du musst es schließlich machen. Ich sitze ja maximal daneben und rede dir gut zu.“
„Ein bisschen mehr wird das schon sein“, sagte Libby und lächelte. „Ich würde mich darum kümmern, eine Hebamme zu finden, wenn wir wieder zu Hause sind. Sie kann dir dann alles erklären.“
„Ja, mach das mal. Das ist bestimmt eine gute Idee“, sagte Owen. „Ich finde den Vorschlag zwar ungewöhnlich, aber das liegt daran, dass ich das nicht kenne. Es war mir bis jetzt auch egal. Aber du hast Recht – du hattest ja wegen Vincent selbst vor mir anfangs Angst. Es muss dir gut gehen, die Umstände müssen für dich stimmen.“
Libby griff über den Tisch hinweg nach seiner Hand. „Danke, Owen. Ich bin froh, dass du das so siehst.“
„Ich fände es anmaßend, dir vorzuschreiben, wie du das machen sollst. Zwar überrascht es mich, weil du immer erzählt hast, dass deine Mum fast bei deiner Geburt gestorben wäre ... und das war doch auch eine Hausgeburt, oder?“
„Sicher, aber sie war erst siebzehn Jahre alt. Das allein ist ein Risiko. Sie hat mir erzählt, dass sie fast ohnmächtig vor Schmerz geworden ist, als die Hebamme ihr den Wehentropf angehängt hat, und ab da ist alles entgleist. Da hatte sie so extreme Wehen, dass die Gebärmutter gerissen ist. Es muss schon ziemlich viel schieflaufen, damit so etwas passiert.“
Owen verzog das Gesicht. „Das hört sich grässlich an.“
„Ja, oder? Ich muss sicher sein, dass die Hebamme meine Geschichte kennt und weiß, was geht und was nicht. Das ist mir wichtig.“
„Dann machen wir das so“, sagte Owen und nickte bekräftigend. „Dein Körper, deine Entscheidung.“
Es tat Libby gut, das zu hören. Sie liebte Owen für seine respektvolle Art und dafür, dass er ihr immer auf Augenhöhe begegnete.
Sie blieben sitzen, bis die Sonne untergegangen war, und beglichen dann die Rechnung. Sobald es dunkel genug war, wurden die Niagarafälle mit Scheinwerfern bunt beleuchtet, was sie sich aus der Nähe anschauen wollten.
Während es immer dunkler wurde, nahm auch die Temperatur rasch ab. Als sie an der Brüstung gegenüber der Horseshoe Falls standen und das bunte Farbenspiel betrachteten, legte Owen einen Arm um Libby. Sie lehnte sich an ihn, schloss für einen Moment die Augen und atmete tief durch.
Während sie das Farbenspiel der Wasserfälle betrachtete, dachte sie darüber nach, wann sie zuletzt so glücklich gewesen war. Sie kam zu dem Schluss, dass das schon eine Weile her war – bewusst erinnerte sie sich an den Moment, in dem Owen ihretwegen nach Virginia gezogen war. Sie hatte nie vergessen, wie er plötzlich in Quantico vor ihr gestanden hatte – ohne Vorwarnung, ganz aus heiterem Himmel, mit neuer Dienstmarke am Gürtel und einem liebevollen Blick.
Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange und seufzte. An ihre Anfangszeit beim FBI dachte sie gern zurück, auch wenn schon damals nicht alles einfach gewesen war. Doch es war okay gewesen – bis sie gegen Randall Howard und Vincent Howard Bailey ermittelt hatte. Das hatte beinahe ihr Leben zerstört.
Doch sie ließ es sich nicht zerstören. Sie hatte es wieder aufgebaut. Und jetzt erwartete sie sogar ein Baby.
Als es ihnen zu kalt wurde, liefen sie zum Hotel zurück. Es lag in fußläufiger Entfernung zu den Niagarafällen, was sich als verdammt praktisch erwies. Am nächsten Tag würden sie gegen Mittag nach Toronto fahren und schließlich zurück nach Hause fliegen. Dann hatte der Alltag sie wieder.
Sie würden im Haus umräumen müssen. Jetzt brauchten sie ein Kinderzimmer. Sie benötigten auch die Ausstattung fürs Kind. Libby freute sich schon darauf, alles zu besorgen.
Am Hotelzimmer angekommen, öffnete Owen die Tür mit der Schlüsselkarte. Sie betraten das Zimmer und machten es sich ein wenig gemütlich, bis sie beschlossen, schlafen zu gehen.
Doch während tiefe Atemzüge Libby verrieten, dass Owen neben ihr schon eingeschlafen war, lag sie neben ihm und starrte an die Decke des Hotelzimmers. Ihr ging so viel durch den Kopf.
Sie war froh, dass Owen ihren Wunsch nach einer Hausgeburt mittrug. Mit Michael hatte sie darüber auch schon gesprochen, dass sie Angst vor traumatischen Ereignissen bei der Geburt hatte. Er hatte sie darin bestärkt, ihren Weg zu gehen und ihr gesagt, dass sie das schaffen konnte. Daran musste sie glauben.
Sadie hatte ihr einmal gesagt, dass sie sich ihr Leben lang als schwach erlebt hatte, weil sie eine Frau war. So war sie erzogen worden, das hatte sie auch selbst erleben müssen. Erst Hayleys Geburt hatte ihr gezeigt, was in ihr steckte.
Libby hoffte, dass es ihr so ähnlich ergehen würde. Sie hatte sich nie als schwach erlebt – das hatte immer ihren Kampfesmut angestachelt. Sie hatte die Dinge niemals einfach hingenommen.
Das hatte sie von ihrer Mum. Grace war es gewesen, die sie immer ermutigt hatte – und das, obwohl sie es selbst nie leicht gehabt hatte. Libby konnte nur erahnen, welche Verletzungen Grace in ihrem Leben erlitten und was es mit ihr gemacht hatte, bei der Geburt ihrer Tochter fast zu verbluten und anschließend unfruchtbar zu sein. Libby wusste, dass Grace gern mehr Kinder gehabt hätte. So hatte ihre Liebe sich auf ihre einzige Tochter konzentriert.
In diesem Augenblick fühlte es sich wie ein Stich ins Herz an, dass Grace nun schon lange tot war. Inzwischen waren es mehr als dreizehn Jahre. Sie hatte nie erleben dürfen, was aus ihrer Tochter geworden war – und sie würde nie ihr Enkelkind kennenlernen.
Libby legte eine Hand auf ihren Bauch und schloss die Augen, während sie sich schwor, ihr Kind immer zu beschützen. Es sollte sich so geliebt fühlen, wie sie sich immer von ihrer Mum geliebt gefühlt hatte.
Dienstag, 30. Mai
„Erzähl schon! Wie war’s?“ Julie hielt mit ihrer Neugier kaum hinterm Berg, als Libby zu ihr ins Auto gestiegen war. Das hatte Libby aber auch nicht anders erwartet.
„Ziemlich toll“, antwortete Libby, nachdem sie sich angeschnallt hatte. „Toronto ist eine Reise wert. Wir waren ja gar nicht lang dort, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Und die Niagarafälle sind einfach nur beeindruckend. Ein echtes Schauspiel.“
„Die stehen auf meiner Liste auch ganz oben. Schon irre, dass ich es da noch nicht hingeschafft habe, so weit sind die ja eigentlich nicht weg. Aber ich sitze mit meinem Urlaub ja immer in der Zwickmühle: Bereise ich die USA oder fliege ich nach Hause?“
„Warum bereist du die USA nicht mit deinen Eltern?“, fragte Libby grinsend.
„Da hast du eigentlich Recht. Dad fliegt nicht so gern, aber vielleicht kann ich ihn ja überreden.“
Libby nickte bloß. Sie wusste, dass Julies Vater schon seit vielen Jahren herzkrank war, womit er aber im Allgemeinen glücklicherweise gut zurechtkam.
„Wann fliegst du wieder hin?“, fragte Libby.
„Das habe ich mir noch nicht überlegt. Mal sehen. Wenn der Flug nicht jedes Mal so lang dauern würde ...“
„Ich weiß noch, wie ich damals mit Sadie und Matt zu euch nach London geflogen bin. An den Flug kann ich mich erinnern ... und daran, wie wir London unsicher gemacht haben. Das war damals eine ziemliche Offenbarung für mich. Ich war ja erst ein Jahr draußen und dann auch noch in ein anderes Land zu reisen, war wirklich grandios.“
„Gut, auf das, was dann passiert ist, hätte ich verzichten können ... aber ich werde nie vergessen, wie dein Dad diese Russen in bester Geheimdienstmanier allein zerlegt hat. Das war toll.“
„Ja, so was kann er. Er ist der Beste“, sagte Libby und lächelte.
Als sie in Quantico eintrafen, empfing sie der Duft von Kaffee im Büro der Profiler. Belinda kam ihnen entgegen und begrüßte sie freundlich. Libby und Julie gingen zu ihren Schreibtischen und Libby hatte gerade ihren Rechner gestartet, als Jesse zu seinem Schreibtisch schräg gegenüber ging.
„Guten Morgen zusammen“, begrüßte er sie. „Schönes Wochenende gehabt?“
„Sehr“, sagte Libby. „Warst du schon mal an den Niagarafällen?“
„Ja, als Jugendlicher. Hat mir sehr gefallen. Und dir?“
„Es war wirklich toll“, sagte Libby und erzählte ein wenig. Darüber traf auch Nick ein, der sich ebenfalls erkundigte, und um halb zehn setzten sich alle für die Wochenbesprechung zusammen. Nacheinander gingen sie alles durch, woran sie arbeiteten. Es war immer gut, einen Überblick zu haben, und in der Besprechung holten sie sich auch immer wieder Impulse von den Kollegen.
„Mich erreichte gestern eine Anfrage aus Baltimore“, berichtete Alexandra. „Die dortige Polizei fahndet erfolglos nach einem Vergewaltiger-Duo. Einer der beiden gibt sich als Uber-Fahrer aus. Es ist eine geschickte Masche – sie bekommen mit, wenn eine einzelne Frau ein Uber bestellt, und einer versucht, vor dem eigentlichen Fahrer dort zu sein. Dann erklärt er, der eigentliche Fahrer hätte einen Unfall oder einen medizinischen Notfall, weshalb er ihn als Vertretung geschickt hat.
Akzeptiert die Frau und steigt ein, sitzt sie in der Falle. Alle Opfer hatten UberShare-Fahrten gebucht, bei denen Fremde sich ein Uber teilen können. Der Fahrer fährt mit der Frau zum nächsten Treffpunkt, wo der zweite Täter zusteigt. Sobald sie merkt, dass etwas nicht stimmt, bedroht der zweite Täter sie mit der Waffe und fesselt sie. Die Männer fahren mit ihren Opfern auf irgendwelche verlassenen Industriegelände, zerren sie aus dem Auto und vergewaltigen sie. Außerdem rauben sie die Frauen aus und nehmen ihnen sämtliche Wertsachen, inklusive Handys, ab. Die Polizei weiß inzwischen von drei Fällen, alle Opfer mussten sich selbst Hilfe holen. Vermutlich sind es noch mehr.
Ihre Ermittlungen sind bislang ins Leere gelaufen, weshalb sie jetzt bei uns um Hilfe bitten. Die Polizei hat zwar letzte Woche bereits entsprechende Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, um die Frauen zu warnen, aber dennoch geht die Sache weiter. Am Samstag gab es wieder einen Fall, deshalb kam jetzt die Anfrage.“
Libby suchte Julies Blick, die ihn gleichermaßen überrascht und interessiert erwiderte, und sagte: „Darum würde ich mich gern kümmern. Was meinst du, Julie?“
Während Julie gleich nickte, sagte Nick: „Sehr gern. Alex, leitest du den beiden die Infos vom BPD weiter?“
„Aber sicher“, versprach Alexandra.
Schließlich fuhr Nick einfach fort, was Libby überraschte – und gleichermaßen freute. Sie war froh, dass Nick ihren Wunsch, ein Profil in diesem Fall zu erstellen, nicht in Frage stellte.
Sie konnte das. Solche Fälle gehörten dazu. Sie war nicht bereit, davor Reißaus zu nehmen – zumal sie Vergewaltiger hasste.
Nach der Besprechung dauerte es keine drei Minuten, bis Alex ihnen die Anfrage aus Baltimore weiterleitete. Sie stammte von Detective Eric Thompson und seiner Kollegin, Detective Frances Garcia. In der Mail standen noch einige Infos, die Alex in der Besprechung weggelassen hatte, aber dennoch beschloss Libby, die Kollegen von der Polizei in Baltimore einfach mal anzurufen. Sie stellte ihr Telefon auf Lautsprecher und Julie rollte mit ihrem Stuhl neben sie.
„Baltimore PD, Thompson“, meldete sich der Detective und klang dabei ziemlich außer Atem.
„Detective Thompson, ich bin Special Agent Libby Whitman, FBI. Bei mir ist meine Kollegin, Special Agent Julie Thornton. Sie hatten eine Anfrage an unser Team gerichtet.“
„Oh. Das ging jetzt aber schnell. Damit hatte ich gar nicht gerechnet“, gab er zu.
„Unsere Kollegin hat uns den Fall vorhin kurz vorgestellt und wir würden Ihnen gern mit einem Täterprofil bei den Ermittlungen helfen.“
„Bitte, das wäre großartig. Frances ist gerade nicht hier, aber ich kann Sie ja schon mal briefen.“ Thompson seufzte tief. „Am Wochenende hatten wir wieder einen Fall. Wir haben unsere Warnung schon an die Medien gegeben, und trotzdem ...“
„Haben Sie es denn nur über die klassischen Medien versucht oder auch über Social Media?“, fragte Julie.
„Letzteres auch – zumindest, so gut es geht. Wir überlegen jetzt, Plakate drucken zu lassen, die wir auf Clubtoiletten aushängen. Zwei der Opfer hat der Fahrer vor Clubs abgeholt, eins am Bahnhof. Aber es ist ja nicht damit getan, mögliche Opfer vorzuwarnen. Wir müssen diese Männer kriegen, bevor sie sich noch auf eine andere Masche verlegen.“
„Gut möglich, dass sie das tun“, sagte Libby. „Sie müssen mir da jetzt mal aushelfen – wie genau sieht ihr Vorgehen aus? Ich habe mir noch nie ein Uber gerufen, muss ich gestehen.“
„Wenn man einen Fahrer braucht, stellt man eine Anfrage in der App. Ein Fahrer kann sie annehmen und man kann in der App auf der Karte verfolgen, wo der Fahrer ist. Der Fahrgast erfährt vor Fahrtantritt, welches Modell und Kennzeichen das Fahrzeug hat und wer der Fahrer ist. Aber genau da setzen die Täter an – wir wissen noch nicht, wie sie das machen, aber sie ziehen sich aus dem Uber-System die Anfrage und schaffen es auch, die Anzeige für den Fahrgast so weit zu manipulieren, dass es wirklich so aussieht, als wäre der eigentliche Fahrer irgendwo stehengeblieben oder gar nicht erst losgefahren. Das berichten die Opfer übereinstimmend. Der Fahrer kennt dann auch die Infos des eigentlichen Fahrers und wirkt so vertrauenswürdiger. Das ist sehr geschickt und perfide gemacht.“
„Hört sich so an“, sagte Libby. „Wissen die Täter denn vorher, dass sie eine Frau allein als Fahrgast haben werden?“
„Ja, diese Fahrten wählen sie ganz gezielt aus. Bei UberShare gibt der Fahrgast vorab die Anzahl der Mitfahrer an. Solche Fahrten sind es bislang gewesen, die diese Täter ausgespäht haben – Frauen, die allein eine UberShare-Fahrt buchen. Das war in jedem der Fälle so. Hat für sie auch den Vorteil, dass einer der Täter mit der Frau irgendwo herumfahren kann, ohne dass sie skeptisch wird, weil sie denkt, dass er noch einen Fahrgast abholen muss – und das ist dann der zweite Täter.“
„Dann kennen sie das System aber gut“, sagte Julie. „Haben Sie denn keine Beschreibung von Tätern und Fahrzeug?“
„Doch, schon. Wir haben hier mehrere Phantombilder, die sich nur entfernt ähnlich sehen. Die Beschreibungen der Opfer decken sich nicht unbedingt. Wir vermuten, dass mal der eine fährt und mal der andere. Sie schlagen immer nachts in schlecht beleuchteten Gegenden zu, behelfen sich mit Sonnenbrillen und Baseballkappen. Vor der Vergewaltigung ziehen sie dann Sturmhauben über.“
Ein kalter Schauer überlief Libby beim Gedanken daran, wie sich das für die Opfer anfühlen musste. „Das ist grauenvoll.“
„Ist es. Als das erste Opfer uns von Krankenhaus aus angerufen und die Tat angezeigt hat, waren wir schockiert über die Perfidität, mit der die Tat ausgeführt wurde. Allein haben die Frauen keine Chance gegen die beiden Männer. Als es zwei Wochen später wieder passiert ist, wussten wir, dass wir ein Problem haben. Wir haben dann überlegt, an die Öffentlichkeit zu gehen, aber bevor wir das geschafft haben, kam es am vergangenen Wochenende schon zur dritten Tat.“
„Haben Sie schon überlegt, den Tätern eine gezielte Falle zu stellen?“
„Haben wir“, sagte Thompson. „Frances würde das sogar übernehmen, aber bislang haben wir keine Genehmigung dafür bekommen. Zu riskant. Der Täter, der sich als zweiter Fahrgast ausgibt, nimmt den Frauen vor der Vergewaltigung alles ab, fesselt sie und schaltet die Handys aus.“
„Das klingt wirklich äußerst riskant“, sagte Libby.
„Dadurch, dass es zwei Täter sind, haben sie auch Zugriff auf verschiedene Fahrzeuge. Die Opfer haben uns bis jetzt zwei verschiedene Autos beschrieben. Teilweise kannten sie noch die Kennzeichen oder hatten sogar Fotos davon gemacht, aber die waren jedes Mal gestohlen.“
„Die denken wirklich an alles“, sagte Julie.
„Genau das ist unser Problem. Wir haben uns schon an Uber gewandt, die jetzt auf ihrer Homepage und sogar in der App eine Warnung implementieren, die die Masche der Täter beschreibt. Nutzern in Baltimore soll diese Warnung jetzt bei UberShare-Fahrten angezeigt werden. Das müssen wir tun, wir müssen verhindern, dass es zu weiteren Taten kommt. Was die Opfer uns teilweise beschrieben haben, war scheußlich.“
„Wann hat das angefangen?“, fragte Julie.
„Erst vor drei Wochen. Zwischen den ersten beiden Taten lagen zwei Wochen, zwischen der zweiten und dritten nur noch eine. Das letzte Opfer sagte uns noch vorgestern, dass sie nichts von dieser Masche wusste, deshalb ist die Warnung in der App auch so wichtig. Die wird jetzt kommen, Uber ist selbst nicht daran interessiert, dass ihr System so missbraucht wird.“
„Mindestens einer der Täter muss entsprechende Programmierkenntnisse mitbringen“, sagte Libby. „Entweder ist er ein Hacker oder er weiß, wie das bei Uber funktioniert, weil er dort mal gearbeitet hat.“
„Das haben wir uns auch schon überlegt. Wir haben bei Uber angefragt und man war auch sehr kooperativ, aber wir haben alle aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter vergeblich überprüft. Da hat sich kein Verdachtsmoment ergeben.“
„Klingt ziemlich vertrackt“, sagte Julie.
„Ist es. Im Augenblick wissen wir nicht, wie wir diese Männer finden sollen. Es gibt drei Zeuginnen, aber die Beschreibungen helfen uns nicht. Wir wissen, dass die Täter Weiße sind. Ihre Opfer sind es ebenfalls.“
„Das ist normal, Sexualstraftäter bleiben meist in ihrer eigenen ethnischen Gruppe“, erkläre Libby.
„Ja, richtig. Frances und ich sind spezialisiert auf sexuell motivierte Straftaten, wie es so schön heißt. Wir hatten auch schon die verrücktesten Dinge, aber das hier?“
„Schicken Sie uns, was Sie haben. Denken Sie, es wäre möglich, dass wir mit den Opfern persönlich sprechen?“
„Ich denke, schon. Das sollte kein Problem sein.“
„Was ist eigentlich mit DNA? Konnte welche sichergestellt werden?“, fragte Libby.
„Nein. Beide benutzen Kondome.“
„Also könnten sie vorbestraft sein“, schloss Julie.
„Gut möglich. Ehrlich, ich weiß nicht mehr weiter. Wir tun, was wir können, und trotzdem geht das weiter. Das lässt mich nachts nicht schlafen. Meine Freundin hat auch gelegentlich Uber genutzt, was nie für Probleme gesorgt hat – doch aktuell tut sie es überhaupt nicht. Aus eigenem Antrieb.“
„Das kann ich mir vorstellen“, sagte Julie.
„Passen Sie auf – ich schicke Ihnen alles. Ihrer Kollegin habe ich den Fall erst mal nur skizziert, weil ich nicht sicher war, ob Sie so etwas überhaupt bearbeiten.“
„Sie meinen, weil es keine Toten gibt?“, fragte Libby.
„Ja. Ich war mir nicht sicher, ob Sie als Profiler nur Tötungsdelikte bearbeiten.“
„Nein, gar nicht. Alles, was eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, und Serienvergewaltiger gehören durchaus dazu.“
„In Ordnung. Oh, da kommt Frances gerade. Fran, ich habe hier das FBI dran. Sie wollen sich alles ansehen, damit sie uns ein Profil erstellen können.“
Julie und Libby hörten die Stimme einer Frau im Hintergrund, dann wandte Thompson sich wieder an die beiden. „Wir tragen schnell alles zusammen und schicken es Ihnen.“
Libby war einverstanden und diktierte ihm ihre Mailadresse. Nachdem sie aufgelegt hatte, sagte Julie: „Klingt nach einer ziemlich krassen Masche.“
„Allerdings. Zwei Täter ... das ist widerlich. Ich will es mir gar nicht vorstellen.“
„Nein, ich mir auch nicht.“ Julie schüttelte sich.
Wenige Minuten später hatten sie alle Unterlagen von Detective Thompson bekommen und begannen, sich einen Überblick zu verschaffen. Vor drei Wochen war Mindy Harris, 21, mit Freunden in einem Club gewesen, um ausgelassen den Spring Break zu feiern. Sie hatten getrunken, getanzt und Spaß gehabt. Um kurz nach zwei hatte Mindy sich ein Uber gerufen – ein UberShare, denn als Studentin hatte sie Geld sparen wollen.
Die innere Unruhe, die Libby bislang verspürt hatte, wurde zu einem handfesten Gefühl von Übelkeit, als sie Mindys Schilderung las. Sie hatten Mindys Handschellen an einem Pfeiler fixiert, ihren Rock und ihr Oberteil zerrissen und dann hatte der erste Täter sie vergewaltigt – angefeuert vom zweiten Täter, der laut Mindys Aussage die Tat fotografiert und gefilmt hatte.
Julie, die mit ihrem Stuhl neben Libby gerollt war und an ihrem Bildschirm mitlas, ballte die Hände zu Fäusten und grollte: „Ich werde mich nie dran gewöhnen, wie ekelhaft und primitiv manche Männer sein können.“
Libby nickte bloß, während sie die schweißnassen Handflächen an ihrer Hose abwischte und tief durchatmete, um das Herzrasen irgendwie in den Griff zu kriegen. Mindys Aussage zu lesen, machte sie unendlich wütend.
Als der Täter von ihr abgelassen hatte, hatte Mindy schon gehofft, dass es vorbei war – war es aber nicht. Der Täter hatte ihr das Video vorgespielt und sich darüber lustig gemacht, dass sie geweint und gebettelt hatte.
Dann hatte der andere Täter weitergemacht. Mindy hatte beschrieben, wie die Männer sie erst von der Säule losgebunden hatten, bevor der zweite Mann sie vor sich auf die Knie gezwungen und ihr seinen Gürtel um den Hals gelegt hatte, mit dem er sie während der Vergewaltiung gewürgt und kontrolliert hatte. Das Ganze hatte nun der erste Täter gefilmt und als es endlich vorüber war, hatten sie ihr einen Tritt in den Unterleib verpasst und waren gegangen.
„Ist das brutal“, wisperte Julie.
Libby nickte langsam. „Das kannst du wohl sagen ... das ist wirklich grauenhaft.“
„Sollen wir erst mal eine Pause machen?“, fragte Julie, aber Libby schüttelte den Kopf.
„Nein. Das ist zwar ein ganz schön harter Trigger, aber es geht schon. Du kannst dir nicht vorstellen, wie motiviert ich jetzt bin, diese Bastarde zu schnappen.“
„Oh doch, ich denke, das kann ich. Wahrscheinlich noch mehr als ich“, erwiderte Julie grinsend. „Ehrlich, ich musste so etwas ja nie erleben, aber da geht mir die Hutschnur hoch.“
„Und mir erst.“ Libby biss sich auf die Unterlippe und atmete tief durch, dann wandten sie sich der zweiten Tat zu. Zoe Macmillan, 23, hatte sich ebenfalls nach einer Clubnacht ein UberShare gerufen und die Tat war beinahe identisch abgelaufen. Sie hatte überdies noch beschrieben, dass der zweite Täter sich neben sie gekniet und begonnen hatte, sich selbst zu befriedigen, während sein Mitstreiter sie vergewaltigt hatte. Gefilmt und fotografiert hatte er sie trotzdem.
Libby hatte so fest die Zähne zusammengebissen, dass es irgendwann schmerzte. Es kostete sie einige Überwindung, weiterzulesen und sich damit auseinanderzusetzen, wie es am vergangenen Wochenende Kayleigh Ashford getroffen hatte. Die Zwanzigjährige hatte von der Party einer Freundin mit einem UberShare nach Hause fahren wollen und war misstrauisch geworden, nachdem der zweite Täter zugestiegen war. Auch sie war nacheinander von beiden Tätern vergewaltigt worden, ganz ähnlich wie Zoe. Sie hatte beschrieben, dass der zweite Täter sie während der Vergewaltigung angefasst hatte.
„Das ist neu“, sagte Julie. „Zumindest hat keine der anderen Frauen etwas Derartiges ausgesagt.“
„Es ist eine Steigerung. Die Reihenfolge, in der die Täter sie vergewaltigen, ist immer die Gleiche. Der dominante Täter kommt immer am Schluss.“
„Haben sie das so ausgesagt?“
„Alle drei hatten den zweiten Täter als den größeren beschrieben“, sagte Libby. „Und nach dem zu urteilen, wie die Frauen den Tatablauf beschrieben haben, halte ich den zweiten Täter für den dominanten. Er ist brutaler, er hat das Sagen. Er bestimmt ja auch über den anderen Täter.“
Julie nickte langsam. „Hm. Hast Recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Hunger. Sollen wir uns eine Kleinigkeit aus der Kantine holen, bevor wir weitermachen?“
Libby war einverstanden und stand auf.
„Hatten Thompson und Garcia uns nicht eine Karte mit allen Entführungs- und Tatorten geschickt?“, überlegte Libby, bevor sie sich setzte und an ihrem Rechner die entsprechende Datei öffnete. Es war ein Foto von einer Karte, die mit Stecknadeln an einer Korkwand pinnte. Die Entführungsorte lagen über das gesamte Stadtzentrum Baltimores verteilt, die Tatorte jedoch zentrierten sich auf Industriegelände, die den Hafen Baltimores flankierten.
„Wir suchen Einwohner Baltimores“, begann sie. „Davon können wir ausgehen. Der beste Ansatzpunkt, den wir haben, sind die IT-Kenntnisse eines der Täter.“
„Was denkst du, welcher es ist?“, fragte Julie.
Libby antwortete nicht direkt auf die Frage, sondern überlegte weiter. „Er kann was. Er hat entweder für Uber gearbeitet oder er ist ein derart begabter Hacker, dass bei Uber noch keiner gemerkt hat, wie er sich da ins System hackt. Da holt er sich das alles her. Er manipuliert das System und holt sich da die Daten. Und ich glaube, dass es der Jüngere der beiden ist, weil das ein Grund für den dominanten Täter wäre, ihn an Bord zu haben. Denn ich denke, dass er ihn eigentlich nicht bräuchte. Er käme sicher auch allein mit den Frauen zurecht und die Taten laufen alle nach seinem Skript ab. Ich denke, dass er den anderen Täter mitmachen lässt, ist zu seinem eigenen Lustgewinn und als Belohnung für den anderen Mann gedacht.“
„Also ist er eher ein Hacker“, überlegte Julie.
„Ja, ich denke schon. Ich meine, worum geht es dem Haupttäter hier? Um Dominanz. Warum? Weil sie ihm im Alltag fehlt. Ich sehe nicht, dass er tatsächlich bei Uber arbeitet. Nein ... er hat eine Kränkung erfahren. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er vergewaltigt. Das glaube ich nicht. Er hat das schon vorher gemacht, aber er hat sich jetzt darauf verlegt, die Frauen mit dieser Uber-Nummer zu kidnappen, weil er das Entdeckungsrisiko minimieren will. Er kann ja dann sogar vorab gezielt filtern und Frauen auswählen, die ihm gefallen.“
„Du glaubst also, dass er im wahren Leben eher ein Loser ist.“
„Hinter seinen Möglichkeiten oder Vorstellungen zurückgeblieben, ja. Er wollte mehr, als er hat – wahrscheinlich auch beruflich, nicht nur in Sachen Frauen. Aber da vor allem.“
„Bei solchen Taten sind die Opfer Stellvertreterinnen“, sagte Julie. „Das hat meine Mum damals im Profil des Campus Rapist von Norwich festgehalten. Das war immer derselbe Opfertyp, Stellvertreterinnen für seine Frau, von der er frustriert war. Wer hingeht und so perfide überlegt, wie man Frauen entführen und vergewaltigen kann, hat ja definitiv ein gestörtes Verhältnis zu Frauen.“
Libby nickte. „Und das schon sehr lange. Aber denkst du nicht, dass Thompson und Garcia schon Vorbestrafte überprüft haben?“
„Sicher. Vorbestrafte. Ich glaube aber nicht, dass einer der Täter vorbestraft ist. Allerhöchstens mal wegen Vergewaltigung festgenommen.“
„Bleibt die Frage, wie sie die Männer finden sollen, wenn sie keinen Ansatzpunkt haben ...“
„Wenn wir davon ausgehen, dass der Jüngere ein Hacker ist, könnten die Kollegen versuchen, ihn im Darknet für irgendeinen Job anzuheuern oder so“, schlug Julie vor und Libby nickte.
„Der Jüngere könnte auch Freelancer oder studentischer Mitarbeiter bei Uber sein. Keine Ahnung, ob sie die auch überprüft haben.“
„Fragen wir sie“, schlug Libby vor und griff nach dem Telefonhörer. Sie hatte Thompson direkt am Apparat.
„Haben sie schon was für uns?“, fragte er.
„Wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Was waren denn Ihre bisherigen Ermittlungsansätze?“
„Dass wir nach einem Duo zwischen 20 und 30 suchen. Der eine Täter eher Anfang 20, der andere ein paar Jahre älter. Wir haben Vorbestrafte überprüft und auch ehemalige Mitarbeiter von Uber, die in Frage kommen. Uber hat ja seinen Sitz in San Francisco – wir haben versucht, herauszufinden, ob ehemalige Mitarbeiter nach Baltimore gezogen sind. Besonders auf Programmierebene sitzen auch nicht alle Mitarbeiter von Uber in San Francisco.“
„Meine Kollegin und ich glauben tatsächlich, dass der Jüngere der beiden Täter derjenige ist, der die Programmierkenntnisse hat – und auch, dass er ein Hacker ist“, sagte Libby und erklärte ihre und Julies Gedankengänge.
„Haben Sie auch Vergewaltigungsanzeigen überprüft, bei denen es zu keiner Verurteilung gekommen ist?“, fragte Julie anschließend.
„Dazu sind wir bis jetzt noch nicht gekommen, hatten das aber überlegt.“
„Das sollten Sie tun. Wir sind ziemlich sicher, dass der dominantere der beiden Täter das nicht zum ersten Mal macht, aber er sucht jetzt nach einer Möglichkeit, die besser klappt – vermutlich, weil er eben vorab mal geschnappt und fast verurteilt wurde. Er will das Risiko minimieren und geschickter vorgehen. Vorhin haben wir uns überlegt, dass wir morgen gern mal bei Ihnen vorbeikommen würden, dann könnten wir vor Ort alles besprechen und vielleicht auch die Opfer befragen.“
„Das ist eine sehr gute Idee“, fand Thompson. „Kennen Sie sich in Baltimore aus?“
„Ein wenig. Ich hatte schon mal mit Kollegen von Ihnen zu tun“, erklärte Libby, deshalb sparte Thompson sich eine Wegbeschreibung.
Nachdem Libby aufgelegt hatte, sagte Julie: „Wir sollten vielleicht auch mal mit unseren Cybercrime-Kollegen sprechen. Die haben möglicherweise eine Idee, womit wir es hier zu tun haben.“
„Gute Idee“, sagte Libby und hörte mit halbem Ohr zu, während Julie bei den Kollegen anrief und ihnen die Sachlage schilderte. Schließlich berichtete sie Libby von dem, was sie erfahren hatte.
„Grundsätzlich halten die Kollegen es absolut für möglich, dass sich hier jemand ins System von Uber hackt“, begann sie. „Ganz offensichtlich haben die irgendwo ein Sicherheitsleck, durch das der Täter ins System kommt und es manipulieren kann. Wir wissen ja nicht, was man bei Uber schon versucht hat, um diese Lücke zu schließen und den Täter zu finden. Sie waren sich jedenfalls einig, dass dazu wohl einige Kenntnisse vonnöten sind. Das kann nicht jeder. Sie sind aber bereit, sich das mal anzusehen und Uber zu unterstützen.“
„Das können wir den Detectives morgen ja sagen“, sagte Libby. „Wir sollten vielleicht auch einen Aufruf an die Öffentlichkeit starten und herausfinden, ob es noch mehr Opfer gibt – falls die Detectives das nicht ohnehin längst getan haben.“
Damit war Julie einverstanden. Bis zum Feierabend sammelten sie ihre Ideen und Libby war froh, als sie sich endlich auf den Heimweg machten. Ihr Kopf fühlte sich leer an, während sie mit Julie nach Hause fuhr. Entsprechend erleichtert war sie, als sie angekommen war und die Haustür hinter ihr ins Schloss fiel. Niemand war zu Hause, nicht einmal Oreo. Libby öffnete die Terrassentür und rief draußen nach der Katze, die Augenblicke später auf der Mauer erschien und maunzend zu ihr kam.
„Da bist du ja“, sagte Libby und ging mit Oreo in die Küche, um sie dort zu füttern. Von Owen keine Spur.
Libby ging nach oben ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Sie zog eine bequeme Trainingshose an und setzte sich anschließend vor den Computer, um nach passenden Hosen zu stöbern. Sie brauchte unbedingt etwas, worin auch ein Babybauch noch Platz fand, vor allem auch für die Arbeit.
Sie war gerade mittendrin, als eine Nachricht von Owen auf ihrem Handy erschien. Es wird später heute, tut mir leid. Ich erzähle alles, wenn ich zu Hause bin.
Libby antwortete nur kurz, dass es kein Problem war, und setzte ihre Suche fort. Schließlich hatte sie eine Umstandsjeans, zwei Hosen fürs Büro und zwei Blusen ausgewählt. Nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben hatte, verließ sie das Arbeitszimmer und stemmte nachdenklich die Hände in die Hüften.
Sie würden umräumen müssen. Im Augenblick gab es ein Arbeits- und Gästezimmer und noch einen Trainings- und Hobbyraum. Das Gästezimmer wollte sie auf jeden Fall behalten, aber es würde ins Erdgeschoss wandern. Auch der Schreibtisch fand dann noch Platz darin. Aber was war mit den Sportgeräten?
Oben neben dem Schlafzimmer würden sie ein Kinderzimmer einrichten. Vielleicht fand der Boxsack Platz in der Garage? Und der Heimtrainer passte noch ins Arbeits- und Gästezimmer. Das war nicht perfekt, aber man konnte nicht alles haben. Sie wurden Eltern, und wenn ein Kind bei ihnen einzog, mussten sie umdenken.
Libby begann, am Laptop nach Hausgeburtshebammen in der Umgebung zu suchen. Sie fand einige und beschloss, eine Handvoll von ihnen anzuschreiben. Dafür war es inzwischen höchste Zeit, wie sie feststellte, denn viele hatten auf ihren Homepages angegeben, bis zum Jahresende bereits ausgebucht zu sein. Alternativ schaute sie sich ein Geburtszentrum an und war noch völlig in ihre Recherche vertieft, als die Haustür geöffnet wurde und sie das Klimpern eines Schlüsselbundes hörte. Sie schaltete den Rechner aus und ging zu Owen, der abgekämpft wirkte und gerade damit beschäftigt war, seine Schuhe auszuziehen.
„Hey“, begrüßte Libby ihn.
„Hey“, erwiderte er und umarmte sie. „Was für ein verrückter Tag. Wie war es bei dir?“
„Nicht verrückt, aber anstrengend.“
„Erzähl mal. Hast du schon gegessen? Ich sterbe vor Hunger. Heute Mittag war nur Zeit für einen Snack.“ Owen strebte gleich in die Küche und Libby folgte ihm. Sie beschlossen, ein schnelles Pastagericht zu kochen, und saßen zwanzig Minuten später zusammen am Tisch, wo Libby von ihrem Tag zu erzählen begann.
„Es gibt einen Serienvergewaltiger in Baltimore“, begann sie und berichtete von der Masche mit den Uber-Fahrten. „Ich hoffe, dass unser Profil der Polizei dabei hilft, die Täter zu fassen.“
„Zwei Täter? Das macht die Sache noch schlimmer, als sie sowieso schon ist. Und diese Masche mit Uber ist ziemlich gerissen, würde ich sagen. Wie bist du damit zurechtgekommen?“
„Einigermaßen“, sagte Libby. „Das ist so ein zweischneidiges Schwert – es ist die Hölle, sich mit solchen Fällen zu beschäftigen. Die absolute Hölle. Ich möchte eigentlich nichts weniger. Aber ich ertrage es auch nicht, zu wissen, dass solche Täter frei herumlaufen und ich kann dann nicht einfach nichts tun. Das geht nicht, das gehört zu meinem Job. Und wenn wir mal ehrlich sind, war ich auch schon vorbelastet, bevor ich zum FBI kam. Das habe ich auch immer gemeistert.“
„Aber jetzt fällt es dir schwerer“, sagte Owen. Libby merkte, dass er es nicht als Frage, sondern als Feststellung formuliert hatte, und protestierte auch nicht dagegen.
„Die Nachwirkungen sind andere“, sagte sie. „Damals war es einfacher, drüber wegzukommen, weil ich gar nicht so viel mitbekommen habe. Aber jetzt ...“
Owen ließ sein Sandwich sinken und umarmte sie. Als er nichts sagte, stutzte Libby.
„Alles okay?“, fragte sie.
„Ich bin einfach nur froh, dass du noch da bist. Dass ich dich nicht verloren habe. Im Gegenteil ... jetzt werden wir Eltern.“
„Das ist auch richtig so. Bailey bestimmt mein Leben nicht.“ Libby sah Owen an und gab ihm einen Kuss. „Was war denn heute bei dir los?“
„Ich war heute Morgen noch auf dem Weg nach DC, als Benny mich angerufen hat. Wir haben einen Doppelmord auf dem Tisch – verdammt unschön. Und bis jetzt fehlt uns jeder Ansatz.“
„Ein Doppelmord?“, fragte Libby und Owen nickte.
„Das war uns auch nicht von Anfang an klar. Arbeiter haben einen Toten im Gleisdreieck in Brentwood gefunden. Er wurde regelrecht exekutiert – er hatte ein Loch in der Stirn, also hat er seinem Mörder in die Augen geblickt.“
„Nicht schön“, sagte Libby.
„Nein, gar nicht. Es handelt sich bei ihm um einen Krankenpfleger aus dem Howard University Hospital. Wir haben dann getan, was man immer so tut und versucht, seine Angehörigen zu benachrichtigen. Er wohnte mit seiner Freundin zusammen, einer Kosmetikerin. Wir haben versucht, sie bei der Arbeit zu finden, wo man uns sagte, dass sie nicht erschienen ist. Sie hat auch nicht Bescheid gegeben. Da hatten wir schon so ein blödes Gefühl. Wir haben uns schnell einen Durchsuchungsbeschluss besorgt und sind in die Wohnung der beiden gegangen. Da haben wir die Frau dann gefunden – ebenfalls mit einem Kopfschuss exekutiert.“
Libby verzog das Gesicht. „Das ist ja furchtbar.“
„Ja, aber das ist nicht alles. Man hatte sie an einen Stuhl gefesselt, da saß sie immer noch. Geknebelt war sie auch. Wir warten jetzt auf die Autopsieergebnisse der beiden, um sagen zu können, wer zuerst gestorben ist.“
„Was vermutet ihr?“
„Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es nicht mal einen Unterschied. Unsere Annahme ist, dass es mehrere Täter waren, mindestens zwei. Die haben sich irgendwie Zutritt zur Wohnung verschafft und die Frau als Geisel genommen, um ihn zu kontrollieren. Worum es dabei gegangen ist – keine Ahnung. Beseitigt wurden beide, um Zeugen aus dem Weg zu räumen.“
„Ein Krankenpfleger und eine Kosmetikerin?“, fragte Libby. „Was kann da das Motiv sein? Hatte er Schulden? Kriminelle Kontakte?“
„Das werden wir jetzt ansetzen, so weit sind wir noch nicht. Wir haben heute mit den Familien der Toten gesprochen und waren auch schon an seinem Arbeitsplatz. Alle haben die beiden als nettes, unauffälliges Pärchen beschrieben.“
„Aber niemand erschießt einfach so ein nettes, unauffälliges Pärchen.“
Owen schüttelte den Kopf. „Nein, da hast du wohl Recht. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Jedenfalls weißt du jetzt Bescheid – es könnte diese Woche immer etwas später werden.“
Libby lächelte. „Kein Problem. Ich fahre morgen erst mal mit Julie nach Baltimore – wir wollen mit den betroffenen Frauen sprechen. Hoffentlich schaffen wir es bald, ein Profil für die beiden Vergewaltiger zu erstellen und sie zu schnappen. Das ist mir ein persönliches Bedürfnis!“
„Kann ich verstehen“, sagte Owen. „Ihr werdet sie kriegen, da bin ich ziemlich sicher.“
„Hoffentlich hast du Recht“, erwiderte Libby.
Mittwoch, 31. Mai
Libby hatte die Fahrt nach Baltimore übernommen, da sie sich dort besser auskannte. Schräg gegenüber vom Police Department stellten sie das Auto ab und betraten das Gebäude. Julie fragte nach Thompson und Garcia und keine zwei Minuten später erschienen beide unten im Foyer, um sie in Empfang zu nehmen.
Eric Thompson war ein annähernd zwei Meter großer Mann mit dunklem Haar. Frances Garcia wirkte neben ihm wie ein Zwerg. Sie war eine stämmige Latina, etwa einen Kopf kleiner als Libby, aber sie hatte einen kräftigen Händedruck.
„Schön, dass wir uns kennenlernen“, sagte Thompson. „Mit wem hatten Sie denn hier schon zu tun?“
„Oh, das war vor etwa zwei Jahren ... bitte fragen Sie mich jetzt nicht mehr nach Namen. Damals ging es um die Drogenrazzia im Hafen, bei der es zu dieser Explosion gekommen ist“, sagte Libby und Erkenntnis zeichnete sich auf Thompsons Gesicht ab.
„Daran erinnere ich mich. Damit hatte ich zwar nichts zu tun, aber ich kenne die Kollegen. Daran hat das FBI mitgearbeitet, das weiß ich noch.“
„Und die DEA“, sagte Libby.
„Ja, war eine große Sache. Was halten Sie davon, wenn wir gleich mit Kayleigh sprechen? Sie hat das Krankenhaus verlassen und ist noch zu Hause. Ich habe sie gestern schon mal vorgewarnt und sie wäre bereit, mit Ihnen zu reden“, sagte Thompson.
Libby und Julie waren einverstanden und verließen so das Büro mit den Detectives gleich wieder. Garcia setzte sich ans Steuer und Thompson bemühte sich, auf dem Beifahrersitz Platz zu finden.
„Wir müssen diese Typen stoppen“, sagte Frances, nachdem sie den Motor gestartet hatte. „Das ist so eine üble Masche ... Sexualdelikte sind ja unser täglich Brot, aber so eine perfide Nummer haben wir selten.“
„Das ist auch außergewöhnlich“, bestätigte Libby.
„Sie haben es vermutlich häufiger mit Mördern zu tun, oder?“
„Ja, das schon. Aber Sexualmörder haben wir auch öfter. Das ist immerhin der häufigste Serienmördertyp.“
„Was wir hier immer wieder haben, sind Morde in Folge einer Vergewaltigung, um die Tat zu vertuschen. Das ist so erschreckend sinnlos ... und macht erlittenes Unrecht noch schlimmer“, sagte Julie.
„Das ist wahr“, stimmte Thompson zu, bevor er sich zu Libby und Julie umdrehte. „Wir haben um Ihre Hilfe gebeten, weil so vieles an diesem Fall anders ist. Es kommt zwar vor, dass mehrere Täter an einer Vergewaltigung beteiligt sind, aber das sind dann eigentlich immer Gruppenvergewaltigungen. Ein Szenario wie dieses, bei dem zwei Täter gezielt losziehen, um gemeinsam eine Frau zu überfallen ... das ist ungewöhnlich.“
„Ist es. Kommt aber immer wieder vor“, sagte Julie.
Das Gespräch erlahmte, aber wenig später hatten sie auch schon ihr Ziel erreicht. Sie parkten vor dem Apartmenthaus, in dem Kayleigh wohnte, und Frances klingelte. Aus der Gegensprechanlage erklang die Stimme einer Frau und die Haustür summte, nachdem Frances erklärt hatte, wer dort war.
Das Apartmenthaus war in die Jahre gekommen und renovierungsbedürftig. Im Hausflur verunzierten Graffitis die Wände, es war zugig und kalt. Kayleighs Apartment lag im dritten Stock, die junge Frau erwartete sie an der geöffneten Tür. Sie trug ihr dunkelblondes Haar zu einem Zopf gebunden und hatte die Hände in der Fronttasche ihres Hoodies versteckt. Sie hatte die Schultern hochgezogen, ihr Blick wirkte leer.
„Guten Morgen“, begrüßte Frances sie. „Bitte entschuldigen Sie das Großaufgebot. Wir haben Unterstützung bei den Profilern des FBI angefordert, um diesen Tätern endlich beizukommen.“
Kayleigh nickte zaghaft und machte einen Schritt zurück. „Kommen Sie rein.“
Nacheinander betraten sie die Zweizimmerwohnung der jungen Frau. Libby schaute sich neugierig um und stellte fest, dass das kleine Apartment geschmackvoll eingerichtet war und sehr gemütlich wirkte.
„Bitte, nehmen Sie irgendwo Platz“, sagte Kayleigh. Es gab ein kleines Zweisitzersofa und einen Tisch mit zwei Stühlen. Thompson lehnte sich an die Fensterbank, die Hände in den Hosentaschen vergraben, während Julie und Frances sich an den Tisch setzten. Kayleigh ging zum Sofa, wo auch Libby Platz nahm.
„Wir müssen auch nicht alle hier sein“, sagte Frances schnell. „Uns haben Sie ja schon alles erzählt.“
„Ist schon okay“, sagte Kayleigh gleichmütig, während sie ihre Hände aus der Pullovertasche zog. „Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr.“
Ihre Handgelenke wiesen blutige Abschürfungen auf. Libby wusste nur zu gut, woher die kamen – von den Handschellen, mit denen die Männer sie gefesselt hatten. Kayleigh klemmte die Hände zwischen den Oberschenkeln ein und atmete tief durch.
„Mein Name ist Libby Whitman, ich bin mit meiner Kollegin Julie Thornton hergekommen, um noch mal von Ihnen persönlich zu hören, was am Wochenende passiert ist.“
Kayleigh nickte tapfer. „Wenn das hilft, diese Männer zu finden ...“
„Das ist unser Ziel. Das muss aufhören.“
„Ich muss immer denken, dass ich dumm war ... dass ich nicht zu ihm ins Auto hätte steigen sollen. Es war doch so offensichtlich, dass da was nicht stimmt!“
Libby schüttelte schnell den Kopf. „Nein, Kayleigh. Geben Sie sich nicht die Schuld für das, was man Ihnen angetan hat. Sie haben ein Recht darauf, sicher nach Hause zu kommen. Die haben Sie schlichtweg überlistet, und zwar sehr clever.“
„Ich hätte es einfach lassen sollen ...“ Unversehens brach Kayleigh in Tränen aus und schlug die Hände vors Gesicht.
„Ich weiß, wie Ihnen zumute ist“, begann Libby. „Glauben Sie mir, es wird besser. Haben Sie psychologische Unterstützung?“
„Haben wir ihr angeboten“, sagte Thompson, als Kayleigh nicht antwortete. „Wir haben eine Polizeipsychologin und Seelsorgerin, die viel Erfahrung mit Verbrechensopfern hat.“
Libby nickte anerkennend, denn sie fand es gut, dass die Polizei sich da so engagierte.
Kayleigh blickte auf. „Aber das macht nichts ungeschehen.“
„Das stimmt, aber es hilft, darüber zu reden“, sagte Libby. „Sich bewusst zu machen, dass man nichts falsch gemacht hat. Sie sind nicht für die Taten dieser Männer verantwortlich.“
„Ich hab mir wirklich nichts dabei gedacht ... ich habe mir schon oft ein UberShare gerufen. Uber ist so sicher, die Fahrer werden regelmäßig überprüft und sie sind immer nett und höflich ... Das war der Fahrer auch diesmal. Er wirkte nervös, aber ich dachte, das liegt daran, dass er eingesprungen ist. Ich habe ihm geglaubt ...“
„Trug er eine Kappe oder eine Sonnenbrille, als er ankam?“, fragte Libby.
„Eine Kappe“, sagte Kayleigh. „Deshalb habe ich sein Gesicht kaum erkannt. Seine Augen habe ich erst richtig gesehen, als er ... als er über mir war, später ...“
„Schon gut. Erzählen Sie einfach ganz ruhig und der Reihe nach“, versuchte Libby, sie zu ermutigen. Kayleigh bemühte sich, den Ablauf wiederzugeben und erzählte davon, wie sie ins Auto gestiegen und kurz darauf der zweite Täter zugestiegen war.
„Der hat mich so angestarrt. Dabei war mir wirklich nicht wohl. Passiert ist da erst mal nichts ... bis wir runter in den Hafen gefahren sind. Das war die völlig falsche Richtung. Als ich den Fahrer gefragt habe, wo er hinfährt, hat der Typ neben mir ein Messer gezückt und mich damit bedroht. Ich hatte Todesangst. Er hat mir die Klinge richtig an den Hals gedrückt, so dass ich mich nicht getraut habe, mich noch zu bewegen. Mit einer Hand hat er mir dann die Handschellen verpasst und kurz darauf haben sie vor einer Industriehalle gehalten. Sie sind ausgestiegen und haben mich aus dem Auto gezerrt. Als ich schreien wollte, hat mir der größere der beiden den Mund zugehalten ... dann sind sie mit mir in diese Halle gegangen. Ich hätte mir beinahe vor Angst in die Hose gemacht“, erzählte Kayleigh unter Tränen.
„Sie machen das großartig“, sagte Libby, um Kayleigh zu beruhigen.