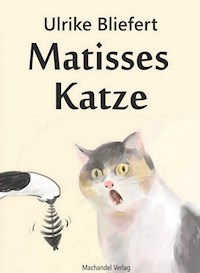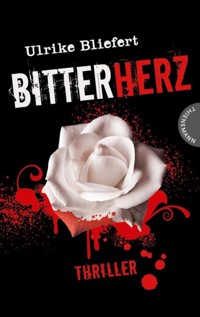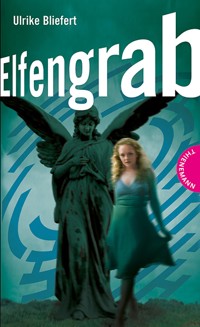Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Auguste Fuchs
- Sprache: Deutsch
Sein letztes Zauberkunststück Die Fotografin Auguste Fuchs ermittelt wieder Spiritistische Zirkel, Geisterfotos und Botschaften aus dem Jenseits haben im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts Hochkonjunktur. Als der Magier »Adolphe le Magicien« – bürgerlich Adolf Klingbeil – bei einer Bühnenprobe im Apollo-Theater von einem herabstürzenden eisernen Taubenkäfig erschlagen wird, darf die junge Fotografin Auguste Fuchs inoffiziell Fotos vom Tatort machen. Auf einem der Bilder scheint man ein seltsames Schattenwesen – nicht Mensch, nicht Tier – erkennen zu können. Augustes Foto sorgt für Furore, und im Nu ranken sich die abenteuerlichsten Theorien um Klingbeils Tod. Doch die offiziellen Ermittlungen führen Kommissar von Barnstedt und seinen Assistenten Jakob Wilhelmi, Augustes Verlobten, in die höchst diesseitigen Niederungen der Hauptstadt. Als von Barnstedt nur mit knapper Not einen Mordanschlag überlebt und dann auch noch Jakob verschwindet, muss Auguste einspringen – und tritt damit der besten Berliner Gesellschaft gehörig auf die Füße.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Die Samariterin
Der Tod der Schlangenfrau
Ulrike Bliefert, geb. 1951, ist Autorin und Film- und TV-Schauspielerin. Ende der 70er-Jahre wurde sie mit der Rolle der Maximiliane in den Literaturverfilmungen Jauche und Levkojen und Nirgendwo ist Poenichen bekannt. Sie wirkte bis heute in mehr als 40 Hauptrollen in Fernseh- und Kinofilmen, Serien und Reihen mit, u. a. in vier Tatort-Folgen und in den Krimiserien Der Bulle und das Landei und Morden im Norden. Neben umfangreicher Tätigkeit als Hörspiel- und Featuresprecherin arbeitet sie als Drehbuchautorin (u. a. Tatort Rückfällig), Bühnen- und Romanautorin. Sie veröffentlichte 2018 bei KBV den Thriller Die Samariterin und mit Der Tod der Schlangenfrau 2019 den ersten Band einer Krimireihe um die Fotografin Auguste Fuchs.
www.augustekrimi.de
ULRIKE BLIEFERT
DER TODDES TASCHENSPIELERS
EIN KRIMINALROMANAUS DER KAISERZEIT
Originalausgabe© 2021 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Umschlaggestaltung: Ralf KrampLektorat: Nicola Härms, RheinbachPrint-ISBN 978-3-95441-588-5E-Book-ISBN 978-3-95441-597-7
Ninne, Ninne, sauseder Tod steckt hinterm HauseEr hat ein kleines Körbeleinda steckt der die bösen Kinder ’neindie guten lässt er sitzenund kauft ihn’n rote Mützen
Deutsches Kinderlied 1895
Inhalt
Berlin, im Herbst 1896
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kurz vor Heiligabend 1896
Zum geschichtlichen Hintergrund
Die gab es wirklich
Dankeschön
BERLIN, IM HERBST 1896
Dem regnerischen Sommer des Jahres folgt ein ebenso unfreundlicher Herbst. Der Automobilverkehr auf den Straßen Berlins nimmt weiterhin zu, ungeachtet dessen, dass es im August in London das erste Todesopfer dieses neuen Fortbewegungsmittels zu beklagen gab, woraufhin der Duke of Beaufort in aller Öffentlichkeit forderte, man solle alle Autofahrer erschießen.
Als sich die Zeit der Großen Gewerbeausstellung im Treptower Park dem Ende zuneigt, wird Friedrich Maharero, dem Sohn des Oberhaupts der Herero – einer im heutigen Namibia ansässigen Ethnie –, die seit Langem erbetene Audienz beim Kaiser gewährt, und Wilhelm II. verspricht ihm und seinem Volk dauerhaften Frieden. Ein Versprechen, das er nicht halten wird.
Die Veranstalter der Gewerbeausstellung sehen sich mit einem gewaltigen Verlustgeschäft konfrontiert, der Bau der ersten Hochbahnstrecke vom Stralauer Tor zum Potsdamer Platz schreitet zur Begeisterung der technikversessenen Berlinerinnen und Berliner unaufhaltsam voran, die Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs beschränkt weiterhin – ungeachtet aller Proteste – die Rechte der Frauen, und am 1. Oktober wird da, wo sich früher der Kohlenplatz der Meierei Bolle befand, das neu gebaute Theater des Westens eröffnet.
KAPITEL 1
Im Grand Hôtel Bellevue am Potsdamer Platz servierte man an diesem Abend ein Hors d’œuvre mêlé, gefolgt von Seezunge à la Normande und in Butter gebratenen Krammetsvögeln.
»Ich hoffe, alles ist zu Ihrer Zufriedenheit.« Der Kellner präsentierte mit einer tiefen Verbeugung eine zweite Flasche Château Lafite. Die beiden Herren am Tisch signalisierten mit einem Kopfnicken, dass es keinen Grund zur Beanstandung gab, und widmeten sich weiter den Wacholderdrosseln auf ihren Tellern. Das kleine Mädchen in ihrer Begleitung starrte unverwandt auf die toten Vögel und rührte sein Besteck nicht an.
»Für das junge Fräulein vielleicht stattdessen ein wenig Kalbsrücken?«
»Ach was!« Der ältere der beiden Herren tätschelte dem Mädchen die Hand. »Lang zu, mein Kind. Sie schmecken köstlich! Und siehst du: Man lässt nur den Schnabel und den Magen übrig.« Zur Demonstration schob er beides mit dem Messer zur Seite und brach den zweiten kleinen Vogelkörper auf.
Das Mädchen würgte, presste die Hand vor den Mund, sprang auf und rannte hinaus.
»Kein Grund zur Aufregung, Herr Ober! Mein Kutscher wird sich um sie kümmern«, versicherte der jüngere der beiden Gäste.
Als der Kellner draußen nach der Kleinen Ausschau hielt, stand ein untersetzter Mann in Zylinder und Cutaway auf dem Trottoir und rauchte eine Zigarre. Das Mädchen war verschwunden.
»Verzeihung, haben Sie hier ein Kind rauslaufen sehen?«
»Keine Angst«, der Mann lächelte, »die Kleine sitzt da drin.« Er deutete mit dem Daumen auf einen geschlossenen Landauer. »Kleiner Übelkeitsanfall. Nicht weiter schlimm.«
Es hätte lediglich eines Blicks ins Wageninnere bedurft, um sich zu vergewissern, ob es dem Mädchen gut ging. Aber der Kellner zweifelte nicht an der Aufrichtigkeit des Kutschers und kehrte beruhigt an den Tisch der Herrschaften zurück.
Wenige Tage später ging es im Fotoatelier Fuchs in der Friedrichstraße hoch her: Ein Ehepaar mit vier Kindern hatte sich zu einem der üblichen Familienfotos eingefunden, und der muntere Nachwuchs ließ buchstäblich keinen künstlichen Stein auf dem anderen. Als Auguste unter das Dunkeltuch schlüpfte, um die Kamera auf das riesige, rot geblümte Familiensofa einzurichten, hörte sie es verdächtig knirschen. »Bitte nicht auf die Balustrade stei…« Zu spät: Das Pappmaché-Geländer, das sich bei Gartenarrangements immer so hübsch im Hintergrund machte, brach unter dem Ansturm zweier Knaben in Matrosenanzügen in sich zusammen, und als Auguste aus ihrem Einstelltuch auftauchte, machten sich die beiden Mädchen gerade über die Truhe mit den Vorhängen her und spielten in entsprechender Verkleidung Sultan und Haremsdame. Die Mutter stand von alldem ungerührt vor dem Spiegel und überprüfte zum wiederholten Mal ihre Frisur, während der Vater seine Bartspitzen zwirbelte.
»Ich wär dann so weit!« Auguste musste brüllen, um den Streit zu übertönen, der bei den Kleinen über die Benutzung des einzig vorhandenen Schaukelpferds entbrannt war. Der Vater versuchte es ein paarmal mit: »Thorwald, Humbert, hierher!«, doch das stieß auf ebenso wenig Echo wie der mütterliche Appell an Klein-Feodora und Klein-Albertinchen, sich aufs Sofa zu begeben. Auguste hätte die Eltern mitsamt ihren vier Ungeheuern am liebsten vor die Tür gesetzt. Der Lärm, den das Niederreiten der letzten Balustradenfragmente mittels Schaukelpferd, flankiert vom Geheul eines empörten Sultan-Haremsdamen-Duos, mit sich brachte, war unbeschreiblich.
»Wir kommen natürlich für den Schaden auf«, erklärte der Vater, zweifellos mächtig stolz auf seinen temperamentvollen Nachwuchs.
»Ihr könnt nachher weiterspielen, wenn das nette Fräulein die Bilder macht, auf denen Papa und ich alleine sind!«, tirilierte die Mutter, als der Sultanspalast erobert war, und scheuchte die Kinder in Positur. Nachdem Albertinchens Zöpfe hübsch parallel auf die Passe ihres Flügelkleidchens drapiert und Thorwalds Scheitel noch eben schnell mit mütterlicher Spucke fixiert worden war, hob Auguste die Blitzpfanne und betätigte den Auslöser. Auf dem Familiensofa sahen die Kinder ungemein manierlich aus.
Als das Elternpaar ohne die Kinder abgelichtet war, glich das Atelier einem Schlachtfeld. Auguste brachte gerade noch die Contenance auf, sich in aller Form von ihrer Kundschaft zu verabschieden, dann ließ sie sich auf das über und über keksbekrümelte Sofa sinken und freute sich auf ein paar ruhige Stunden im Labor.
Doch daraus wurde nichts.
»Jeht sofort weiter!«, verkündete Liftboy Luis, und Hulda Preissing stürmte aus dem Aufzug. »’n Toter, Häseken. Anruf kam gerade rein.«
Auguste schob die Unterlippe vor und stöhnte. Diesmal ausnahmsweise nicht, weil ihre ehemalige Kinderfrau sie trotz ihrer einundzwanzig Jahre immer noch »Häseken« nannte, sondern weil sie ahnte, was auf sie zukam.
»Wo?«
»Draußen in Rixdorf.«
»Puuuh …«
Bisher hatte sie sich um Post-mortem-Fotografien erfolgreich gedrückt, aber diesmal gab es wohl kein Entrinnen. Immerhin: Einen Versuch war es wert. »Kann Papa das nicht machen? Ich hab hier wirklich genug zu tun.« Auguste breitete demonstrativ die Arme aus. Das Durcheinander, das im Atelier herrschte, war bemerkenswert, aber Hulda ließ sich nicht erweichen. »Nee, mach du man die Leiche. Dein Vater soll in Ruhe Mittagsschläfchen halten.« Sie schickte sich bereits an, die ausgestopften Tiere, die Vorhänge, Decken und Deckchen und die in allen Größen vorhandenen Vasen mit Trockenblumen-Arrangements wieder ordentlich in der Requisitenkammer zu verstauen. »Die holen dich in knapp ’ner Viertelstunde ab. Mach hinne, Häseken!« Huldas Ton verriet, dass Widerspruch zwecklos war. Auguste stöhnte zwar noch einmal herzzerreißend auf, aber es nützte nichts; Hulda tat ganz einfach so, als habe sie nichts gehört, und im Grunde gab Auguste ihr recht.
Seitdem ihrem Vater immer öfter kleine Missgeschicke unterliefen, lag fast der gesamte Atelierbetrieb in ihren Händen. Es hatte mit harmlosen Vergesslichkeiten angefangen, doch mittlerweile war es lebensgefährlich, Julius Fuchs im Labor allein zu lassen, und im Laden erkannte er manchmal selbst seine Stammkunden nicht mehr. Augustes Cousin Gustav brannte darauf, als Kompagnon in die Firma aufgenommen zu werden, und er spekulierte nach wie vor – und unbeeindruckt von Augustes deutlicher Zurückweisung – auf eine Heirat: Er ging stur davon aus, dass bei seiner störrischen Cousine früher oder später die Vernunft über den weiblichen Unverstand obsiegen würde. Und infolge einer ewig waltenden göttlichen Ordnung würde er dann umgehend zum Alleininhaber aufsteigen, denn Ehefrauen hatten gemäß göttlichem Gesetz daheim zu bleiben, allzeit hübsch auszusehen und dem Gatten drei bis fünf wohlgeratene Kinder zu schenken. Abgesehen davon, dass Auguste davon überzeugt war, dass man Kinder nicht verschenken sollte, hatte sie nicht einmal während Pfarrer Rebmanns strengem Konfirmandenunterricht irgendeine Bibelstelle gefunden, die diese Thesen stützte. Außerdem hasste sie es, wenn Vetter Gustav ihr bei seinen Besuchen ungefragt den Arm um die Taille legte: Die Mischung aus Bartwichse und kaltem Zigarrenrauch, die ihn umwaberte, löste bei ihr regelmäßig Fluchtinstinkte aus. Und so hatte sie Gustavs schlecht getarntes Angebot, in Atelier, Labor und Laden auszuhelfen, ohne zu zögern abgelehnt. »Daraus wird nichts, selbst wenn Vetter Gustav lecker riechen und an Schönheit, Eleganz und Güte nicht zu übertreffen wäre«, hatte Auguste kategorisch erklärt. Von Huldas Seite gab es keinen Widerspruch, und auch wenn Julius Fuchs manchmal vergaß, was er vor zehn Minuten getan oder gesagt hatte: Dass Auguste bis über beide Ohren in jenen flotten jungen Mann verliebt war, der seit dem Sommer bei ihnen ein und aus ging, schloss selbstverständlich jede Einheirat von Gustavs Seite aus. An guten Tagen konnte Julius Fuchs sich sogar daran erinnern, wie Augustes Verehrer hieß: Jakob Wilhelmi! Und er war der Assistent von einem Kommissar mit Namen …
»Gustchen, wie heißt noch mal der Vorgesetzte von deinem Herzensschatz?«
»Von Barnstedt, Papa. Kommissar Hubert von Barnstedt.«
»Ja, natürlich! Lag mir auf der Zunge!«
Für Hulda und Auguste waren solche Dialoge an der Tagesordnung. Es war klar, dass es immer dringlicher wurde, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einzustellen. Nur leider blieben die Annoncen im Photographischen Wochenblatt bisher ohne das ersehnte Echo.
»War ’n Unfall.« Hulda riss Auguste gnadenlos aus ihren Gedanken und drückte ihr die Tasche mit Schminke, Fischleim und Knetwachs in die Hand. »Solltest zur Sicherheit ’n bisschen Tünche mitnehmen, muss ja schließlich hübsch aussehen, der Dahingeschiedene.«
Augustes Fantasie lief Amok. Bei dem Gedanken, eine Leiche zu schminken, drehte sich ihr schier der Magen um. Sie seufzte pro forma ein drittes Mal, aber natürlich blieb auch diesmal der Erfolg aus: Hulda war nicht zu erweichen. »Einer der Söhne holt dich ab. Emil heißt er.«
»Aha.« Auguste schulterte ihre Ausrüstung, grummelte etwas, das wie »Danke, Hulda« klang, und drückte auf den Fahrstuhlknopf. Ihr fehlte für das, was auf sie zukam, jedes Verständnis: Verstorbene so herzurichten, als seien sie lebendig und säßen friedlich lächelnd im Kreise ihrer Lieben? Eine ekelhafte Gepflogenheit! Einige Hinterbliebene ließen den Toten sogar im Fotolabor offene Augen aufmalen, um damit die Illusion, sie seien bei der Aufnahme noch am Leben gewesen, zu perfektionieren.
»Wo soll’s ’n hinjehn?« Wie immer musste Liftboy Luis minutiös über Augustes Vorhaben informiert werden.
»’ne Leiche fotografieren«, brummte Auguste, »und dafür muss ich raus nach Rixdorf.«
»Leuchtet ein«, Luis grinste verständnisinnig. »Wer doot is, kann ja nu mal nich mehr selber in ’t Atteljeh komm’, wa?«
»Na, bis vor ’n paar Jahren war das noch so.«
»Wat?« Luis riss entsetzt die Augen auf. »Willste mir uff’n Arm nehm’?«
»Nee, im Ernst!« Wider Willen musste Auguste lachen. »Aber natürlich sind die Toten nicht von alleine ins Atelier marschiert! Die wurden von ihren Angehörigen hergebracht, und Papa hat sie dann – also: die Leichen, nicht die Angehörigen – an speziell dafür angefertigten Eisengestellen festgeschnallt. Damit der Kopf oben blieb und die Toten aussahen, als würden sie aufrecht stehen.«
»Ehrenwort?« Der Liftboy starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an.
»Ich schwör’s!« Augustes Mundwinkel zuckten. »Das ging natürlich nur vor oder nach der Leichenstarre. Aber egal wie: Verwackeln konnten die jedenfalls nichts mehr.« Nicht zum ersten Mal sorgte Luis’ durch nichts zu bremsende Neugier dafür, dass Augustes Laune sich schlagartig besserte. »Gab außerdem noch ’n paar raffinierte Kniffs, wenn’s darum ging, so zu tun, als wär’n die gar nicht tot«, setzte sie feixend hinzu, »zum Beispiel den mit dem Sessel.«
»Erzähl.« Luis war inzwischen so blass geworden, dass man jede einzelne seiner Sommersprossen hätte zählen können.
»Dazu hat man die Leiche einfach auf’n Sessel gepackt und dann den Sessel mitsamt der Leiche umgekippt.«
»Wat?«
»Na, nicht geschubst! Sondern mit der Lehne nach unten auf’n Boden gelegt. Dann musste man die Toten nicht mehr festbinden, weil: Die bleiben logischerweise brav auf’m Rücken liegen. Nur die Beine und der Kopf mussten fixiert werden.«
»Und dann?«
»Dann hat man später die fertige Fotografie einfach um neunzig Grad gedreht.«
»Hä? Versteh ick nich.«
»Hochkant genommen und fertig.«
»Pfff«, Luis blies die Backen auf und ließ geräuschvoll die Luft entweichen, »na, da hab ick aber Schwein jehabt.«
»Du? Wieso?«
»Na, ick würd doch nie im Leben nich ’ne Leiche in mei’m Fahrstuhl ruff und runter kutschieren!«
»Musst du ja Gott sei Dank auch nicht.« Auguste versetzte Luis einen freundschaftlichen Knuff in die Seite und ging nicht weiter darauf ein. Es war nur zu verständlich, dass die schöne Schlangenfrau aus dem Wintergarten-Varieté für Luis nicht zu den anonymen Toten zählte, deren Transport er offenbar als Zumutung betrachtete. Samirah – oder bürgerlich: Charlotte Paulus – hatte bei ihrer Fahrt hinauf ins Atelier wahrscheinlich herzlich über Luis’ vorwitzige Art gelacht. Und als sie dann – exotisch gewandet und wunderschön – mit einer riesigen, gefleckten Schlange vor Augustes Kamera posierte, hatte Luis ihr geradezu weltvergessen zugeschaut. Tatsächlich hatte ihm der Anblick regelrecht die Sprache verschlagen.
Ein trauriges Lächeln huschte über Augustes Gesicht. Wenig später war die schöne Schlangentänzerin sterbend zusammengebrochen.
»Kleener, starr hier keene Löcher in die Luft«, hatte der ältere der beiden Sanitätsgehilfen Luis angeblafft, als sie die Totenbahre in den Aufzug schoben, »det Mädel muss so schnell et jeht in ’t Leichenkommissariat.«
Energisch schüttelte Auguste die Gedanken an die Geschehnisse und das, was ihnen gefolgt war, ab. Bevor sie aus dem Haus ging, steckte sie noch einmal sorgfältig ihren Hut fest und nahm den warmen Mantel von der Garderobe. Es war bewölkt. Auch wenn es durchaus noch einige sonnige Oktobertage gab, war es zu kühl, um – wie Hulda zu sagen pflegte – »per Taille« rauszugehen.
Draußen auf der Friedrichstraße herrschte die übliche Betriebsamkeit: elegant gekleidete Damen, müßige Flaneure, blasse Dienstmädchen mit unhandlichen Einkaufskörben und Reisende, die vom oder zum Bahnhof unterwegs waren. Auf der Fahrbahn ein fluchender Radfahrer, Kutschen, Hand- und Pferdewagen, dazwischen eine finster dreinblickende Bürstenmacherin im Hundekarren und vereinzelt Automobile, deren Besitzer eifrig von der Hupe Gebrauch machten. Ein Schutzmann hoch zu Ross überholte den wie immer voll besetzten Pferdeomnibus, begleitet vom Gejohle einer Gruppe angetrunkener Corpsstudenten auf dem Oberdeck.
Auguste hatte eine Droschke erwartet, doch der Junge, der sich ihr mit einem artigen Diener als Emil Krause vorstellte, deutete stattdessen auf einen Einspänner mit überdachter Ladefläche, der vor der Hofeinfahrt wartete. K. und A. Krause stand darauf, Kleintransporte aller Art.
»Wenn’s Ihnen nichts ausmacht, mit unserer Lastkarre zu fahren?« Der Junge drehte unsicher die Mütze in den Händen. Auguste schätzte ihn auf höchstens sechzehn. »Ich … ähm, ich wusst ja nicht, dass ’n feines Fräulein wie Sie die fotografischen Aufnahmen macht«, stammelte er verlegen.
»Keine Angst. Feine Fräuleins können das.«
»Ja … ähm … natürlich!« Emil wurde rot. »So hab ich das nicht gemeint.«
»Ich weiß.« Auguste stellte ihre Ausrüstung ab und schwang sich, ohne Emils hilfreiche Hand zu ergreifen, auf die schmale Holzpritsche, die für den einzigen Mitfahrer vorgesehen war.
»Kann aber holprig werden!« Der Junge zurrte das Stativ und den Kasten mit der Kameraausrüstung auf der Ladefläche fest und stieg zu ihr auf den Kutschbock. »Wolln Se nich vielleicht doch lieber ’ne Droschke nehmen?«
»Nö. Normalerweise wär ich mit dem Fahrrad gekommen. Das ist noch holpriger, das können Sie mir glauben.«
»Mit dem Fahrrad?« Emil warf Auguste einen ungläubigen Seitenblick zu; anscheinend passten Rad fahrende Frauen genauso wenig in sein Weltbild wie fotografierende feine Fräuleins. Doch wie es aussah, wollte ihn das feine Fräulein nicht zum Narren halten. Er murmelte ein anerkennendes »Schappoh«, tippte an den Rand seiner Mütze und griff nach den Zügeln. »Hüh, Gravelotte!«
Das Pferd setzte sich in Bewegung und reihte sich gemächlich in den Strom der anderen Verkehrsteilnehmer ein.
Die Richardstraße, in der die Krauses lebten, wirkte geradezu ländlich. Während im Rixdorfer Ortskern ein bürgerliches Mietshaus nach dem anderen entstand, hatte man hier das Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein: An das Backsteinhaus, in dem Emils Familie wohnte, grenzte eine Remise, in der die Fahrzeuge untergebracht waren, dahinter befanden sich die Pferdeställe und eine große hölzerne Scheune. Im Vorgarten blühten Sonnenhut und Herbstastern, und den Geräuschen zufolge musste sich in unmittelbarer Nähe eine Schmiede befinden. Wie praktisch, dachte Auguste.
»Brrr, Gravelotte!« Während Emil den Wagen anhielt und Augustes Ausrüstung ablud, öffnete eine rundliche kleine Frau die Haustür. Sie trug Schwarz und hatte verweinte Augen. Bei Augustes Anblick schien sie zunächst genauso irritiert zu sein wie ihr Sohn.
»Das ist das Fräulein Fuchs, Mama, die Fotografin«, beeilte sich Emil zu erklären.
»Oh! Verzeihung … Natürlich. Magda Krause.« Emils Mutter streckte Auguste zur Begrüßung beide Hände entgegen. »Schön, dass Sie da sind. Bitte, kommen Sie doch rein.«
Drinnen in der guten Stube war ein Kaffeetisch gedeckt, und es duftete nach frisch gebackenem Apfelkuchen.
»Wenn Sie hier Platz nehmen wollen?« Ein hagerer Mann mit großen Händen und verwittertem Gesicht schob Auguste einen Stuhl am Kopfende zurecht, und Magda Krause stellte ihr einen nach dem anderen die ganze Familie vor: »Mein Schwager Konrad und meine beiden jüngeren Söhne Achim und Theodor, meine Schwägerin Helene und ihre Tochter Emma, und auf dem Schoß von meinem Neffen Paul, das ist Karline, unser Nesthäkchen.«
Auguste hatte angesichts des leinenen Tischtuchs und des Sonntagsgeschirrs, das die Krauses zu ihrer Begrüßung hervorgeholt hatten, einen regelrechten Kloß im Hals. Sie schämte sich im Nachhinein für ihr vorschnelles Urteil. Die Menschen hier hatten einen lieben Angehörigen verloren, und die jüngsten Kinder würden sich ohne eine Fotografie später nicht einmal mehr an sein Gesicht erinnern können.
»Danke«, murmelte sie, als Magda Krause ihr ein Stück Apfelkuchen auf den Teller legte.
Wenig später erwiesen sich alle ihre Befürchtungen als ungerechtfertigt: Arnold Krause war bereits aufgebahrt. Der offene Sarg stand im rückwärtigen Teil des Hauses in einem Anbau, den man offenbar erst kürzlich hinzugefügt hatte. Die Familie scharte sich um den Katafalk, und zu Augustes grenzenloser Erleichterung musste nicht einmal die mitgebrachte Schminke zum Einsatz kommen, denn Gesicht und Hände des Toten waren unversehrt.
Auguste fotografierte. Wie sie aus dem Wenigen, das dabei gesprochen wurde, heraushören konnte, war Arnold Krauses Kutsche bei dem Unfall schwer beschädigt worden. Die Instandsetzung würde Wochen dauern, und das bedeutete erheblichen Verdienstausfall. Auguste beschloss, beim Honorar für ihre Arbeit diskret mit dem Preis ein wenig herunterzugehen. Als sie mit den Aufnahmen fertig war, schloss Emil gemeinsam mit seinem Onkel den Sargdeckel. »Dann würd ich Ihnen jetzt ’ne Droschke für den Rückweg bestellen, wenn’s recht ist.«
»Wir können aber auch gern wieder mit Ihrem Transportwagen fahren.«
»Ehrlich?« Emil Krauses Augen leuchteten auf. »Das ist ja großartig! Ich muss nämlich ganz bei Ihnen in die Nähe. Zum Apollo-Theater.«
Auguste schmunzelte. »In der Nähe« war übertrieben; das Apollo-Theater lag genau am entgegengesetzten Ende der Friedrichstraße, auf dem Weg zum Halleschen Tor.
»Von da aus ist es aber noch ’n ganzes Stück bis zu mir nach Hause.«
»Och, so ’n kleiner Umweg macht doch nichts. Und anschließend ist noch genügend Zeit bis zur Abendvorstellung.«
»Aha …?«
Emil musste unwillkürlich grinsen. »Nee, nich, was Sie denken! Ich steh da nicht auf, sondern hinter der Bühne.«
»Kulissenschieber isser«, mischte sich sein Onkel ein, »ganz und gar aus der Art geschlagen, der Bengel!« Er versetzte seinem Neffen einen scherzhaften Nasenstüber. »Aber aus der kleenen Fuchskreete wird bestimmt mal wat janz Besonderet.« Konrad Krause war unverkennbar mächtig stolz auf seinen Neffen. »Regissör will er werden! Unter dem macht er ’t nich!«
Eine erstaunliche Familie, dachte Auguste. Normalerweise würde so ein Berufswunsch als Hirngespinst abgetan, denn der älteste Sohn hätte selbstverständlich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Hier hingegen schien man Emils Ambitionen sogar zu unterstützen. »Regisseur also …«
Emil nickte und strahlte übers ganze Gesicht, und Auguste überlegte, was ein Regisseur eigentlich genau zu tun hatte. So richtig vorstellen konnte sie sich das nicht, aber der Junge gefiel ihr. Das Licht war günstig, und bevor sie ihre Ausrüstung zusammenpackte, fragte sie Emil, ob sie vielleicht ein paar Aufnahmen von ihm machen dürfte. »Wissen Sie, ich mag die üblichen steifen Atelierbilder nicht sonderlich. Da drauf gucken doch die meisten Menschen, als hätten sie was Schlechtes gegessen.«
»Stimmt!« Emil stellte sich bereitwillig in Positur.
»Aber wenn ich den Leuten vorschlage, sich doch lieber draußen in der Natur ablichten zu lassen, empfinden das die meisten als Zumutung.«
»Vielleicht, weil bei Ihnen im Atelier kein Wind weht.«
»Was?« Das war ein sonderbarer Gedanke. Auguste kam kurz unter dem Einstelltuch hervor: »Wieso?«
»Na, da kann es keinem die Frisur verstrubbeln, der Hut bleibt auf’m Kopf, und es gibt keine fliegenden Plagegeister, die die vornehme Pose stören könnten.« Emil schlug demonstrativ nach einer kampflustigen Wespe.
»Hm. Da ist was dran.« Auguste kroch nachdenklich wieder unter ihr Dunkeltuch. Ihr war es ein bisschen peinlich, dass sie nicht selbst auf eine derart einleuchtende Begründung gekommen war.
Bevor Auguste wenig später neben Emil auf dem Kutschbock Platz nahm, steckte ihr seine Mutter zwei große Stücke ihres köstlichen Apfelkuchens zu.
»Herzlichen Dank, Frau Krause! Die Bilder kann Emil dann morgen Mittag abholen.«
Als die brave Gravelotte sich ins Zuggeschirr legte und der Wagen über das Kopfsteinpflaster in Richtung Berlin zockelte, schaute Auguste sich noch einmal um und winkte. Die ganze Familie hatte sich zum Abschied vor dem Haus aufgereiht: Magda mit der kleinen Karline auf dem Arm, flankiert von den Zwillingen Achim und Theodor, daneben Konrad und Helene Krause mit ihrer Tochter Emma und dem kleinen Paul. Der Herbstwind blies die Blätter einer riesigen Kastanie über den Platz vor der Remise, und nur das rhythmische Schlagen des Schmiedehammers durchbrach die Stille. Im Nachhinein stellte Auguste fest, dass sich ihr dieser Anblick für immer ins Gedächtnis gebrannt hatte: ein Bild des Friedens. Nur Emil Krause fehlte.
KAPITEL 2
Nu stell’n Se sich man nich so an, Wilhelmi!« Kommissar von Barnstedt drückte seinem Untergebenen einen Karton mit kleinen, weißen Pappkärtchen in die Hand und hielt das gläserne Tintenfass gegen das Licht, um dessen Füllmenge zu prüfen. »Sie kennen sich doch bis in alle Einzelheiten mit dem Schlangenfrau-Fall aus. Also wer sonst könnte die entsprechenden Exponate bestmöglich katalogisieren und beschriften?«
»Aber …«
Jakob Wilhelmi starrte ungläubig auf den Inhalt eines Wäschekorbs, den der neue Polizeisekretär vor wenigen Minuten ins Büro gebracht hatte: wild durcheinandergewürfelte Gegenstände, Notizzettel und Zeitungsartikel. »Kann das nicht Mielke machen?«
Von Barnstedt quittierte Jakobs mangelnde Begeisterung mit einem Achselzucken. »Polizeisekretär Mielke muss sich erst noch einarbeiten. Außerdem haben Sie die schönere Schrift.«
»Das mag ja sein. Nur …«
»Im Moment gibt’s sowieso nichts zu tun. Und Sie sind doch sonst für alles Moderne.«
»Was hat denn das damit zu tun?«
»’n hausinternes Kriminalmuseum hat in Deutschland schließlich niemand außer uns hier in Berlin!«
»Schön und gut, aber …«
»So was Fortschrittliches hat nicht mal Scotland Yard!«
»Aber ich bin Kriminalassistent und kein Archivar!«
»Na, wenn Sie das hier sehen, überlegen Sie sich Ihre Berufswahl vielleicht noch mal.« Von Barnstedt nahm mit einem triumphierenden »Taddah!« einen Gegenstand aus seiner Gladstone-Tasche.
»Aha?« Jakob zuckte mit den Achseln: Dem schweren, schwarzen Eisending war keinerlei sinnvolle Bestimmung anzusehen.
»Einer von Graf Teubnitz’ Neffen hat mir das geschenkt. Zum Ausprobieren, sozusagen.« Dass ihn jemand aus den hehren Kreisen seines Herrenclubs eines Geschenks für würdig erachtet hatte, kam für von Barnstedt offenbar einem Ritterschlag gleich. Das Ding sah allerdings nicht gerade kostbar aus.
»Und was soll das sein?«
»Ein Handperforator!«
»Ach?« Jakob grinste. Mittlerweile fand er das aufgeregte Federnspreizen seines Chefs amüsant. »Und wozu sollte jemand freiwillig seine Hand perforieren?«
»Nu stell’n Se sich man nich dümmer, als Sie sind, Wilhelmi! Gucken Sie mal!« Von Barnstedt griff nach einem Blatt Papier, schob es in einen Schlitz im unteren Teil der Eisenkonstruktion und drückte auf den darüberliegenden Hebel. »Voilà!«