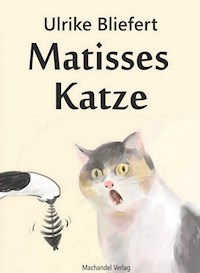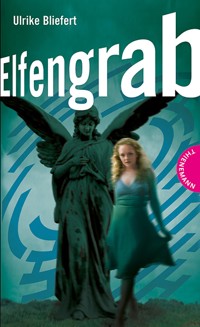Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: KBV-Krimi
- Sprache: Deutsch
Sie pflegt. Sie hilft. Doch sie kann auch anders … In einem alten Forsthaus am Rande der Eifel verzichtet die Krankenschwester Susanne Kleinschmitt auf ein eigenes Leben. Sie pflegt ihre Mutter – eine bösartige Frau, unter deren Tyrannei sie seit ihrer Kindheit leidet. Susanne ist die sprichwörtliche Samariterin, selbstlos, still, unsicher. Doch dann, ebenfalls aus dem Wunsch heraus zu helfen, beginnt sie einen Briefwechsel mit dem Häftling Andreas Vogel, der in der JVA Diez einsitzt. Den Briefen folgen schon bald Besuche, aus Zuneigung wird schließlich Liebe. Vogel könnte bei günstiger psychologischer Beurteilung vielleicht schon bald die Freiheit wiedererlangen. Es hat den Anschein, dass sich Susannes Leben ganz unerwartet zum Positiven verändert. Ist dies die Chance auf das Glück, das Menschen wie sie niemals für sich zu beanspruchen wagen? Doch dann tut sich plötzlich ein Abgrund auf, als sie etwas herausfindet, das sie niemals hätte entdecken dürfen … Ein äußerst raffiniert gewobener Thriller um Manipulation, Selbstzweifel und die Suche nach der Schuld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike Bliefert, geb. 1951, ist eine beliebte Film- und TV-Schauspielerin. Ende der 70er Jahre wurde sie mit der Rolle der Maximiliane in den Literaturverfilmungen Jauche und Levkojen und Nirgendwo ist Poenichen bekannt.
Sie wirkte bis heute in mehr als 40 Hauptrollen in Fernseh- und Kinofilmen, Serien und Reihen mit, u. a. als Täterin, Ermittlerin, Hauptverdächtige und Zeugin in vier Tatort-Folgen, in der Eifelkrimi-Reihe Der Bulle und das Landei und der Krimiserie Morden im Norden.
Neben umfangreicher Tätigkeit als Hörspiel- und Featuresprecherin arbeitet sie als Drehbuchautorin (u. a. Tatort Rückfällig), Bühnen- und Romanautorin. Sie veröffentlichte eine Jugend-Thriller-Reihe, sowie diverse Kurzkrimis in Anthologien.
ULRIKE BLIEFERT
DIE
SAMARITERIN
THRILLER
Originalausgabe
© 2018 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von: © PinkShot - Fotolia.com
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-435-2
E-Book-ISBN 978-3-95441-445-1
Strafvollzug war und ist der Versuch,an Menschen, die man kaum kennt,unter Verhältnissen, die man wenig beherrscht,Strafen zu vollstrecken,um deren Wirkung man nicht viel weiß.
Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung(Prantls Blick vom 22. Juli 2018)
Inhalt
Über den Autor
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
DREI MONATE SPÄTER
WAS NOCH ZU SAGEN BLEIBT
KAPITEL 1
Es gibt Menschen, die schnarchen geradezu lieblich: sanft schnarrendes Einatmen, gefolgt von einem genussvoll entspannten Püüü oder Pfüüü; beide Sequenzen etwa gleich lang und beinahe ohne Pause aufeinander folgend: Genussschnarcher, mit schönen Träumen. Aber die waren in der Klinik eindeutig in der Minderzahl. Nach unzähligen Nachtschichten waren Susanne Kleinschmitt sämtliche anderen Varianten vertraut: Stressschnarcher zum Beispiel wirkten selbst im Tiefschlaf noch gehetzt, als gäbe es furchtbar Wichtiges, Unaufschiebbares zu erledigen: ein dumpfes Knarzen wie von einer schweren Eichentür, dann eine mitunter beängstigend lange Pause – unter zehn Sekunden Atemstillstand gab es jedoch keinen Anlass zur Sorge –, dann ein knappes, arrogantes Ph!
Die Einschüchterungsschnarcher übertrafen alle anderen in Sachen Lautstärke und Kontinuität. Sie demonstrierten Dominanz und Kompetenz, ganz im Sinne jener Theorie, dass das Schnarchen einst dem Verscheuchen wilder Tiere gedient und somit der Menschheit das Überleben gesichert habe. Das Ausatmen erfolgte bei ihnen meist geräuschlos, damit der nächste Schnarcher umso wirkungsvoller in Szene gesetzt werden konnte.
Mutti war Ekelschnarcherin. Ihr Einatmen erinnerte an das Geräusch, mit dem manche Männer ihren Nasenschleim zu komprimieren pflegen, um ihn anschließend auf die Straße zu spucken. Meist folgte auf Muttis Einatmer eine längere Pause – Susanne zählte jedes Mal die Sekunden –, und beim Entweichen der Atemluft entstand ein blubberndes Geräusch. Mitunter bildete sich dabei eine kleine Speichelblase, die nach kurzer Zeit mit einem »Plitsch!« zerplatzte.
Susanne Kleinschmitt stellte ihrer Mutter eine Thermoskanne mit Hagebuttentee und einen Teller mit Schinkenbrötchen und Essiggurken auf den Nachttisch.
»Mutti, brauchst du noch was?«
»Samstags hast du noch nie Spätschicht gehabt.«
Ich hab auch heute keine, aber das werd’ ich dir nicht auf die Nase binden.
»Ich bin für Katja eingesprungen, das ist die Schwangere, weißt du? Die, die letztes Jahr unseren Physiotherapeuten geheiratet hat. Micha heißt er.«
Glatt gelogen.
»Ich will Bier.«
»Gleich, Mutti.«
Bier macht das Ganze noch schlimmer. Irgendwann krieg ich den Uringestank beim besten Willen nicht mehr raus.
Susanne nahm ein Bier aus dem Kühlschrank und brachte es – zusammen mit Flaschenöffner und Glas – ins Zimmer ihrer Mutter.
Früher hatte der Raum als Esszimmer gedient, mit einem Ausziehtisch und sechs Stühlen in der Mitte. Eine sinnlose Möblierung, denn außer Pfarrer Beckmann kam nie jemand zu Besuch.
Als Mutti nicht mehr in den ersten Stock hoch konnte, hatte Susanne den Eichentisch und die Polsterstühle in den Keller gebracht und das Zimmer zum Krankenzimmer umgestaltet, obwohl Mutti damals noch gar nicht krank war. Sie zog es einfach vor, im Bett zu bleiben. Raucherbein. Die Prothese lag ungenutzt im Kleiderschrank. Und irgendwann war Mutti so dick geworden, dass sie ohne Hilfe kaum noch aufstehen konnte. Oder wollte.
Gertrud Kleinschmitt biss in ihr Schinkenbrötchen, kaute und musterte ihre Tochter missbilligend von oben bis unten. »Seit wann donnerst du dich für den Dienst so auf?«
Susanne wurde rot. »Das Kleid hab ich doch schon seit dreieinhalb Jahren. Hab’s nur noch nie angezogen.«
Auch gelogen. Aber egal.
Ihre Mutter gab einen abschätzigen Schmatzlaut von sich. »Bei deinen schrohen Knien solltest du besser nur Hosen tragen.«
Susanne rollte den Toilettenstuhl neben das Bett und schlüpfte in ihren Anorak. »Tschüss, Mutti. Bis dann.«
Das Fahrrad stand vor der Tür, gleich neben der Treppe. Unabgeschlossen. Hierhin kam ohnehin kein Mensch. Siebenhundert Meter Mischwald bis zum nächsten Wanderpfad: Privatweg! Durchgang und Durchfahrt verboten!
Das Haus war der Preis dafür, dass Gertrud Kleinschmitt bei Susannes Geburt nicht wahrheitsgemäß »Vater: Wolfgang Thelen«, sondern »Vater unbekannt« angegeben hatte. Ein uneheliches Kind wäre dem Image des traditionsreichsten Mayener Bestattungsunternehmens nun mal mehr als abträglich gewesen. Als Wolfgang Thelens Vater das Haus diskret auf Gertrud Kleinschmitt überschreiben ließ, hatte es bereits mehr als ein Jahrzehnt lang leer gestanden. Ein weißes, villenähnliches Gebäude mit Schieferdach, erbaut um die Jahrhundertwende, in Ausmaß und Ausstattung dem Zeitgeist Rechnung tragend. Nach dem Kriegsende hatte es für einige Jahre das Forstamt beherbergt: acht Zimmer, drei Mansarden, Keller, Waschküche, Vorratsraum, Balkon und Terrasse, dazu eine Küche in Gutshausformat und drei Bäder. Viel zu viel Platz für eine junge Mutter mit Kind, aber weit genug abgelegen, um Gertrud Kleinschmitt der Mayener Gerüchteküche zu entziehen. Als Gegenleistung hatte sie sich bereit erklärt, auf Kindesunterhalt zu verzichten. Lebenslänglich.
Beherzt trat Susanne Kleinschmitt in die Pedale.
Bestimmt wird Stefan kommen.
Stefan Stühn. »Streberleiche« hatten die anderen ihn gerufen, aber Susanne hatte ihn verehrt. Glühend.
Er war der Klügste in der Klasse.
Eigentlich hatte Susanne das neue, taubenblaue Seidenkleid nur seinetwegen gekauft.
Ich hätt mir eine passende Jacke dazu besorgen müssen. In Grau oder Beige. Der grüne Anorak passt überhaupt nicht dazu.
An ihrer ehemaligen Schule angekommen, klemmte Susanne den Anorak auf den Gepäckträger und stellte das Rad genau an der Stelle ab, an der sie es auch damals immer abgestellt hatte.
Auf dem Pausenhof schlug ihr ehemaliger Sportlehrer gerade ein Fass an. »Hallo! Schön, dass Sie gekommen sind. Marianne, nicht wahr?«
»Susanne«, korrigierte Susanne, »guten Abend, Herr Wirtz.«
»Bierchen?«
»Gern.«
Susanne stürzte in rascher Folge zwei Gläser eiskaltes Bitburger herunter und versuchte, in den Gesichtern der anwesenden Enddreißiger die Schulkameradinnen und Schulkameraden von damals wiederzuerkennen. Die mit den unnatürlich weinroten Haaren und dem viel zu engen Blazer musste Bettina sein.
Bettina Kersten. Die hat sich schon damals für nichts als Mode und Schminken interessiert.
Und der hochgewachsene Blonde mit Stirnglatze und Designerbrille war eindeutig Stefan.
»Stefan?«
Er saß mit Michaela Dornbusch zusammen an einem der Biergartentische und fummelte an seinem iPhone herum.
Als Susanne an den Tisch trat, blickte er nur kurz auf. »Ach. Grüß dich.«
Michaela Dornbusch sagte »Hi«, ohne den Blick von Stefans iPhone zu wenden. »Toller Strand.«
Susanne wurde rot. »Ich wollte nicht stören.«
»Ach was! Setz dich doch.«
Das Seidenkleid klebte an ihren Oberschenkeln.
Hätt ich doch bloß ’nen Unterrock druntergezogen!
»Wie alt ist er denn jetzt?« Michaela wischte auf dem iPhone herum und schaute immer noch nicht hoch.
»Finn? Dreieinhalb. Geht ab nächsten Herbst in den Kindergarten. Silke will auf jeden Fall wieder halbtags arbeiten.«
»Versteh ich gut! Ging mir genauso damals.«
Dieses Lachen von der Dornbusch. Aufdringlich. Genau wie früher.
Michaela Dornbuschs Lachen ging in kokettes Kichern über. »Gott, ist der süß! Willst du auch mal sehen?« Sie reichte Susanne das iPhone und wandte sich dann wieder Stefan zu.
Das Foto zeigte einen auffallend hellblonden kleinen Jungen, der umgeben von bunten Plastikförmchen im Sand buddelte.
»Das ist unser kleiner Finn.«
Susanne lächelte tapfer.
Ich muss jetzt irgendwas Nettes sagen …
»Finn? Schön. Passender Name.«
»Was?«
»Finn. Das kommt doch aus dem Gälischen. Fionn. Das heißt ja blond oder sehr hell.«
»Quatsch!« Stefan lachte. »Finn kommt aus dem Schwedischen und heißt ganz einfach der Finne oder die Finnin.«
»Aber bei uns auf der Station war mal eine Schottin, und die hat gesagt …«
Stefan winkte ab. »Jaja. Andere behaupten, der Name würde aus dem Altgriechischen stammen. Von Phineas abgeleitet. Aber …«, er lachte erneut, »aber das ist genauso bescheuert. Das heißt nämlich dunkel oder braun!«
Michaela Dornbusch fand das offenbar unglaublich lustig.
Ich wollte doch nur was Nettes sagen …
»Ich verstehe.« Susanne nickte beschämt. Als ihr Tränen in die Augen schossen, senkte sie den Blick. Am Tisch entstand eine unbehagliche Stille.
Ich hätte den Mund halten sollen.
Schließlich brach Michaela das Schweigen. »Und du, Susanne? Mann? Kinder?«
»Weder noch.«
»Na, was nicht ist, kann ja noch werden.«
Michaela und Stefan saßen jetzt so eng beieinander, dass ihre Schenkel sich berührten.
Hemmungslos. So war die Dornbusch schon immer.
Auf der Mädchentoilette gab Susanne das Bier und die Reste des Abendbrots von sich und presste sich anschließend die Hand vor den Mund, um das aufsteigende Schluchzen zu unterdrücken. Unter den Armausschnitten ihres neuen Seidenkleides hatten sich dunkle Schweißflecken gebildet.
Oh Gott! Bestimmt haben das alle gesehen.
Sie zwang sich dazu, gleichmäßig und tief durchzuatmen. Die letzte Magenkontraktion brachte nur noch Galle hervor.
Rechts und links klappten Türen, und die Klospülung rauschte in beinahe regelmäßigen Abständen. Im Vorraum Gekicher, Gesprächsfetzen und das Brummen des Händetrockners.
Als Susannes Magen sich beruhigt hatte, zog sie das hochgerutschte Kleid zurecht und durchsuchte ihre Tasche nach einem Pfefferminzbonbon.
»Suse?«
Susanne schrak zusammen. So hatte sie seit zwanzig Jahren niemand mehr genannt.
»Suse, kann ich dir irgendwie helfen?«
»Nein nein, alles bestens.«
Die Stimme war niemandem zuzuordnen, jedenfalls nicht, ohne das dazugehörige Gesicht zu sehen.
»Na gut. Ich warte hier auf dich, und wenn du wieder okay bist, gehen wir zusammen zurück zu den anderen, ja?«
»Aber … Wieso …?«
»Hab mit halbem Ohr mitgekriegt, was an eurem Tisch abgelaufen ist. Bei mir am Tisch dasselbe in Grün. Kinder, Küche, Kirche. Wie in den Fifties. Ätzend, oder?«
Susanne schwieg.
»Suse? Geht’s wieder?«
Die Stimme der Frau klang tief und rau. Beinahe maskulin.
Vielleicht ’ne Lesbe. Oder Kettenraucherin.
»Du brauchst nicht auf mich zu warten. Ich komm schon zurecht.«
»Ach, weißt du was? Ich fahr dich nach Hause!«
Susanne suchte fieberhaft nach einem Grund, das Angebot abzulehnen.
Was soll ich der Frau sagen? Dass ich Mutti was von ’ner Spätschicht vorgeflunkert hatte und dass ich deshalb auf keinen Fall vor Mitternacht nach Hause kommen darf?
»Ich weiß nicht …«
»Wenn du willst, können wir auch woandershin gehen.«
»Ist das ’n neues Partyspiel oder kann man hier mal pinkeln?« Eine zweite, bedeutend jüngere Stimme.
»Hey, immer mit der Ruhe, ja? Meiner Freundin ist nicht gut.«
Meiner Freundin …
»Moment! Sofort!« Susanne schob sich ein weiteres Pfefferminzbonbon in den Mund und öffnete die Tür.
»Na endlich!« Eine etwa fünfzehnjährige Schülerin, die am heutigen Abend mit Mitschülern das Bewirten der Ehemaligen übernommen hatte, drängelte sich an Susanne vorbei ins Innere der Toilettenkabine. Sie nahm sich nicht einmal die Zeit, den Riegel vorzuschieben.
Die Frau, die an die Waschbeckenreihe gelehnt auf sie wartete, hatte Susanne noch nie zuvor gesehen: kurze, exakt geschnittene schwarze Haare, weißes T-Shirt, Blue Jeans.
Sehr burschikos. Lange Beine.
Die Frau trug eine schwarze Lederjacke über dem Arm.
Kein Trauring.
Angesichts der sorgfältig manikürten, rot lackierten Fingernägel ließ Susanne reflexartig die Hände in die Taschen ihres Seidenkleides gleiten. Sie hatte es noch nie geschafft, ihren Nägeln eine einigermaßen ansehnliche Form zu geben. Ihre Mutter hatte behauptet, man müsse die Monde sehen. Als sie klein war, hatte sie ihr die Nagelhaut zuerst mit der Schere weggeschnitten und dann das rohe, blutende Fleisch mit einem Metallspatel nach unten geschoben. Immer und immer wieder. Genützt hatte es nichts.
»Ich hab erst während der Schwesternausbildung erfahren, dass diese halbrunden weißen Stellen unten an den Fingernägeln bei manchen Menschen ganz einfach nicht zu sehen sind.«
Oh Gott! Hab ich das eben etwa laut gesagt?
»Suse? Alles okay?«
»Ja. Danke.«
Susanne nahm ein paar tiefe Züge Leitungswasser. Die Frau reichte ihr ein Papiertaschentuch. »Wetten? Du überlegst die ganze Zeit fieberhaft, wo du mich hinstecken sollst, was?«
Susanne fühlte sich ertappt und wurde rot.
»Evelyn«, sagte die Frau, »oder besser: Ev. Ev Meinecke. Ich war in der Parallelklasse, und in der Oberstufe hatten wir zusammen Reli.« Sie tippte auf ihren Nasenrücken. »Die kennst du noch mit Höcker. Na? Fällt jetzt der Groschen? Evi-mit-der-Adlernase?«
Susanne nickte, nicht ganz aufrichtig. Es hatte eine Evelyn im Religionsunterricht gegeben. Aber die lässig-elegante Schwarzhaarige mit der rauen Stimme hatte in ihren Augen keinerlei Ähnlichkeit mit dem langen, dünnen Mädchen, das drei Jahre vor dem Abi an die Schule gekommen war.
Evelyn Meinecke lächelte. »Pfefferminztee oder eiskalte Cola und Salzstangen?«
»Was?«
»Gegen verdorbenen Magen.«
»Och, geht schon wieder.«
»Na dann: Löffels Landhaus oder Alte Mühle?«
Zwei Stunden später hatte Susanne alles über Evelyn Meinecke erfahren. Dass sie Psychologie studiert hatte und in der JVA Diez als Therapeutin arbeitete, dass sie sich gerade eine Eigentumswohnung in Vallendar gekauft hatte, in der sie allein lebte, dass sie sich noch nie Kinder gewünscht hatte und dass sie definitiv keinen Mann fürs Leben brauchte.
»Ab und zu ein kleines Affärchen«, hatte sie vertraulich erklärt. Dann hatte sie lachend »Man gönnt sich ja sonst nichts« hinzugefügt und Susanne kumpelhaft in die Rippen geboxt.
Also doch keine Lesbe. Aber vielleicht lügt sie mir auch einfach was vor.
Um zehn nestelte Susanne ihr Handy aus der Handtasche und rief – wie immer um die Zeit – zu Hause an. »Hallo, Mutti, alles in Ordnung?«
Mutti war außer sich. »Dr. Flemming hat angerufen wegen der OP morgen früh. Ich hab gesagt, du bist auf Station!«
»Mutti, ich …«
Susanne begann schon während des aufgebrachten Monologs ihrer Mutter, ihren Anorak von der Garderobe zu holen und hineinzuschlüpfen: Sie hatte gelogen, und Mutti war zu Recht böse.
Aufregung ist Gift für sie. Wegen ihrem Blutdruck. Und überhaupt.
»Ich bin in ein paar Minuten zu Hause!«
Evelyn winkte die Kellnerin herbei und wehrte Susannes Versuch, ihren Anteil an der Rechnung zu bezahlen, mit einer energischen Handbewegung ab.
»Warum lässt du dich denn dermaßen gängeln?«, fragte sie kopfschüttelnd, als sie im Wagen saßen und in Richtung Kürrenberg fuhren.
»Mutti meint das nicht so …«
Wie sollte Susanne das alles in ein paar Sätzen erklären? Ihre Mutter war nun mal bettlägerig: tagein, tagaus mal auf der linken, mal auf der rechten Seite, weil ihr in Rückenlage das Atmen schwerfiel.
»Na ja, geht mich ja auch nichts an.« Evelyn zuckte mit den Achseln und bog, Susannes Anweisung folgend, in einen holprigen Waldweg ein. Als sie am Alten Forsthaus ankamen, schaltete der Bewegungsmelder die Außenbeleuchtung an. Evelyn war einen Moment lang buchstäblich sprachlos. »Was? Hier wohnst du?«
»Ja. Mutti hat das Haus … geerbt.«
»Und ihr beide wohnt hier ganz alleine?«
Susanne hob ihr Fahrrad aus dem Wagen und stellte es neben der Treppe ab. »Ja. Schon immer.«
»Wahnsinn!«
Evelyn musterte ungläubig die vielen Fenster in der schneeweißen Stuckfassade. Bei Nacht, im bläulichen Licht der Außenlampen, sah man die Risse und Ausblühungen nicht.
»Das muss doch weit über ’ne Million wert sein.«
»Kann sein.«
Susanne kramte umständlich ihren Schlüssel hervor.
Es wäre das Natürlichste von der Welt, sie noch auf n Kaffee oder ’ne Apfelschorle reinzubitten. Aber das kann ich nicht machen. Auf keinen Fall!
»Danke fürs Bringen, Ev. Und für die Einladung.«
»Tja, dann …« Evelyn machte keine Anstalten, wieder in den Wagen zu steigen.
Betretenes Schweigen. Susannes Kehle war wie zugeschnürt.
Mutti wird eingekotet haben. Das macht sie immer, wenn sie böse auf mich ist.
»Ich würde dich ja noch reinbitten, aber …«, stammelte sie schließlich, ohne zu wissen, was sie als Begründung dafür vorschieben sollte, dass sie genau das nicht tat.
Evelyn lächelte, legte ihr den Arm um die Schultern und zog sie kurz an sich. »Schon gut. Ist ja auch schon spät.« Sie beugte sich ins Wageninnere, griff ins Handschuhfach, drückte Susanne eine Visitenkarte in die Hand und gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
»Ciao!«, sagte sie, »bis bald!« Dann wendete sie den Wagen und fuhr winkend davon.
Reflexartig fuhr Susannes Hand zu der Stelle, an der Evelyn sie geküsst hatte.
Keine Angst. Das hat nichts zu bedeuten, das macht man heute so.
Sie rührte sich nicht von der Stelle, bis die roten Strahlen der Rücklichter von der Dunkelheit verschluckt wurden.
»Susanne?!«
Der Gestank im Flur war eindeutig und gab Susanne im Nachhinein recht.
Mutti ist mit Recht böse auf mich. Und ins Bett zu machen, ist nun mal ihre einzige Waffe.
»Gleich, Mutti!«
Menschen wie Evelyn verstehen so was nicht.
Einen Moment lang zögerte Susanne, dann zerknüllte sie Evelyn Meineckes Visitenkarte und warf sie in den Papierkorb.
Ich könnte sie sowieso niemals hierher einladen.
»Susanne!!!«
»Ich bin sofort bei dir!«
Niemand. Ich kann niemanden jemals hierhin einladen …
»Nicht, solange sie lebt.«
»Red lauter! Ich versteh’ kein Wort!«
»Ich komm ja schon, Mutti.«
AZ 45329/C23
Transkript des Mitschnitts der Vernehmung
(vgl. Vernehmungsprotokoll)
Elke Peters
53945 Blankenheim
Im Eschenhölzchen 8 a
Also, ich war ja mit dem Fahrrad unterwegs. Richtung Leudersdorf, weil: Da wohnt ’ne Freundin von mir. Das war so um zwei oder drei nachmittags. Und auf’m Weg dahin hab ich mal austreten müssen.
Und da bin ich dann ’n paar Meter weit rein in ’n Wald, weil: Ich wollt ja nicht, dass mich einer sieht. Das war links vom Hauptweg, also: Da waren erst nach ’n paar Metern ’n paar Büsche, deswegen.
Auf jeden Fall hab ich dann, wie ich fertig war, was Rotes liegen sehen. Stück weiter, in so ’ner Bodensenke. Also, das war so ’ne Farbe, so irgendwie künstlich. Fast pink. Ich mein, das konnten keine Blumen sein, oder so, weil: War ja Herbst, da wächst doch so was nicht. Jedenfalls nicht im Wald. Na ja, und da dacht ich, da ist vielleicht jemand gestürzt und braucht Hilfe. Und wie ich dann näher gekommen bin, hab ich gesehen, dass da ’ne Frau liegt. Und da denk ich noch, die ist vielleicht nur ausgerutscht und hingefallen, weil: Wie die so dalag, da war ja nichts weiter in Unordnung an der. Außer eben dass der ihr Mantel und der ihre Haare total nass waren vom Regen.
Na, jedenfalls bin ich hin, aber wie ich näher dran war, hab ich’s dann gerochen. Sie wissen schon. Und wie mir klar war, dass die tot is, bin ich zurück zu meinem Fahrrad. Hab mich auf dem Weg dahin zweimal übergeben müssen. Und wie ich dann wieder bei meinem Rad war, hab mich erst mal kurz hingesetzt, weil: Mir war total kodderig. Und dann hab ich von meinem Handy aus die Polizei gerufen.
KAPITEL 2
Am nächsten Morgen herrschte in der Klinik die übliche Hektik. Susanne fand nicht einmal die Zeit, Dr. Flemming zu fragen, was er sich eigentlich dabei gedacht hatte, so spät noch anzurufen, noch dazu auf dem Festnetz.
»Susanne, wenn Sie heute zwischendurch noch mal eine Sitzwache übernehmen könnten …?«
»Natürlich.«
Sterbende in den Tod zu begleiten gehörte schon lange nicht mehr zu den Aufgaben der Mayener Klinik. Umso höher rechnete Susanne es der neuen Krankenhausleitung an, dass sie trotz Personalknappheit daran festhielt.
In der Mittagspause schlang sie hastig das mitgebrachte Brötchen hinunter; für den Weg in die Kantine war keine Zeit.
Der Tod hält sich nun mal nicht an Tarifverträge.
»Richard Wendel« stand auf der Patientenakte. Susanne betrat das Sterbezimmer und schloss behutsam die Tür. Der alte Mann lag mit geschlossenen Augen da, blass, mit eingefallenen Wangen und fast kahlem, altersfleckigem Schädel.
»Martha?«
»Ja.«
Wer auch immer das sein mag.
»Keine Angst. Ich bin bei dir.«
»Das ist gut.« Bei jedem Einatmer des Sterbenden entstand ein tiefes, rasselndes Geräusch.
Susanne schob einen Stuhl neben das Bett, setzte sich, nahm die Hand des alten Mannes in die ihre und lauschte seinen immer mühsamer werdenden Atemzügen.
Es kann nicht mehr lange dauern.
Als es so weit war, strich sie dem Sterbenden sanft über den Kopf. »Richard? Alles ist gut. Du kannst jetzt gehen.«
Es gelang Richard Wendel, ein letztes Mal zu lächeln, bevor das rasselnde Geräusch ein Ende fand.
Susanne legte den schlaff gewordenen Arm des Toten zurück auf die Bettdecke, faltete ihm die Hände und schloss seine Augenlider. Dann stand sie auf, bekreuzigte sich, murmelte ein Vaterunser und verließ den Raum so leise und behutsam, wie sie gekommen war.
»Exitus auf der 2, Zimmer 228.«
Der Rest war Krankenhausroutine.
»Guck mal, wie schön sich die Rhododendronbüsche erholt haben.« Susanne nutzte die ersten Sonnenstrahlen nach der verregneten Woche und schob ihre Mutter im Rollstuhl durch den Garten. Das kleine Paradies hinter dem Haus – von Susanne in jahrelanger Kleinarbeit dem vernadelten Waldboden abgetrotzt – war ihr ganzer Stolz.
»Ja. Und das Unkraut erholt sich ganz besonders gut bei deiner Pflege!«
»Mutti, es war doch die letzten Tage immer so schlechtes Wetter.«
»Zu faul! Das ist alles! Wenn ich so könnte, wie ich wollte, säh das hier aber tipptopp aus!«
Es sieht hier auch ohne dich tipptopp aus. Und du wolltest noch nie. Selbst als du noch gekonnt hast.
»Soll ich dir was zu trinken holen?«
»Ich will wieder rein.«
Als Susanne ihre Mutter zurück zur Terrasse schob, hörte man in einiger Entfernung das Geräusch eines näher kommenden Autos. Schließlich kam der Wagen auf der Auffahrt vor dem Haus zum Stehen.
»Kleinen Moment, Mutti. Da hat wohl mal wieder jemand die Schilder ignoriert.« Susanne ließ den Rollstuhl ihrer Mutter stehen und lief zum Gartentor. »Hallo?«, rief sie schon von Weitem, »haben Sie sich verfahren?«
»Nein, ganz und gar nicht!« Ev Meinecke stieg aus ihrem Cabrio und winkte Susanne gut gelaunt zu. »Ich dachte, wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, muss der Berg halt zum Propheten.«
»W…welcher Berg?«, stammelte Susanne und hätte sich gleichzeitig für ihre Begriffsstutzigkeit ohrfeigen können.
»Lust, mit mir nach Maria Laach rüberzufahren? Im Kloster ist ’ne interessante Ausstellung von …«
»Nein! Auf keinen Fall!«, unterbrach sie Susanne, heftiger als beabsichtigt. »Ich kann hier doch nicht weg«, setzte sie erschrocken über ihren aggressiven Ton hinzu, »wegen Mutti.«
»Na, macht doch nichts!« Ev Meinecke zuckte mit den Achseln. »Dann bleiben wir halt hier und trinken ’n Schluck zusammen. Ist doch so schönes Wetter.« Ganz offensichtlich keinerlei Widerspruch duldend, zauberte sie eine Flasche Prosecco unter dem Beifahrersitz hervor. »Paar Minütchen im Tiefkühlfach wären nicht schlecht.«
Was mach ich jetzt bloß? Ich kann sie doch nicht einfach wegschicken!
»Susanne?! Wer ist da?!« Muttis Stimme klang alarmierend schrill.
»Kein Grund zur Aufregung, Frau Kleinschmitt! Ich bin eine Freundin Ihrer Tochter!«, rief Ev, noch bevor Susanne antworten konnte. Dann drückte sie ihr die Flasche in die Hand, wisperte verschwörerisch: »Eiskalt schmeckt er einfach besser«, und marschierte mit einer Selbstverständlichkeit in Richtung Garten, als sei sie schon hundertmal dort gewesen.
Noch bevor sie das hölzerne Törchen erreicht hatte, ertönte hinter dem Haus ein von scheinbar heftigen Schmerzen gedämpfter Hilfeschrei.
Es dauerte fast eine Stunde, bis das Schluchzen und Zittern aufhörte und Susannes Tränen versiegt waren. »Hast ja recht. Mutti macht das mit Absicht.« Susanne schnappte nach Luft und griff dankbar nach dem soundsovielten Papiertaschentuch. »Aber wer will ihr das verdenken? Sie hat doch nur mich.«
»Und wen hast du?« Ev hob Susannes Kinn an und zwang sie, ihr direkt in die Augen zu sehen. »Suse, du hast das gleiche Recht auf Spaß und Freude und Menschen, die lieb zu dir sind, wie jeder andere auch.«
»Aber …«
»Nichts aber! Und jetzt köpfen wir erst mal unsern Schampus! – Bleib sitzen, ich mach das schon.«
Während sie in die Küche ging, um Prosecco und Gläser zu holen, dachte Susanne noch einmal über das nach, was Evelyn Meinecke gesagt hatte.
»Suse, du bist doch eine junge, hübsche Frau! »Du kannst doch das Leben nicht einfach an dir vorüberrauschen lassen. Dass du deine Mutter pflegst, ehrt dich, aber was sie da treibt, ist Sklavenhaltung, und die ist schon lange abgeschafft.«
Sie hatte mit Evs Hilfe den umgekippten Rollstuhl wieder aufgestellt, Mutti hineingehievt und zurück ins Haus geschoben, und damit wäre eigentlich alles wieder in Ordnung gewesen, hätte Gertrud Kleinschmitt nicht darauf bestanden, von Kopf bis Fuß untersucht zu werden, »… ob ich mir auch nichts gebrochen habe«, um anschließend zunächst nach einem innen aufgerauten langärmeligen und dann doch lieber einem kurzärmeligen, etwas dünneren Nachthemd zu verlangen und zu guter Letzt dringend eine leichtere, zuvor frisch zu beziehende Bettdecke zu brauchen: zeitaufwendig genug, um ihre Tochter vor dem »unverschämten Mannweib da draußen im Garten« zu warnen und Susanne aufzufordern, »dieser Frau« mit allem Nachdruck klarzumachen, dass sie hier unerwünscht war. Irgendwann war Mutti – erschöpft von den üblichen Bosheiten – eingeschlafen.
Ev hat bestimmt nicht die ganze Zeit gewartet. Und wiederkommen wird sie auch nicht.
Doch Evelyn Meinecke hatte die Pumps ausgezogen und saß – die Füße auf die Brüstung gelegt – entspannt rauchend auf der Terrasse.
Als sei nichts gewesen.
Susanne konnte ihr Glück kaum fassen. In der Grundschule hatte es eine Barbara gegeben. Die hatte sie ein Mal besucht, aber die hatte Mutti ebenso erfolgreich vergrault wie später auf dem Gymnasium sämtliche anderen Klassenkameradinnen.
In der Proseccoflasche schwebte ein Eisklumpen.
»Prost!«, sagte Ev.
Als Susanne mit ihr anstieß, durchrieselte sie ein geradezu euphorisches Glücksgefühl.
Ev stört sich nicht an Mutti und ihren Tiraden. Vielleicht kommt sie sogar irgendwann mal wieder. Das wär so wunderbar …
»Auf dich!«
»Auf uns! – Ach, übrigens: Ich hab da was für dich!«
Evelyn kramte in ihrer Tasche. »Das ist der Lichtblick. So heißt unsere Gefangenenzeitung.« Sie riss eine mit Kugelschreiber umkringelte Annonce aus der letzten Seite heraus und schob sie zu Susanne hinüber. »Suche Brieffreundschaft mit einer vorurteilslosen, liebenswürdigen Frau …«
»Ev, was soll ich damit?« Auf der Stelle schrillten bei Susanne sämtliche Alarmglocken. Sie hatte ein Mal – vor zehn Jahren ungefähr – auf eine Kontaktanzeige geantwortet. Der Mann klang sehr nett in seinen Briefen und auch später noch am Telefon. Sie hatten sich schließlich getroffen, auf Susannes Bitte hin fernab der Mayener Gerüchteküche, in Monreal. Er hatte sie am Bahnhof abgeholt. Sie hatten im Café Plüsch Tee getrunken und Apfelkuchen gegessen, und auch da war alles noch sehr nett. Zum Abschied hatte er ihr dann einen Zungenkuss aufgedrängt, so überraschend und so heftig, dass sie das Ganze wie erstarrt über sich ergehen ließ. Bei dem Gedanken an das lauwarme, zuckende, speichelnasse Stück Fleisch in ihrer Mundhöhle drehte sich Susanne heute noch der Magen um.
Nein. Ich werd ganz sicher nicht noch mal irgendeinem fremden Mann …
»Suse, hörst du mir überhaupt zu?«
»Jaja, natürlich. Nur, weißt du …«
»Der ist bei mir in Therapie.« Ev ließ Susanne keine Zeit zum Nachdenken. »Netter Kerl. Immer höflich, hat sich während seiner Haftzeit nie was zuschulden kommen lassen. Demnächst besteht für ihn womöglich die Aussicht auf Haftlockerung und später dann auf vorzeitige Entlassung. Er hat es wirklich verdient, dass sich jemand die Mühe macht, ihm ab und zu mal zu schreiben. Andreas Vogel heißt er.«
»Aber … Ich kann doch keinem Verbrecher …«
»Ach was! Sind doch nur Briefe! Du kannst dir wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise vorstellen, was für einen positiven Einfluss sowas auf meine LLs hat.«
»LLs?«
»Lebenslängliche.« Ev zuckte entschuldigend mit den Achseln und grinste. »Knastjargon.«
Lebenslänglich? Dann muss er ja was Schreckliches getan haben.
»Ev, ich weiß nicht …«
»Was weißt du nicht?«
»Ich weiß nicht, ob ich so was kann. Oder was dieser Mann sich davon verspricht …«
»Andreas Vogel? Der verspricht sich erst mal gar nichts davon. Ein Wunder, dass er sich überhaupt dazu durchgerungen hat, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen.« Ev beugte sich vor und grinste verschwörerisch. »Ich bin als seine Therapeutin ja sozusagen ans Beichtgeheimnis gebunden, aber ich glaub nicht, dass ich den professionellen Ehrenkodex verletze, wenn ich dir ganz unter uns anvertraue, dass Andreas Vogel das Thema Schuld und Sühne für meinen Geschmack ein bisschen allzu wörtlich nimmt. Als hätte der ’n Schweigegelübde abgelegt! Bleibt immer für sich und hält sich aus allem raus. Sein Zellengenosse ist der Einzige, mit dem er Kontakt hat, und der ist leider nicht die hellste Kerze auf der Torte.«
Bei der Vorstellung einer Torte mit nur schwach leuchtendem Zellengenossen musste Susanne unwillkürlich lachen: Evs flapsiger Ton wirkte geradezu ansteckend.
Es tut so gut, mit ihr zusammen zu sein. Bestimmt ist sie eine fantastische Therapeutin.
»Suse?«
»’Tschuldigung, ich hab nur gerade an die Bergpredigt gedacht: Selig seid ihr, die ihr hier weint, denn ihr werdet lachen.«
»Aha.«
Offenbar kann Evelyn mit Bibelzitaten nichts so recht anfangen.
»Hat unser Herr Jesus gesagt«, erklärte Susanne. »Natürlich ist es im Sinne christlicher Nächstenliebe wunderbar, jemanden zu trösten.«
»Okay. Wenn das sogar in der Bibel steht, dann nichts wie ran! Andreas Vogel braucht einfach jemanden, der nett zu ihm ist und mit dem er den ein oder anderen vernünftigen Gedanken austauschen kann.«
Ob ich das schaffe? Einen Menschen, der vielleicht für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzt … aufzuheitern?
Irgendwann hatte Susanne zugestimmt. Schließlich hatte jeder – auch wenn er noch so Schlimmes getan hatte – das Recht auf ein paar hilfreiche, freundliche Worte.
Nachdem Susanne sich einmal dazu durchgerungen hatte, Andreas Vogel zu schreiben, sehnte sie die nächste Nachtschicht geradezu herbei.
Endlich Ruhe!
Aber jetzt – allein im nächtlich verlassenen Schwesternzimmer – kamen ihr doch wieder Zweifel.
Warum hab ich mich bloß nicht getraut zu fragen, was dieser Mann eigentlich getan hat?
»Sehr geehrter Inserent …«, diktierte sie sich leise, um die Seite gleich anschließend zusammenzuknüllen und in den Papierkorb zu werfen. Dort lag bereits eine Seite mit »Sehr geehrter Herr Vogel« und eine mit »Lieber Andreas Vogel«.
Vielleicht ist es ja besser, gar nicht erst zu wissen, weswegen er verurteilt worden ist. Es geht hier schließlich nicht um seine Vergangenheit, sondern darum, ihm dabei zu helfen, in Zukunft anständig zu bleiben.
Schließlich rang sie sich zu einem »Lieber Brieffreund Andreas« durch. Unglücklicherweise platzte just in diesem Moment eine von den Pflege-Azubis herein. »Menno! Mir ist voll schwummerig!« Nadja Küppersbusch setzte gekonnt ihren üblichen Du-wirst-mich-doch-nicht–verhungern-lassen-Blick ein. »Zuckerspiegel unter zero. Ich glaub, ich bräuchte dringend ’n Apfel oder ’ne Banane oder so was.«
Jaja. Ich weiß. Du brauchst immer irgendwas ganz dringend. Andererseits … Bist ja fast noch ’n Kind …
»Leberwurstbrötchen mit Gurke?«
»Au ja!«
Als Susanne sich zu ihrer Tasche hinunterbückte, segelte der Brief an Andreas Vogel vom Tisch, direkt vor Nadja Küppersbuschs Füße. Natürlich kannte die auch in Sachen Diskretion keinerlei Tabus. »Ey, Hammer!«, versetzte sie nach einem Blick auf die Anrede, »haste den Typi aus’m Internet oder was?«
Susanne versuchte vergebens, nicht rot zu werden. »Ich … ich schreib’ dem nur, weil … Eine Freundin hat mich darum gebeten«, stammelte sie, »der … dieser Mann sitzt in Koblenz – also in Diez – im Gefängnis, weißt du, und, und …«
»Nee, in echt jetzt?« Nadja Küppersbusch biss herzhaft in Susannes Pausenbrötchen und kaute ausgiebig. »Und wozu soll das gut sein?«
»Quasi als …«, Susanne suchte nach Worten, »als seelische Unterstützung. Und vielleicht für später. Wenn er entlassen wird. Resozialisation und so …«
»Boah, krass!« Nadja machte sich nicht die Mühe, vor dem Sprechen den Mund leer zu machen, »Wenn der für länger sitzt, is das doch ’n Schwerverbrecher, oder?«
»Ich weiß nicht …«
»Na, du hast vielleicht Nerven! Aber irgendwie auch cool.«
Während Nadja Küppersbusch sich mit an den Tisch setzte und Susanne beim Erstellen des Briefes half, lag dessen Empfänger in seiner Gefängniszelle auf dem oberen Stockbett und lauschte dem Monolog seines Zellengenossen.
»Dann zudrücken bis kurz vor Schluss. Bis kurz bevor sie die Augen verdreht und wegsackt.« Peter Esser lauschte in die Dunkelheit. »Der Moment ist der geilste, oder?« Er machte eine weitere auffordernde Pause, doch Andreas Vogel rührte sich nicht. »Pennst du?«
»Nein.«
»Also: Samstagabend. Disco, Club, Puff, was auch immer. Samstag halt. Und ist schon ziemlich dunkel. Und die Ische sieht auf jeden Fall nuttig aus. Um die zwanzig. Lange Haare. Blond gefärbt. Also … ob die Ische in echt ’ne Nutte is oder ob die nur so aussieht: egal. Stiefel. Und ’n kurzer Rock. So einer, wo man im Sitzen den Schlüpfer sehen kann. Dann hat se’s ja auch nicht anders gewollt, oder? Also, die sollte ruhig ’n bisschen Fett auf’m Arsch haben, was?«
Diesmal wartete Esser nicht auf eine Antwort. Er musste sich im Grunde nicht einmal vergewissern, dass sein Kumpel da oben im Bett wach war und zuhörte. Das Zuhören gehörte schließlich zum Ritual. Und das Ritual selbst war beinahe noch wichtiger als das, was er sich bei den nächtlichen Sitzungen ausdachte. »Wenn der Rock so über dem Arsch spannt … ein, zwei Nummern zu eng. Leder. Auf jeden Fall so kurz, dass es nur ’ne Handbreit bis zu ihrer geilen, kleinen Fotze ist …«
Andreas Vogel lag auf dem Rücken und starrte mit unbewegtem Gesicht zur Decke.
»Hallo Andreas.« Susanne las ihren Brief zum dritten Mal durch, um sich zu vergewissern, dass zwischen den Zeilen nichts Missverständliches herauszulesen war. Auf Nadjas Rat hin hatte sie das »Lieber« durch »Hallo« ersetzt.
»›Lieber‹ klingt als Anrede für ’nen Knacki doch irgendwie bescheuert«, hatte Nadja festgestellt, und Susanne musste ihr recht geben. Sie hielt beim Lesen inne und dachte daran, dass sie als Kind sogar an »Lieber Gott« gezweifelt hatte: Warum sollte sie zu einem »lieben« Gott beten, wenn der wollte, dass sie sich seinetwegen wehtat?
Mutti hatte ihr erklärt, dass man sich wehtun muss, wenn man kein liebes Mädchen gewesen ist, weil man sonst in die Hölle kommt. Und Susanne hatte beinahe täglich etwas Schlimmes getan: »Der liebe Gott ist böse auf dich, weil du den Frühstückstisch nicht abgeräumt hast!«