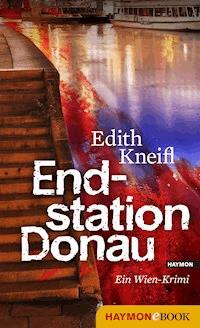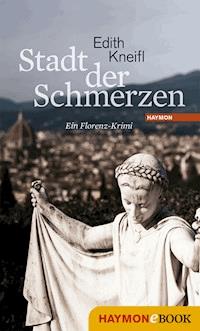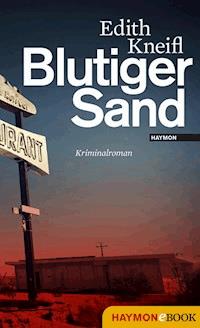Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Wien-Krimis
- Sprache: Deutsch
MORD IM WIENER PRATER! WIEN UM 1900: Die fünfzehnjährige Leonie ist verschwunden. Alle Indizien deuten darauf hin, dass das Mädchen entführt wurde. Kurz darauf geschieht ein zweites Verbrechen: In einer Gondel des Riesenrades wird ein toter Zwerg entdeckt. Der Privatdetektiv Gustav von Karoly wird von der besorgten Mutter Leonies mit den Ermittlungen beauftragt. Unterstützung bekommt er von Artisten und Hellseherinnen, Jockeys und Praterstrizzis. Nur der reiche, tyrannische Großvater Leonies hält nichts von Karolys Bemühungen. Hat er gar etwas mit dem Fall zu tun? Spannend und mit viel Zeitkolorit erzählt Edith Kneifl einen historischen Kriminalroman, der die LeserInnen bis zur letzten Seite fesselt. LESERSTIMME: "Ein hervorragend recherchierter historischer Krimi! Edith Kneifl zeichnet ein lebendiges Bild vom alten Wien und schafft es mit ihren authentischen Figuren und einer spannenden Krimiszenerie den Leser in eine andere Welt zu entführen." WEITERE HISTORISCHE WIEN-KRIMIS MIT PRIVATDETEKTIV GUSTAV VON KAROLY: "Die Tote von Schönbrunn" "Totentanz im Stephansdom (erscheint im Herbst 2015)"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Edith Kneifl
Der Tod fährt
Riesenrad
Ein historischer Wien-Krimi
Der Tod, das muss ein Wiener sein.
Nur er trifft den richtigen Ton:
Geh Schatzerl, geh Katzerl, was sperrst dich denn ein?
Der Tod muss ein Wiener sein.
Georg Kreisler:
Der Tod, das muss ein Wiener sein
für Hilde und Heinz
Prolog
Ich war allein. Gefangen in völliger Dunkelheit. Er war nicht hier. Trotz der Finsternis hätte ich seine Anwesenheit bemerkt. Hätte ihn gerochen oder seinen Atem gespürt. Hatte ich geschlafen oder war ich nur kurz ohnmächtig gewesen?
Ich blinzelte in die Schwärze. Bemerkte, dass meine Augen nicht mehr zugebunden und meine Knöchel nicht mehr gefesselt waren. Fast wäre ich vor Freude aufgesprungen. Doch meine Freude währte nicht lange. Meine Beine waren steif. Vorsichtig stand ich auf. Fiel fast hin. Ungeduldig wartete ich, bis das Blut in meinen Adern zu fließen begann und ich meine Beine wieder spüren konnte.
Über mir erklang ein dumpfes monotones Geräusch. Oder kam es von nebenan? Ich lauschte. Zählte die Sekunden. Zählte von eins bis sechzig. Die Minuten schienen so schneller zu vergehen. Das merkwürdige Geräusch hielt an.
Ich bekam kaum Luft. Atmete durch die Nase und versuchte mit der Zunge den Knebel zu lockern. Der ekelige Fetzen gab keinen Millimeter nach. Vorhin war der Fetzen feucht gewesen. Nun war er staubtrocken. Ich hatte keinen Speichel mehr. Entweder würde ich verdursten oder ersticken.
Verzweifelt versuchte ich meine Hände, die am Rücken gefesselt waren, freizukriegen. All mein Ziehen und Zerren war fruchtlos. Die Schnur schnitt nur schärfer in die weiche Haut über meinen Gelenken. Als ich warmen klebrigen Saft auf meinen Händen spürte, wollte ich schreien.
Kein Ton kam mir über die Lippen. Ich geriet in Panik. Bekam überhaupt keine Luft mehr. Bemühte mich, langsam und regelmäßig durch die Nase zu atmen. Tränen liefen über meine Wangen. Ich hoffte, die salzigen Tropfen würden meine aufgesprungenen Lippen erreichen. Vergeblich.
Ich versuchte wieder zu gehen. Stolperte, und taumelte gegen eine Wand. Schlug mit der Stirn gegen kalten feuchten Stein. Blut tropfte auf meine Nase. Mir ekelte vor meinem eigenen Blut. Ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Auf einmal kam mir eine Idee. Ich tastete mit meinen nackten Zehen den Boden ab. Die dünne eiserne Stange, über die ich gestolpert war, schien in der Erde befestigt zu sein. Ich stieß sie mehrmals mit der Fußspitze an. Sie ließ sich nicht verschieben. Etwa einen halben Meter daneben befand sich eine zweite Stange. Ich machte ein paar vorsichtige Schritte. Plötzlich streifte etwas Weiches, Haariges meine Beine. Ich erstarrte. Mein Herzschlag setzte aus. Eine Ratte, oder gar ein Gespenst? Seit ich denken kann, hatte ich vor nichts mehr Angst als vor Gespenstern.
Das fremde Wesen rührte sich nicht. Ich trat einen Schritt zurück. Es schien mir nicht zu folgen. All meinen Mut zusammennehmend, näherte ich mich ihm wieder. Meine Brust berührte etwas Hartes. Geister und Gespenster sind körperlos, fiel mir gerade rechtzeitig ein, sonst wäre ich bestimmt erneut in Panik verfallen. Ich stupste das Ding mit meinem Knie an. Ein lautes Krachen. Was immer es gewesen war, jetzt lag es auf dem Boden und war offenbar außer Gefecht gesetzt.
Vorsichtig schritt ich, einen Fuß vor den anderen setzend, weiter mein Gefängnis ab, bis ich auf das nächste Hindernis stieß. Es fühlte sich glitschig und schwabbelig an. Mir ekelte. Doch ich riss mich zusammen und versuchte, auch diese Hürde mit einem Tritt aus dem Weg zu räumen. Es gab zwar nach, versperrte mir aber weiterhin den Weg. Klatschte zurück, wenn ich dagegentrat. Ich musste eine Pause machen und Atem holen.
Als ich meine Umgebung schließlich erkundet hatte, war ich nicht viel schlauer als vorher. Ich war in einem sehr schmalen, langen Raum eingesperrt, in einer Art Schlauch unter der Erde. Ich hatte eine hölzerne Leiter entdeckt und versucht, hinaufzusteigen, hatte mich mit meinem Kinn von Sprosse zu Sprosse weitergehantelt, bis ich mit dem Kopf an ein eisernes Gitter gestoßen war, das sich keinen Zentimeter bewegen ließ.
Ich überlegte. In diesem unterirdischen Raum befanden sich neben mir einige merkwürdige, leblose Dinge. Wurde ich in einem Käfig gefangen gehalten? Aber wofür waren die beiden langen Eisendinger am Boden gedacht?
Ich bildete mir ein, dass durch das Gitter ein schwacher Lichtschimmer in mein Gefängnis drang. Plötzlich spürte ich einen Luftzug. Erschrocken zuckte ich zusammen und stolperte zurück an das andere Ende des Raumes.
Sein höhnisches Lachen fuhr mir durch Mark und Bein. Er packte mich an meiner linken Schulter und schüttelte mich. Die Kerze hielt er so, dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Ich wusste ohnehin, wer es war.
Während er mir den Knebel abnahm, drohte er, mir die Kehle aufzuschlitzen, wenn ich nur den leisesten Ton von mir geben würde. Die Spitze seines Messers kitzelte meinen Hals. Trotz seiner Drohung hätte ich fast geschrien, als die Kerzenflamme plötzlich eine unheimliche Fratze beleuchtete.
Zu meinen Füßen lag der gehörnte Luzifer mit roter, herausgestreckter Zunge. Ein riesiger, behaarter Schwanz ragte aus seiner feurigen Hose. Allerdings schien Luzifer aus Pappe zu sein, während mein Peiniger real war.
Er gab mir Wasser und ein Stück Brot. Gierig verschlang ich das Brot. Den Becher trank ich in einem Zug leer. Leise flehte ich ihn dann an, mich nicht mehr zu knebeln. Ich schwor, nicht um Hilfe zu rufen. Er lachte nur und stopfte mir den Mund zu. Sogleich geriet ich wieder in Atemnot. Mein Unterkiefer zitterte. Lautlos begann ich zu weinen.
Ich spürte eine Hitzewelle in mir hochsteigen, von den Füßen bis zum Kopf. Mein Atem setzte für ein paar Sekunden aus. Mein Zwerchfell schien blockiert.
Aber ich gab nicht auf. Langsam sog ich die Luft durch die Nasenflügel ein und blies sie wieder raus. Mein Puls klopfte heftig in meinem Hals. Im Kopf drehte sich alles. Als das Blut in meinen Ohren zu dröhnen begann und kleine Blitze vor meinen Augen explodierten, befürchtete ich, in Ohnmacht zu fallen.
Er packte mich an den Armen und setzte mich auf einen Kübel.
Mir war nichts mehr peinlich, nicht einmal das laute Plätschern, als ich mich erleichterte. Ich spürte, dass er es genoss, mich zu demütigen.
Als ich fertig war, half er mir aufzustehen. Ich machte einen raschen Schritt nach links und gab dem Kübel einen Stoß. Sein Schrei, als sich der Inhalt des Kübels über seine Füße ergoss, bereitete mir eine große Genugtuung. Aber mein Triumphgefühl hielt nicht lange an. Seine Ohrfeige raubte mir das Bewusstsein. Die Dunkelheit hüllte mich wieder ein.
Donnerstag, 2. Juli 1897
1
Gustav von Karoly war ein großer Freund der Frauen. Er sah dem schwachen Geschlecht so manchen Fehler nach. Doch er hasste Unpünktlichkeit. Obwohl er momentan nichts Besseres zu tun hatte, als sich dem Müßiggang hinzugeben, konnte er es nicht leiden, wenn jemand seine Zeit verschwendete. Ungeduldig rutschte er auf der mit braunem Leder überzogenen Sitzbank im Café Schwarzenberg hin und her und zupfte so lange an der weißen Blume in seinem Knopfloch, bis nur mehr zwei Blütenblätter übrig waren. Die restlichen Blätter der Gardenie lagen verstreut unter dem wackeligen Marmortischchen auf dem schmutzigen Boden. Seine Augen wanderten immer wieder zwischen der Eingangstür und dem großen Porträt von Kaiser Franz Joseph I., das über der Theke hing, hin und her. Zu Hause hatte er das Konterfei Seiner Majestät aus seinem Zimmer entfernt. Da seine Tante es ebenfalls nicht aufhängen wollte, hatte sein ehemaliges Kindermädchen Josefa das Bild in ihrem Kabinett hängen. In den öffentlichen Gebäuden, den Cafés und Geschäften der Residenzstadt aber konnte man dem väterlichen Blick des Herrschers nicht entkommen.
Der erste Tisch im Café Schwarzenberg, gleich links neben dem Eingang, diente Gustav als provisorisches Büro. Lieber wäre ihm der Tisch in der Fensternische, rechts von der Eingangstür, gewesen, denn dort war es wesentlich ruhiger als hier, gegenüber der Theke. Doch das war der Stammtisch von Josef Hoffmann, einem Architekten und Künstler, der gerade, gemeinsam mit Joseph Maria Olbrich, Gustav Klimt und anderen Künstlern, die Wiener Secession gegründet hatte.
Der Anblick all der hübschen Damen der Halbwelt und der besseren Gesellschaft, die vor seinem Fenster vorbeiflanierten, ließ ihn die Benachteiligung gegenüber dem bekannten Architekten leichter in Kauf nehmen. Der Ringstraßenkorso begann an der Sirkecke, beim feinen Lederwarengeschäft des Herrn August Sirk, gegenüber des k.k. Hofoperntheaters, und endete am Schwarzenbergplatz, quasi vor seinem Fenster. So mancher Blick aus himmelblauen oder rehbraunen Augen streifte wohlwollend seine ebenmäßigen Züge und seinen sorgfältig gekämmten, dichten, schwarzen Schnurrbart.
Dennoch fand er es höchst ärgerlich, dass sich seine Tante weigerte, ihm das Kabinett, das früher sein Kinderzimmer gewesen war, als Büro zu überlassen. Sie hatte nach dem Tod seiner Mutter Zimmer und Kabinett, die vom Vorraum aus separat begehbar waren, untervermietet. Bis vor kurzem hatten Hermann Baier und seine Frau dort gewohnt. Als dem alten Grantscherben die Frau davongelaufen war, hatte er das Kabinett aufgegeben. Gustav hatte sogleich darauf gespitzt. Vor einem Monat hatte seine Tante Vera es jedoch an Eduard vermietet, einen Bierkutscher aus Brünn, der für einen Fiakerbesitzer arbeitete.
Von allen Wiener Kaffeehäusern war Gustav das Café Schwarzenberg am liebsten. Die mit dunkelbraunem Holz getäfelten Wände, die marmornen Tische, die mit tabakbraunem Leder überzogenen Clubsessel und die schönen Luster, die an der mit kleinen weißen Kacheln gefliesten Decke hingen, erinnerten ihn an die Einrichtung britischer Männerclubs. Nach seinem Abschied vom Militär hatte er ein Jahr in London verbracht. Anstatt an der neu gegründeten London School of Economics ernsthaft zu studieren, hatte er seine Tage in den Londoner Clubs verbracht. Allerdings hatte er im Herbst 1895 doch einige Vorlesungen in der John Street besucht und notgedrungen etwas von den Diskussionen um Klassenunterschiede und die neuen Wege des sozialen Fortschritts mitbekommen. Der Besuch dieses Colleges war die Idee seiner Tante gewesen. Eine englische Freundin hatte ihr diese fortschrittliche Institution empfohlen.
Als Gustav seinen Kleinen Schwarzen ausgetrunken hatte und bereits beim zweiten Glas Wasser angelangt war, hatte er die Hoffnung aufgegeben, dass die Dame noch kommen würde. Vielleicht war es keine so gute Idee gewesen, sich hier mit ihr zu verabreden. Damen der besseren Gesellschaft gingen höchstens nach einer Soiree oder einem Ball in ein Kaffeehaus, und dann nur in Herrenbegleitung.
Plötzlich erschien eine verschleierte Frau in der Tür. Er wusste sofort, dass es sich um seine neue Klientin handelte. Sie blickte sich hastig um, bevor sie unsicheren Schrittes das Lokal betrat. Offensichtlich fühlte sie sich unwohl.
Trotz der Hitze war sie ganz in Schwarz gekleidet. Ein hauchdünner schwarzer Schleier hing von ihrer ausladenden Kopfbedeckung herab. Ihre Figur war tadellos. An den richtigen Stellen gut gepolstert. Ein kritischer Blick auf ihr Gesicht, das trotz des raffinierten Netzwerks zu sehen war, und er konstatierte, dass sie einige Jahre jünger sein musste als er.
Als sie zögernd auf seinen Tisch zutrat, sprang er auf und verbeugte sich tief.
„Gustav von Karoly. Sehr erfreut!“
Sie reichte ihm die Hand.
Er ergriff sie sanft und hauchte einen Kuss auf ihre behandschuhten Finger.
„Bitte nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun?“ Er war sich bewusst, dass er ein bisschen zu schnell vorging. Es mangelte ihm eben noch an Erfahrung in seinem neuen Beruf. Die Dame in Schwarz würde erst sein dritter Fall sein, wenn es ihm überhaupt gelänge, sie davon zu überzeugen, dass er der richtige Mann für die Lösung ihres Problems war.
Er vermutete ein Liebesdrama. Waren doch seine ersten beiden Klienten engstirnige, eifersüchtige Ehemänner gewesen. Dass dieses Mal ein weibliches Wesen seine Dienste beanspruchen könnte, erregte ihn ungemein.
Vor zwei Tagen war ihr Brief in einem zart parfümierten champagnerfarbenen Kuvert bei ihm eingelangt. Er hatte ihr durch einen Boten umgehend eine Antwort geschickt. Und nun war sie tatsächlich zu dem Treffpunkt, den er vorgeschlagen hatte, erschienen. So viel Glück musste man erst einmal haben, dachte er und bemühte sich, seinen Fehler von vorhin wieder gutzumachen.
„Was darf ich Ihnen bestellen? Eine Melange und einen Apfelstrudel vielleicht? Der Apfelstrudel hier ist sehr empfehlenswert.“
„Nein, danke. Ich möchte lieber ein Glas Tokajer.“
Ihre heisere rauchige Stimme jagte köstliche kleine Schauer über seinen Rücken.
Energisch winkte er den Kellner herbei und bestellte zwei Achterl, obwohl es erst zwölf Uhr mittags war und er normalerweise tagsüber keinen Alkohol trank. Aber er wollte keinesfalls als Weichling dastehen.
„Margarete von Leiden“, stellte sie sich überflüssigerweise vor.
Er hatte nach ihrem Brief bereits recherchiert, wusste, dass sie die Witwe des Barons von Leiden war. Viel interessanter als ihren verstorbenen Ehemann fand er allerdings ihren Vater. Herr von Schwabenau war ein stadtbekannter Wiener Fabrikbesitzer, der beim Bau der neuen Eisenbahnlinien viel Geld verdient hatte. Sein Stahl- und Eisenwerk hatte einen Großteil des österreichischen Schienennetzes hergestellt. Neben Eisenbahnschienen und Waffen wurden in seiner Fabrik auch komplizierte technische Apparaturen für den Wiener Vergnügungspark erzeugt. Viele der wundersamen neumodischen Attraktionen im Volksprater, wie der Wurstelprater seit 1873 offiziell hieß, waren von Schwabenaus Ingenieuren entwickelt worden. Nur zuletzt, beim Bau des größten Wunderwerks der Technik, dem Riesenrad, war er laut Zeitungsberichten von Gabor Steiner ausgebootet worden. Seither hatten sich die Schwabenau-Werke draußen in Hernals wieder mehr auf die Waffenproduktion verlegt.
Auf einmal bildete sich Gustav ein, dass Margarete von Leiden weniger nach Veilchen als nach tödlichem Pulver roch. Dennoch schwebte er im siebten Himmel und wusste nicht, bei welchem Heiligen er sich für diese Klientin bedanken sollte.
Ihre Vornehmheit schien nicht gespielt zu sein. Gustav meinte, ein gutes Gespür für Menschen zu haben. Auch wenn ihr Vater, ursprünglich ein einfacher Wagner, wahrscheinlich wegen seiner Verdienste um die Waffenproduktion im letzten Krieg geadelt worden war, hatte sie Klasse. Bestimmt hatte der Alte bei der Erziehung seiner einzigen Tochter keine Kosten gescheut. Gustav tippte auf ein Schweizer Internat.
Da das Schweigen zwischen ihnen bereits unangenehm wurde, fragte er noch einmal, was er für sie tun könne.
„Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen verwirrt. Hier ist es so laut. Ich war noch nie in einem Kaffeehaus.“ Sie warf einen neugierigen Blick in den benachbarten Salon, der mit seinen hellen marmornen Wänden und riesigen Spiegeln viel luftiger wirkte.
Gustav dachte nicht im Traum daran, seinen Stammtisch gegen eines der filigranen Messingtischchen dort drüben einzutauschen. Dies war schließlich kein privates Stelldichein, sondern ein rein geschäftlicher Termin.
„Meine Tochter ist spurlos verschwunden“, seufzte sie endlich. „Mein Vater hat all seine Beziehungen spielen lassen, aber leider nichts in Erfahrung bringen können.“ Sie nahm ein mit Spitzen besetztes Taschentuch aus ihrem Beutel, hob ihren Schleier und trocknete ihre feuchten Wangen.
Schneeweißer Teint, eine süße kleine Stupsnase, geheimnisvolle hellviolette Augen, sinnliche Lippen. Gustav malte sich aus, wie er diese Lippen mit seinen Küssen zum Glühen bringen würde. Sein Blick wanderte zu ihren hohen festen Brüsten. Ihm wurde ganz heiß und seine Schenkel begannen zu vibrieren.
„Sollten Sie mich nicht fragen, seit wann ich meine Tochter vermisse?“
Ihr leicht ironischer Ton riss ihn aus seinen süßen Träumen.
„Ja, natürlich, ja …, wann und wo haben Sie Ihr Kind zum letzten Mal gesehen?“
„Vorigen Sonntag. Wir waren im Lusthaus zu einem Galadiner eingeladen. Kurz bevor wir aufbrechen wollten, fiel mir auf, dass Leonie, die schon vor einer Weile die Tafel verlassen hatte, nicht mehr zurückgekehrt war. Ich befürchtete, dass ihr das üppige Mahl nicht bekommen war. Jedenfalls machte ich mich sogleich auf die Suche nach ihr. Draußen dunkelte es bereits. Ich musste die Suche bald aufgeben, informierte aber meinen Vater, und er schickte unseren Kutscher und ein paar Kellner mit Fackeln los. Als sie unverrichteter Dinge zurückkamen, fuhren wir nach Hause, in der Hoffnung, sie vielleicht dort anzutreffen. Doch zu Hause war sie auch nicht. Mein Herr Papa suchte mit seinen Leuten die halbe Nacht lang die ganze Umgebung des Lusthauses ab. Ohne Erfolg.“ Margarete von Leiden verbarg ihr Gesicht in ihren Händen.
„Bitte beruhigen Sie sich!“ Weinende Frauen riefen bei Gustav ein Gefühl völliger Hilflosigkeit hervor.
Sie beruhigte sich tatsächlich relativ rasch.
„Am nächsten Morgen ließen mein Vater und ich uns in die Freudenau bringen und anschließend zur Trabrennbahn in der Krieau. Es mag für Sie etwas eigenartig klingen, aber meine Tochter ist eine große Pferdeliebhaberin …“
Bevor sie wieder zu weinen anfing, fragte Gustav schnell: „Und dann sind Sie auf das Kommissariat gegangen?“
„Nein! Wo denken Sie hin?“
„Warum nicht?“
Sie nippte an ihrem Weinglas, schien über eine Antwort erst nachdenken zu müssen.
„Ich möchte mir erst sicher sein, dass ich Ihnen vertrauen kann, bevor ich mit Ihnen offen über familiäre Angelegenheiten spreche.“ Sie taxierte ihn herablassend.
Wenn Gustav eines nicht leiden konnte, dann waren es arrogante Adelige. Er war ein überzeugter Liberaler und großer Anhänger der Französischen Revolution und der gescheiterten Märzrevolution in den späten vierziger Jahren. Das Biedermeier und die politische Restauration hatten in seinen Augen alle grandiosen Ideen zunichte gemacht.
Er musterte sie mindestens ebenso arrogant wie sie ihn.
„Sie haben sich an mich gewandt. Darf ich fragen, warum?“
„Ein Bekannter, der Arzt von Graf Batheny, der auch meinen Vater wegen seiner Herzprobleme behandelt, hat Sie mir wärmstens empfohlen.“
Bei der Erwähnung des Grafen zuckte Gustav unwillkürlich zusammen. Um Fassung bemüht, zündete er sich eine Zigarette an. Seine Hände zitterten.
Nach dem ersten Zug besann er sich jedoch auf seine gute Erziehung und fragte, ob es sie störe, wenn er rauche.
Sie schüttelte den Kopf.
„Kann ich auch eine haben?“
Er glaubte seinen Ohren nicht zu trauen, reichte ihr aber sogleich das silberne Zigarettenetui, das er von seinem Großvater geerbt hatte.
Sie bediente sich. Er gab ihr Feuer und stellte mit Genugtuung fest, dass seine Hände zu zittern aufgehört hatten.
„Sind Sie mit Doktor Lipschitz oder gar mit dem Grafen Batheny befreundet?“, fragte sie.
Jetzt ließ er sich lange Zeit mit seiner Antwort. Er starrte auf ihre Lippen, die sich fast vulgär wölbten, als sie einen Zug von ihrer Zigarette nahm. Die Baronin kam ihm plötzlich richtig verrucht vor.
„Befreundet ist nicht der richtige Ausdruck.“ Sein abweisender Blick ließ keine weitere Frage zu.
„Wenn ich diesen Fall übernehmen soll, benötige ich mehr Informationen. Wir Detektive sind wie Ärzte, oder besser gesagt, wie diese neumodischen Nervenärzte. Wir haben Schweigepflicht. Alles, was Sie mir erzählen, bleibt bei mir.“ Theatralisch griff er sich ans Herz.
Endlich schien er den richtigen Ton getroffen zu haben. Sie dämpfte ihre bis zur Hälfte gerauchte Zigarette aus.
„Meine Tochter ist ein sehr eigenwilliges und außergewöhnliches Kind. Sie ist nicht zum ersten Mal verschwunden. Vor zwei Jahren ist sie schon mal für drei Tage von zu Hause ausgerissen. Aber das tut nichts zur Sache.“
„Oh doch! Wo war sie damals?“
„Im Prater auf der Vermählungswiese … bei den Zigeunern … Mein Herr Papa und ich haben die Zigeuner auch gleich als Erstes aufgesucht. Keiner von ihnen hat Leonie in letzter Zeit gesehen.“
„Und Sie haben diesen Leuten so ohne Weiteres geglaubt?“
„Warum sollten sie uns nicht die Wahrheit sagen? Sie würden es nicht wagen, meinen Vater zu belügen. Sie haben viel zu viel Angst vor ihm. Er ist ein mächtiger Mann. Sein Einfluss reicht weit über die Pratergrenzen hinaus.“
Gustav war gespannt, was seine Tante von diesem ungewöhnlichen neuen Fall halten würde. Obwohl er oft Streit mit ihr hatte, hielt er große Stücke auf sie. Tante Vera hatte ihm Vater und Mutter ersetzt. Denn seine Mama war zwar sehr schön gewesen, hatte aber in ihrer eigenen Welt gelebt und niemanden geliebt außer sich selbst. Das hatte er schon als Zehnjähriger begriffen.
„Ich übernehme den Fall.“ Er hoffte, selbstbewusst genug zu klingen. „Geben Sie mir die Namen und Adressen von allen Leuten, mit denen ihre Tochter verkehrte.“
Margarete von Leiden blickte ihn verblüfft an, tat aber wie ihr geheißen. Anscheinend war sie daran gewöhnt, Befehle von Männern entgegenzunehmen. Brav schrieb sie mit dem Stift, den er ihr reichte, einige wenige Namen in sein Notizbuch.
„Die Adressen dieser Personen kenne ich nicht“, sagte sie entschuldigend.
Gustav war überrascht, als er die Namen las. Sie waren ihm fast alle bekannt. Er hätte niemals gedacht, dass eine Baronesse mit solch dubiosen Leuten Kontakt haben könnte.
Während er überlegte, wie viel Honorar und Spesengeld er verlangen solle, fragte sie: „Genügen fünfzig Kronen als Anzahlung und zwanzig Kronen Spesen für jeden folgenden Tag Ihrer Nachforschungen?“
Er hatte für sich gerade die Hälfte des vorgeschlagenen Betrages veranschlagt, war aber so geistesgegenwärtig zu nicken.
„Und wenn Sie meine Leonie finden, zahle ich gern noch einmal hundert Kronen Erfolgshonorar.“
„Haben Sie zufällig ein Foto von Ihrer Tochter dabei?“
Sie holte aus ihrem schwarzen Beutel, der mit weißen funkelnden Perlen bestickt war, eine Fotografie hervor und reichte sie ihm über den Tisch.
Gustav bemühte sich, sein Erstaunen zu verbergen. Hatte er doch damit gerechnet, ein Kind suchen zu müssen. Auf dem Bild lächelte ihm ein hübsches junges Mädchen kokett entgegen.
„Wie alt ist die Baronesse?“
„Fünfzehn.“
Er hatte die Baronin auf höchstens dreißig geschätzt.
„Bitte erzählen Sie mir ein bisschen mehr von Ihrer Tochter.“
„Was wollen Sie wissen?“
„Geht sie zur Schule? Was hat sie für Interessen?“
„Sie ist, wie gesagt, verrückt nach Pferden. Das hat sie von ihrem Va… Großvater“, stammelte Margarete von Leiden.
Gustav hatte ihren Versprecher sehr wohl bemerkt, ließ sie aber weiterreden.
„Leonie besucht das Mädchengymnasium. Sie ist eine gute Schülerin, aber ein bisschen wild, wenn Sie verstehen, was ich meine. Keiner konnte sie bisher bändigen. Sie hat sämtliche Kindermädchen und Gouvernanten in die Flucht geschlagen. Mein Mann hat sie sehr verwöhnt und ich war zu schwach, mich in Erziehungsfragen durchzusetzen.“ Sie wischte sich mit ihrem nicht mehr ganz so blütenweißen Taschentuch über die Augen.
„Ich weiß nicht, was ich Ihnen sonst noch erzählen könnte.“
„Wer sind ihre Freundinnen? Oft wissen die besten Freunde mehr über unsereins als die Familie.“
„Leonie hat keine Freundinnen. Bis jetzt habe ich geglaubt, ich wäre ihre beste Freundin …“ Margarete von Leiden schnäuzte sich ungehörig lautstark.
„Gibt es außer Ihnen noch jemanden, der mir etwas über Ihre Tochter erzählen könnte?“
„Vielleicht mein Vater? Allerdings ist er momentan nicht gut auf Leonie zu sprechen. Er befürchtet, dass …, dass sie durchge… gebrannt sein könnte“, stammelte sie.
„Mit wem? Hat er einen bestimmten Verdacht?“ Gustav konnte sein Erstaunen schwer verbergen.
„Nein, nein, nicht dass ich wüsste. Er ist nur schrecklich wütend und sehr enttäuscht, dass sie zum zweiten Mal, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, verschwunden ist. Vor zwei Jahren war die Situation aber eine ganz andere. Leonie …“ Sie brach seufzend ab.
„Was wollten Sie gerade sagen?“
„Ich …, ich fühle, dass sie diesmal nicht einfach aus Lust und Laune davongelaufen ist, sondern dass viel Schlimmeres dahintersteckt. Eine Mutter spürt so etwas. Außerdem hat sie nichts bei sich, keine Kleider und Schuhe zum Wechseln. Selbst ihr Retikül habe ich in ihrem Nachtkästchen gefunden. Sie ist ohne Heller.“
„Sie befürchten, dass Ihre Tochter entführt worden ist?“
„Nicht auszudenken …“
„Aber Sie haben bisher keine Nachricht erhalten? Keinen Erpresserbrief, keine Lösegeldforderung?“
Sie schüttelte den Kopf. Ihre violetten Augen schimmerten feucht. Gustav wechselte rasch das Thema.
„Sie wohnen bei Ihrem Vater?“
„Ja, nach dem Tod meines Mannes sind Leonie und ich wieder in das Palais Schwabenau gezogen.“
Gustav kannte den neoklassizistischen Neubau am Parkring nur von außen. Er nahm sich vor, Herrn von Schwabenau sobald wie möglich in seinem Prunkbau aufzusuchen.
„Ich muss mit ihm reden. Wäre es Ihnen möglich, einen Termin für mich zu arrangieren?“
„Wie spät haben wir?“
„Viertel nach drei.“
„Am besten, Sie kommen gleich mit mir. Wenn wir Glück haben, treffen wir ihn zu Hause an. Um diese Zeit beendet er normalerweise sein Mittagsschläfchen.“
2
„Eine Kutsche?“ Gustav deutete auf den Fiakerstand gegenüber vor dem Hotel Imperial.
„Nein. Lassen Sie uns zu Fuß gehen, es ist nicht sehr weit.“
„Was für ein wunderschöner Tag“, sagte Gustav im Plauderton und bot ihr galant seinen Arm an.
Als sie sich ganz ungezwungen bei ihm einhängte, streifte ihr Busen seinen Ellbogen. Er spürte wieder Bewegung in seiner Hose.
Arm in Arm schlenderten sie die Ringstraße entlang. Der Lärm und Dreck auf den Baustellen am Straßenrand tat seinen romantischen Gefühlen keinerlei Abbruch. Ihr Parfüm raubte ihm beinahe den Atem. Oder war es all der Staub und Dreck? Wenn es nicht bald regnete, würde die Reichshauptstadt in einer dicken Staubwolke ersticken.
„Wien wird jetzt zur Großstadt demoliert“, hatte Karl Kraus in der Künstlerzeitschrift Wiener Rundschau geschrieben. Dieser kritische Geist hatte wieder einmal Recht gehabt, dachte Gustav. Die Fertigstellung der Ringstraße, der Bau der Gasleitung und die Regulierung des Wienflusses – Baustellen, nichts als Baustellen seit über zwanzig Jahren. Obwohl Gustav ein glühender Anhänger des Fortschritts und der Moderne war, litt auch er unter dieser permanenten Lärm- und Geruchsbelästigung.
Der vier Kilometer lange, kreisförmige Prachtboulevard rund um die Wiener Innenstadt war drei Jahre nach seiner Geburt eröffnet worden. Die wichtigste städtebauliche Veränderung in Wien seit dem Mittelalter, hatte sein Großvater einst stolz behauptet. Vorher sei Wien eine enge, dunkle und überfüllte Stadt gewesen, eingezwängt in mittelalterliche Mauern. Die Vorstädte ringsum waren durch das Glacis von der Stadt getrennt gewesen. Dieser unbebaute, vierhundertfünfzig Meter breite Wiesengürtel war früher als Exerzier- und Paradeplatz und als Erholungsgebiet genutzt worden. 1857 hatte Kaiser Franz Joseph das Billet zum Abbruch der Stadtmauern unterzeichnet. Die jahrzehntelangen Bauarbeiten waren bis heute nicht abgeschlossen. Aber zumindest waren seit 1890 die Vorstädte mit der Innenstadt vereint.
Als sie bei der Himmelpfortgasse angelangt waren, ertönte ein ohrenbetäubendes Poltern und Krachen. Lautes Wiehern, brüllende Stimmen, verzweifelte Schreie, zwischendrin leises Wimmern. Die Pferde einer Droschke waren durchgegangen. Das filigrane offene Gefährt war mit dem Waggon einer Pferdetramway zusammengeprallt und umgekippt. Die Geschirre der Pferde hatten sich ineinander verheddert. Zwei Pferde waren gestürzt. Die Insassen der Droschke lagen auf der Straße. Ein kleiner Junge war unter die Hufe eines Gauls geraten. Er blutete am Kopf. Die Frau, die sich kreischend über den Jungen beugte, war ebenfalls blutüberströmt. Das andere Kind, ein Mädchen von etwa vier Jahren, lag regungslos unter dem linken Hinterrad der Droschke.
Gustav wollte den Kindern zu Hilfe eilen. Margarete von Leiden presste sich jedoch eng an ihn, verbarg ihr Gesicht an seiner Brust und flüsterte unter Tränen: „Bitte bleiben Sie bei mir.“
Er streichelte ihren Rücken, um sie zu beruhigen.
„Es wird alles gut. Die Sicherheitswache ist schon da.“ Er fand sowohl sein Verhalten als auch seine Worte idiotisch. Obwohl sein bester Freund Rudi Kasper Oberkommissär bei der Polizei war, hielt er nicht viel von den k.k. Ordnungshütern. Gustav hatte prinzipiell ein Problem mit Autoritäten.
Ein Schuss und gleich darauf ein zweiter ließen Margarete von Leiden heftig zusammenzucken. Gustav befürchtete, sie würde jeden Moment in Ohnmacht fallen. Der Uniformierte hatte die beiden Pferde von ihren Qualen erlöst. Als Gustav genauer hinsah, bemerkte er, dass sich eines der Pferde noch bewegte. Auch Margarete sah es.
„Tierquälerei! Erschießen Sie den armen Gaul endlich!“, schrie sie.
Als der dritte Schuss ertönte, drängte sie darauf, weiterzugehen. Gustav zögerte. Sie zog ihn mit sich.
Nach ein paar Metern waren sie vor dem Eingangstor des Palais Schwabenau angelangt. Das Palais wirkte höher als die anderen fünfstöckigen Bauten rundum. Es protzte durch einen Dachaufbau, obwohl für die moderne Wiener Architektur ein gerader Gesimsabschluss ohne Dach, Kuppel oder andere Aufbauten typisch war.
Margarete schloss das schwere Eichentor auf und ging voran. In dem prächtigen Stiegenhaus aus weißem Marmor standen riesige Kandelaber und lebensgroße neoklassizistische Statuen.
„Mein Vater ist herzkrank und hat einen hohen Blutdruck. Er darf sich nicht aufregen“, sagte Margarete von Leiden leise, als sie die breite Treppe in die Beletage hinaufgingen. „Lassen Sie mich bitte zuerst allein mit ihm sprechen.“ Sie wirkte sehr nervös.
Gustav blieb ein paar Schritte hinter ihr zurück. Obwohl es seinen guten Manieren widersprach, hinter einer Frau die Stufen hinaufzusteigen, genoss er es, mit seinem Blick den aufreizenden Bewegungen ihrer Hüften folgen zu dürfen. Da er nur Augen für ihren durch eine große Schleife betonten Hintern hatte, lief er fast in einen der beiden mannshohen Kerzenständer am Ende der Treppe.
Die Wände der weitläufigen Galerie im ersten Stock waren holzgetäfelt. Eine mit Gold verzierte Kassettendecke ließ den Raum niedriger erscheinen, als er war. Der Geruch von Holzpolitur stieg Gustav in die Nase. Er musste niesen.
„Gesundheit“, wisperte Margarete von Leiden.
Als sie den Salon betrat, bedeutete sie ihm, in der Galerie zu warten. Allerdings schloss sie die Tür nicht ganz hinter sich.
„Ich habe einen Gast mitgebracht, Papa. Herr Gustav von Karoly ist Privatdetektiv und wurde mir vom Doktor Lipschitz wärmstens empfohlen. Er wird Leonie finden, glaub mir …“, hörte Gustav sie sagen.
Sie wurde von einer lauten, polternden Männerstimme unterbrochen. Herr von Schwabenau schimpfte, dass sie ihm einen Fremden ins Haus brachte. Obwohl er wahrscheinlich wusste, dass Gustav vor der Tür wartete, senkte er seine Stimme nicht, sondern maßregelte sie lautstark: „Dumme Gans …, nichts als Flausen im Kopf, genau wie deine Tochter … Ich habe eure Faxen gründlich satt!“
Für Gustav hatte er ebenfalls nur beleidigende Worte übrig: „Glaubst du im Ernst, dass so ein dahergelaufener Haderlump sie eher finden wird als meine Leute? Privatdetektiv nennt er sich? Das ist kein anständiger Beruf …“
Gustav spürte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss, und er überlegte, auf der Stelle kehrtzumachen und diesen Fall schnellstens zu vergessen. Parvenüs wie dieser Schwabenau trieben ihn zur Weißglut. Am liebsten hätte er diesen präpotenten Emporkömmling links und rechts geohrfeigt. Stattdessen griff er nach einer Alabastervase mit einem Makartbouquet, die auf einer Rokoko-Kommode thronte. Hob sie hoch und wollte das geschmacklose Ding gerade auf dem Boden zerschmettern, als Margarete von Leiden aus dem Salon trat.
„Bitte nicht!“, flehte sie ihn an.
Sie hatte Hut und Schleier abgelegt. Ihre dunkelbraune Haarpracht war in Auflösung begriffen, einige Strähnen hingen ihr ins Gesicht. Sie schaute ihn so verzweifelt an, dass seine Wut sogleich wieder verrauchte.
Herr von Schwabenau erschien hinter ihr und erwiderte Gustavs knappen Gruß mit einem kaum merklichen Nicken.
„Gehen wir in den Salon.“ Er deutete Gustav, ihm zu folgen. „Lass uns allein“, herrschte er seine Tochter an.
Sie zuckte zusammen, gehorchte jedoch und eilte von dannen, ohne auf Wiedersehen zu sagen.
Herr von Schwabenau war eine imposante Erscheinung. Er war genauso groß wie Gustav, der mit einem Meter fünfundachtzig Gardemaße hatte, aber um mindestens dreißig Kilo schwerer. Sein eleganter heller Sommeranzug hatte bestimmt ein kleines Vermögen gekostet. Gustav erkannte sofort die Handschrift des k. k. Hofschneiders Ranitzky am Graben. Der alte Freiherr hatte noch volles graues Haar. Sein dichter, gepflegter Backenbart erinnerte an die Barttracht des Kaisers. Seine blauen, fast violetten Augen ließen Gustav jedoch sogleich an Margaretes Augen denken. Auch den großen Mund mit den vollen, sinnlichen Lippen hatte seine Tochter offensichtlich von ihm geerbt.
Der alte Herr platzierte sich vor dem Kamin, auf dessen Sims eine Marmorbüste von ihm stand. Die Ähnlichkeit war verblüffend. Der Bildhauer ein Naturalist.
Gustav blickte sich in dem großen Salon um, während sich von Schwabenau gemächlich eine Zigarre anzündete. Seinem Gast bot er keine an.
Ein prächtiger Kronleuchter hing von der mit allegorischen Figuren bemalten Decke herab. Die goldbestickten Gardinen an den Fenstern waren zugezogen. An den Wänden hingen wertvolle Gobelins. Gustav erkannte einige Szenen aus der germanischen Mythologie. Bordeauxrote Tapeten, dicke Perserteppiche. Glasvitrinen bestückt mit Meißner Porzellan. Verschnörkelte Biedermeier-Kommoden, ein Louis-XVI-Schreibtisch, der so gar nicht zu den schweren altdeutschen Schränken passte. Zwei Sofas, die unter dicken Seidenkissen verschwanden. Mehrere bequem aussehende Fauteuils um ein filigranes Couchtischchen gruppiert – ein Sammelsurium aus teuren, wild zusammengewürfelten Möbeln und golden leuchtenden Accessoires. Vergoldete Kerzenständer, goldene Uhren, goldene Putten und goldfarbene Bilderrahmen … Gold, Gold und wieder Gold. Im Hause Schwabenau zeigte man, was man hatte.
„Sagen Sie mir in wenigen Worten, was Sie zu tun gedenken. Ich lasse mir nicht gern meine Zeit stehlen.“ Herr von Schwabenau blies Gustav den Rauch seiner Zigarre ins Gesicht.
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Auftrag Ihrer Tochter überhaupt annehmen werde.“ Mit hochgezogenen Brauen betrachtete Gustav die beiden riesigen Bilder an der Stirnwand des Salons. Diese Hans-Makart-Epigonen waren ihm ein Dorn im Auge. Er fand ihre Arbeiten schwülstig und pathetisch. Es fehlte ihnen die Grandezza ihres Herrn und Meisters. Sein Blick wanderte zu den versperrbaren Bücherschränken. Die Bücher hinter den sauber geputzten Glasscheiben sahen alle neu aus. Hauptsächlich Enzyklopädien, Atlanten, die Edda und die gesammelten Werke von Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. Lauter prächtige Ledereinbände mit Goldprägungen. Einige Buchrücken sahen verdächtig nach Attrappen aus. Was man als Neureicher halt so im Schrank haben muss, dachte Gustav amüsiert. Er war endgültig davon überzeugt, dass Herrn von Schwabenaus Nobilitierung erst vor kurzem stattgefunden hatte. Wahrscheinlich war er wegen seiner Verdienste um die Verschmutzung der Stadt in den Adelsstand erhoben worden, dachte er boshaft.
„Was finden Sie so witzig?“, schnauzte ihn der Alte an.
„Ich bewundere Ihren erlesenen Geschmack.“ Gustav verbeugte sich lächelnd. Sein Zynismus prallte an dem alten Schwabenau ab. Sinn für Humor und feine Zwischentöne schienen ihm völlig fremd zu sein.
„Sie trauen sich also zu, meine Enkelin aufzuspüren? Wie werden Sie vorgehen? Damit eines von Anfang an klargestellt ist: Ich will keine Polizei. Verstehen wir uns richtig, Herr Karolli.“
„Von Karoly!“
„Ungar, eh?“
„Mein Großvater, Albert von Karoly, war Stallübergeher beim Kaiser.“
Tatsächlich wurde der Alte daraufhin eine Spur freundlicher.