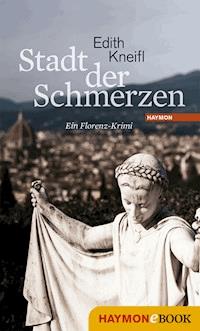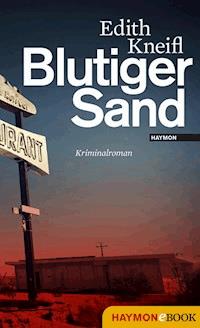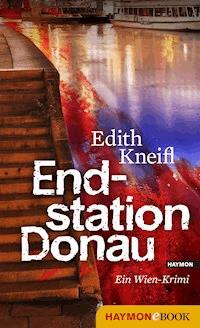
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Katharina Kafka & Orlando-Krimis
- Sprache: Deutsch
AUF DER DONAU WIRD GESCHMUGGELT UND GEMORDET, WIEN IM VISIER DER MAFIA Für die Schönheit der Donau haben die beiden Kleinkriminellen Marko und Toni wenig Zeit, sind sie doch dabei, sich in der osteuropäischen Mafiaszene Wiens nach oben zu arbeiten. Während sie immer mehr in Schwierigkeiten geraten, kommt es einige Kilometer weiter auf einem Donaukreuzfahrtschiff zu einem mysteriösen Vorfall. Die Wiener Kellnerin Katharina Kafka, die mit ihrem Freund Orlando an der Schiffsbar angeheuert hat, erblickt im Wasser vor dem Bullauge ihrer Kabine eine Leiche. Und bald ist klar: Auf der "MS Kaiserin Sisi" geht es nicht mit rechten Dingen zu. Neben Kreuzfahrtpassagieren scheint das Schiff auch heiße Ware zu befördern. Hat die Mafia ihre Finger mit im Spiel? Ist Kafka gar dabei, sich in einen Kriminellen zu verlieben? Je weiter sich die "MS Kaiserin Sisi" Wien nähert, desto dramatischer wird die Lage. Die Abgründe der Wiener Seele sind Edith Kneifls Spezialität. Ebenso wie für die Donau gilt: So friedlich und ruhig die Oberfläche auch wirken mag, darunter verbirgt sich oft Böses! WEITERE KRIMIS MIT DEM ERMITTLERDUO KATHARINA KAFKA UND ORLANDO: - Schön tot - Blutiger Sand - Stadt der Schmerzen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edith Kneifl
Endstation
Donau
Ein Wien-Krimi
Inhalt
Titel
Widmung
1. Wien
2. Tulcea, Rumänien
3. Wien
4. Donau: Rumänien
5. Donaumündung, Schwarzes Meer
6. Wien
7. Donaudelta
8. Wien
9. Constanza, Mamaia, Rumänien
10. Wien
11. Russe, Bulgarien
12. Wien
13. Donau: Russe – Nikopol
14. Wien
15. Donau: Nikopol – Vidin
16. Wien
17. Donau: Eisernes Tor
18. Wien
19. Belgrad
20. Wien
21. Belgrad
22. Belgrad
23. Wien
24. Donau: Belgrad – Apatin
25. Wien
26. Apatin, Serbien
27. Wien
28. Donau: Apatin – Budapest
29. Wien
30. Donau: Ungarn
31. Budapest
32. Wien
33. Donau: Budapest – Esztergom
34. Esztergom
35. Wien
36. Wien
37. Wien
38. Wien
39. Wien
Endstation
Edith Kneifl
Zur Autorin
Impressum
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
für Stefan
1. Wien
Wien. Mexikoplatz. Kurz vor vier Uhr morgens. Kein Mond, keine Sterne. Selbst die Straßenbeleuchtung im zweiten Wiener Gemeindebezirk ließ zu wünschen übrig.
Zwei dunkel gekleidete Gestalten schleppten einen prall gefüllten Leinensack durch den verwahrlosten Park am Donauufer.
Ein eisiger Wind pfiff durch die Bäume. Es war viel zu kalt für diese Jahreszeit. Der Sommer hatte sich gerade erst verabschiedet. Trotz der niedrigen Temperaturen standen den Männern Schweißperlen auf der Stirn. Fluchend setzten sie den Sack auf dem Rasen ab.
„Scheiße! Mach nicht solchen Krach, Toni“, flüsterte der Kleinere der beiden. Ein stämmiger Mann Anfang dreißig. Er hatte pechschwarzes Haar und ein auffallend unproportioniertes Gesicht: niedrige Stirn, schiefer Mund und fliehendes Kinn.
„Beruhig dich, Marko. Hier ist kein Mensch.“
„Bist du blind, Mann?“ Marko deutete auf eine Parkbank.
Unter einem Berg von Zeitungen sah man ein bärtiges Gesicht.
„Der ist so betrunken, dass er nichts mehr mitkriegt.“ Toni nahm ein Zigarettenpäckchen aus seiner Hosentasche. Steckte sich eine an. Reichte das Päckchen dann seinem Freund. „Warum müssen wir bloß immer die Drecksarbeit machen?“
„Weil wir noch auf Probe sind.“
„Du meinst, die trauen uns nicht?“
„Endlich geschnallt, Mann?“
Das monotone Rauschen des Flusses war um diese frühe Stunde das einzig vernehmbare Geräusch. Nur ab und an drang Motorenlärm von der sechsspurigen Auffahrt zur Reichsbrücke zu ihnen hinunter. Pendler auf dem Weg zur Arbeit? Oder Nachtschwärmer auf dem Nachhauseweg?
Die Glocke der Franz-von-Assisi-Kirche schlug viermal.
Marko zuckte zusammen.
„Die Stunde des Todes“, flüsterte er.
„Sag bloß, du bist abergläubisch?“
„Meine Großmutter hat behauptet, dass der Tod die meisten Menschen um diese Stunde holt.“
„Und meine hat behauptet, dass die Donau blau sei. Schau dir das Wasser an. Dabei haben die überall Kanalisation. Trotzdem könnte man glauben, dass der ganze Dreck der Stadt hier vorbeischwimmt.“
„Wieso? Ich sehe nur schwarz.“
„Das weiß ich.“
Marko, völlig unempfänglich für Ironie, wollte weiter über die Farbe der Donau diskutieren Toni brachte ihn mit einer energischen Handbewegung zum Schweigen.
„Sei still. Da ist jemand.“
„Ratten! Wenn ich eine Scheiß-Knarre dabei hätte, würde ich diese Scheiß-Viecher sofort abknallen.“
„Musst du dauernd solche Kraftausdrücke verwenden?“
Marko antwortete nicht, sondern gab komische Geräusche von sich, die entfernt nach dem Knattern eines Maschinengewehrs klangen.
Er war ein Fan von amerikanischen Kriminalfilmen. Sein Wortschatz in Deutsch stammte von synchronisierten B-Movies der achtziger und neunziger Jahre.
„Ich krieg bald eine Knarre, hat Vladimir gesagt.“
„Keine Schusswaffen, habe ich gesagt!“
„Bleib cool, Mann. Du brauchst ja keine. Es genügt, wenn ich eine hab.“
Toni hatte seinem Freund schon mehrmals zu verstehen gegeben, dass er Waffen prinzipiell ablehnte. Dieser schießwütige kleine Kerl wollte das einfach nicht kapieren.
Mittlerweile waren sie unter der Reichsbrücke angekommen.
Dieses Mal legten sie den Sack behutsam auf den Boden. Ein leises Klirren war trotzdem zu hören.
„Wir sind zu früh“, sagte Marko.
„Nein, vier Uhr war abgemacht. Sie sind zu spät.“
2. Tulcea, Rumänien
Es war zu spät, um umzukehren. Ich bereute längst, mich auf dieses Abenteuer eingelassen zu haben. Was für ein reizloser, schmuddeliger Hafen, dachte ich beim Anblick der heruntergekommenen Lagerhäuser und verrosteten Kräne, die in den strahlend blauen Himmel ragten.
Ich saß mit meinem Freund Orlando in einem Gastgarten in der rumänischen Stadt Tulcea. Unser Tisch stand nahe am Donauufer, eine alte Linde spendete dürftigen Schatten. Es war Mitte September und hatte um die dreißig Grad.
„Tulcea ist sozusagen das Nadelöhr zum Donaudelta“, sagte ich zu Orlando. „Du wirst sehen, das Delta wird dir gefallen.“
Seit wir in Bukarest den Flieger verlassen hatten, schmollte er. Es war sein erster Besuch in einem ehemals sozialistischen Land.
Ich hatte ihm von der grandiosen Landschaft und der beeindruckenden Weite Rumäniens vorgeschwärmt. Er interessierte sich jedoch nur für Graf Dracula. Seit er kapiert hatte, dass Transsylvanien von der Donau weit entfernt ist und sich ein Abstecher dorthin nicht ausgehen würde, ließ er mich seine Enttäuschung spüren.
Ich war an seine Launen gewöhnt. Orlando war eben eine Zicke. Dennoch versuchte ich ihn aufzuheitern, indem ich den tollen Kaviar erwähnte, den wir hier kriegen würden. Mein Freund gebärdete sich gern als Gourmet, obwohl Pizza Margherita seine Lieblingsspeise war.
„Kaviar?“
„Ja, den unbefruchteten Rogen von Stören.“
„Hier gibt’s bald keinen Kaviar mehr. Hab gerade erst gelesen, dass die Störe vom Aussterben bedroht sind. Durch den Bau der Wasserkraftwerke und Staudämme haben sie ihre Laichgründe verloren. Außerdem werden sie wegen ihrer Eier schlicht und einfach abgeschlachtet …“
„Quatsch! Der Stör ist der Fisch der Donau! Er wird sogar ‚der König der Donau‘ genannt.“
„Du bist wieder mal nicht am Laufenden, Kafka. In dem Artikel stand, dass durch die hemmungslose Wildfischerei und den illegalen Kaviarhandel die Störe beinahe ausgerottet wurden. Obwohl die bulgarischen und rumänischen Behörden ein vierjähriges Fangverbot für Störe in der Donau und im Schwarzen Meer verhängt haben, werden diese armen Fische wegen ihrer heißbegehrten Eier zu tausenden umgebracht.“
„Störe gab es schon vor zweihundertfünfzig Millionen Jahren und wird es immer geben. Mag sein, dass einige Arten wegen der Überfischung bedroht sind, aber sicher nicht alle.“
„Ich habe noch nie einen Stör gesehen.“
„Kein Wunder. Sie schwimmen ja auch am Grund des Flusses. Angeblich sind sie genauso alt wie Dinosaurier. Haben aber im Gegensatz zu denen überlebt.“
„Sie sehen den Dinos wirklich ähnlich.“ Orlando zeigte mir ein Foto, das er im Internet gefunden hatte.
„Du weißt, dass die Roaming-Gebühren irrsinnig hoch sind? An deiner Stelle würde ich nicht ständig im Internet surfen.“
„Ich schalte es gleich aus.“
Missmutig starrten wir beide auf den langen, alten Kahn, der direkt vor dem Lokal angelegt hatte.
Die „MS Kaiserin Sisi“ war nicht gerade das neueste Schiff der rumänischen Kreuzfahrt-Flotte. Obwohl es vor ein paar Jahren generalsaniert worden war, mangelte es ihm an Schick und vor allem an Komfort. Die Kabinen, selbst die Doppelkabinen auf Deck 1, waren sehr klein. In den Toiletten und Duschen konnte man sich kaum umdrehen. Die Klimaanlage funktionierte nur hin und wieder und bei über dreißig Grad Außentemperatur gab sie vollends den Geist auf.
Als ich Orlando erzählt hatte, dass das Schiff, auf dem wir die nächsten fünf Wochen verbringen würden, nach seiner geliebten österreichischen Kaiserin benannt war, konnte er sich vor Begeisterung kaum einkriegen.
Orlando hatte einen Sisi-Tick. Als wir uns kennenlernten, machte er des Nachts in langen Sisi-Roben die Straßen Wiens unsicher. All meine Überredungskünste waren vonnöten gewesen, ja ich hatte ihn sogar regelrecht erpressen müssen, hatte gedroht, ihm die Freundschaft zu kündigen, wenn er diese idiotische Verkleidung nicht ablegte. Ich habe kein Problem damit, dass er Transvestit ist, aber dieser Sisi-Wahn überstieg meine Toleranzgrenze.
„Kreuzfahrt – dass ich nicht lache! Sieh dir dieses Prachtstück an. Alles verrostet und schnell überstrichen“, meckerte er.
„Das sieht dein Malerauge sofort.“
Orlando war ein begabter Maler, aber leider ein faules Aas. Vom Verkauf seiner Bilder konnte er ebenso wenig leben wie ich von den zeitgeschichtlichen Projekten über Roma und Sinti, an denen ich hin und wieder mitarbeitete.
„Spotte ruhig. Du wirst noch beten, dass wir heil nachhause kommen.“
„Was soll uns auf einem Schiff passieren? Noch dazu auf einem Fluss? Wenn es untergehen sollte, schwimmt man halt an Land.“
„Da spuckt mal wieder jemand große Töne. Gestern hast du fast geflennt, als es ein paar harmlose Turbulenzen gegeben hat.“
„Ich habe Flugangst. Das ist ganz was anderes.“
„Und ich habe Angst vorm Wasser. Ertrinken ist bestimmt ein sehr qualvoller Tod.“
„Quatsch, im Gegenteil, ich stelle mir vor, dass das eine sehr angenehme Todesart sein könnte.“
„Du bist morbid, Kafka!“
„Und du bist ein Angsthase.“
„Jeder hat eben seine Ängste.“
Ich hatte keine Lust auf eine Fortführung dieses idiotischen Gesprächs und zündete mir eine Zigarette an.
Orlando setzte an, mich zum hundertsten Mal zu ermahnen, dass mich die Zigaretten noch eines Tages ins Grab bringen würden. Mit einem heftigen „Halt den Mund“ gebot ich ihm zu schweigen. Als ich seinen verletzten Blick bemerkte, bereute ich es sogleich, ihn derart angefahren zu haben.
„Glaubst du nicht auch, dass diese rumänische Airline TAROM bis heute die alten, längst schrottreifen, sowjetischen Tupolews einsetzt?“
„Wir sind mit einer stinknormalen McDonnell Douglas geflogen, meine Liebe.“
„Sind die nicht ebenfalls steinalt?“
„Mag sein. Wir sind heil angekommen und nur das zählt, oder?“
Vor nunmehr etwa zehn Tagen rief mich überraschender Weise mein Onkel Sandor an. Letztes Frühjahr hatte ich mit Orlandos Hilfe den zweiten Mörder meiner Eltern in den USA überführt. Daraufhin hatte ich meinen Patenonkel, den Bruder meiner Mutter, per Internet gesucht. Wir Roma haben überall auf der Welt Verwandte. Schließlich hat einer meiner Cousins Sandor wirklich in einer Bar in Marseille entdeckt. Die Bar gehörte seiner aktuellen Lebensgefährtin, und er geigte dort an den Wochenenden auf.
In Wien hatte er den Ruf gehabt, ein Teufelsgeiger zu sein. Seine Fans hatten ihn für fast so begnadet gehalten wie Paganini. Ich war damals sehr stolz auf meinen berühmten Onkel.
Nachdem ich die Telefonnummer der Bar herausgefunden hatte, telefonierten wir ein paar Mal miteinander. Es hatte ihn schwer beeindruckt, dass ich den Mörder seiner geliebten Schwester zur Strecke gebracht hatte. Nach ein paar Wochen war der Kontakt aber wieder eingeschlafen. Sandor war kein großer Telefonierer. Deshalb freute ich mich letztens auch sehr über seinen Anruf.
Er fragte mich, ob ich nicht Lust auf eine kostenlose Kreuzfahrt hätte. Und meinen kleinen, tapferen Freund sollte ich gleich mitbringen.
Ich bin studierte Historikerin, verdiene mir jedoch meinen Lebensunterhalt seit Jahren als Barkeeperin. Da ich gerade ohne Job war und Orlando sowieso seine Arbeitsplätze wechselte wie seine Unterwäsche, fragte ich, welche Gegenleistung ich dafür bringen müsste.
„Die Bar übernehmen“, sagte Sandor. „Du wärst Chef de Bar.“
Als er mir vorrechnete, wie viel ich auf drei Donaukreuzfahrten in fünf Wochen verdienen würde, sagte ich, ohne Orlando zu fragen, für uns beide zu.
Ich hätte mir denken können, dass diese Geschichte einen Haken hatte.
Sandor hatte, was den angeblich so tollen Lohn betraf, das durchschnittliche Trinkgeld miteingerechnet und auch verschwiegen, dass wir einen 16-Stunden-Tag haben würden. Gestern bei meinem Vorstellungsgespräch mit dem rumänischen Kapitän begriff ich zudem, dass auf dem Schiff ein permanenter Personalwechsel herrschte. Kein gutes Zeichen, das wusste ich aus Erfahrung.
Der Kapitän war nicht unsympathisch und sah auch nicht übel aus. War groß, breitschultrig und hatte dunkelblondes, dichtes Haar. Aber seine hohe Stimme, die so gar nicht zu seinem kräftigen Körper passte, missfiel mir ebenso wie die ersten Worte, die er an mich richtete. „Ah, du bist die kleine Zigeunerin.“
„Mein Name ist Katharina Kafka. Magistra Kafka.“
Normalerweise erwähne ich meinen akademischen Titel nie. Es ärgerte mich nur, dass er mich duzte. Ich bin vierzig Jahre alt und einen Meter fünfundsiebzig groß – von wegen kleine Zigeunerin!
„Einen studierten Chef de Bar hatten wir meines Wissens noch nie.“ Falls er beeindruckt war, ließ er es sich nicht anmerken.
„Wenigstens wird sie rechnen können“, sagte er zum Ersten Offizier, der uns keinerlei Beachtung geschenkt hatte und auch jetzt nicht vom Bildschirm seines Laptops aufblickte.
„Das ist korrekt“, hörte ich ihn nach ein paar Sekunden leise sagen.
„Uniformen habt ihr euch besorgt?“ Der Kapitän musterte Orlando, der ein schickes, rosafarbenes Etuikleid trug, abschätzig von Kopf bis Fuß.
Ich hatte uns in Wien blaue Uniformen gekauft. Orlando hatte beteuert, dass er so eine Scheußlichkeit nicht anziehen würde, während ich es eher als Zumutung empfand, dass wir unsere Arbeitskleidung selbst bezahlen mussten.
„Ja, haben wir“, sagte ich, da Orlando es vorzog zu schweigen.
In diesem Augenblick schneite der Kreuzfahrtdirektor herein. Er begrüßte uns freundlich lächelnd und wandte sich dann mit einer Frage an den Kapitän.
Ich betrachtete unser Vorstellungsgespräch als beendet, wünschte allen einen guten Tag und verließ mit Orlando im Schlepptau die Kommandobrücke.
Der Kreuzfahrtdirektor schien okay zu sein. Er war Deutscher und hieß Bernhard.
Gestern Abend an der Bar, als noch keine Gäste an Bord waren, hatte er mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, dass die MS Kaiserin Sisi vor kurzem in einer Werft in Belgrad technisch überholt werden hatte müssen. Sie hatten auf der Fahrt von Wien ins Donaudelta kurz nach Belgrad einen Maschinenschaden gehabt. Die Passagiere hatten von Belgrad aus den Heimflug antreten müssen und die Hälfte der Mannschaft hatte das Schiff mit ihnen verlassen. Deshalb hätten sie so rasch neues Personal für Bar, Küche und Service gebraucht.
Er deutete an, dass mein Onkel, der vom rumänischen Reiseveranstalter als Alleinunterhalter engagiert worden war, eine anständige Provision kassiert hätte, weil er ihnen so schnell Ersatz verschafft hatte.
Das konnte ich mir gut vorstellen. Obwohl ich meinen Patenonkel liebe, halte ich ihn für einen Gauner. Von meinen nahen Verwandten sind mir aber nur Sandor und mein Großvater väterlicherseits geblieben. Wahrscheinlich hatte ich hunderte Verwandte in aller Welt. Doch die kannte ich nicht näher.
Leider war Orlando dabei gewesen, als Bernhard von den technischen Problemen gesprochen hatte. Seither nervte er mich mit seinen Untergangsphantasien.
„Diese alte Fregatte ist total marod“, fing Orlando wieder zu meckern an als wir zurück aufs Schiff gingen.
„Mit ‚alte Fregatte‘ meinst du wohl die Kaiserin Elisabeth?“
„Hör auf, Kafka! Mir schwant Übles. Diese Reise steht unter keinem guten Stern! Spürst du das denn nicht? Was ist bloß los mit dir?“
Früher hatte Orlando oft behauptet, ich würde wegen meiner Roma-Vorfahren über den sechsten Sinn verfügen und hellsehen können. Mittlerweile bildete er sich ein, selbst diese Fähigkeit zu besitzen.
„Du weißt, ich halte nicht viel von Intuitionen.“
„Ich schon. Vor allem von deinen und meinen eigenen.“
„Nun gut. Wir werden es mindestens mit zwei oder sogar drei mysteriösen Todesfällen zu tun kriegen. Darauf wette ich, wenn ich an das Alter unserer Passagiere denke.“ Lachend legte ich den Arm um Orlandos Taille und schubste ihn mehr oder weniger über die Gangway an Bord.
Unser Dienst begann um achtzehn Uhr.
„Du fällst in deiner Heimat ganz schön auf mit deinen roten Haaren“, sagte Orlando, als er in einem eleganten, weißen Sommerkleid und perfekt geschminkt die Bar betrat.
„Rumänien ist nicht meine Heimat. Ich bin genauso Wienerin wie du.“
Orlando kicherte.
„Was gibt es da zu lachen?“
„Anscheinend hast du endlich kapiert, dass ich auch eine ‚in‘ bin.
„Idiot.“
„Warum wirst du immer gleich ausfallend? Im Ernst, die Leute in Tulcea haben uns beide angestarrt, als hätten sie noch nie Rothaarige gesehen.“
Zu meinem Leidwesen hatte sich Orlando am Tag vor unserer Abreise in Wien eine rote Mèche in seine kinnlangen, dunkelblonden Haare machen lassen. Man hielt uns nun tatsächlich für Schwestern. Seit ich ihm abgewöhnt hatte, in langen, wallenden Kleidern herumzulaufen, hatte er sich auf Vintage-Klamotten verlegt und bemühte sich, wie die berühmte, leider viel zu früh verstorbene Sisi-Darstellerin Romy Schneider auszusehen.
„Außerdem habe ich die roten Haare von meinem österreichischen Vater geerbt. Meine Mutter war dunkelhaarig, wie oft soll ich dir das noch erzählen? Und sie stammte weder aus Rumänien noch aus Ungarn, sondern war eine österreichische Romni.“
„Aber du sprichst ungarisch.“
„Ja, weil meine Großmutter eine ungarische Romni war. Könnten wir das Thema bitte beenden? Ich denke, du solltest dich schleunigst umziehen.“
„Muss ich wirklich diese grauenhafte blaue Uniform anziehen? Blau steht mir überhaupt nicht. Vor allem dieses langweilige Marineblau …“
„Orlando, du kannst sofort wieder heimfliegen …“
„Ich bin schon unterwegs. Mach mir inzwischen einen Capuccino, Baby“, zwitscherte er und eilte nach unten.
Wir bewohnten zu zweit eine Viererkabine. Nachdem ich mir die Unterkunft der Matrosen kurz angesehen hatte, versuchte ich erst gar nicht, mich zu beschweren. Trotzdem fand ich unsere enge Kabine ebenso grässlich wie Orlando.
Sie hatte kein Fenster, sondern ein winziges Bullauge, das sich zu einem Drittel unter Wasser befand. Bei stärkerem Wellengang verschwand es gänzlich.
Ich kam mir vor wie in einem Aquarium. Nur, dass Fische jetzt uns begafften.
Das Wiedersehen mit meinem Onkel Sandor an diesem Abend verlief relativ unsentimental.
Ich war erstaunt, dass er sich in all den Jahren, in denen wir uns nicht gesehen hatten, kaum verändert hatte. Er sah blendend aus, hatte weder einen Wohlstandsbauch noch Haarausfall. Im Gegenteil, er trug sein graues, dichtes Haar nach wie vor schulterlang. Seine kantigen, sonnengegerbten Züge und vor allem seine großen, grünen Augen brachten bestimmt auch heute noch einige Frauen um ihren Verstand.
Ich rechnete in Gedanken kurz nach, wie alt er war. Sandor war der jüngste Bruder meiner Mutter. Sie hatte ihn praktisch aufgezogen. Meine Mutter wäre heuer siebzig geworden, wenn diese Psychopathen sie nicht umgebracht hätten. Also musste mein Onkel ungefähr Sechzig sein.
Orlando und ich plauderten eine Weile mit ihm. Ich schilderte ihm noch einmal in Kurzfassung unseren abenteuerlichen USA-Trip. Als ich beschrieb, wie der Mörder meiner Mutter zu Tode gekommen war, wirkte er sehr befriedigt und gab eine Runde aus. Danach zog er sich bald in seine Kabine zurück. Ein alter Mann wie er brauche seinen Schlaf, behauptete er. Ich verdächtigte den alten Womanizer noch ein Rendezvous zu haben.
Orlando schaute nach der Arbeit auf einen Sprung ins örtliche Casino. Ich war zu kaputt, um ihn zu begleiten. Machte mir jedoch ernsthaft Sorgen um ihn.
Orlando war ein leidenschaftlicher Spieler. Letztes Frühjahr in Las Vegas war es mir nur mit Müh und Not gelungen, ihn von den Roulettetischen fernzuhalten. Doch an diesem Abend in Tulcea konnte ich ihn nicht davon abbringen, wenigstens einen Blick in das örtliche Casino zu werfen. Da er zwei Stunden später in unserer Kabine aufkreuzte und beteuerte, umgerechnet etwa hundert Euro beim Pokern an einem Automaten gewonnen zu haben, verzichtete ich auf jeden Kommentar.
„Unser Käpt’n war auch dort. Aber er hat mich nicht gesehen. War zu sehr in seine Karten vertieft. Er hat übrigens Black Jack gespielt.“
Es war zwei Uhr früh, als ich endlich einschlief.
3. Wien
Fünf Uhr morgens. Motorengeräusche hallten unter der Reichsbrücke wider. Sie kamen nicht von der Straße. Ein schnittiges weißes Motorboot tauchte aus der Dunkelheit auf. Näherte sich langsam dem Ufer.
Toni und Marko hoben den Leinensack hoch. Warteten, bis das Boot auf einen Meter herangekommen war. Warfen den Sack dann an Bord.
Der Mann am Heck reichte ihnen ein dickes Kuvert.
Der Mann am Steuer gab Gas.
Rasch entfernte sich das Boot wieder.
Toni und Marko machten sich auf den Weg zu ihrem Wagen. Im Schein einer Straßenlaterne öffnete Toni das Kuvert.
Fotos von Häusern, ein Straßenplan, diverse Adressen … Das Übliche eben.
„Hast du es nicht auch satt, die Wohnungen von irgendwelchen Leuten auszuräumen? Da ist nicht wirklich was zu holen. Das ist Kinderarbeit. Meine Stiefsöhne könnten diese Jobs ebenso gut erledigen wie wir. Ich will endlich mal für einen größeren Coup eingeteilt werden.“
„Du bist ein Neuer, Mann.“
„Aber du bist schon eine Weile dabei. Warum muten sie dir solchen Kleinkram zu?“
Marko zuckte mit den Achseln.
Weil du ein gutmütiger Trottel bist, dachte Toni. „Hast du die Handynummer vom Boss?“
„Hab nur die vom Vladimir.“
„Der hat nichts zu reden. Außerdem ist er ein gefährlicher Psychopath.“
„Das bin ich auch.“
„Wer hat das behauptet?“
„Der Erzieher in dem Scheiß-Heim, wo ich war. Er hat mich gehasst …“
„Lass es gut sein. Hauen wir ab. Es wird gleich hell.“
Sie fuhren mit Markos altem VW Passat Richtung Praterstern. Vor einem Café am Anfang der Heinestraße fanden sie einen Parkplatz.
Sie bestellten zwei Gulaschsuppen bei der übernächtig aussehenden Wirtin.
Marko wollte ein Bier. Toni Kaffee und Mineralwasser.
„Du wirst Läuse im Bauch kriegen, wenn du soviel Wasser säufst.“
„Und du wirst richtig fett werden, wenn du weiterhin soviel Weißbrot in dich hineinstopfst.“
Marko hatte bereits ein ofenwarmes Salzstangerl verdrückt. Er wollte gerade nach dem nächsten greifen, zögerte aber nach Tonis Bemerkung.
„Im Ernst, du bist in letzter Zeit ganz schön aus dem Leim gegangen.“ Toni klopfte seinem Freund auf den Bierbauch.
„Du hast leicht reden, Mann. Kannst fressen und saufen, soviel du willst, und bleibst trotzdem zaundürr. Vielleicht hast ja einen Wurm?“
„Einen Wurm? Wieso?“
„Meine Oma hat gesagt, dass die Dünnen einen Bandlwurm im Magen haben, der ihnen alles wegfrisst.“
„Prost! Auf deine Oma und meine Läuse und Würmer!“
Toni wusste, dass Marko bei seiner rumänischen Großmutter aufgewachsen war. Als sie ein Jahr nach dem Zusammenbruch des Ceauşescu-Regimes starb, kam er als Siebenjähriger gemeinsam mit anderen Straßenkindern von Bukarest nach Wien. Er wuchs in einem Flüchtlingsheim auf. Mit dreizehn schloss er sich einer kriminellen Bande an. Arbeitete eine Zeitlang als Taschendieb in den Einkaufsstraßen von Wien. Als er erwischt wurde, war er noch minderjährig. Statt in den Knast wurde er wieder in ein Heim gesteckt und einem Resozialisierungsprogramm unterzogen. Dort lernte er Boxen. Der Trainer konzedierte ihm großes Talent. Im Mittelschwergewicht hätte er es weit bringen können. Sein Chef brauchte ihn jedoch bald wieder für weniger sportliche Kämpfe.
Marko hatte seine Mutter kaum gekannt. Sie war in den dunklen Gassen der Bukarester Altstadt dem horizontalen Gewerbe nachgegangen. Seinen Vater hatte er nie zu Gesicht bekommen. Er behauptete, sein Alter wäre ein wichtiger Capo bei der rumänischen Mafia gewesen.
Toni bestellte einen zweiten Kaffee und starrte beim Fenster hinaus.
Auf dem Praterstern staute sich der Verkehr. Fußgänger waren an diesem trüben Morgen kaum unterwegs.
„Der Boss hält große Stücke auf dich, Mann.“
„Davon hab ich bisher nichts bemerkt. Der kennt mich doch gar nicht.“
„Der hat seine Augen überall.“
„Man könnte fast glauben, du sprichst vom lieben Gott.“
„Vladimir hat’s mir gesteckt. Er ist eifersüchtig. Du solltest dich vor ihm in Acht nehmen.“
„Ruf ihn an. Sag ihm, dass ich keine Lust mehr auf diese Brüche habe. Entweder bietet er mir einen lukrativeren Job an oder ich steige aus.“
„Du bist nicht ganz dicht, Mann. Den Boss kann man nicht einfach anrufen. Der redet nicht mit unsereins. Außerdem hab ich seine Nummer nicht. Das Geschäftliche läuft alles über Vladimir.“
„Dann ruf den an.“
„Um diese Zeit? Es ist erst halb acht.“
„Na und? Meinst, die schlafen noch?“
Zögernd griff Marko zu seinem Handy und wählte Vladimirs Nummer.
Er stammelte ein paar Entschuldigungen. „Ja, tut mir leid. Ich weiß …, wollt nur sagen, dass alles gut gelaufen ist. … Ja, Ware unterwegs …“
„Gib ihn mir, ich sage es ihm selbst.“ Toni riss seinem Kumpel das Handy aus der Hand.
„Ich will den Boss sprechen! – Bist du taub? – Halt den Mund! Mit dir rede ich nicht. – Ja, droh mir ruhig. Ich habe schreckliche Angst vor dir.“ Plötzlich änderte sich sein Tonfall. Freundlich aber bestimmt erzählte er seinem Gesprächspartner von seinem Plan.
„Einen Moment bitte. Habe fast keinen Empfang.“ Toni stand auf und ging mit dem Handy am Ohr vor die Tür: „Nein, ohne Marko mache ich es nicht … Ja, ich habe mich dort gründlich umgesehen … Wir brauchen keinen Aufpasser … Wie Sie meinen … Ja, von mir aus … Ja, ich habe verstanden. Vladimir hat das Sagen. Okay.“
Als er in das Lokal zurückkehrte, sagte er zu Marko: „Auf ins Goldene Quartier!“
„Scheiße Mann! Du hast echt mit dem Boss telefoniert?“
„Ja, und er hat uns grünes Licht gegeben. Leider hat er darauf bestanden, dass Vladimir mit von der Partie ist.“
„Ist das abgefahren! Echt krass, Mann! Darauf brauche ich gleich noch ein Krügerl.“ Er boxte Toni spaßhalber in die Rippen.
„Aua! Spinnst du?“
„Weichei“, kicherte Marko.
Als er sich wieder beruhigt hatte, sagte er kleinlaut: „Diese Luxusschuppen im Ersten haben nie Bargeld in der Kasse. Dort zahlen alle mit Kreditkarten.“
„Glaubst du das im Ernst? Die Russen rennen immer mit Packen von Geldscheinen im Hosensack herum. Und bei Prada, Versace und Co. kaufen fast nur mehr die Weiber von diesen Oligarchen ein. Selbst die Verkäuferinnen sprechen russisch, hat mir mal jemand erzählt. Außerdem sage ich nur: Frühstück bei Tiffany!“
„Was redest du da, Mann? Prader, Versatsche, Tifni?“
„Der New Yorker Schmuckladen am Kohlmarkt. Kennst du nicht diesen berühmten Film mit Audrey Hepburn?“
Marko tippte sich auf die Stirn.
„Was soll der Scheiß, Mann?“
„Der Film ist wirklich nett.“
„Du weißt, ich steh auf Jackie Brown. Hab ich mindestens zwanzig Mal gesehen. Die Alte ist echt cool. Auch Pulp Fiction war super. Paff, paff, paff.“
„Und das Blut spritzte …“
„Echt krass, oder?“
„Ja, ja …, aber wir werden kein Blutbad veranstalten. Hast du das kapiert?“
„In diesen feinen Läden wimmelt es von Scheiß-Security-Leuten.“
„Redest du von den Bodybuildern am Eingang? Die schickst du mit einem Schlag auf die Bretter. Schrecklich unbeweglich, diese Herren. Die sollten lieber mal Joggen gehen, als dauernd an den Kraft-Maschinen zu hängen. Außerdem muss es ja nicht ausgerechnet Tiffany sein. Im Goldenen Quartier gibt es noch mehr Juwelierläden.“
Marko klopfte seinem Freund auf die Schulter. Sein schiefer Mund verzog sich zu einem makabren Grinsen. „Okay Mann, wird gemacht!“, sagte er auf Rumänisch.
Obwohl Toni Ungar war und auch leidlich Rumänisch sprach, unterhielten er und sein Kumpel sich meistens auf Deutsch. Marko verfiel nur, wenn er sehr aufgeregt war, ins Rumänische.
4. Donau: Rumänien
Ein junger Matrose steht am Bug des Schiffes und versorgt die Seile.
In den sanften Wellen des Flusses spiegelt sich der Halbmond.
Was für eine klare Nacht! Morgen wird das Wetter schön sein, denkt er. Kein Regen mehr, kein Nebel.
Am Abend, nachdem er gesehen hat, was er nicht hätte sehen sollen, hat er darauf vergessen, die Seile ordentlich aufzurollen.
Er konnte nicht schlafen, hat hin und her überlegt, was er tun soll. Zur Polizei kann er nicht gehen. Er hat unter falschem Namen und mit einem falschen Pass auf derMSKaiserin Sisi angeheuert.
Ihm ist klar, dass hinter der Geschichte eine Menge Geld steckt. Wenigstens ein kleines Bisschen davon würde er gern abbekommen.
Er muss unbedingt mit jemandem reden, jemandem von dieser Entdeckung erzählen. Nur wem kann er auf diesem Schiff vertrauen? Seiner Liebsten? Ja. Aber sie kann genauso wenig unternehmen wie er. Sie wird ihm raten, den Mund zu halten und schleunigst alles zu vergessen. Was bestimmt das Klügste wäre. Sie ist sehr clever und viel erfahrener als er. Deshalb bewundert er sie auch.
Er traut sich nicht, sie mitten in der Nacht aufzuwecken. Sie teilt ihre Kabine mit drei anderen Mädchen.
Er raucht eine Zigarette. Nach einer Weile kommt ihm eine Idee. Er schreibt seiner Liebsten eineSMS.
Mittlerweile ist es fünf Uhr vorbei. Es wird bald hell werden.
Er hockt sich wieder auf den Boden und müht sich mit den Seilen ab.
Die Donau erwacht zum Leben. Leichter Wind ist aufgekommen. Die Wellen klatschen an die Bordwände.
Er hört ihn nicht kommen. Lautlos wie eine Katze nähert sich ein Mann dem Bug des Schiffes.
Erst als er knapp hinter ihm steht, nimmt der Bursche ihn wahr.
Erschrocken dreht er sich um. Springt auf, als er sieht, wer es ist.
Der erste Schlag trifft ihn mitten ins Gesicht.
Er kippt um.
Ein Tritt in die Eier. Stöhnend greift er sich zwischen die Beine.
Ein Seil schlingt sich um seinen Hals.
Er wehrt sich nach Kräften, fuchtelt wild herum. Versucht seine Hände zwischen das Seil und seine Kehle zu bekommen.
Als er schreien will, zieht der andere die Schlinge enger zu.
Er kriegt kaum mehr Luft. Beginnt zu röcheln.
Sein Blick verengt sich, während sein Bewusstsein allmählich schwindet. Er sinkt zu Boden.
Der Mann packt das Ende des Seils und zieht den zuckenden Körper hinter sich her zur Reling. Dort entfernt er die Schlinge vom Hals des Toten und wälzt ihn über Bord.
5. Donaumündung, Schwarzes Meer
An Bord der MS Kaiserin Sisi ging es bereits vor Sonnenaufgang sehr laut und hektisch zu. Das über hundert Meter lange Kreuzfahrtschiff legte in der Hafenstadt Tulcea ab.
Das Rumoren im Bauch des Schiffes weckte mich kurz vor sechs Uhr früh. Ich drehte den Kopf zum Bullauge, um zu schauen, ob schon Tag war.
Ein breites Fischmaul schien nach mir zu schnappen.
Bleiche Wangen und ein von Schlangen bekränztes Haar drückten sich an das Glas. Riesige dunkle Augen starrten mich vorwurfsvoll an.
„Eine Lei… Leiche!“, schrie ich.
Orlando fiel beinahe aus dem Bett. „Um Himmels willen, was ist los?“
„Da draußen, ein toter Mann …“ Meine Stimme zitterte, als ich auf das Bullauge deutete.
„Du hast schlecht geträumt. Solltest abends weniger essen.“
„Mein Gott, bist du blind?“
Ich hatte nicht geträumt. Ich hatte einem Toten in die Augen gesehen.
Das gespenstische Gesicht war inzwischen verschwunden. Unser Schiff fuhr mit etwa 15 km/h oder mehr stromaufwärts. Die Wasserleiche hatte es bestimmt längst abgetrieben.
Orlando legte sich wieder hin. „Gib endlich Ruhe!“, murmelte er verschlafen.
Er glaubte mir nicht. Und ich begann selbst zu zweifeln. Hatte ich mir die riesigen Augen und das algengeschmückte Haar doch nur eingebildet?
Als ich wieder einnickte, vernahm ich eine leise Stimme an meinem Ohr. Ich konnte nicht verstehen, was sie mir sagen wollte. Laute, gurgelnde Geräusche übertönten das Flüstern. Ich schreckte auf.
Orlando stand am Waschbecken und putzte sich die Zähne.
Ich ging, ohne mir die Zähne zu putzen, in die Bar. Machte mir einen Espresso und wankte damit hinauf aufs Sonnendeck.
In der Steuerkabine saß mit dem Rücken zu mir der Erste Offizier. Ich erkannte ihn an seinem dichten, dunklen Haarschopf und seinem schmalen Oberkörper. Er war ein großer, schlanker, etwas steif wirkender Typ in meinem Alter.
Das Schiff lenkte ein älterer Mann mit grauem Vollbart, den ich noch nie gesehen hatte. Vermutlich handelte es sich um den Steuermann.
Ich hoffte, dass mich keiner der beiden entdeckte und wählte eine Liege, die sich außerhalb ihres Blickfeldes befand.
Während ich mir meine erste Zigarette anzündete, stellte ich mir vor, wie ich halbtot auf dem trägen Fluss dahintrieb, bis mich einer der gefährlichen Strudel erfassen und in die Tiefe hinabziehen würde. Meine Augen wurden feucht, als ich mir meinen eigenen Tod ausmalte.
Ich trank meinen ersten Kaffee und rauchte meine erste Zigarette und konnte an nichts anderes denken als an die Leiche vor unserem Bullauge. Ich war mir sicher, dass ich weder eine Vision noch einen Traum gehabt hatte. Trotz seines verzerrten Aussehens hatte ich den Toten erkannt. Er war mir gestern Abend bei der Vorstellung der Crew aufgefallen, weil er mit der jungen Kellnerin, die in der Bar aushalf, herumgemacht hatte. Er schien sehr verliebt in die Kleine zu sein.
Was war passiert? Ein Unfall nach einer durchzechten Nacht? Diese Osteuropäer tranken mindestens soviel wie wir Österreicher. War der arme Bursche am frühen Morgen besoffen über Bord gefallen? Sein Gesicht hatte unverletzt ausgesehen. Hatte mit dem offenen Mund und der plattgedrückten Nase fast komisch gewirkt.
Ich fröstelte. Die feuchte Kälte am frühen Morgen kroch unter meinen dünnen Schlafanzug, den ich mir extra für diese Reise im Abverkauf zugelegt hatte. Eigentlich war es ein seidener, dunkelgrüner Hausanzug. Ein hübsches, weit ausgeschnittenes Oberteil und eine unten weit ausgestellte Hose, so wie man sie in den Siebzigerjahren trug. In diesem Anzug könne ich durchaus auch tagsüber herumlaufen, hatte Orlando gemeint.
Ein heller, rosa Streifen zeigte sich am Horizont. Versprach einen freundlichen Tag.
Als ich mir die zweite Zigarette in den Mund steckte, klickte ein Feuerzeug. Eine kleine Flamme erschien vor meinem Gesicht.
„Danke.“
„Frühaufsteherin?“, fragte mich der Erste Offizier.
„Eigentlich nicht. Bin eher eine Nachteule.“
Die aufgehende Sonne tauchte die Ufer in rosafarbenes Licht.
„Fantastische Sonnenuntergänge habe ich oft gesehen. Aber so ein Sonnenaufgang über dem Fluss ist einzigartig. Ich mag es, der Sonne endlich mal zusehen zu können, wie sie an Kraft und Stärke gewinnt. Ist ja fast noch eindrucksvoller.“
„Das ist korrekt.“
„Die Farben sind ein Traum. So weich und warm.“
Er sagte nichts.
Ich sah ihm in die Augen.
Was für schöne, schwermütige Augen! – Er ist ein Spinner, Kafka, ermahnte ich mich sogleich.
„Möchten Sie auch eine?“ Ich hielt ihm mein Zigarettenpäckchen hin.
Er schüttelte den Kopf. Nahm ein silbernes Zigarettenetui aus der Tasche seiner Uniformjacke und steckte sich einen Zigarillo an.
Schweigend sahen wir beide dem Rauch zu, der meiner Zigarette und seinem Zigarillo entwich.
Er machte keine Anstalten, auf der Nachbarliege Platz zu nehmen. Ich hatte keine Lust, weiterhin zu ihm aufzuschauen. Wandte meinen Blick wieder der aufgehenden Sonne zu.
Plötzlich wurde ich richtig wütend. Wütend auf mich selbst. Wie konnte ich nur seelenruhig über Sonnenaufgänge quatschen, während gerade ein junger Matrose gestorben war?
Vielleicht sollte ich lieber diesem eigenartigen Ersten Offizier von dem Toten erzählen?
So ein Zigarillo brennt lange. Ich empfand das Schweigen zwischen uns unerträglich, wollte es gerade brechen, als er sagte: „Sie sind sehr schön.“
Oh Gott! Wie antwortete man bloß auf so ein Kompliment? Sollte ich boshaft sein und sagen ‚Das ist korrekt‘?
Ich zog es vor zu schweigen. Mal sehen, ob er einen weiteren Satz zusammenbrachte.
Aber das war’s schon. Er dämpfte seinen Zigarillo in meinem Aschenbecher aus und kehrte, ohne sich zu verabschieden, in die Steuerkabine, auch Kommandobrücke, wie ich bei der Rettungsübung gelernt hatte, zurück.
Ein paar Minuten später begab auch ich mich hinunter, zog meine Uniform an und ging in den Speisesaal.
Die Kollegen richteten gerade das Frühstücksbuffet her.
Angeblich die beste Mahlzeit des Tages. Beim Frühstück ließe sich die Küche nicht lumpen, hatte der Kreuzfahrtdirektor gestern gesagt.
Außer Orlando und meinem Patenonkel schienen alle schon auf zu sein.
Bernhard begrüßte mich mit zwei Küsschen links und rechts auf die Wangen.
Die Besatzungsmitglieder nahmen das Frühstück in der Küche ein. Die meisten tranken nur Kaffee und aßen ein Croissant oder ein Stück Kuchen.
Hannes, der österreichische Küchenchef, bereitete Ham and Eggs für die Passagiere zu.
Er sah mich fragend an.
„Ja bitte. Ich leide unter Eiweißmangel“, sagte ich.
Wortlos schaufelte er eine Riesenportion auf meinen Teller.
Da Orlando mich für verrückt erklärt hatte und fest davon überzeugt war, dass ich heute Morgen nur eine Vision gehabt hatte, wollte ich weder unserem Kreuzfahrtdirektor noch sonst einem Kollegen von der Wasserleiche erzählen. Den Kapitän sollte ich jedoch bald informieren, der war aber nirgends zu sehen.
Nach dem Frühstück machte ich mich auf die Suche nach dem Matrosen, der gestern Abend mit der jungen Kellnerin Händchen gehalten und geschmust hatte. Vielleicht war er ja doch noch am Leben. Es bestand immerhin die winzige Möglichkeit, dass der Tote nicht von unserem, sondern von einem anderen Kreuzfahrtschiff ins Wasser gefallen oder gestoßen worden war. Im Hafen von Tulcea waren mehrere Schiffe gelegen.
Die Matrosen standen am Heck und diskutierten heftig gestikulierend miteinander. Als ich mich ihnen näherte, verstummten sie.
„Zigarette?“
Sie bedienten sich alle fünf aus meiner Schachtel.
„Seid ihr nicht gestern zu sechst gewesen?“, fragte ich.
Schweigen. Ich bildete mir ein, dass sie mich misstrauisch ansahen.
„Da war doch noch so ein großer Schlanker mit einem Mädchen.“
Einer der Burschen zuckte mit den Schultern. Ein anderer schüttelte den Kopf.
„Du irrst dich“, sagte ein Kleinerer, der sehr kindlich aussah, auf Deutsch.
Ich beschloss, ihn mir demnächst allein vorzuknöpfen.
„Bis später“, sagte ich und ging hinunter in den Bauch des Schiffes.
Klopfte an die Tür von Onkel Sandors Kabine.
Keine Reaktion.
Ich drückte auf die Klinke.
Abgesperrt.
„Ich bin’s, Sandor“, rief ich.
Kurz darauf öffnete sich die Tür einen Spalt.
Ich trat ein.
Seine Kabine sah genauso aus wie unsere. Ein Stockbett links und rechts und dazwischen kaum fünfzig Zentimeter Raum.
Sandor lag im Bett, wirkte aber hellwach. Auf dem Bett gegenüber lag seine Geige.
Ich wollte mich gerade setzen als er mich anfuhr: „Setz dich ja nicht drauf.“
„Keine Angst.“ Ich schob den Geigenkasten beiseite und begann, ihm von der Wasserleiche zu erzählen.
„Ich habe normalerweise keine Visionen“, endete ich.
„Deine Mutter hatte oft welche.“
„Deswegen muss ich noch lange keine haben.“
„Reg dich wieder ab, Kleines. Ich behaupte ja nicht, dass du dir das alles nur eingebildet hast.“
Erst jetzt fiel mir auf, dass Sandor die Vierbettkabine für sich allein hatte. Die anderen drei Betten waren nicht bezogen. Er hatte sein Zeug darauf verstreut. Auf den beiden oberen Betten lagen seine Hemden und Hosen, sowie Bücher und Waschbeutel. Und was ein Mann halt sonst so braucht, befand sich auf dem Bett, auf dem ich saß. Ich musste mich sehr beherrschen, nicht zu kichern, als ich die Pornohefte erblickte, die unter seinem Geigenkasten, den ich gerade verschoben hatte, hervorlugten.
Sandor zündete sich eine Zigarette an.
„Ich werde mich schlau machen“, sagte er.
Ich war nahe daran, ihm zu glauben. Ein Blick in seine grünen Augen, die meinen so ähnlich waren, überzeugte mich, dass ich besser misstrauisch bleiben sollte.
„Was willst du tun?“, fragte ich.
„Mich umhören?“
„Das kann ich selbst. Hab ich sogar schon getan.“
„Das habe ich mir gedacht.“
Sein Lächeln gefiel mir nicht.
„Mach dich nicht lustig über mich.“
„Tu ich nicht. Magst du einen Tschik?“
Natürlich mochte ich einen.
Er gab mir Feuer.
„Hörst du mir bitte mal zu, Kleines.“
Warum sagten bloß neuerdings alle Kleines zu mir? Ich war vierzig und wie gesagt nicht gerade klein gewachsen.