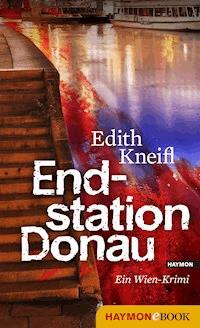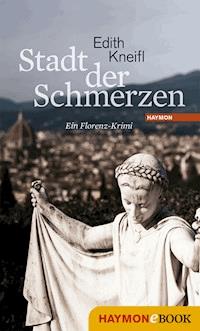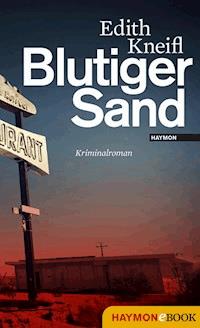Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Wien-Krimis
- Sprache: Deutsch
SISI UND DER FRAUENMÖRDER VON SCHÖNBRUNN Die schöne Kaiserin Sisi wurde eben erst zu Grabe getragen, da fallen gleich mehrere adelige Damen in der Nähe von Schloss Schönbrunn einem brutalen Serienmörder zum Opfer. Und alle haben sie auffallende Ähnlichkeit mit der jungen Kaiserin. Eindeutig ein Fall für den Privatdetektiv Gustav von Karoly. Aber ist er dem Frauenmörder von Schönbrunn gewachsen? Mit Karolys zweitem Fall entführt Edith Kneifl noch tiefer ins Herz der Donaumonarchie und beweist ihr goldenes Händchen für das kriminelle Wien der Jahrhundertwende. LESERSTIMMEN: "Edith Kneifl versteht es, Krimispannung mit historischem Flair kunstvoll zu verbinden! Mit authentischen Figuren und viel Lokalkolorit entführt sie uns in das alte Wien zur Jahrhundertwende und spart nicht mit Morddetails - absolute Leseempfehlung!" "Ein Buch für starke Frauen: Die Geschichte rund um die Mordermittlungen ist gezeichnet von der Befreiung aus alten Frauenrollen und die Ablehnung von historischen Vorstellungen der adeligen Männerwelt. Mutig, spannend, mitreißend!" WEITERE HISTORISCHE WIEN-KRIMIS MIT PRIVATDETEKTIV GUSTAV VON KAROLY: "Der Tod fährt Riesenrad" "Totentanz im Stephansdom (erscheint im Herbst 2015)"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Edith Kneifl
Die Tote von Schönbrunn
Ein historischer Wien-Krimi
Motto
Die Kunst des Detektivs besteht darin,
etwas zu finden, was er gar nicht gesucht hat.
Georg Kreisler
1
Die Kaiserin ermordet! stand in großen Lettern auf der Titelseite der Neuen Freien Presse.
Gustav von Karolys Augen füllten sich mit Tränen. Er hatte sie geliebt, obwohl er sie nur ein einziges Mal aus nächster Nähe gesehen hatte. Damals war er fünf Jahre alt gewesen. Sein Großvater Albert von Karoly, der Stallübergeher beim Kaiser war, hatte ihn mit ins Oktogon in den k.k. Hofstallungen genommen. Gustav hatte zusehen dürfen, wie Ihre Majestät an der Longe eine Reitstunde nahm. Ihr Antlitz war von überirdischer Schönheit und ihre Haltung wahrhaft königlich gewesen. Sie hatte einem der Engel auf den Gemälden im Schlafzimmer seiner Großeltern geglichen. Und jetzt ist sie selbst ein Engerl, dachte Gustav.
Er hatte nicht nur die Sonderausgabe der Neuen Freien Presse gekauft, sondern auch das Extrablatt und andere Zeitungen, die er für gewöhnlich nicht las. Überall in der Stadt liefen Zeitungsverkäufer herum und schrien: „Unsere geliebte Kaiserin ist tot! Ihre Majestät, die durchlauchtigste Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, wurde ermordet …“
Die Menschen rissen den Kolporteuren die Ausgaben buchstäblich aus der Hand.
Die schreckliche Neuigkeit verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Wien. Auf den Straßen bildeten sich Menschentrauben. Die Leute steckten die Köpfe zusammen und sprachen im Flüsterton. Handwerker und Dienstboten drängten aus den Häusern, blieben an den Toren stehen und baten die Vorübergehenden um Auskunft. Die ganze Stadt schien plötzlich in einen schwarzen Schleier gehüllt. Dunkle Regenwolken verstärkten noch die düstere Stimmung.
Als Gustav gegen halb acht Uhr abends seine Wohnung betrat, wurde er von Vera von Karoly im Vorzimmer empfangen.
„Hast du die entsetzliche Nachricht schon vernommen?“ Seine Tante, mit der er die Wohnung über den k.k. Hofstallungen teilte, war bleich im Gesicht. Der dicke Knoten in ihrem Nacken hatte sich gelöst. Lange graublonde Haarsträhnen hingen ihr ins Gesicht, und ihre Hände zitterten.
„Von wem hast du es erfahren?“
„Mein Fenster ist offen. Ich habe die Kutscher unten tratschen gehört. Ist es wahr? Ist sie tatsächlich ermordet worden? – Nein, sag nichts. Ich sehe es dir an. Hast du etwa geweint?“ Sie umarmte ihn und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Dann entriss sie ihm unversehens eine der Zeitungen, ging damit in die Küche und las ihm laut aus der Sonderausgabe der Neuen Freien Presse vom Samstag, dem 10. September 1898, vor:
„Eine niederschmetternde Nachricht ist soeben eingetroffen. Unsere edle Kaiserin Elisabeth, aus deren Händen die Welt nur Gutes empfing, ist an den Ufern des Genfer Sees, wohin sie gekommen war, um Heilung für ihre Leiden zu finden, von einem Elenden ermordet worden.
Sehr prosaisch“, lautete Veras Kommentar. „Mal sehen, was die Kollegen von der Konkurrenz zu bieten haben.“ Sie griff nach der Gratisausgabe des Illustrierten Wiener Extrablatts.
„Unsere Kaiserin todt!
Ermordet von einem Anarchisten in Genf.
Eine entsetzensvolle Nachricht durchläuft die Stadt. Unser schwergeprüfter Kaiser ist abermals von einem furchtbaren Schicksalsschlage getroffen worden, seine hohe Gemahlin unsere geliebte Kaiserin, wurde von ruchloser Hand ermordet.
Gott gebe unserem armen Kaiser Kraft, dieses Entsetzliche zu überwinden!“
„Hör auf, Vera, ich kann selber lesen“, sagte Gustav, der die Neue Freie Presse wieder an sich genommen hatte.
„Kaiserin Elisabeth hatte heute eine Spazierfahrt mit dem Dampfer über den Genfer See unternommen. Als das Schiff in Genf landete und die Passagiere das Schiff verließen, näherte sich der Kaiserin ein Individuum, das ihr ein Dolchmesser in die Herzgegend stieß. Die Kaiserin wurde blutend aufs Schiff gebracht. Da sich ihr Zustand sichtlich verschlimmerte, trug man die Kaiserin ans Land und bettete sie auf eine Tragbahre, wo sie den Geist aufgab.
Der Mörder, ein Italiener, wurde von der Menge sofort festgehalten und in Haft gebracht. Er gab an, ein Anarchist zu sein. Als die Kaiserin ins Hotel gebracht wurde, war sie bereits eine Leiche.“
„Blödsinn. Hier steht etwas ganz anderes“, sagte Vera und las ihm wieder vor:
„Genf, 10. September, 3 Uhr 40 Minuten nachmittags. Ihre Majestät Kaiserin Elisabeth verließ um 12 Uhr 40 Minuten mittags das Hotel Beau Rivage, um sich nach dem Landungsplatze der Dampfer zu begeben. Auf dem Wege dahin stürzte sich ein Individuum auf Ihre Majestät und führte einen heftigen Stoß gegen Allerhöchstdieselbe. Ihre Majestät fiel zu Boden, erhob sich jedoch wieder und erreichte den Dampfer, wo sie bald darauf in Ohnmacht fiel. Der Kapitän des Schiffes wollte das Schiff nicht abgehen lassen, gab indeß, später über Bitten des Gefolges Ihrer Majestät, das Zeichen zur Abfahrt. Das Schiff hielt jedoch, nachdem es den Hafen verlassen hatte, wieder an und kehrte zum Landungsplatze zurück. Ihre Majestät hatte das Bewusstsein nicht wiedererlangt und Allerhöchstdieselbe wurde auf einer rasch hergestellten Tragbahre nach dem Hotel Beau Rivage gebracht. Die Kleider Ihrer Majestät zeigten Blutflecken. Der Thäter wurde festgenommen.
Ihre Majestät Kaiserin Elisabeth gab einige Augenblicke, nachdem Allerhöchstdieselbe in das Hotel gebracht worden war, den Geist auf. Es wurde festgestellt, dass Ihre Majestät einen Dolchstich in die Herzgegend erhalten hatte. Der Mörder ist ein in Paris geborener italienischer Anarchist namens Lucheni.“
Vera runzelte ihre hohe Stirn.
„Merkst du etwas? Deine Lieblingszeitung ist wieder einmal schlechter informiert als dieses Boulevardblatt.“
„Selbstverständlich unterscheidet sich die Berichterstattung der beiden Zeitungen fundamental! Das brauche ich dir wohl nicht zu erklären. Die Neue Freie Presse beschränkt sich eben auf die Fakten.“
„Und die scheinen nicht zu stimmen. Die Kaiserin ist nicht bei ihrer Ankunft in Genf, sondern erst bei ihrer Abreise ermordet worden.“
„Macht das einen Unterschied?“, fragte Gustav.
„Wer weiß. Wir werden es erfahren. Jedenfalls ist das, was hier steht, sicher nicht die ganze Wahrheit. Was denkst du? Wurde sie wirklich von einem Anarchisten umgebracht? Ich kann das nicht ganz glauben …“
„Wer soll es sonst getan haben? Es ist allgemein bekannt, dass sich in der schönen Schweiz jede Menge Anarchisten herumtreiben.“
„Bestimmt war es ein gedungener Mörder. Vielleicht wurde sie im Auftrag des englischen oder russischen Herrscherhauses ermordet? Oder es steckt gar jemand vom Wiener Hof dahinter? In letzter Zeit war sie dem Hochadel richtiggehend verhasst.“
„Deine Fantasie geht wieder einmal mit dir durch, Vera. Vielleicht solltest du auch Kriminalgeschichten schreiben, so wie deine Freundin Auguste Groner.“
„Gustav, denk nach. Wer könnte Interesse am Tod der österreichischen Kaiserin haben? Die Kriegstreiber in ganz Europa natürlich. Ihre Majestät war für den Frieden, auch wenn sie Bertha von Suttners Briefe nie beantwortet hat. Und trotz ihrer ständigen Abwesenheit von Wien hatte sie großen Einfluss auf Seine Majestät den Kaiser.“
„Und wem sollen wir jetzt bitte den Krieg erklären? Vielleicht gar der Schweiz? Nein, liebe Tante, das sind reine Hirngespinste. Ich fürchte, du leidest ein bisschen unter Verfolgungswahn. Als sich Kronprinz Rudolf umgebracht hat, hast du auch geglaubt, dass ihn die Geheimen am Gewissen haben.“
„Ich sehe schon, du bist für logische Argumente nicht zugänglich. Ich muss mit Dorothea reden“, beendete Vera das Gespräch und erhob sich.
2
Dorothea, die fünfundzwanzigjährige Tochter von Veras verstorbener Freundin Valerie Palme, wohnte vorübergehend bei ihnen. Sie wartete auf einen Studienplatz in Zürich, da sie unbedingt Medizin studieren und so wie ihr Vater Arzt werden wollte.
Veras Jugendfreundin hatte einen Hamburger jüdischer Herkunft geheiratet, der in Wien Medizin studiert hatte. Nach Dorotheas Geburt war sie ihm in die deutsche Hansestadt gefolgt, wo er ein paar Jahre später an der Cholera starb. Doktor Palme hatte sich in dieser Stadt der reichen Pfeffersäcke um die Ärmsten der Armen gekümmert und sich bei ihnen angesteckt. Valerie war nach seinem Tod mit ihrer Tochter nach Wien zurückgekehrt. Vergeblich hatte sie in der Kaiserstadt darum gekämpft, Medizin studieren zu dürfen. Da sie jahrelang mit ihrem Mann zusammengearbeitet und viel von ihm gelernt hatte, setzte sie seine Tätigkeit in den Elendsvierteln von Wien fort, behandelte hauptsächlich Kinder und Frauen, die unter Keuchhusten, Bronchitis oder der Krätze und Ekzemen litten.
Als sie wegen Kurpfuscherei angezeigt und verhaftet wurde, hatte sie einen Nervenzusammenbruch und wurde in die k.k. Irrenanstalt auf dem Michelbeuerngrund eingeliefert. Ihre ohnehin angegriffene Gesundheit verschlechterte sich rapide durch die brutalen und rückständigen Behandlungsmethoden der Ärzte. Man versetzte sie in Schockzustände, indem man in ihrer unmittelbaren Nähe Pistolenschüsse abfeuerte, und schmierte ihren kahl geschorenen Kopf mit Zugsalbe ein. Die Güsse mit eiskaltem Wasser mitten im Winter überlebte sie nicht. Sie starb vor nunmehr fast drei Jahren an einer Lungenentzündung. Vera sprach damals von Mord.
Dorothea war nach dem Tod ihrer Mutter allein in der Zwei-Zimmer-Wohnung in der Josefstadt geblieben und hatte als Gasthörerin eifrig Vorlesungen an der Medizinischen Fakultät besucht. Auf einen ordentlichen Studienplatz in Wien hatte sie aber keine Aussicht. Vor einem halben Jahr hatte ihr Vermieter, nachdem sie seine lästigen Annäherungsversuche energisch abgewiesen hatte, plötzlich kein alleinstehendes junges Frauenzimmer mehr in seinem Haus haben wollen. Daraufhin war Dorothea zu ihrer Patentante Vera von Karoly gezogen.
Gustavs Verhältnis zu Dorothea konnte man nicht gerade als entspannt bezeichnen. Valerie Palme hatte ihre Freundin Vera fast jedes Jahr mit ihrer Tochter in Wien besucht. Gustav hatte damals oft mit der Kleinen gespielt oder auf sie aufgepasst, wenn die beiden Damen zu sehr ins Gespräch vertieft gewesen waren und auf das Mädchen fast vergessen hatten.
Als Kleinkind hatte er sie entzückend gefunden und sich gefreut, wenn sie über seine Grimassen und Blödeleien gelacht hatte. Heute stritten sie oft über Gott und die Welt und hatten nur mehr selten Spaß miteinander. Obwohl – Dorotheas perlendes Lachen gefiel Gustav heute noch. Aber er fühlte sich von der um elf Jahre jüngeren Frau nicht ernst genommen, da sie des Öfteren und meist zu den unpassendsten Gelegenheiten über ihn lachte.
Der böhmische Kutscher Edi, der früher zur Untermiete bei ihnen gewohnt hatte, musste, solange Dorothea bei ihnen weilte, in den Stallungen schlafen. Edi hatte ohnehin fast nie die Miete bezahlt.
Dorothea würde eines nicht allzu fernen Tages von einer Großtante väterlicherseits ein kleines Vermögen erben. Einstweilen erhielt sie nur eine monatliche Rente. Sie bestand jedoch darauf, für Essen und Unterkunft einen Beitrag zu leisten. Vera schämte sich, dass sie von ihrem Patenkind Geld annahm. Aber sie waren darauf angewiesen, denn das Wasser stand ihnen bis zum Hals. Mit Gustavs Einkünften aus seinen detektivischen Ermittlungen bestritten sie momentan mehr schlecht als recht ihren Lebensunterhalt. Vera schrieb Artikel für die Österreichische Illustrierte und redigierte Dissertationen reicher, aber fauler Studenten. Die mickrigen Honorare, die sie dafür bekam, gingen für Sonderausgaben wie Konzertkarten, Bücher und Kleidung drauf. Wäschermädeln und Weißnäherinnen wollten ebenso bezahlt werden wie Kutscher und Dienstmänner, die man hin und wieder gezwungen war, in Anspruch zu nehmen.
Zum Glück führte ihnen Josefa, Gustavs ehemaliges Kindermädchen, den Haushalt praktisch gegen Kost und Logis. Sie bekam zwar fast jeden Monat ihren Lohn ausgezahlt, aber die paar Kronen gab sie meistens im Delikatessengeschäft aus. Denn Gustav war in ihren Augen viel zu dünn. Schon als Kind war er ein schlechter Esser gewesen und bis heute äußerst heikel. Nur das Beste vom Besten war ihrer Meinung nach gerade gut genug für ihren Liebling. Dazu kam sein empfindlicher Magen, den er von seinem Großpapa geerbt hatte. Die alte Frau lebte in der ständigen Angst, dass er, genauso wie Albert von Karoly, ein Magengeschwür bekommen könnte.
Dorothea pflegte sich hin und wieder über Josefas Fürsorglichkeit lustig zu machen, die in ihren Augen schwer übertrieben war. Sie beteuerte manchmal, dass sie ja irgendwann einmal relativ wohlhabend sein würde und Josefa dann ihrem geliebten Gustav täglich ein zartes Filetstückchen oder gar Beluga-Kaviar servieren könne.
Gustav musste an Dorotheas Spötteleien denken, als Josefa ihn nötigte, ein paar Löffel warme Hühnersuppe zu sich zu nehmen. „Du hustest schon wieder“, sagte sie, die selbst unter schwerem Asthma litt.
„Raucherhusten, das weißt du doch.“
„Du musst viel Milch trinken. Das ist gut für die Lunge.“
„Bitte, Josefa, lass mich in Frieden. Mir ist heute nicht nach Essen zumute.“
Josefa verzog das Gesicht.
„Sei nicht immer gleich beleidigt. Ich hab’s nicht bös gemeint. Unsere Kaiserin ist ermordet worden, ich bekomme jetzt keinen Bissen hinunter!“
Die alte Frau wandte sich ab und begann mit dem Geschirr zu klappern.
„So hilf mir doch, Vera“, bat er seine Tante, die das Geplänkel amüsiert verfolgt hatte.
„Ich werde mich hüten“, sagte sie leise.
Wieder einmal beklagte Gustav sein Schicksal. Mit drei starrköpfigen Frauen zusammenzuleben, war kein Honiglecken. Pflichtschuldig kostete er die brühend heiße Hühnersuppe.
„Vorsicht, heiß!“
„Verdammt!“, fluchte er.
„Hast du dir die Zunge verbrannt?“ Vera lächelte ihn spöttisch an.
Dorothea würde bald von ihrem Konzert im Musikverein nach Hause kommen. Gustav war sich sicher, dass alle Theatervorstellungen und Konzerte abgesagt worden waren. Er war auf dem Heimweg einigen Besuchern des k.k. Hofoperntheaters begegnet.
Da er keine Lust hatte, sich heute mit den drei streitbaren Frauen in seinem Haushalt auseinanderzusetzen, machte er sich bald wieder auf den Weg in die Innere Stadt und mischte sich unters Volk.
Hunderte Wiener zogen durch die Hofburg und standen eine geraume Zeit dicht an dicht im großen Hof, wo sie lautlos verharrten, so als wollten sie dem Kaiser, den sie in der Burg wähnten, hierdurch ihr Beileid ausdrücken.
Gegen acht Uhr abends strömten die Massen aus den Vorstädten, wohin die traurige Kunde inzwischen ebenfalls gedrungen war, in den ersten Bezirk. Viele hofften, hier genauere Auskunft über das Verbrechen zu erhalten. Andere wiederum fuhren aus dem Zentrum hinaus in die Vororte, um ihren Familien die furchtbare Nachricht zu überbringen. Die Pferdetramways waren ebenso überfüllt wie die Elektrische. Die Fiaker hatten Hochbetrieb.
Ein richtiger Ansturm erfolgte auf die Telegrafenämter, besonders auf dem Haupttelegrafenamt am Börseplatz drängten sich die Menschen um den Schalter. Die Telefone ruhten keinen Moment. Auch die Kaffeehäuser waren voller als an gewöhnlichen Abenden, denn hier versammelten sich die Leute, um von dem einen oder anderen Bekannten neue Mitteilungen zu erhalten.
Gustav betrat das Café Schwarzenberg am Ring. Dort kam ihm sogleich der erste Satz zu Ohren, den Seine Majestät der Kaiser angeblich gesagt hatte, nachdem ihm die Botschaft von Sisis Ermordung überbracht worden war: „Mir bleibt wirklich nichts erspart.“ Der Egoismus und die Gefühllosigkeit des alten Herrschers empörten ihn. Plötzlich bildete er sich ein, diese Anarchisten verstehen zu können. Nicht dieses Schwein, das Ihre Majestät umgebracht hatte. Vielleicht hätte der Lucheni lieber deren alten Gatten ins Jenseits befördern sollen, dachte Gustav und bestellte einen zweiten Einspänner.
In seinem Stammcafé hatten sich viele Besucher aus dem Musikverein und dem Konzerthaus eingefunden. Ausnahmsweise befanden sich heute zahlreiche Damen der guten Gesellschaft in dem beliebten Kaffeehaus, das sonst eher den Männern vorbehalten war. Dieser Samstag, der 10. September, war eben ein ganz besonderer Tag, ein Tag, der in die Geschichte eingehen würde.
Gustav kehrte erst spät abends nach Hause zurück. Er saß noch lange im Dunkeln in dem bequemen Ohrensessel seines Großvaters beim Fenster, starrte auf die nächtliche Stadt hinaus und sann über sein eigenes Leben nach.
Sein Großvater Albert von Karoly war Ungar gewesen und wegen seiner Verdienste als Stallübergeher des Kaisers nicht nur geadelt worden, sondern hatte auch eine geräumige Dienstwohnung über den k.k. Hofstallungen zugewiesen bekommen. Er hatte eine schöne Frau von älterem Adel geheiratet und gemeinsam mit ihr und den beiden Töchtern ein relativ sorgenfreies Leben geführt. Als er starb, ließ er seine Töchter und seinen Enkel nicht unversorgt zurück. Da beide Töchter nie geheiratet hatten, war das väterliche Erbe bald aufgebraucht. Gisela, Gustavs Mutter, hatte als stadtbekannte Operettensängerin auch ein eigenes Einkommen gehabt, doch als sie mit kaum vierzig Jahren schwer erkrankte, schrumpfte ihr Vermögen rasch dahin. Während seiner acht Jahre bei der Armee war es Gustav mit seinem Sold und dem Geld, das ihm seine Mutter hin und wieder geschickt hatte, gelungen, seine Extravaganzen zu bestreiten. Als er nach dem Abschied vom Militär und dem Tod seiner Mutter ein paar Monate in Paris und anschließend ein Jahr in London lebte, brachte er die letzten Ersparnisse durch. Der Karoly’sche Haushalt stand damals kurz vor dem Bankrott. Seit Gustav als Privatdetektiv arbeitete, ging es wieder ein bisschen bergauf. Allerdings hatte er kein regelmäßiges Einkommen. Meistens bezahlten Vera und er von seinen Honoraren die Schulden, die sich in den vergangenen Wochen oder Monaten angehäuft hatten.
3
Kurz nach acht Uhr abends machte sich Gustav auf den Weg zum Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof.
Der Schienenstrang, der nach Westen, in die ehemalige Heimat der Kaiserin führte, hatte einst ihren Namen erhalten, und auf diesen Schienen vollendete sie nun ihre letzte Reise.
Durch die Mariahilfer Straße schoben sich die Menschenmassen. Gustav kam kaum voran.
Plötzlich tauchte Militär auf. Bataillone der Infanterie und Artillerie errichteten ein Spalier. Sie sperrten die Gegend um den Bahnhof hermetisch ab, doch es kam zu keinerlei Protesten. Bevölkerung und Militär schienen in der Trauer eins.
Gegen halb neun fuhren die ersten Wagen zum Bahnhof, vorüber an der schnurgeraden Kette von Soldaten, deren Uniformknöpfe, Rosetten und Adler in der Dunkelheit blitzten.
Das Bahnhofsgebäude selbst war in schwarzes Trauergewand gehüllt. Mächtige Fahnen wehten von den Türmen und dem Giebel.
Gustav traf seinen Freund, Polizei-Oberkommissär Rudi Kasper, vor dem Bahnhof. Rudi nahm ihn mit auf den Perron, wo sich neben der kaiserlichen Familie der gesamte k.u.k. Hofstaat und die wichtigsten Würdenträger des Reiches versammelt hatten, um die Kaiserin zu empfangen und ihr das letzte Geleit zu geben. Inmitten der hochherrschaftlichen Trauergemeinde erblickte Gustav Bürgermeister Lueger. Plötzlich war er froh, Dorothea nicht mitgenommen zu haben. Sie hasste den Wiener Bürgermeister aufgrund seiner deutschnationalen Gesinnung und seiner antisemitischen Äußerungen und hätte andauernd missbilligende Bemerkungen von sich gegeben. Falschheit und Heuchelei waren ihr ein Gräuel. Sie machte ihrem Herzen immer und überall Luft. Es schien ihr völlig egal zu sein, wie unpassend oder gar taktlos ihr Benehmen auf andere wirken mochte.
Zehn Uhr abends. Aus der Ferne hörte man das Husten und Schnauben der Lokomotive. Die acht Waggons fuhren nahezu lautlos im Bahnhof ein. Fackelträger beleuchteten den Perron. Das Feuer spiegelte sich in den hohen Scheiben des Salonleichenwagens. Gustav erhaschte einen Blick auf den mit schönen Kränzen geschmückten Sarg Ihrer Majestät und sogleich kamen ihm wieder die Tränen.
„Reiß dich gefälligst zusammen“, fauchte sein Freund Rudi ihn an. Bald darauf ließ er Gustav wortlos stehen und begab sich zum Hofsalon, wo die tote Kaiserin aufgebahrt und eingesegnet werden sollte. Gustav wagte nicht, ihm zu folgen, da in diesem Augenblick die Offiziere am Perron Front machten und salutierten. Der Tambour schlug den Generalmarsch auf die mit einem Trauerflor umhüllte Trommel und der Trauerzug setzte sich in Bewegung. Gustav wurde an die Mauer gedrückt, konnte keinen zweiten Blick mehr auf den Sarg werfen, der von acht Edelknaben mit Wachsfackeln, sechs Arcièren und sechs ungarischen Leibgarden sowie mehreren Leibgardereitern begleitet wurde.
Rudi hatte gemeint, die Einsegnung in dem zu einer Kapelle umgestalteten Hofsalon des Bahnhofs würde nicht lange dauern. Daher eilte Gustav über die mit schwarzen Teppichen bedeckte Freitreppe hinaus, um vor dem Bahnhof einen guten Platz zu ergattern.
Als der von acht Lakaien getragene Sarg in Sicht kam, geriet die Volksmenge in großen Aufruhr. Die Frauen schluchzten und viele Männer wandten sich erschüttert ab, um ihre Tränen zu verbergen, als der Sarg in den Leichenwagen geschoben wurde.
Mittlerweile hatte das Gefolge der toten Kaiserin die Trauerkarossen bestiegen und langsam setzte sich der düstere Zug in Bewegung, glitt wie eine schwarze Riesenschlange durch die Mariahilfer Straße, dann die Babenbergerstraße entlang auf die Ringstraße und durch das äußere Burgtor in die Hofburg. Wo auch immer die gespensterhafte Prozession vorüberkam, erklang gedämpfter Trommelwirbel. Das Militär leistete die Ehrenbezeugung und die Menge entblößte das Haupt, wenn sie des Trauerwagens ansichtig wurde. Die Leute achteten nicht auf die goldstrotzenden Uniformen der Garden, nicht auf die spanische Tracht, die weiß gepuderten Perücken des Geleites, nicht auf die seltsam altherkömmlichen Laternenträger zu Pferde. Alle Blicke waren auf den hohen, feierlich dunkel verhängten Wagen gerichtet, der Ihre Majestät barg.
Eine weitere Einsegnung fand in der Hofburgpfarrkirche statt. Zur Hofburg hatten die Massen keinen Zutritt. Dennoch blieben viele auf der Baustelle bei der Neuen Burg. Eine merkwürdige Stille kehrte ein. Die sonst so tratschfreudigen Wiener hielten schweigend Andacht. Nur hin und wieder ertönte ein Hüsteln oder verlegenes Räuspern.
Gustav machte sich bald auf den Heimweg.
Vor dem Eingang zu den k.k. Hofstallungen stolperte er über eine alte Frau, eine der unzähligen Obdachlosen, die in der Reichshaupt- und Residenzstadt ums Überleben kämpften. Statt Schuhen hatte sie mit einer Schnur Fetzen um ihre geschwollenen Füße gebunden. Obwohl sie ihn nicht anbettelte, griff Gustav nach seinem Portemonnaie und wollte ihr ein paar Kreuzer geben, da stand sie plötzlich auf und trat ganz dicht an ihn heran.
„Du kommst zu spät. Sie ist tot“, murmelte sie und blies ihm ihren stinkenden Atem ins Gesicht.
Angeekelt wandte er sich ab und ging weiter. Die Alte folgte ihm. „Es wird noch viele schöne Tote geben. Er ist wieder da und holt sich eine nach der anderen.“
„Wer ist wieder da? Von wem sprichst du?“, herrschte Gustav sie an.
„Der Teufel“, flüsterte die zahnlose Alte.
4
Um acht Uhr früh ließ man das Publikum in die Hofburgpfarrkirche ein, wo es Ihrer Majestät im geschlossenen Sarg, der auf einem Schaubette ruhte, die letzte Ehre erweisen konnte. Gustav wartete schon seit einer Stunde vor dem Tor. Vor ihm standen an die hundert Leute. Die Menschenschlange hinter ihm war schier endlos.
Als er schließlich die Kapelle betrat, wurde ihm speiübel. Dieser verdammte Weihrauch! Kirche und Oratorien waren schwarz spaliert, die Betstühle dunkel überzogen, die Altäre mit schwarzen Kreuztüchern behängt, auf denen die Wappen Ihrer Majestät angebracht waren. Über dem ringsum beleuchteten Schaubett schwebte ein schwarzer Samtbaldachin. Auf dem Bette waren die Kaiser- und Königskrone, der Erzherzoghut, die Insignien des Sternkreuzordens, ein Paar weißer Handschuhe und der Fächer Ihrer Majestät auf schwarzen, goldbordierten Samtpölstern ausgelegt.
All das Gold und Geschmeide drohte sich vor Gustavs Augen in totaler Schwärze aufzulösen. Er klammerte sich an eine der roten Absperrungskordeln und tastete sich langsam vor zum Sarg.
Gerade wurde eine Seelenmesse gelesen. Als er endlich bis zur Kaiserin vorgedrungen war, hoben die Sänger der Hofmusikkapelle zum „Miserere“ an.
Gustav fühlte sich einer Ohnmacht nahe. Da packte ihn plötzlich jemand am Arm. Er schaute auf und blickte in die Augen seines Freundes Rudi Kasper.
„Mir ist schle…echt“, stammelte Gustav.
Rudi zerrte ihn von dem Schaubett weg und geleitete ihn aus der Kapelle. „Du brauchst einen Schnaps.“ Er hängte sich bei ihm ein und schleppte ihn ins Café Central.
Dieses Kaffeehaus im Bank- und Börsengebäude in der Herrengasse, das der berühmte Architekt Heinrich von Ferstel im toskanischen Neorenaissance-Stil errichtet hatte, war besonders bei Literaten beliebt. Genau das war auch der Grund, warum Gustav das Central eher mied. Es zählte jedenfalls nicht zu seinen Lieblingslokalen. Er fühlte sich in Gesellschaft der literarischen und anderer geistiger Größen der Kaiserstadt nicht wohl, kam sich deplatziert vor. Das präpotente Gehabe dieser Leute schüchterte ihn ein. Außerdem hatte er keine Lust, Graf Batheny zu begegnen, der ebenfalls Stammgast im Café Central war. Gustav hielt den Grafen für seinen Vater. Der Graf hatte die Vaterschaft auch nie geleugnet, seinen Sohn jedoch nicht offiziell anerkannt. Und das verübelte Gustav ihm bis heute.
Kaum hatten sie Platz genommen, berichtete Rudi seinem Freund von dem Attentäter.
„Der Mörder heißt Luigi Lucheni, 1873 in Paris geboren. Ein Jahr später hat ihn seine Mutter nach Parma gebracht und dem Findelhaus übergeben. Danach kam er zu einer Bäuerin in Pflege. Mit zehn Jahren wurde er auf die Straße gesetzt und musste sich sein Brot selbst verdienen oder stehlen. Später hat er an der Eisenbahnlinie Parma–Spezia gearbeitet, ist daraufhin eine Zeit lang in die Fremde gegangen und wurde nach seiner Rückkehr in das 13. Kavallerieregiment eingereiht. Nach dem afrikanischen Feldzug hat man ihm den Posten eines Gefängniswärters angeboten, den er aber ausschlug. In letzter Zeit hat er als Steinhauer in Lausanne gelebt. Er ist ein armes Schwein, das sag ich dir.“
„Hast du etwa Mitleid mit ihm?“
„Für einen Polizeikommissär der k.u.k. Monarchie ist Mitleid ein Fremdwort“, antwortete Rudi. Sein Blick strafte ihn Lügen. Gustav wusste seit langem, dass Rudi ein verkappter Revolutionär war. Er fragte sich nicht zum ersten Mal, was ein Mann mit seiner politischen Gesinnung bei der Polizei verloren hatte.
Rudi stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater führte ein Wirtshaus in Margareten, in der Nähe des Wienflusses. Der alte Kasper hatte sich das Geld buchstäblich vom Mund abgespart, um seinen gescheiten Sohn ins Gymnasium zu schicken und danach studieren lassen zu können. Rudi hatte sein Studium der Jurisprudenz in Mindestzeit absolviert, während Gustav, der mit ihm bereits das Gymnasium besucht hatte, wegen Betrügereien von der Universität geflogen war.
„Dieser Lucheni ist ein wütender, verzweifelter Mann, ein typischer Anarchist eben.“
„Und was wird nun mit ihm geschehen?“
„Nach der Jurisdiktion des Kantons Genf, der Lucheni untersteht, ist die Todesstrafe ausgeschlossen. Er hat also Glück gehabt oder er hat es gewusst. Egal. Ich nehme an, er wird zu dreißig Jahren Kerker verurteilt. Das Mordinstrument ist übrigens eine dreieckige einfache Feile, elf Zentimeter lang. Der obere Teil ist zugeschliffen und die äußerste Spitze abgebrochen. Der Griff ist ganz primitiv aus einem viereckigen Stück Fichtenholz geschnitzt. Auf dem Mordinstrument waren keine Blutspuren sichtbar. Trotzdem ist es eindeutig die Waffe, mit der die Kaiserin ermordet worden ist.“
Ein großer hagerer Mann mit einem dichten, sehr gepflegten grauen Schnurrbart betrat das Kaffeehaus, nahm seinen Hut ab und übergab ihn dem Garderobier.
Obwohl nicht mehr der Jüngste, war er ein auffallend gut aussehender Mann. Ein eigensinniges, intelligentes Gesicht, fein geschnittene Züge, tief liegende, dunkle Augen und volles graues Haar. Seine Ähnlichkeit mit Gustav war verblüffend.
Rudi hielt in seiner Schilderung inne und starrte Graf Batheny unverblümt an.
Gustav drängte zum Aufbruch.
Rudi, der die komplizierte Familiengeschichte seines Freundes kannte, zeigte Verständnis und rief: „Herr Ober, zahlen!“
Ausnahmsweise gerieten sie sich nicht in die Haare, wer von ihnen beiden die Rechnung begleichen dürfe. Gustav war bereits aufgesprungen, während Rudi noch auf das Restgeld wartete.
Als sie das Lokal verließen, mussten sie am Tisch des Grafen vorbei. Gustav nickte knapp. Rudi verbeugte sich tief vor Graf Batheny.
Vor dem Kaffeehaus verabschiedeten sich die beiden Freunde mit einem kurzen „Servus“ voneinander und gingen in verschiedene Richtungen.
Am Fuße des Denkmals der Kaiserin Maria Theresia zwischen den neuen Museen hockte eine Obdachlose. Gustav erkannte sie sogleich wieder. Es war dieselbe alte Hexe, die ihm gestern Abend beinah ein wenig Angst eingejagt hatte.
Sie sah ihm dabei zu, wie er einen großen Bogen um sie machte.
„So viele schöne Leichen“, kicherte sie.
Gustav reagierte nicht auf ihre Worte.
„Und es werden noch mehr sterben“, murmelte die Alte, die gar nicht so alt war, wie Gustav ursprünglich gedacht hatte. Wahrscheinlich war sie kaum älter als seine Tante.
„Er kennt keine Gnade. Er wird sie alle aufspießen.“
„Wer? Von wem redest du?“
„Vom Satan höchstpersönlich!“
Die ist komplett verrückt, dachte Gustav und ging weiter.
„Er holt sie alle zu sich in die Hölle!“, rief sie ihm nach.
5
Dorothea vermutete nach wie vor ein politisches Komplott hinter der Ermordung der Kaiserin und erging sich in allen möglichen Spekulationen. Vera schien nicht mehr so ganz von dieser Verschwörungstheorie überzeugt. Die Ellbogen auf die Tischplatte gestützt, ein Zigarillo in der rechten Hand, hörte Gustav den beiden aufmerksam zu.
„Wenn man sie damals ermordet hätte, zu der Zeit, als sie die ungarischen Aufständischen unterstützt und angeblich ein Verhältnis mit dem Grafen Andrássy gehabt hat, ja, dann würde ich dir Recht geben, dann könnte tatsächlich die österreichische Geheimpolizei ihre Finger mit im Spiel gehabt haben. Aber in den letzten Jahren war sie einfach nicht mehr präsent. Sie hatte jedes Interesse an Politik verloren“, sagte Vera.
Die Geheimpolizei respektive Staatspolizei war eine gefürchtete Organisation, über deren Aktivitäten allerlei schlimme Gerüchte im Reich kursierten.
„Ich glaube, sie litt unter einer tiefen Traurigkeit und war deswegen in den Augen der autoritätshörigen Beamten völlig unbrauchbar als höchste Repräsentantin des Kaiserreichs. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass gewisse reaktionäre Kräfte in diesem Land der Meinung sind, dass ein Vielvölkerstaat wie Österreich-Ungarn in schwierigen Zeiten eine starke Hand benötigt und keinen senilen, starrköpfigen Kaiser mit einer eitlen Schauspielerin als Freundin und einer Melancholikerin als Ehefrau“, sagte Dorothea.
„Kaiserin Elisabeth war vor allem symbolisch unheimlich wertvoll für das Reich“, widersprach Vera. „Ganz Europa war hingerissen von ihr, als sie jung war.“
„Das mag schon sein, aber seit ich erwachsen bin, habe ich sie so gut wie nie wahrgenommen. Dafür hab ich Geschichten über Geschichten über sie gehört. Anscheinend war sie schon zu ihren Lebzeiten ein Mythos. Ein Volk braucht nicht nur Mythen, sondern auch präsentable Regenten, zumindest denken das die Leute, die wirklich regieren.“
„Ich glaube nicht an ein Komplott der Aristokratie, diese Leute sind viel zu dekadent und viel zu faul und zu feige, um einen politischen Umsturz herbeizuführen, liebe Dorothea. Und die Geheimen machen so was nicht ohne Anweisung von oben. Die sind die Lakaien der Herrschenden.“
„Ich kann nur hoffen, dass du Recht hast.“
„Soviel man hört, hat die Kaiserin keinerlei Sicherheitsvorkehrungen auf ihren Reisen geduldet, sie wollte anonym bleiben und war daher ohne jegliche Bewachung unterwegs. Ihr lächerliches Inkognito, als Gräfin von Hohenembs aufzutreten, hat man bestimmt bald durchschaut. Ich bin überzeugt, dass jeder in Genf wusste, wer die Gräfin in Wirklichkeit war.“
„Willst du damit etwa andeuten, dass sie selbst schuld an ihrer Ermordung war?“, warf Gustav ein.
„Nein. Ich denke nur laut nach“, meinte Vera ungehalten.
„Das würde meine andere Theorie unterstützen“, sagte Dorothea, ohne Gustavs Einwurf zu beachten. „Sie sehnte sich nach dem Tod. Vielleicht hat sie es selbst darauf angelegt, dass sich ihre Todessehnsucht erfüllt …“
„Hör auf zu fantasieren, Dorothea. In der Zeitung stand, ein Anarchist hat sie ermordet, weil das Opfer, das er für sich auserkoren hatte, zufällig gerade nicht greifbar war.“
„Es gibt keine Zufälle, Gustl, glaub mir!“
Gustav war froh, als sich die Damen nach dem Mittagessen, das sie, wie immer, wenn sie keine Gäste hatten, in der Küche einnahmen, in ihre Zimmer zurückzogen, um sich für das Begräbnis umzuziehen. Er konnte und wollte sich vor allem Dorotheas haarsträubende Theorien nicht länger anhören.
Dorotheas Räumlichkeiten befanden sich links von der Eingangstür. Ihr Zimmer war etwas kleiner als die anderen beiden, dafür war ihr Ankleideraum doppelt so groß wie Veras. Dorothea hatte ihn mit Hilfe eines Schreibtisches und eines Bücherregals in ein Arbeitszimmer verwandelt. Deshalb kam sie auch kurz darauf mit einer Hand voller Kleider wieder in die Küche und störte Gustav beim Genuss eines Zigarillo und eines kleinen Verdauungsschnäpschens.
„Musst du dir Mut antrinken fürs Begräbnis deiner geliebten Kaiserin?“
„Zieh dich endlich um. Du bist dieselbe Trödelliese wie Vera“, sagte Gustav ungalant.
Grinsend verschwand Dorothea in Veras Ankleidezimmer, das sich im hinteren Teil der Küche neben der Dienstbotenkammer befand.
Daraufhin suchte auch Gustav sein Zimmer auf. Er hatte den ehemaligen Salon, in dem nach seiner Geburt seine Großeltern gewohnt hatten, für sich allein. Es war der schönste und größte der drei Räume, hatte aber keinen eigenen Ankleideraum.
Er zog seinen schwarzen Anzug an und schlüpfte in seine alten schwarzen Schuhe, die ihm Josefa aufpoliert hatte. Wenn er auf seine Schuhspitzen hinabblickte, konnte er fast sein Antlitz im spiegelglatten Lackleder sehen. Ungeduldig schritt er in der Küche auf und ab.
„Setz dich endlich hin und trink deinen Kaffee“, sagte Josefa. „Die Damen benötigen sicher noch eine Weile.“
Vom Küchentisch aus erhaschte er so manchen Blick auf Dorothea und Vera, die sich vor dem großen Spiegel im Ankleidezimmer seiner Tante kritisch beäugten.
„Ihr seht fantastisch aus. Kommt endlich. Sonst werden wir die Zeremonie versäumen!“, rief er, nachdem sich Dorothea zum dritten Mal mit einem von Veras Schals im Spiegel betrachtet hatte.
„Es ist völlig egal, was ihr anhabt, Hauptsache ihr seid schwarz gekleidet.“
In Tante Veras Ankleidezimmer herrschte das übliche Chaos. Amüsiert beobachtete Gustav, wie sich Dorothea auf die Knie begab, um in den unteren Schubladen von Veras Schrank schwarze Handschuhe zu finden.
„Schau lieber in den Bücherregalen oder auf ihrem Schreibtisch nach. Vera pflegt ihre Handschuhe dort abzulegen, wenn sie spät abends von ihren Frauenversammlungen nach Hause kommt“, riet Gustav seiner jungen Mitbewohnerin.
„Josefa, könntest du diesem sinnlosen Treiben nicht endlich ein Ende bereiten? Bitte hilf den Damen beim Ankleiden, sonst versäumen wir den Beginn der Feierlichkeiten“, wandte er sich hilfesuchend an sein altes Kindermädchen.
Und tatsächlich, kaum hatte sich Josefa eingeschaltet, waren die Damen ausgehfertig.
Sie hängten sich links und rechts bei Gustav ein und spazierten zu Fuß zur Kapuzinergruft. Die drei schönen schwarz in schwarz gekleideten Menschen ernteten so manch bewundernden oder neidischen Blick auf ihrem Weg.
„Ich fürcht mich …
„Ich fürcht mich so“, flüsterte die blutjunge Zofe. „Wollen Sie das wirklich tun? Es ist nicht richtig. Was, wenn uns jemand erwischt?“
„Sei still, du dummes Ding!“, fauchte ihre Herrin sie an. Die Gräfin hatte immer davon geträumt, sich einmal im Leben wie die Kaiserin höchstpersönlich zu fühlen. Heute würde ihr Traum endlich wahr werden. So eine Gelegenheit kam nie mehr wieder.
Zitternd folgte die neue Zofe der Hofdame über die Geheimtreppe hinauf in die Privaträume Ihrer Majestät. Immer wieder blickte sie sich ängstlich um. Dabei schwappte Wasser aus den beiden großen Krügen in ihren Händen auf die Stufen.
„Kannst du nicht aufpassen!“, schimpfte die Gräfin, als ihr Kleid ein paar Spritzer abbekam.
„Entschuldigen Sie bitte. Ich tu das nicht absichtlich. Ich hab die Krüge zu voll gemacht.“
„Damit du nicht so oft auf und ab laufen musst, du faules Geschöpf.“ Trotz ihres Geschimpfes schien die Gräfin bester Laune zu sein. Als die Wanne im Toilettezimmer der Kaiserin halb voll war, ließ sie sich von der Zofe aus ihren Kleidern schälen und von ihr helfen, ein großes, weißes Handtuch um ihr langes, rötlichbraunes Haar zu schlingen. Danach schickte sie das Mädchen um weitere Krüge mit heißem Wasser in die Küche.
In ihrem eigenen Haus hatte sie Fließwasser. Sie fragte sich, wie die Kaiserin es bloß in diesem alten Barockschloss ohne jeglichen modernen Komfort ausgehalten hatte. Wahrscheinlich hatte Ihre Majestät Schönbrunn nicht zuletzt wegen der primitiven Ausstattung gemieden.
„Es wurde schön langsam Zeit. Das Badewasser ist nur mehr lauwarm“, sagte die Gräfin, als die Zofe mit den Krügen zurückkam.
„Entschuldigen S’ bittschön, der Herd ist ausgegangen, ich hab erst wieder nachlegen müssen.“
„In der Tasche meines Kleides steckt ein Brief. Reich ihn mir bitte und dann verschwinde. Ich brauche dich nicht mehr.“
Die Zofe tat, wie ihr geheißen.
Versonnen lächelnd las die Gräfin zum zehnten Mal die paar Zeilen, deren Wortlaut sie ohnehin auswendig wusste.
„Ma Clementine! Erwarte mich während der Begräbnisfeierlichkeiten im kaiserlichen Boudoir. Ich werde zu dir eilen, sobald es mir möglich ist, mich davonzustehlen. Ich kann es kaum mehr erwarten, dich aus dem Bade steigen zu sehen, so wie Gott dich schuf, meine schöne Nymphe! Auf ewig der Deine.“ Die Unterschrift war kaum lesbar, wie in all seinen Briefen. In diesem Moment öffnete sich die Tapetentür neben dem Kamin.
„Mon ami, du hast mich zu Tode erschreckt!“ Ihr koketter Blick sagte etwas ganz anderes. Sie ließ den Brief ins Wasser fallen und schlang ihre schlanken schneeweißen Arme um seinen Hals, als er sich über sie beugte und sie küsste.
Es ging alles sehr schnell. Mit der Rechten umklammerte er ihr Handgelenk. In seiner Linken blitzte die Klinge einer Schere auf. Ihr wurde plötzlich warm ums Herz. Sie sah noch, wie ihr Blut das Wasser verfärbte, und wunderte sich, wie dickflüssig es war. Kurz darauf schwanden ihr die Sinne.
6
Tausende Wiener waren gekommen, um Ihrer Majestät das letzte Geleit zu geben. Trotzdem brach keine Massenhysterie aus. Der erste Schock war vorüber, die ersten Tränen vergossen. Gustav hatte den Verdacht, dass die meisten aus reiner Sensationsgier und weniger aus Trauer gekommen waren. Kaiserin Elisabeth hatte sich ihrem Volk entfremdet. Wie Dorothea richtig bemerkt hatte, gab es eine junge Generation von Österreichern, die ihre Kaiserin gar nicht kannte, nie zu Gesicht bekommen hatte.
Die Begräbnisfeierlichkeiten erinnerten Gustav eher an einen der Festumzüge zu Fronleichnam oder zu diversen kaiserlichen Thronjubiläen. Die vielen Gaffer bestaunten die prächtigen Galauniformen der Offiziere von den diversen Regimentern, besonders die farbenfrohen ungarischen, und die edlen Gewänder der aristokratischen Damen, die ihre neuesten und extravagantesten Modelle trugen – oder besser gesagt, sich darin zur Schau stellten. Es fehlte gerade noch, dass die Menge zu applaudieren begann. Der Großteil der Trauergäste war ganz in Schwarz gekleidet und hatte sich, trotz des warmen Wetters, mit kostbaren Pelzen und Straußenfedern geschmückt. Seine schönen Begleiterinnen, die Bekannte vom Österreichischen Frauenverein getroffen hatten, verlor Gustav bald aus den Augen.
„Was für ein Aufmarsch der Eitelkeiten“, flüsterte ihm plötzlich eine bekannte Stimme ins Ohr.
„Rudi! Du bist auch da.“
„Schon länger als du. Ich wurde zum Sicherheitsdienst abkommandiert. Was für ein Spektakel“, meinte er leise. „Hat sich Ihre Majestät das verdient?“
Gustav wollte seinen Freund schon zurechtweisen, als er die Ironie, die in Rudis Worten lag, erkannte. „Du hast Recht. Sie hat für das spanische Hofzeremoniell nie viel übrig gehabt. Vor dem strengen Protokoll bei Hof ist sie gern geflohen.“
Der Kaiser und die Mitglieder des Herrscherhauses begaben sich vor der Überführung der Leiche zu den Kapuzinern und wurden am Kaiser-Einfahrtstor von den Patres empfangen.
Nachdem die Meldung, dass der Leichenzug herannahte, erstattet worden war, gingen die allerhöchsten Herrschaften in die Kirche.