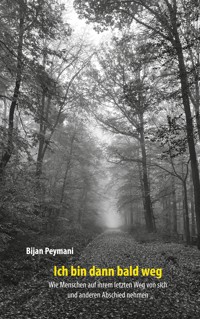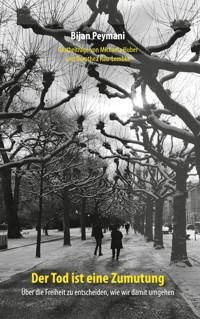
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ohne Denkverbote, mit klarer und kraftvoller Sprache, richtet sich dieses Buch an alle, die nach einem schicksalhaften Verlust wieder zu sich selbst zu finden hoffen. Es soll aber auch den Angehörigen helfen, besser zu verstehen, was genau in einem trauernden Menschen vorgeht. Denn Trauer ist individuell und ein Überwinden nie sicher. Schonungslos zeigt das Buch die verschiedenen Wege auf und tritt dabei konsequent für Selbstbestimmtheit ein. Es will Anstöße geben, mit Tabus brechen und zur breiten Diskussion anregen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet meinem Lieblingsmenschen und treuen Gefährten über fast 28 Jahre.
Inhalt
Vorwort von Michaela Huber: Melancholie – stilles Drama und Sehnsucht nach dem Trost
Das Trauma eines persönlichen Verlustes
Sterben und Trauern als große Unbekannte
Die angemessene Begleitung Trauernder
Der Weg der Überwindung scheint das Ziel
Exkurs: Sterbehilfe in Deutschland – Möglichkeiten und Grenzen
Die immerwährende Suche nach dem Sinn
Die Zeit, in der wir leben – und die uns bleibt
Das Geschäft mit der menschlichen Endlichkeit
Trauerrituale weltweit – der bessere Ansatz?
Schlussbemerkung
Gastkapitel/Dorothea Rau-Lembke: Der Umgang mit dem unsagbar Unsäglichen – Lernen aus Traumata
Vorwort von Michaela Huber: Melancholie – das stille Drama und die Sehnsucht nach dem Trost
„Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz: Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.“
So fein, so gefühlvoll und zugleich traurig formulierte einst Rainer Maria Rilke, einer der bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts. Er setzte diese Worte an den Anfang seiner „Duineser Elegien“. Die beeindruckende Sammlung von zehn Klagegedichten („Elegien“) beschreibt den inneren Weg der Auseinandersetzung mit sich, prototypisch für den Künstler, den Suchenden, Erfahrenden, sein Bewusstsein Erweiternden. Ein Prozess, der 1912 begann und – durch den Ersten Weltkrieg buchstäblich auseinandergerissen – erst 1922 abgeschlossen werden konnte.
Am Ende kommentierte Rilke sein Werk selbst: „Lebens- und Todesbejahung erweist sich als Eines in den ,Elegien’. Das eine zuzugeben ohne das andere, sei, so wird hier erfahren und gefeiert, eine schließlich alles Unendliche ausschließende Einschränkung. Der Tod ist die uns abgekehrte, von uns unbeschienene Seite des Lebens: wir müssen versuchen, das größeste Bewußtsein unseres Daseins zu leisten, das in beiden unabgegrenzten Bereichen zu Hause ist, aus beiden unerschöpflich genährt.“
Für mich, die ich mich als Psychologische Psychotherapeutin ein Leben lang mit der Melancholie (oft anders benannt, aber das soll hier keine Rolle spielen) in meinen oft so schwer geschädigten Patienten beschäftige, sind die „Duineser Elegien“ seit vielen Jahren ein Quell der Inspiration. Und wenn ich meinen PatientInnen davon vorlese, in dieser, auch damals neuen, wunderbar gefassten Sprache, mit langsamer Betonung, damit der Sinn des so Verdichteten erkennbar werden könnte, dann nicken sie, staunen und sagen meist so etwas wie „Das kenne ich“.
Wovon erzählt Rilke am Anfang seines Gedichtes? Von Untröstlichkeit.
„Wer, wenn ich schriee“: Konjunktiv. Ja wenn ich schreien würde, wenn es denn nach außen käme. Oft ist der Kummer so schlimm, dass er – ins Hirn gesickert, in den Körper eingedrungen, hinabgesunken in die Seele – den Menschen erstarren und auf Dauer erschlaffen lässt.
Tief drinnen aber klumpt sich die „schwarze Galle“ (griechisch: „melancholia“) zusammen, versteinert und ergibt manchmal so einen kleinen kalten Knoten oder mehr aus fühllosem Trotz: Da ist etwas, das war. Das hätte ablaufen sollen. Und das bleibt. Etwas, das nicht weiter fließen konnte, keinen Raum dazu hatte und daher innen kaum Raum einnimmt. Nur in Momenten, in denen es wieder so ist, wenn niemand hört und niemand antwortet, wenn man das Geröll des Grolls spürt – dann tut es weh.
„Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen“: Ja, man ist beschädigt, man ist auf seltsame Art vom Geröll des Grolls erfüllt, melancholisch und leise böse. Denn die Wucht des Eingedrungenen macht einen zum Außenseiter, Loser, Outlaw, vielleicht zum einsamen Wolf. Oder zur still leidenden Maus. Die fernen anderen – früh einsam Gewordene sagen über ihre Mutter, die nicht trösten konnte, zum Beispiel: „diese schöne, fremde Frau“ – sind manchmal grausam, aber oft auch gutwillig, freundlich, leuchtend und engelsgleich. Nur so weit, unendlich weit weg, wie später auch andere gutwillige Menschen, für den tief innen vergrabenen Kummer. Da außen herrschen Ordnungen, die für innen nicht gelten, an die man sich nur anpassen kann, mehr oder weniger freundlich lächelnd…
„Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz“; wieder im Konjunktiv. Staunend hört man die Sängerin trällern: „Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf’s ankommt – weiß ich, was ich tu.“ Ein kummervoller Mensch wird es nicht wissen. Ganz „plötzlich“, also nach langer Zeit des Darbens, „ans Herz“ genommen zu werden, wirkt eher erschreckend. Distanzlos. Zu dicht, zu nah, zu viel. Denn „ich verginge von seinem stärkeren Dasein“. Konjunktiv, immer noch. Man sieht, fühlt voraus: Wenn Du Dich meiner bemächtigst, wenn Deine Stärke auf meine Schwäche trifft, kann ich nicht bestehen.
Viele Menschen haben mir erzählt, dass sie fürchten, „gesehen“ zu werden. Schon das wird fast panisch vermieden. „Schau mich bitte nicht so an, Du weißt genau, ich kann Dir dann nicht widerstehen.“ Diesen Teil des Liebesliedes, das ganz anders weitergeht, verstehen viele scheue Menschen als: „Ich könnte verschwinden, wenn Du mich berührst“, wie der Titel eines Buches einer solch scheuen Frau lautet. Denn um den Kummer, um diesen kleinen kalten Knoten, der manchmal schmerzt, herum ist eine Persönlichkeit entstanden, die sich – und ihn – zu schützen bemüht ist, oft lebenslang. Und ihn dadurch vor der Auflösung bewahrt. Und sich. Der Kummer tief innen nämlich wird als das Authentischste von sich empfunden.
„Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen“: Indikativ mit Aussicht auf Futur 1 („Es wird sehr schrecklich werden“) oder sogar Futur 2 („Später wird es schlimm gewesen sein – also wehret den Anfängen!“). Das Schöne immer als den Beginn des Schrecklichen zu sehen, ist eine typische Sichtweise des Melancholikers. „Warum freuen, wenn es doch wieder schlimm wird?“ Und so hält man den Ball flach, atmet vorsichtig ein und aus, wenn es schön ist, und erwartet das Unvermeidliche: das kommende Unglück.
Wenn man Glück vermeiden könnte (das Glück, das man doch so sehr ersehnt), würde man es tun. Weil es einmal so absolut unaushaltbar schlimm war, was nach dem Geborgensein geschah, soll es nie wieder so sein. Nie mehr. Lieber sich nicht einlassen, auf das Schöne, oder nur ein kleines bisschen, gerade so viel, dass das Damoklesschwert vielleicht dieses Mal nicht allzu grausam niedersaust – oder man rechtzeitig zurückzucken kann. „Weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören.“ Das Nichtzerstören liegt ebenso wie das Zerstören in der Macht des jeweils anderen, vom Melancholiker aus gesehen. Nur der Mächtige kann das Zerstören „gelassen verschmähen“. Hopp oder top. Daumen rauf oder runter.
Wer einmal auf Gedeih und Verderb sein Schicksal oder sein Herz in der Hand eines mächtigen Anderen hatte, als Kind, als verliebter Teen oder später als reiferer Mensch, und gespürt hat, was die Zerstörung, etwa die Trennung oder der Verlust des anderen, dann anrichtete, fürchtet die Macht jedes anderen lebenslang. Und so gilt für ihn: „Ein jeder Engel ist schrecklich.“ Bleib mir vom Leib, rühr mich nicht an. So wird das Liebevolle, Engelsgleiche im anderen Menschen zu etwas Gefürchtetem.
So geht es auch in der Spiritualität, die ein Melancholiker oft verloren hat. „Es gibt keinen guten Gott.“ – „Ein Gott, der so etwas zulässt, muss ein Zyniker sein.“ – „Gott ist tot.“ – „Es gibt keinen Gott, nur die Kälte und Einsamkeit da draußen im All.“ Da man sich nicht mehr von der Liebe anrühren lassen möchte, da alles „keinen Sinn“ hat, werden viele Melancholiker selbst zu Sarkasten, wenn nicht zu Zynikern.
Wer die Begegnung im Buber’schen Sinne („Jedes wirkliche Leben ist Begegnung“) scheut, wird bestenfalls die Höflichkeit und den geschliffenen Humor eines Oscar Wilde schätzen („Ich bin durchaus nicht zynisch, ich habe nur meine Erfahrungen, was allerdings ungefähr auf dasselbe hinauskommt.“). Und im schlimmsten Fall zu denen gehören, die, wenn sie Blumen sehen, sofort nach dem Sarg Ausschau halten, wie der deutschstämmige US-Journalist Henry L. Mencken einmal ätzte.
Rilke lässt den ersten Zeilen seiner ersten „Duineser Elegie“ noch weitere eindrucksvolle Sätze folgen:
„Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunkelen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht, und die findigenTiere merken es schon, daß wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind in der gedeuteten Welt.“
Hier wird immer deutlicher, dass der Mensch in seinem einsamen Kummer gern schluchzen würde, dass er das aber nicht wagt, vor dem Hintergrund, dass ihm schon durch einen anderen Menschen genau dieser Kummer angetan wurde. Der heraus müsste, aber zurückgehalten wird, weil man dasselbe nicht noch einmal erleben möchte. Weder im spirituellen Engel noch im wirklichen Menschen findet diese Not ein Gegenüber. Und selbst die Tiere merken, dass dieser Ich-Erzähler mit seinem inneren „Wir“-Gefühl sich in der Welt unbehaust fühlt und schlecht zurechtkommt.
Oft merken die Tiere das besser als andere Menschen – je nachdem, wie der kummervolle Mensch sich tarnen kann. Tiere können dann auf klügere Weise tröstend sein als jeder Homo sapiens. „Gib dem Menschen einen Hund, und seine Seele wird gesund“, meinte schon Platon, vielleicht etwas zu optimistisch. Und manchmal kann man die Fürsorge eines Tieres besser annehmen als die einer menschlichen Person. Kaspar Hauser-Syndrom nennt man das im schlimmsten Fall: ein Mensch, der, von Tieren versorgt, sich in der menschlichen Gemeinschaft nicht (mehr) zurechtfindet.
Was bleibt dem Menschen, dem ungetrösteten, untröstlichen? Rilke fährt so fort, in seinem Text:
„Es bleibt uns vielleicht irgend ein Baum an dem Abhang, daß wir ihn täglich wiedersähen; es bleibt uns die Straße von gestern und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, der es bei uns gefiel, und so blieb sie und ging nicht.“
Der melancholische Mensch, unbehaust in der Welt der anderen, gewöhnt sich an das, was er täglich sieht, und reagiert vielleicht wie der „Kleine Prinz“ von Saint-Exupéry: „Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man Sonnenuntergänge.“ Das Vertraute wird zum Nichtaufreger, es tröstet auf seine Weise, mit seinem stoischen, vielleicht selbst irgendwie traurigen oder zumindest zu verantwortenden Vorhandensein – wie Sitten und Unsitten, zu befolgende Regeln und die Symptome und Routinen, an die man sich gewöhnt hat. Und wer sich an das Banale von gestern erinnern kann, erwartet zwar wenig vom Heute oder Morgen, aber lebt in einer Kontinuität, die den entsetzten Aufschrei des jähen Endes (noch?) nicht enthält.
Jenes jähen schmerzhaftesten Endes, das man schon einmal erlebte, und von dem man ahnt, dass man ihm doch nicht endlos (noch einmal) ausweichen kann. Je nachdem, wie quälend diese tiefe innere Wahrheit dem Menschen erscheint, können die selbsttröstenden Angewohnheiten auch – sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge – selbstzerstörerisch sein, wie die Neigung, zu viele Medikamente, Drogen, Alkohol zu schlucken, unerklärliche Unfälle zu haben oder sich geistig, seelisch, körperlich oder in Beziehungen aufzureiben.
„O und die Nacht“, fährt Rilke fort, „die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum uns am Angesicht zehrt –, wem bliebe sie nicht, die ersehnte, sanft enttäuschende, welche dem einzelnen Herzen mühsam bevorsteht.“ Oh ja, die Nächte, sie können grausam sein, für kummervolle Menschen. Erschöpft vom Tage, sehnen sie sich nach dem „kleinen Tod“ des Schlafes. Er möge den inneren Drang, sich zu entäußern, löschen, das Toben beruhigen, die müden Knochen sanft betten, vielleicht den gesamten Körper gen Morgen mit Energie aufladen. Aber dann. Dann schafft man es nicht in den komatösen Schlummer. Oder man ahnt, was auf einen wartet, in der Nacht.
Entweder, man vermeidet dann den Schlaf und flieht nach draußen, wo die Weite, das rettende Dunkel, die Sterne und vielleicht irgendwo Musik und Lichter wie Leuchtfeuer von der Enge und der inneren Schwärze der nächtlichen Unruhe ablenken. Oder man erlebt in den Träumen und Albträumen das quälende Gewahrwerden innerer Agonie, schreckt immer wieder hoch und vergräbt das Gesicht in den Händen. Viele Kummervolle sehnen sich nach gutem Schlaf und sind enttäuscht und zermürbt, wenn sie wieder und wieder das Hochkriechen und sich öffnen Wollen des kleinen kalten Knotens im Innern wahrnehmen. Ja, die Nacht.
„Ist sie den Liebenden leichter?“, fragt sich Rilke, und antwortet: „Ach, sie verdecken sich nur mit einander ihr Los.“ Ist Partnerschaft also keine Lösung? Dann nicht, wenn es nicht gelingt, sich wirklich aufeinander auf Gedeih und Verderb einzulassen. Viele Liebende tun das nicht. Sie wissen es nicht besser. Oder sie wollen einander nur das zeigen, was sie an sich für das Beste halten. Sie „verschlucken den Lockruf dunkelen Schluchzens“ auch einander und fürchten, dann erneut, offen wie ein Stück rohes Fleisch, zurückgelassen zu werden – schutzlos, hilflos, sterbend vor Schmerz.
Und so sind sie anfangs lieb miteinander, respektvoll und vorsichtig, aber im Innersten einander fremd. Und schließlich behandeln sie einander so, wie sie sich selbst im Innersten behandeln: ängstlich, wütend, vermeidend, bis die Liebe nach und nach erlischt. „Jeder für sich und Gott gegen alle“, wie Werner Herzog seinen Film über Kaspar Hauser betitelte, so habe ich etliche Paare erlebt, in ihrer gemeinsamen Hilflosigkeit. So manches Mal habe ich mich gefragt: Wie können sie einander nur so wenig kennen? Dass jeder der beiden den vergrabenen Kummer hütete und einen Zerberus vor die eigene Hölle gesetzt hatte, der im Streitfall den anderen fertigmachen konnte, das hat sich mir im Laufe der Jahrzehnte mehr erschlossen.
Und so manchem Einsamen habe ich Rilkes überraschenderweise auf die vorherigen Zeilen folgende Empfehlung vorgelesen:
„Weißt du’s noch nicht? Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen; vielleicht daß die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigerm Flug.“
„Wirf aus den Armen die Leere“ – das ist oft der Anfang einer Veränderung. Das Gefühl des inneren Vakuums, das so viele Kummervolle empfinden, mal zu entäußern, hilft ihnen oft, die Annäherung an das Unaushaltbare im kalten kleinen Kern für sich zu ermöglichen. Das Leeregefühl, das lähmende, von dem in etlichen Büchern der „Generation Z“ zu lesen ist, „zu den Räumen hinzu“ zu werfen, „die wir atmen“, ist ein so ungewöhnlicher Vorschlag, dass wir oft Stunden damit zubringen, das genauer zu untersuchen. Was könnte das sein?
In Bewegung kommen, das Leeregefühl nach außen „werfen“, nicht es dem anderen überstülpen und gemeinsam ins Vakuum zu versinken, wie könnte das vonstatten gehen? Und die Reaktion könnte wirklich sein, dass „die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigerm Flug“? Dass es für andere Räume eröffnen könnte, wenn der still Leidende sein inneres Leeregefühl „hinauswirft“, in die Luft? Welch großartige Vorstellung.
So manchem „Lebensmüden“ habe ich die nächsten Zeilen Rilkes aufgeschrieben:
„Ja, die Frühlinge bräuchten dich wohl. Es muteten manche Sterne dir zu, daß du sie spürtest.“
„Wie? Mich?“, antworten manche auf die eine oder andere Weise. „Die Frühlinge bräuchten mich?“ Was für eine Umkehr des Bisherigen. Der melancholische Mensch braucht den Frühling wie die Luft zum Atmen. Nun soll er den ungeheuerlichen Gedanken zulassen: „Die Frühlinge bräuchten dich wohl“? Warum bräuchten die Frühlinge Dich? Weil sie Dein Sein – wie Du bist – als Leben zum Entstehen brauchen. Ohne Leben wird es keinen Frühling geben. Und die Sterne, man soll sie „spüren“? Das „muten sie dir zu“? Was bedeutet das? Denken Sie darüber nach, und lesen Sie fort, in diesem vielleicht wichtigsten Text, den dieses Genie Rainer Maria Rilke je geschrieben hat. Im neunten Klagegedicht seiner „Duineser Elegien“ heißt es:
„Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag?“
Diesen Satz gab Rilke seinem Alterswerk als Motto – ein Werk, das der quälenden Suche nach der Erlösung inneren Schmerzes und nach spirituellem Aufgehobensein entstammt.
Melancholie, die innen angesammelte „schwarze Galle“, die kleinen kalten Steine aus unverdautem und möglicherweise unverdaubarem Kummer, sie will und will zugleich nicht verstanden und gelöst werden. Worin lässt sie sich wandeln? In eine Art, sanft mit sich und den eigenen Beschädigungen umzugehen? In eine mildere Art von Verzweiflung? In einen schmerzhaften Auflösungsprozess der kleinen Knoten? Sublimiert in Humor, Satire, Sarkasmus? Oder in einem Erkennen und Versorgen der anderen, auf dass das Eigene dadurch auch etwas mehr heilen kann?