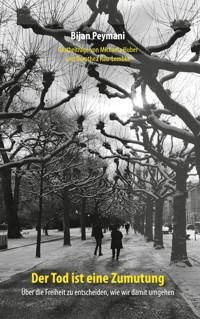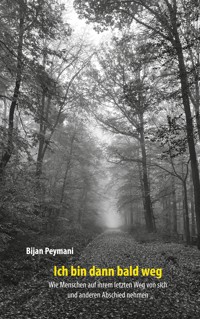
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wir alle wollen leben! Deshalb können wir es kaum fassen, dass ein Mensch sein Leben selbstbestimmt beenden möchte. Dass er aufgeben will, wie es heißt, ganz so, als sei Der- oder Diejenige zu feige, trotz noch so widriger Umstände weiterleben zu wollen. Doch es kann jeden von uns ein Schicksalsschlag treffen, der ein qualitatives Weiter subjektiv nicht mehr zu ermöglichen scheint oder objektiv nicht mehr möglich macht. Wie zum vorzeitigen Sterben verdammte und zu ihrem vorzeitigen Ende bereite Menschen auf ihrem letzten Weg von sich und anderen Abschied nehmen, damit befasst sich dieses Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet meiner Schwester, die mich mit Liebe, Verständnis und Tapferkeit begleitet.
Inhalt
Lebenswenden – bis zum Kipppunkt
Das Schicksal annehmen, um jeden Preis?
Freud und Leid – zwei souveräne Gebieter
Depression – die unterschätzte Volkskrankheit
Exkurs: Die Psychisch-Kranken-Gesetze
Vor der Zeit gehen: Der große Unterschied
Das Unaushaltbare irgendwie aushalten
Beim Sterben helfen – Tabu-und Grauzone
Exkurs: Schwangerschaftsabbruch – Töten auf Verlangen?
Palliativ- und Hospizangebote: Wartesaal zum Jenseits?
Schlussbemerkungen
„Ode an Markus“
Lebenswenden – bis zum Kipppunkt
Schmerz. So viel Schmerz. Einer, der alles Lebendige verbrennt. In mir steckt ein Pfeil, den niemand sehen kann. Lange füllte mich dunkle Leere. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wohin mit mir. Hatte nur noch mich, hielt mich fest und versuchte, nicht zu fallen. Vor meinen Augen starb der Mensch, mit dem ich mein halbes Leben teilte. Ich verlor mit ihm einen Gefährten, der mir wie ein Bruder war. Doch das allein war es nicht: In mir und um mich herum zertrümmerte dieser Schlag alles – das, was mich ausmachte, aber auch mein wirtschaftliches Fundament und vor allem die Gesundheit. Ich wurde zum ohnmächtigen Beobachter meines eigenen Dahinscheidens.
Ich hatte mich aufgelebt, mir kamen Kraft und Gründe zur Gegenwehr abhanden. Noch war ich nicht im Himmel und nicht in der Hölle. Ich ging durchs Fegefeuer. Von dem, was mich einst mit Sinn erfüllte, blieb nicht mehr viel übrig. Bald wurde ich mir selbst und anderen fremd. Die Welt drehte sich weiter, und auch an allen Tagen nach diesem Schicksalsschlag ging die Sonne wieder auf. Doch für mich blieb alles anders. Ich wollte nicht mehr, hatte aufgehört, den nächsten Tag anzunehmen, als ich aufhörte, das Leben anzunehmen.
Tatsächlich hatte ich in meinem Leben vieles erreicht und alles gehabt, was mir bedeutsam war. Ich hatte bis dahin ein erfülltes und sehr erfüllendes Leben. Ja, ich hatte es einstmals geliebt. Genau genommen lieben wir ja nicht das Leben. Sondern wir lieben Menschen und Momente, Erfahrungen und Erinnerungen und das, was wir erlebt und erschaffen haben. Das erst macht Leben aus.
Wer dabei echtes Glück hat, der begegnet womöglich der einen Person, die es wert ist, dass er ihr all die Aufmerksamkeit, all die Zuneigung schenkt, die er zu geben vermag. Mir wurde dieses Glück zuteil. Von Liebe könnte ich schreiben. Doch Liebe ist ein so großes Wort und wird oft falsch aufgefasst. Reine Liebe ist weit entfernt von Romantik. Sie hat auch wenig mit Erotik oder mit Sex zu tun. Vielmehr ist sie mit Arbeit verbunden, zur gegenseitigen Ergänzung, mit täglicher Pflege und getragen von dem ehrlichen Respekt, den zwei Menschen einander erweisen.
Die Verbindung zwischen meinem Gefährten und mir entstand aus Gemeinsamkeit und Grundvertrauen. Sie wuchs durch Erfahrung und Neugier, reifte durch Krisen, Chaos und Gelehrsamkeit. Unser Weg war nicht immer einfach und auch nicht immer friedlich, oft wehrhaft bis zur Todesverachtung. Wir hatten zusammen vielleicht kein besseres Leben.
Aber wir hatten einander. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das passende Wort Freundschaft oder – jetzt schreibe ich doch davon – nicht vielmehr Liebe ist. Ich weiß nur, dass ich sie in mir spüre, diese Liebe, so lange ich lebe, und vermutlich darüber hinaus.
Wer, derart verbunden, eines Tages diesen Menschen verliert, der denkt, alles andere müsse ebenfalls enden. Aber alles andere geht einfach weiter – nur eben nie wieder, wie es war. Der französische Schriftsteller Jean Giraudoux formulierte einmal bildhaft: „Man hat ein einziges Wesen verloren. Und gleich ist diese Leere mächtig bevölkert.“ Ja, wir bleiben von zahllosen anderen Wesen umgeben: Familie, Freunde und Menschen, die ein ähnliches Schicksal teilen. Das soll uns trösten, kräftigen, hoffen lassen, eines Tages an ein Morgen anknüpfen zu können.
Doch für viele Betroffene sind die meisten der anderen Wesen nur Statisten, die den Blick verstellen. Eher unwillkommen, jedenfalls bedeutungslos, soweit sie das individuelle Leid nicht in seiner Gänze mitfühlen und auf Dauer mittragen können. In ihrer Trauer suchen Hinterbliebene daher immer wieder Erlösung in der Einsamkeit. Denn die verheißt ihnen Raum, ganz sie selbst sein zu dürfen. Auch ich wollte einfach sein, ohne Appelle und ohne Imperative. Nur sein im Moment.
Bis zum Tode meines Gefährten war mir Einsamkeit kein Begriff. Nun war sie mein unerbittlicher Begleiter, selbst in Gesellschaft. Ich las dazu Fachartikel, die mich sorgen sollten und doch gleichgültig ließen. So hat die Wissenschaft festgestellt, dass das Gefühl von Einsamkeit und gesellschaftliche Isolation das vorzeitige Sterberisiko eines Menschen erheblich erhöhen, nämlich im Schnitt um 14 Prozent beziehungsweise sage und schreibe ein Drittel. Das Geschlecht der Person spielt dabei übrigens keine Rolle.
Zunehmend gesellschaftlich isoliert und auch unter Menschen einsam – so fühlte sich mein Herzensmensch mit Fortschreiten seiner Erkrankung. Fast alle Freunde oder jene, die er dafür hielt, gingen auf Abstand, und das galt mithin auch für meinen Freundeskreis. Am Ende blieben nur wir beide füreinander. Im Herbst 2022 dann verließ mein Gefährte das Irdische. Es war keiner dieser typischen Abschiede von lieb gewonnenen Menschen, die uns alle durch unser Leben begleiten.
Es schien auch mein Abschied von mir.
In der Welt gibt es zwei Arten von Schmerz: einen, der eine Zeit lang weh tut und einen, der einen Menschen für immer verändert. Dieser Schmerz mag erträglicher werden, mit der Zeit. Aber er stirbt erst mit uns selbst.
Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem ordentlichen Haus. Um Sie herum stehen andere Häuser. Eine Siedlung, mit den Nachbarn eben. Eines der Häuser stürzt plötzlich ein, weil es alt war oder das verbaute Material ziemlich schlecht. Und in diesem Haus, das Sie sehr gut durch Ihr Fester sehen können, wohnte womöglich jemand, den Sie kannten und der Ihnen vielleicht sogar nahe stand. Der ist jetzt tot. Das macht Sie ehrlich traurig. Vielleicht lebte da, gleich nebenan, Ihre Mutter? Oder ein Onkel? Oder die beste Freundin? Die Partnerin oder der Partner hat schwer verletzt überlebt, bleibt allein zurück.
So bedrückend das Geschehene für Sie sein mag: Ihr Haus steht noch. Nachdem Sie dort gegenüber geschaut, geholfen, nach Kräften getröstet und Anteil genommen haben, kehren Sie zurück, in Ihr intaktes Heim. Hier finden auch Sie nun Halt und Trost bei jenen, die Ihr Epizentrum, Ihre Mitte ausmachen. Und dann geht Ihr Leben weiter. Nicht nur irgendwie. Es geht so weiter wie bisher, mit seinen Abläufen, in seinen Strukturen, mit den Aufgaben, die der Alltag stellt. Ja, einer fehlt (nebenan). Aber nach der Erschütterung von außen – durch den Sterbefall – stabilisiert sich Ihr Leben bald wieder. Das macht den Unterschied.
Denn in meinem Fall blieb das Leben stehen.
Das Haus, das da einstürzte, war unseres, in dem wohnten mein Gefährte und ich. Die herabfallenden Trümmer hatten uns beide getroffen. Ich überlebte, aber ich trug Wunden davon, die äußerlich später kaum mehr zu sehen sein würden. Doch mein Mensch aus dem Alltag, aus meinem Leben, aus diesem jahrzehntelangen gemeinsamen Leben, der starb. Und so saß ich plötzlich in einer Ruine, dennoch hielten die Grundmauern irgendwie stand. Mit diesem Unglück wurde mein Alltag allerdings im Wortsinn über Nacht in seinen Strukturen, mit seinen Abläufen und seinen Aufgaben aufgelöst. Unwiederbringlich.
Nun hätte man einwenden können, ich solle doch in ein anderes Haus ziehen. Aber ich wollte alleine nicht weiter. Wie hätte mir das gelingen sollen, nach fast 28 gemeinsamen Jahren? Es heißt, jene, die zurückbleiben, gewöhnten sich irgendwann an das Alleinsein. Glauben Sie mir: Das ist gelogen! Indes, es war nicht die Trauer allein, die mich gefangen hielt. Was vielen aus dem Blick gerät: Ein Leben zu zweit baut darauf auf, dass sich beide nach ihren Kräften auch finanziell einbringen. Fällt einer weg, gerät das gesamte Gefüge aus der Balance.
Plötzlich stand ich vor dem Nichts. In meinen Kummer grub sich eine sich manifestierende Perspektivlosigkeit. Ich stand auf Trümmern, schwankte und stolperte vor mich hin, hielt mich halbwegs auf den Beinen. Aber immer öfter wünschte ich mir, endlich zu fallen, um diesen unerträglichen Zustand zu beenden.
Die fortschreitende Grunderkrankung meines Gefährten samt weiterer Begleiterkrankungen hatte alle vorhandenen Rücklagen aufgezehrt. Corona raubte mir schließlich nahezu meine berufliche Existenz. Es war uns gleichwohl gelungen, unser Dasein finanziell passabel auszugestalten. Und wir hatten uns ein Biotop erschaffen, abgegrenzt von weiten Teilen der Außenwelt, das uns beiden als Lebensraum Sicherheit und Geborgenheit vermittelte. Das funktionierte für mich allein nicht mehr.
Ich hatte das Gefühl, über Geld und Gebote Dritter nur noch durch und für andere zu existieren. Aber so bin ich nicht konstruiert.
Mit Nachdruck riet mir mein Umfeld, mich an die Umstände anzupassen. Die Wohnung, das eigene Auto, Liebgewonnenes und Nützliches, aber sicher Verzichtbares – alles müsse auf den Prüfstand. Reduce to the max? Darauf habe ich eine klare Antwort: Nein! Und damit stehe ich nicht allein. Einer Unternehmensberaterin schilderte ich einmal mein Dilemma. Was sie daraufhin sagte, hallt bis zum heutigen Tag in mir nach: „Sie lieben Ihre Wohnung und sehen darin nicht nur Ihr Zuhause, sondern Sie finden hier im Bestfall Sicherheit und Geborgenheit, mindestens jedoch die nötige Stabilität. Gut gewohnt ist halb gelebt. Bleiben Sie dort!“ Es gehe darum, die Einnahmen Zug um Zug zu steigern, statt sich unkenntlich zu sparen.
Und dann führte sie weiter aus: „Mit jedem Posten, den Sie ab jetzt erzwungenermaßen streichen, streichen Sie auch ein Stück Ihrer Lebensleistung, die hinter dem steht, was Sie bis hierher erreicht haben. Natürlich können Sie eine kleinere Wohnung beziehen. Sie können Ihr Auto verkaufen, noch achtsamer einkaufen und unnötige Ausgaben vermeiden. Aber damit verlieren Sie an Lebenswert und Selbstwertgefühl. Denn in Wahrheit streichen Sie Zug um Zug Ihre Lebensleistung. Und das beschädigt Sie am Ende nachhaltig.“
Beschädigt war ich längst, es hätte mich wohl vollends zerstört. Auch, weil diese ehemals gemeinsame Wohnung mit dem Raum, den mein Gefährte einnahm, wahrhaftig meine letzte physische Verbindung zu ihm ist. An besonders schlechten Tagen kann ich in sein Zimmer gehen, innehalten, meine Augen schließen und sein ganzes Wesen, seine Seele spüren, für einen stillen Moment.
Doch ich betrauere nicht nur diesen Verlust, ich betrauerte auch mich selbst. Ich war bis dahin ein Mensch, zu dem andere aufschauen und an dem sie sich aufrichten konnten. Der schier jede Situation zu meistern schien und allen Unbilden zum Trotz souverän wirkte und stark. Stark für zwei. Plötzlich jedoch war ich verbraucht, verdruckst und verloren.
So stolz ich auf meine Lebensleistung sein konnte: Sie erschien mir nur noch als eine Erinnerung. Ich war nur noch eine Erinnerung.
Seither kämpfe ich darum, mich wieder zu finden. Wer war ich denn noch? Und wer wollte ich in einem Morgen sein, das ich tief in meinem Innersten ablehnte? Gute Momente überschreiben seither schlechte Erfahrungen. Was fehlt, sind persönliche Erfolgserlebnisse, die mein Selbstwertgefühl erneuern könnten. Auch wenn ich mich weiter über Dinge errege oder um andere sorge, so spüre ich mich doch an den meisten Tagen nicht mehr. Und ich fühle die Zeit nicht mehr. Wie lange drei Monate sind, wie weit weg ein Jahr, dafür habe ich jedes Empfinden verloren. Die Zukunft bleibt für mich das Jetzt.
Als diese Lebenszeugenschaft mit meinem Herzensmenschen ihr Ende fand und damit auch mein Leben bald an sein Ende brachte, schien sich für mich der Kreis zu schließen. Denn beide waren wir mit der Welt um uns herum längst nicht mehr zurechtgekommen.
Zwar war uns nichts Menschliches fremd, die Menschen waren uns allerdings mehrheitlich fremd geworden. Doch so viel mehr hatte sich im Lauf der Jahrzehnte verändert – jedenfalls nach unserer Auffassung. Was gut und was böse ist, definieren inzwischen die Lügen der Sieger. Uns wird vorgegeben, wie wir uns zu ernähren und zu konsumieren, wie wir uns fortzubewegen haben, wer mit uns eine Gemeinschaft bildet. Schlimmer noch: was wir denken und wie wir sprechen dürfen.
Beide hatten wir das Gefühl, nur Zaungäste einer Aufführung zu sein, die auf uns immer irritierender wirkte. Inmitten dieses scheinbar unaufhaltsam um sich greifenden Irrsinns war es die gemeinsame Verbindung, die uns den Sinn erhielt, die es erträglich machte.
Der jüngst verstorbene Schauspieler Alain Delon bekannte kurz vor seinem Tod: „Das Leben reizt mich nicht mehr. Ich habe alles erlebt. Ich hasse diese Epoche, ich habe genug davon! Alles ist falsch, alles wird auf den Kopf gestellt. Alle lachen übereinander, ohne sich selbst anzusehen! Ich weiß, dass ich diese Welt verlassen werde, ohne darüber traurig zu sein!“ Ich kann Delon gut verstehen.
Worüber ich nie nachdachte, was mir heute jedoch klar ist: Mein Gefährte war meine Insel der Ruhe; ohne ihn wäre ich vermutlich schon lange vorher ins Meer gespült oder von den sich um mich herum auftürmenden Wellen verschlungen worden. Die enge Bande zu ihm war mein Unterstand, selbst wenn die Lage aussichtslos erschien. Ich hätte mein Leben für seins gegeben. Als er von mir ging, fragte ich mich, wofür ein Mensch noch lebt, wenn da nichts mehr ist, wofür er sterben würde.
Ich wollte nicht mehr weiter. Jedenfalls nicht nur, damit es erst mal weitergeht, irgendwie. Das galt auch für die Verbesserung meiner finanziellen Situation. Es gab Optionen, sogar konkrete Angebote, die allerdings weniger an meine Vernunft und eher an meine Eitelkeit appellierten. Die meine Überzeugungen und Werte einer ernsthaften Prüfung unterzogen, mir selbst in Vollzeit nicht ermöglicht hätten, meine Existenz ohne Transferleistungen zu sichern. Das ist entwürdigend.
„Du kannst es Dir in Deiner Lage nicht leisten, auch noch ‚picky’ zu sein und Dir die besten Jobs auszuwählen“, hörte ich. Kann ich nicht? Warum nicht? Warum sollte ich einfach alles annehmen, was mir an Arbeit, Aufträgen und Aufgaben angetragen wird? Das habe ich in den über 25 Jahren freiberuflicher Tätigkeit nie getan! Warum also sollte ich jetzt damit anfangen? Habe ich nicht das Recht, Aufwand und Ertrag abzuwägen und im Zweifel auf den Auftrag zu verzichten? Wählen Menschen nicht gezielt die Rolle als Freischaffende, um sich eben diese Freiheit zu bewahren, zu jedem Job zu jeder Zeit auch Nein sagen zu können, selbst zum vermeintlichen Schaden?
Als Freiberufler hast Du gute und schlechte Monate, fair bezahlte Jobs sind ohnehin rar. Ich wollte es so, an einer Festanstellung hatte ich nie Interesse. Kollegen sind mir ein Graus, und sprechen Menschen über ihre Arbeit oder persönliche Karrierepläne, langweilt mich das kolossal. Ich würde vielleicht härter arbeiten, wenn es sich lohnte. Wenn mir Vollzeit unter Volllast in diesem Land mehr ermöglichte, als gerade so den Kopf (und bestenfalls noch die Brust) dauerhaft über Wasser zu halten.
Ich bin selbstehrlich genug, um zu erkennen, dass mich bis auf Weiteres primär staatliche und private Alimentierung tragen werden. Und meine Erfahrung lehrt mich, dass mich eine Existenz auf Kredit stets einholt und ich jede empfangene Mildtätigkeit werde verzinsen müssen. Doch Not kennt kein Gebot. Mein Weg wird ohnehin endlich sein, die Strecke nicht mehr allzu zu lang. Ich will zwar noch ein bisschen weiter, aber sicher nicht überziehen.
„Was immer Du als nächstes tust – Du hast stets die Wahl“, werde ich oft ermahnt, mir die eigene Zukunft offen zu halten. Stimmt das überhaupt? Hat ein Mensch in jedweder Lage die (gute!) Wahl, so wie es scheinbar für alles eine Lösung gibt? Wohl nur, wenn die von den Betroffenen subjektiv empfundene Qualität des Ergebnisses außer Acht bleibt.
Wer an einem Kipppunkt im Leben anlangt, für den ist nicht länger der Weg das Ziel; das Ziel ist das Ziel. Klar, zu jedem Ziel führt ein Weg. Den aber bin ich nur noch zu gehen bereit, wenn ich einen konkreten Nutzen oder Mehrwert für mich erkennen und definieren kann. Erst einmal loslaufen und sehen, wo ich ankomme, das hielte ich für sinnlos. Ich möchte nicht mehr ausprobieren, einen Versuch starten, dem Prozess vertrauen. Was ich mir jedoch vorgenommen habe, ist, nach meinen Möglichkeiten gute Momente zu sammeln, für den Rest meiner Zeit. So viele wie möglich, mit Menschen, die mir gut tun.
Mir ist bewusst, dass mein Sein fortan nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen auf Reduktion angelegt sein wird. Wenn ich dem Leben jedoch stets weniger abringen kann, das Leben mir indes immer mehr abverlangt – mehr als ich zu erdulden bereit bin –, worin besteht dann noch der Reiz?
Eine Frage, auf die mein Gefährte für sich bald keine Antwort mehr fand. Dass sich das Schicksal seiner schließlich erbarmte, war für ihn Erlösung. Für mich war es ein Trauma. Es zwang mich, Bilanz zu ziehen. Ich habe für mich wohl das Wesentliche erreicht. Dem Wesentlichen aber lässt sich nichts von den Wesenskern nachhaltig verändernder Bedeutung oder Größe hinzufügen.
Es ist schon sonderbar, wie wir über unser Leben nachdenken. Wie geht’s weiter? Was passiert als nächstes? Wir blicken stets nach vorn. Ob alles mehr Sinn ergeben würde, wenn man das Leben rückwärts betrachtete? Können wir unser ganzes Glück vielleicht im Moment empfinden, aber erst im Rückblick wirklich (er)fassen? Ich erkenne in meinem Gestern mehr Sinn als in einem Morgen. Jedenfalls müsste alles, was noch kommt, berechenbar sein, verlässlich, stabil. So ist Zukunft nicht.
Ich beginne mich zu fragen, ob ich mit Mitte 50 noch richtig bin oder längst deplatziert, in einer Gesellschaft, die unentwegt schneller, höher, weiter – jedenfalls irgendwie nach vorne – will und nie zurück. Mich irritiert das in jeder Krise mit Hybris vorgetragene Mantra, dass sich die Dinge immer regeln, irgendwann immer bessern, immer zum Guten wenden. Sagt nicht „immer“! „Immer“ macht uns ein Versprechen, das es nicht halten kann. Lasst in jeder Situation ein Scheitern zu, wenn Ihr es so benennen wollt, oder sogar ein Ende, selbst in meinem Fall. Haltet das aus.
Ich war nie lebensmüde, aber bin ich vielleicht lebenssatt? Lebenssattheit enthält nicht diese Bitterkeit, ihr wohnt auch nicht das lähmende Gefühl inne, dem eigenen Schicksal gänzlich ausgeliefert zu sein. Vielmehr führen jene, die sich für lebenssatt halten, weiterhin Regie. In diesem Zustand greift innerer Frieden Raum. Der Mensch wird sich klar und kommt zu dem Schluss, dass es gut war, bis hierher.
„Alt und lebenssatt“, so beschreibt die Bibel das Ideal vom Ende des irdischen Lebens. Im ersten Buch – es geht um den Tod Abrahams – heißt es: „Das ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams: Hundertfünfundsiebzig Jahre wurde er alt, dann verschied er. Er starb in hohem Alter, betagt und lebenssatt, und wurde mit seinen Vorfahren vereint.“ Die dort genannte Zahl steht symbolisch für das, was wir heute ein „biblisches Alter“ nennen. Auf ihr liegt bei der Betrachtung allerdings nicht mein Augenmerk. Es geht vielmehr um das Wort „lebenssatt“. Dieses nimmt den Gedanken auf, dass es irgendwann genug sein kann.
Nach meiner Auffassung – hier widerspreche ich der Bibel – hat Lebenssattheit nichts mit dem erreichten Alter zu tun. Der evangelische Bibelwissenschaftler und Alttestamentler Gerhard von Rad bleibt abstrakter: „Es gibt ein innerliches Damit-zu-Ende-kommen, einen Zustand der Sättigung, einen Punkt, an dem das von Gott Zugemessene ausgeschöpft ist.“ Oder, um es weniger sakral zu formulieren: Ein Mensch, der lebenssatt ist, ist nach einem womöglich erfüllten, jedenfalls ausgereiften Leben bereit, es loszulassen – im Zweifel auch, indem er es vorzeitig beendet.
Faktisch ist das dann Selbstmord. Doch darin schwingt der Vorwurf mit, die Schuld – ganz so, als begehe, wer selbstbestimmt vor seiner Zeit abtrete, eine Straftat. Mir hat mal jemand vorgehalten, bei einem Suizid handle es sich um einen „Akt des Terrors – verübt, gegen alle Menschen, die Sie jemals geliebt haben“.
Gewiss, gerade diese sind es, die es am meisten schmerzt. Sie leiden unter dieser persönlichen Entscheidung in einer Art, die mit Worten nicht zu fassen ist. Warum also sollte, warum wollte, wie könnte ein Mensch ausgerechnet seinen Liebsten so etwas Grausames antun?