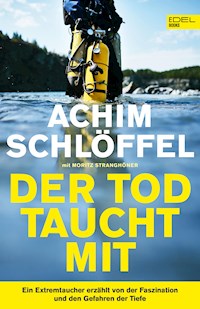
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Achim Schlöffel ist Extremtaucher. Als erster Mensch hat er allein den Ärmelkanal durchtaucht, in Tausenden von Tauchgängen zahlreiche Grenzsituationen erlebt. In 50 hochspannenden Berichten erklärt er den Sog der Tiefe und den richtigen Umgang mit der Angst, erzählt von seinen aufregendsten und gefährlichsten, aber auch schönsten Erlebnissen in der faszinierenden Welt unter Wasser. Er nimmt uns mit auf atemberaubende Tauchexpeditionen zu versunkenen Schiffwracks, in unerforschte Unterwasser-Höhlensysteme und eiskalte Bergseen, zu gefährlichen Rettungsaktionen, bei denen er mehrfach sein Leben riskiert, um das anderer zu retten – nicht immer mit Erfolg. Dazu liefert der Tauchprofi eine Menge Tipps für ambitionierte Hobbytaucher, u.a. seine spektakulärsten Wracks, Höhlen und Tauchplätze, sowie die wichtigsten zehn Überlebensregeln. Eine der ersten: zwischen "Ich kann nicht mehr" und "Es geht nicht mehr" ist immer noch genug Luft, um weiterzumachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ich widme diese Geschichten meiner Tochter Charleen McCoy-Schloeffel (* 1.5.1990 † 1.5.2008) und meinem Freund Jan Lars Hanz (* 6.9.1977 † 11.2011), die beide viel zu früh von uns gegangen sind und mit denen ich gerne noch viele Abenteuer erlebt hätte,
sowie meinen Söhnen Ben und Luis, denen ich mindestens so viele spannende Momente unter Wasser wünsche, wie ich sie hatte.
INHALT
I. DURCH DEN KANAL
Meine zehn Überlebensregeln
II. ÜBER LEBEN UNTER WASSER
1. Nicht normal
2. Nachts im Wald
3. Kostas
4. Hightech
5. Jagd auf Roter Oktober
6. Haifutter
7. König der Tiefe
8. Der Tod taucht mit
9. Schein und Sein
10. Gefangen
11. Ganz unten
12. Angst
13. Goodbye, Deutschland
14. Amerika
15. Schatzsucher
16. Herr der Höhlen
Meine fünf Lieblingshöhlen
17. Panik
18. Muränen
19. Alligator
20. Robinson Crusoe
21. Charleen
22. Zurück in die Kälte
23. Hölle
24. Eis
25. Nazi-Fund
26. Netz in der Schraube
27. Ratten im Kanal
28. Kuh im Kraftwerk
29. Säge
30. Verheizt
31. Beton
32. Verklagt von einem Toten
33. Horror im Hafen
34. Vermisster Jäger
35. Leiche? Welche Leiche?
36. Aufgelöst
37. Flaschen weg
38. Rakete
39. James Bond
40. Schätze der Tiefe
Meine fünf Lieblingswracks
41. U-Boot im See
42. Einbaum
43. Rückschläge
44. Geisterschiffe
45. Lampe
46. Verloren
47. Rettung
48. Ende einer Liebe
49. Neugier
Meine fünf Lieblingstauchplätze
50. Sind wir noch zu retten?
III. INNER SPACE EXPLORERS ODER:WARUM TECHNISCHES TAUCHEN?
Danksagung
Die wagemutigen Schwimmer, die sich jedes Jahr vom Strand der Shakespeare Bay in Folkestone in die schäumenden Wellen des Ärmelkanals stürzen, um sich bei jedem Wetter die 36 Kilometer durch die eisige, raue Nordsee nach Frankreich zu kämpfen, faszinieren mich, seit ich denken kann. Die Schwimmer müssen nicht nur Kälte, Angst und Erschöpfung ertragen, sondern sich auch vor den zahllosen Containerfrachtern in Acht nehmen, die wie an einer unsichtbaren Perlenschnur aufgefädelt unaufhörlich durch die Fluten walzen …
Nachdem ich erste Taucherfahrungen gesammelt und die größte Leidenschaft meines Lebens entdeckt hatte, begann ich von diesem Abenteuer zu träumen. Nur: Ich wollte nicht schwimmen. Ich wollte diesen finsteren Nordseekanal zwischen England und Frankreich, dessen Tiefen so viele Geheimnisse und Mythen bergen, in dem unzählige Wracks ruhen, durchtauchen, und zwar an einem Stück. Natürlich wurde mir später, als aus der Leidenschaft Tauchen schon lange mein Beruf und mein Leben geworden war, klar, dass die finanziellen und technischen Hindernisse schier unüberwindbar waren. Weder gab es Scooter, die ausgereift genug waren, das Gewicht eines Menschen und seiner Ausrüstung über eine derart lange Distanz durchs Wasser zu ziehen, noch waren entsprechende Geräte zur Luftversorgung verfügbar, sogenannte Rebreather-Systeme, die die eigene Atemluft in einen Kreislauf überführen, sodass man keine Flaschen mehr wechseln muss. Von den Kosten einer solchen Expedition, für die man jede Menge Material, Logistik und eine ganze Mannschaft brauchte, einmal abgesehen.
Doch in all den Jahren ließ mich diese Spinnerei nie los. Die technische Entwicklung machte Fortschritte, meine Erfahrung als Taucher nahm stetig zu, und durch Sponsoren und Arbeit war irgendwann auch genug Geld vorhanden, um das Projekt Kanaldurchquerung wenigstens von Zeit zu Zeit zu Hause am Schreibtisch durchzuplanen, wenn gerade keine Projekte anstanden oder kleinere oder größere Katastrophen meine Pläne mal wieder über den Haufen warfen.
Das größte Hindernis ließ sich allerdings lange Zeit nicht mal theoretisch überwinden und war einfach unvorstellbar: Durch den Kanal zu tauchen, ohne zwischendurch einen Stopp einzulegen und Material, Sauerstoff, Nahrung aufzufrischen. Mitte der 2000er-Jahre kam ich mit Christiane und Patrick Bonetsmüller, deren Firma Bonex die besten Scooter der Welt herstellte, ins Gespräch. Wir hatten uns im Laufe der Jahre angefreundet, und eines Tages erzählte ich ihnen von meinem Traum. Auch sie waren skeptisch, versprachen aber, darüber nachzudenken. Ich hatte bereits Hunderte Stunden Erfahrung mit diversen Rebreather-Systemen gesammelt, ihre Stärken und Schwächen herausgefunden und andere Taucher auf ihnen ausgebildet. Ich hatte Tauchgänge von bis zu 15 Stunden in Wracks und tiefen Höhlen absolviert, mit stundenlangen Dekompressions-Stopps und zusätzlicher Luftversorgung in der Tiefe. Ich wusste, was im Bereich des Möglichen lag, und welche Grenzen es gab. Und mein Ehrgeiz wuchs, sie zu durchbrechen. Es musste einfach möglich sein, den Kanal zu durchqueren – und zwar im Alleingang!
Ich begann, den Tauchgang wie ein Besessener im Detail zu planen. Studierte Karten, Strömungen und Gezeiten, ging alle möglichen Notfallszenarien durch, testete Ausrüstung und baute sie um. Wie konnte ich auf ein Begleitboot verzichten? Sollte ich mir von einem Partner helfen lassen oder den Versuch lieber allein durchziehen? Brauchte ich eigentlich eine Genehmigung, war dafür irgendeine Behörde zuständig? Ich fragte bei der britischen Polizei, bei den Hafenbehörden und beim Zoll nach, erntete aber überall nur Schulterzucken.
Letztendlich verwarf ich die eigentlich immer und überall gültige Grundregel, nie allein zu tauchen. Die Komplexität und Schwierigkeit des Tauchgangs und der Navigation schien mir keinen Raum für einen weiteren Taucher zu lassen, der meine Konzentration gefährden und mich im Zweifel nur ablenken würde – und dem ich im Notfall würde beistehen müssen. Den Ablauf und die Technik wollte ich so perfekt planen, dass ich keine Hilfe benötigte. Und wenn doch etwas schiefging, sollte es nur mir selbst schaden.
Meine Freunde konstruierten einen Scooter aus zwei eigenständigen, ursprünglich für militärische Zwecke entwickelten, durch einen Mittelsteg verbundenen Geräten, der mich über elf Stunden ziehen konnte. Als ersten echten Härtetest unter realen Bedingungen unternahm ich einen Tauchgang längs durch den Starnberger See. Und tatsächlich: Über die gesamten 21 Kilometer in rund 15 Metern Tiefe funktionierte die Transport-Doppelrakete hervorragend. Mir war aber auch klar: Ein See, so kalt und tief er auch sein mag, ist kein Meer mit seinen Strömungen und Wellen, Stürmen und Schiffen.
Auch einen herkömmlichen Rebreather hatte ich mir vorgeknöpft und ihn so modifiziert, dass ich zwei unabhängige Systeme für meine Atemluft auf dem Rücken tragen konnte. Das Problem: Bei höheren Geschwindigkeiten fingen die Dinger an, sehr stark zu vibrieren – und das bereits unter den harmlosen Bedingungen im See. Die Verkleidung, eigentlich zur Verbesserung der Stromlinienform entworfen, hielt dem Druck nicht stand. Es war niederschmetternd, mir fiel keine Lösung ein. Letzte Tests musste ich absagen und schließlich den kompletten Kanaltauchgang aufgrund der Jahreszeit verschieben – es hagelte Spott in der Szene, nach dem Motto: Alles nur Gerede eines Spinners, einfach nicht machbar …
Mich spornte das Gequatsche nur noch mehr an. Wir studierten noch einmal ausgiebig und genau Strömungen und Gezeiten im Kanal, planten erneut alle Details, versuchten alle Gefahren, die einen dort unten erwarten mochten, einzuberechnen, und konstruierten das Rebreather-Gehäuse vollständig neu.
Am 26. Juni 2012 war es soweit, das Abenteuer konnte beginnen. Ich fuhr mit meiner Frau voraus nach England. Wir nahmen uns ein Zimmer in einem ziemlich abgerockten Hotel in Folkstone und erkundeten die Küste, um einen geeigneten Startplatz für den Tauchgang aufzuspüren. Fündig wurden wir bei Dymchurch, einem kleinen Kaff an der Küste Kents mit einem großen, von einem Deich abgeschirmten Strand. Hier konnten wir ungestört alles zusammenbauen, und der Fußweg ins Wasser war nicht weit. Hier sollte es losgehen!
Der Rest meines Teams reiste uns hinterher nach England und nach Calais in Frankreich. Am 29. Juni riss uns um 3 Uhr nachts der Wecker aus dem Schlaf. Meine Frau kochte einen großen Teller Spaghetti, den ich trotz der Uhrzeit runterschlang, um meine Kohlehydratspeicher vor dem langen Tauchgang noch einmal aufzufüllen. Anschließend warf ich eine Immodium-Tablette gegen ungeplante Zwischenfälle unter Wasser ein. Dann packten wir unsere Sachen und fuhren zum Strand, wo meine Mitstreiter bereits alles vorbereitet hatten. Den Rebreather hatte ich bereits am Vortag mit Atemkalk befüllt, alle Checks waren durchgeführt. Den Scooter bauten wir am Strand zusammen. Die Flut drückte bereits an Land und kam schnell näher. Gerade als wir fertig waren, schwamm er auch schon in den schäumenden Wellen. Ich zog mehrere Schichten Unterwäsche übereinander, der Trockentauchanzug wurde mir übergestülpt, meine Frau gab mir einen letzten Kuss. Sie versprach, mir den Kopf abzureißen, falls mir etwas passieren sollte. Die anderen klopften mir auf die Schulter und wünschten mir Glück. Ich glitt ins Wasser, richtete den Scooter aus und drückte den Gashebel nach vorn.
Es tat sich erst mal: gar nichts. Die Brandung im flachen Wasser war heftig, die schäumende Suppe knallte mir mit voller Wucht entgegen. Ich konnte nicht feststellen, ob ich abtauchte und Strecke machte oder zur Belustigung meines Teams auf der Stelle stand und mein Hintern aus dem Wasser ragte. Ich drückte meine Maske an den Kompass, setzte eine kleine Lampe drauf, um sicher zu gehen, dass ich wenigstens nicht rückwärts Richtung Strand unterwegs war. Es fühlte sich sehr lange an, als ginge es nicht vorwärts, und nach einer knappen Stunde war ich so genervt, dass ich ernsthaft an Rückzug dachte. Da fiel der Boden unter mir plötzlich abrupt ab und ich schwebte im Freiwasser.
Ich sah: Sand. Die Flut, die mich eigentlich auf den ersten sechs Stunden des Tauchgangs hatte tragen sollen, hatte mich die ganze Zeit gebremst. Endlich hatte ich aber tiefes Wasser erreicht und konnte meine Instrumente erstmals einigermaßen klar ablesen. Ich befand mich in gerade mal sechs Metern Tiefe, konnte Peilung aufnehmen und fuhr weiter. Als ich 20 Meter Tiefe erreichte, flog ich ins dunkelgrüne Freiwasser, der Boden verschwand. Die Sicht wurde besser, Ruhe umgab mich, ich entspannte mich, gewann an Sicherheit und Selbstvertrauen. Und hätte mich im nächsten Moment fast vom Bock werfen lassen. Mein Scooter riss mich bei voller Fahrt nach rechts, fuhr Karussell mit mir, in dichten Kreiseln herum und herum. Ich musste eine Vollbremsung hinlegen: Der rechte Scooter war ausgefallen, durch die Vibrationen hatte sich ein Magnetschalter gelöst. Doch ich hatte Glück und konnte das Problem mit ein bisschen Gefummel am Kontakt beheben: Nach drei, vier Kreiselattacken entschied sich mein Scooter, die Reise trotz holprigem Start fortsetzen. Ich glitt weiter vorwärts, die Zeit verging, die Monotonie wirkte einschläfernd, aber ich wusste, dass ich meine Konzentration hochhalten musste. Die Kälte, der Druck, die dunkle Umgebung, die Ungewissheit, was mich in den kommenden Stunden erwartete – jetzt bloß nicht weich werden, Junge.
Über längere Zeit hatten mich nun schon große Schatten begleitet, deren Umrisse noch finsterer waren als meine dunkle Umgebung aus grauer Brühe, in der mir ansonsten nur ein paar fingerlange Fische begegneten und ab und zu schwarze Klumpen, wohl schwebende Teerfetzen, mit denen ich keine nähere Bekanntschaft machen wollte und sie daher lieber umkurvte. Oder träumte ich etwa? Bildete ich mir Dinge und Gefahren, die hier unten lauerten, lediglich ein? War meine Angst vor frei im Wasser treibenden Fischernetzen möglicherweise ein Hirngespinst? Der eigene Kopf ist die größte Stärke des Menschen, doch er kann auch zu seinem schlimmsten Feind werden.
Ein riesiger, schwarzer, zunächst nur schemenhaft erahnbarer Klotz riss mich aus meiner leichten Lethargie. Ich raste auf einen verlorenen, frei im Wasser schwebenden Schiffscontainer zu, der sich wie aus dem Nichts vor mir auftürmte! Mir stockte der Atem. Immerhin näherte ich mich dem Ungetüm mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Minute (also sechs Bahnen im Schwimmbad in nur einer Minute, um sich das leichter vorstellen zu können) und die Sicht betrug nicht viel mehr als 15 Meter. Ich riss den Scooter gerade noch rechtzeitig zur Seite und schrammte um Zentimeter an dem Stahlklotz vorbei, der, wie ich jetzt deutlich wahrnahm, hellblau leuchtete. Mein Herz hämmerte wie wild, ich brauchte etwas Zeit, um durchzuatmen, mich zu beruhigen, bevor ich wieder Fahrt aufnehmen konnte. Meine Sinne waren auf jeden Fall wieder hellwach, die Nerven bis zum Anschlag gespannt. Ich vernahm jetzt immer deutlicher ein Geräusch, das zunächst wie ein Fön im Badezimmer nebenan klang und sehr schnell immer lauter wurde, bis ich den Eindruck hatte, eine Bohrmaschine würde direkt neben meinem Kopf eingeschaltet.
Der Lärm kam von den Schiffen im Kanal, den Giganten aus Stahl, die mit ihren Zigtausend Tonnen Fracht aus aller Welt über mir hinwegzogen. Und trotz der eigentlich sicheren Distanz: Ihr Lärm, ihr Strömungssog, ihre schiere Masse über mir wirkten wie eine einzige Bedrohung.
Plötzlich wurde es heller, ich erkannte eine sanft ansteigende Sandfläche in etwa 35 Metern Tiefe. War ich schon in Frankreich? Unmöglich, viel zu früh. Ich flog die Anhöhe hinauf und fand mich auf 20 Metern wieder, bevor der Grund erneut abfiel und im grünen Nichts verschwand … Ich hatte die Varne-Sandbank gekreuzt, die den Ärmelkanal durchteilt wie eine Mittelleitplanke eine Autobahn. Ich war also auf dem richtigen Weg, wie ich dankbar registrierte.
Doch hier unten folgte kleinen, kostbaren Wohlfühlmomenten stets ein kräftiger Tritt vors Schienenbein – offenbar ein ungeschriebenes Kanal-Gesetz. Der Lärm wurde erneut infernalisch laut, und die Vibrationen wurden so heftig, dass ich in meinem Gurt am Scooter hin und her geschüttelt wurde. Obwohl ich mich in 35 Meter Tiefe befand, konnte ich die Schiffe über mir am ganzen Körper spüren. Dazu wurde es deutlich finsterer um mich herum, sodass ich keine Distanzen mehr abschätzen konnte. Ich reagierte mit einem Fluchtreflex und drückte die Schnauze des Scooters mit voller Kraft nach unten, stürzte mich hinab in die Tiefe. 54 Meter, dann war Schluss. Ebenso abrupt musste ich das Shuttle wieder hochreißen, sonst hätte ich mich in den schwarzen Schlick gebohrt, der hier den Boden bedeckte.
Ich fuhr am Grund des Kanals, als die beiden Scooter, die mein Shuttle bildeten, versagten. Offenbar hatten sich die Kontakte wieder gelöst. Die Vibrationen rissen an den Schläuchen meines Rebreathers, und ich hatte Mühe, das Mundstück mit den Zähnen festzuhalten. Wasser floss in meine Maske, ich hatte keine Chance, sie in dieser Situation auszublasen. Der Schlick vom Boden stieg auf und hüllte mich ein, raubte mir das letzte bisschen Sicht. Der Spuk dauerte, Gott sei Dank, nur wenige Minuten, ich verharrte still am Grund, blies das Wasser aus meiner Maske, das heftig in meinen Augen brannte, stellte sicher, dass der Rebreather noch in Ordnung war, und justierte die Kontakte an den Scootern. Schließlich konnte es weitergehen.
Vorsichtig stieg ich höher, bis das höllische Dröhnen der Schiffsmotoren zurückkehrte. Diesmal drang der pochende, unerträgliche Lärm sogar bis in eine Tiefe von 40 Metern vor. Wieder wich ich nach unten aus, wartete ab, bis sich auch dieser Krach verzogen hatte, bevor ich meine Fahrt fortsetzte. Irgendwann hatte ich gelernt, mit der Situation klarzukommen.
Später konnte man am Computer über das Tracking des Schiffsverkehrs und meiner Route feststellen, dass ich ein Rendezvous mit einem der größten Containerschiffe der Welt gehabt hatte, der CMA CGM Wagner. 277 Meter lang, 40 Meter breit. Tiefgang: Schlappe 15 Meter, vorsichtig geschätzt, die gigantischen Schiffsschrauben nicht eingerechnet. Viel Platz blieb da nicht mehr. Der zweite Pott, der mich so plötzlich in die Tiefe zwang, war vermutlich eine der vielen zwischen Frankreich und England verkehrenden Kanalfähren.
Nach knapp sieben Stunden in der Tiefe veränderte sich endlich der Untergrund, Sand kam in Sicht. Ich folgte dem sanft ansteigenden, von kleineren Stufen strukturierten Bodenprofil, und es tat unfassbar gut, nach dem langen, dunklen Nichts wieder Strukturen erkennen zu können.
Die Strömung war auf Grund der Gezeiten auf Südwest gewechselt, und ich hatte meine Richtung angepasst, wollte die Strömung ausnutzen und mich Frankreich in einem weiten Bogen nähern. So der Plan. Mein Rebreather war inzwischen ziemlich am Ende, und ich atmete aus meinem Zweitgerät, da ich den ersten nicht vollständig austauchen wollte – er war schließlich auch meine letzte Lebensversicherung.
Ich befand mich in 15 Metern Tiefe, Tendenz steigend. Ich war mir nun sicher: Vor mir ist Frankreich. Ich scooterte nun nicht mehr, sondern ließ mich von der Strömung tragen, immer westwärts. Der Boden flog unter mir dahin, und je höher ich kam, desto schlechter wurde die Sicht durch den Sand, den die Wellen aufwirbelten. Bei 12 Meter schoss ich meine Boje mit dem GPS-Sender an die Oberfläche, um meinem Team die Position zu übermitteln. Zehn Minuten später war ich auf 9 Meter aufgestiegen, wo ich weitere 25 Minuten verbrachte. Auf sechs Metern verschlechterte sich die Sicht dramatisch, und ich prallte mehrfach ziemlich heftig in unterschiedliche Hindernisse, erwischte die Reste eines Fischerboots und mehrere große Steine, als wolle der Kanal mich noch einmal richtig verprügeln, bevor er mich freigab. Ich steckte die Schläge ein, ignorierte die Schmerzen und versuchte, meine Ausrüstung zu sichern, sie nicht im letzten Moment noch zu verlieren. Am Bodenprofil erkannte ich, dass ich offenbar um eine Landzunge getrieben sein musste. Nach 45 weiteren, endlos langen Minuten stieg ich zum letzten, bei jedem Tauchgang aber wichtigsten Deko-Stopp auf 3 Meter auf. Die Brandung knallte mir um die Ohren, in dieser Waschmaschine konnte ich die Instrumente nur mit Mühe ablesen. Ich wurde ungeduldig, sehnte mein Team herbei, damit es mich von dem sperrigen Scooter befreite. Außerdem wäre ich für einen Getränkeservice unglaublich dankbar gewesen: Meine beiden Trinkbeutel mit insgesamt 4 Litern Wasser waren schon lange leer, ich litt quälenden Durst. Dazu setzten böse Kopfschmerzen ein. Ich zählte die 80 Minuten einzeln runter und war einfach nur froh, als ich mich langsam Richtung Oberfläche bewegen konnte.
Das Erste, was ich wahrnahm, war eine etwa 400 Meter breite Brandungszone und dahinter ein endloser, vollkommen verlassener Strand. Über den sonnigen Nachmittagshimmel trieben Wolkenfetzen. Kein Mensch weit und breit. Die Brecher überrollten mich im Sekundentakt, ich nahm meine letzte Kraft zusammen und begann, über den flachen Grund Richtung Strand zu schwimmen, wobei ich immer wieder auf den Boden knallte. Aber laufen oder krabbeln war mit der schweren Ausrüstung einfach nicht möglich, und meine Superkräfte waren nach diesem Trip leider aufgebraucht.
Aber schließlich erreichte ich den Strand, und später stellte sich heraus, dass ich wie durch ein Wunder sogar ungefähr an unserem Zielort Cap Gris-Nez bei Audresselles angelandet war. Dabei war ich vollkommen unbemerkt geblieben, meine Sorgen um Genehmigungen oder Probleme wegen „illegaler Einreise“ erwiesen sich als unbegründet – wobei allerdings wenige Tage später die französische Polizei am Strand bereitstand, als der amerikanische Milliardär und Virgin-Gründer Richard Branson auf einem Kite-Board – in einer Rekordzeit für seine Altersklasse – über den Kanal gesurft kam.
Branson hat für seine Aktion etwa drei Stunden gebraucht. Ich war acht Stunden unter Wasser getaucht, dazu kamen noch über zweieinhalb Stunden Dekompressionszeit – ich hatte also einmal die Uhr rumgedreht. So fühlte ich mich auch: Ich ließ den Scooter liegen und taumelte ein paar Meter zu einem Felsen, wo ich den Rebreather ablegte. Dann quälte ich mich zurück zum Scooter und zerrte ihn an den Strand, um ihn vor den Fluten zu sichern. Ich kontrollierte meinen GPS-Tracker: Er sendete. Warum zum Teufel war dann außer mir niemand hier? Totale Erschöpfung drückte mich nieder, als hätte jemand meinen persönlichen Ausschalter betätigt: Nichts ging mehr. Ich ließ mich neben den Scooter in den Sand plumpsen, starrte in den blauen Himmel, ließ mit den Wolken noch einmal die langen Stunden unter Wasser an mir vorbeiziehen. Die Dose mit dem GPS ließ sich nicht öffnen, entweder hatte sie sich verklemmt oder durch den Temperaturunterschied Vakuum gesaugt. Das Notfall-Handy darin – unerreichbar. Fast eine Stunde dämmerte ich durstig vor mich hin, als ich plötzlich eine kleine Gestalt in den Dünen sah. Ich blinzelte. Die Figur winkte. Und lief wieder weg. Eine Fata Morgana? Doch Augenblicke später rannten die Team-Mitglieder über den Strand jubelnd auf mich zu. Ich wurde gedrückt und umarmt und wieder gedrückt, und schließlich erspähte ich auch meine Frau. Ich schloss sie in die Arme und durfte meinen Kopf, so laut er auch brummte, auf den Schultern behalten.
Später erfuhr ich, dass das GPS-Signal erst gesendet wurde, nachdem ich an der Oberfläche war. Offenbar hatte die Brandung den Sender in seinem Gehäuse so sehr geschüttelt, dass er sich kurzfristig verabschiedet hatte. Das Team hatte mich schon ein wenig verzweifelt gesucht. Mein Glück war, dass eine Helferin in den Dünen austreten musste, wobei sie mich am Strand erblickte.
Nach ein paar Flaschen Wasser war ich wieder einigermaßen hergestellt. Wir verluden die Ausrüstung und feierten mit einem großartigen Abendessen (was das für mich heißt, erzähle ich später). Glückwünsche aus aller Welt trafen ein. Ich war gerade 40 geworden, hatte in Seen, Flüssen, Höhlen und Ozeanen rund um den Globus getaucht, Wracks erforscht und Expeditionen geleitet, meinen Tauchverband gegründet und Jahre voller Höhen und Tiefen erlebt. Vor allem: Ich hatte überlebt. Kurz darauf kamen meine beiden Söhne zur Welt.
Ich weiß, ich bin noch nicht am Ende meiner Reise. Doch es ist Zeit, einmal zurückzublicken und zu berichten, über mein Leben unter Wasser.
Meine zehn Überlebensregeln
1.Du kannst nichts gewinnen, wenn du nicht anfängst: Sei mutig!
2.Zwischen „Ich kann nicht mehr“ und „Es geht nicht mehr“ ist immer noch genug Luft, um weiterzumachen.
3.Gib niemals auf. Denk nicht mal dran!
4.Lass Ängste zu. Sie zeigen dir deine Grenzen. Aber lass dich nicht überwältigen.
5.Vertraue niemandem. Aber gib jedem die Chance, sich dein Vertrauen zu verdienen.
6.Hab immer einen Plan B. Und am besten auch einen Plan C.
7.Fokussiere dich auf das Wesentliche. Und das heißt oft einfach nur: Überleben.
8.Kenne deine Herausforderungen, studiere deine Gegner. Unterschätze sie niemals.
9.Wenn jemand um Hilfe bittet, bekommt er sie.
10.Vergiss niemals, wirklich niemals den Worst Case und bereite dich auch auf ihn vor.
1. NICHT NORMAL
Es soll ein recht heißer Oktobertag in München gewesen sein, als ich beschloss, meine Mutter bei der Gartenarbeit zu unterbrechen und eine gute Woche zu früh aufzutauchen. Mein Vater verstieß gegen alle Verkehrsregeln, und wenig später war ich da. Arsch voran natürlich, vermutlich, um der Welt zu zeigen, was sie mich mal kann. Schon als Kind war ich ziemlich eigenwillig und hatte einen seltsamen Geschmack. Während andere Kinder nach Gummibärchen und Schokolade lechzten, war ich komischerweise mit Suppen-Brühwürfeln glücklich. Schon als junger Teenager las ich nicht Bravo, sondern Metal Hammer und Geo. Während meine Freunde Fußball spielten, erforschte ich am liebsten die Seen und Tümpel der Umgebung, um Kaulquappen und Molche zu fangen, sie zu Hause zu beobachten und wieder in die Freiheit zu entlassen. Ich fing an, die E-Gitarren meiner Rockidole von z. B. Motörhead oder Kiss nachzubauen und selbst wie besessen zu spielen. Mein Zimmer war eine Mischung aus Zoo, Musikbörse und Tauchladen, zwischen halb zerlegten Instrumenten und Verstärkern lagen Tauchflaschen und Neoprenflicken und -fetzen, darüber thronten auf Schränken und Gestellen Aquarien und Terrarien mit Amphibien und Reptilien aller Art. Als mir der Vater eines Freundes das Ei einer Tigerpython schenkte, brütete ich es in einer Zigarrenkiste aus. Die daraus geschlüpfte Schlange, meine geliebte Emma, begleitete mich, bis ich Deutschland verließ. Sie wurde bei einem Freund, dem ich sie schließlich schweren Herzens überließ, fast 30 Jahre alt. Meine Eltern ertrugen meine etwas besonderen Vorstellungen vom Leben mit einer Mischung aus Verwunderung und Verzweiflung.
Ich muss noch heute an eine etwas schräge Situation denken, die mich als Kind stark geprägt hat: Bei meiner geliebten Oma wohnte ein ehemaliger Fremdenlegionär zur Untermiete, der sich nach zahlreichen Kriegseinsätzen, über die er natürlich nie ein Wort verlor, alkoholkrank und kaputt zurückgezogen hatte und nur selten das Haus verließ, seine Miete aber wohl pünktlich zahlte. Als ich mir auf dem Schulhof mal ein blaues Auge geholt hatte, traf ich ihn tags darauf im Treppenhaus – und als er mein Veilchen sah, hörte ich ihn zum ersten Mal sprechen. Er packte mich bei den Schultern, sah mich aus hellen, wässrigen Augen an und sagte: „Junge, du darfst dich nicht schlagen lassen, niemals. Das Leben ist Krieg, und im Krieg ist kein Platz für Schwächlinge. Du musst überleben – nur das zählt. Verschaffe dir Respekt. Nur die Sieger werden respektiert.“ Einige Zeit später fand meine Oma den Mann tot in seiner Wohnung, aber ich habe seine Worte nie vergessen.





























