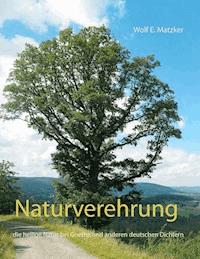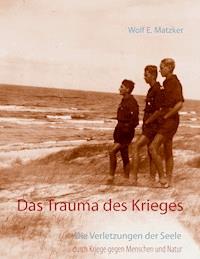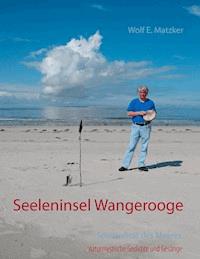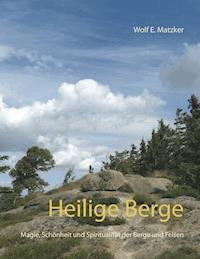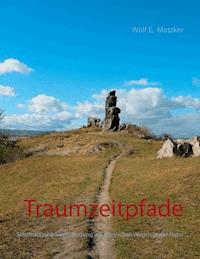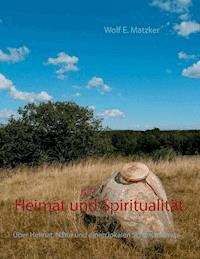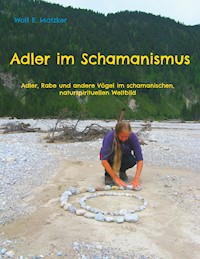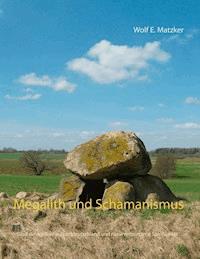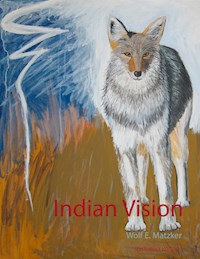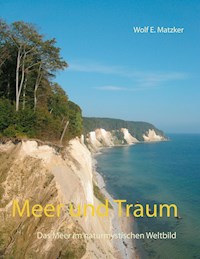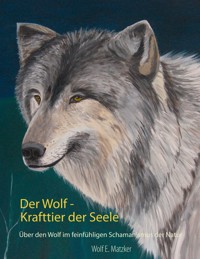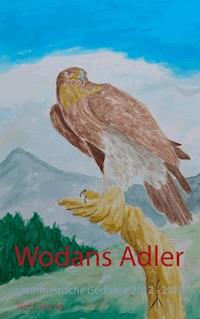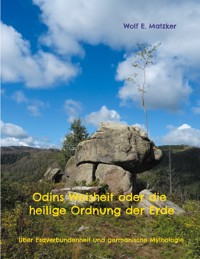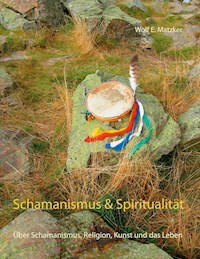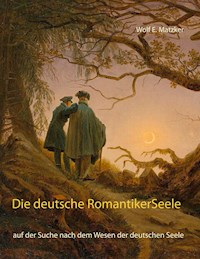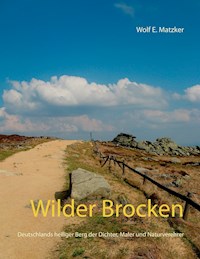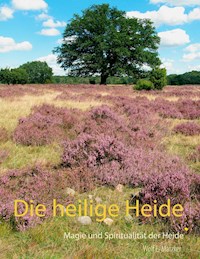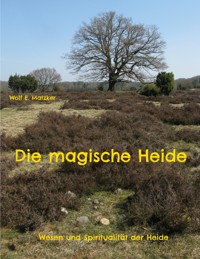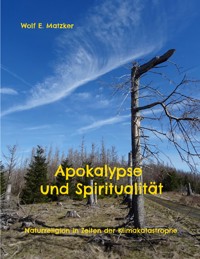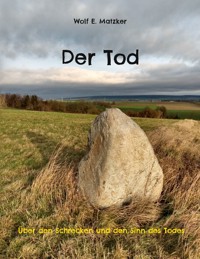
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch enthält zwei Teile. Im ersten Teil geht es um verschiedene Aspekte des Todes. Im zweiten Teil um mehr persönliche Gedanken über die Vergänglichkeit, unter der Überschrift: Verlorene Zeiten, verlorenes Leben. Es wird sowohl der Schrecken als auch der Sinn des Todes im Leben und in der Natur behandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Teil 1
1. Eine Gedenkstätte in der Heide
2. Zeichnungen und Gemälde zum Thema Tod
3. Das sichtbare Totenreich in der Natur
4. Die germanische Göttin Hel und Maria
5. Der Kreuzestod ist ein Mythos der Kirche
6. Suizid, oder der schnelle Tod
7. Philosophisches zum Tod
8. Der Tod in Büchern und Filmen
9. Genozid oder die Vernichtung der Anderen
10. Leben und Tod, Tod und Leben – das System der wilden Natur
11. Der Schrecken des Todes
12. Totenkult
13. Der Tod im Tarot und im Runensystem
14. Der Tod des Iwan Iljitsch
15. Rituale zum Thema Sterben und Tod
16. Reinkarnation
17. Gedichte über den Tod
Teil 2
Verlorene Zeiten, verlorenes Leben
1. Eine Gedenkstätte in der Heide
Es gibt sehr viele Gedenkstätten, die mit Steinen gestaltet wurden. Allein für Hermann Löns gibt es viele. Eine davon befindet sich nördlich von Betzhorn, das zwischen Gifhorn und Hankensbüttel liegt.
Hermann Löns steht für den Dichter der Natur, oder allgemein für den Naturmenschen. Aus diesem Grund, denke ich, hat man ihm so viele Gedenkstätten gewidmet. Das steht in einem Widerspruch zu dem Wunsch, den er in seinem Gedicht „Abendsprache“ geäußert hat.
Abendsprache
Und geht es zu Ende, so lasst mich allein
Mit mir selber auf einsamer Heide sein,
Will nichts mehr hören und nichts mehr seh'n,
Will wie ein totes Getier vergehn.
Das graue Heidemoos mein Sterbebett sei.
Die Krähe singt mir die Litanei.
Die Totenglocke läutet der Sturm,
Begraben werden mich Käfer und Wurm.
Auf meinem Grabe soll stehen kein Stein,
Kein Hügel soll dort geschüttet sein,
Kein Kranz soll liegen, da wo ich starb,
Keine Träne fallen, wo ich verdarb.
Will nichts mehr hören und nichts mehr seh’n,
Wie ein totes Getier will ich vergeh’n,
Und darum kein Kranz, und darum kein Stein,
Spurlos will ich vergangen sei
Das blieb am Ende ein frommer Wunsch. Das Grab in der Tietlinger Heide bei Bad Fallingbostel und eine weitere Anlage zur Erinnerung an den Heidedichter dort bilden geradezu eine Art Kultstätte. Auch den Lönsstein auf einem monumentalen Sockel auf dem Wietzer Berg kann man als eine Kultstätte verstehen. Heute gibt es wohl keine große Wertschätzung des Dichters mehr. Wir haben hier den großen Gegensatz: einerseits das völlige Verschwinden, und andererseits das Gedenken in Gestalt von Steinen.
Meine Seele kommt aus der Steinzeit. Es ist alles unendlich lange her. Alles liegt in einem grauen Nebel, aber dennoch war und ist die Verbundenheit vorhanden, seit meiner Geburt.
Der Tod spielte immer eine Rolle.
Der Tod der vielen Tiere, von denen wir lebten und leben mussten, mit denen wir überlebten. Wir überlebten nur mit dem toten Fleisch der Tiere.
Der Tod der Kinder, die zu schnell, zu früh starben.
Der Tod von geliebten Menschen.
Immer herrschte der Tod.
Der Tod ist der Meister des Lebens.
2. Zeichnungen und Gemälde zum Thema Tod
Ich finde die Gemälde von Zdenek Burian sehr eindrucksvoll. Der Malstil passt sehr gut zu der archaischen Welt der Steinzeit. Eine spezifische Mischung von Präzision und unscharfen Stellen. Leider habe ich nicht herausfinden können, ob sie „gemeinfrei“ sind oder nicht. Im Netz kann sie jeder finden.
Archaisches Grab, eigene Zeichnung nach Burian
Das Gemälde „Das Frauengrab von Vestonice“ zeigt uns eine Beerdigungsszene. Zwei Männer legen eine große Knochenplatte, ein Schulterblatt eines Mammut?, über eine Frau, die in Hockstellung in einem Loch liegt. Auf der linken Seite steht ein alter Mann, der ein Lid zu singen scheint. Einen Grabgesang. In der Mitte stehen zwei Männer, die eine weitere Knochenplatte herbeischaffen. Rechts steht ein Mann, der alles zu organisieren scheint. Im ferneren Hintergrund sieht man weitere Figuren.
In der Steinzeit war man dauernd mit dem Tod konfrontiert. Allein die vielen toten Tiere, von denen man lebte, die man tötete, töten musste, um selbst zu leben, zu überleben, denn viel mehr war das Leben kaum, ein permanenter Kampf ums Überleben.
Die Menschen wurden damals nicht alt. So mancher Jäger starb beim Jagen. Viele Kinder starben früh, zu früh und konnten so nicht für Nachwuchs, für kommende Generationen sorgen. Das war tragisch für die damaligen Menschen. Wir können uns das alles kaum in unserer „Wohlstandswelt“ vorstellen.
Der Tod zwang zur Ehrfurcht, vor dem Leben und dem Tod, vor den Toten. Tod, das war immer Schmerz und Leiden und oft unendlich großer Verlust. So entwickelten die Menschen Rituale, um ihre Gefühle, ihre Trauer, ihren Verlust auszudrücken. Ich denke, wir können uns kaum vorstellen, wie wichtig diese Rituale waren. Sie waren sicher auch der Ausdruck und die Sehnsucht nach einer ewigen, beständigen Welt, denn das Leben war flüchtig.
*
Bei den Bildern von Burian sind mir einige Jagdszenen aufgefallen. Die Jagd war essentiell für das Überleben der Menschen der Vorzeit, keine Frage, aber es war auch ziemlich brutal und rücksichtslos gegenüber den Tieren, zumindest aus heutiger, moderner Sicht.
Eine Szene zeigt einen großen Höhlenbären. Oberhalb der Höhle, aus welcher der Bär läuft, stehen Menschen mit großen Steinen, die sie auf den Bären hinunter werfen, um ihn zu töten. Eine brutale Steinigung.
Eine andere Szene zeigt ein Mammut, das in eine Falle gelaufen und in eine Grube gefallen war. Nun umringen Menschen das Tier, um es zu töten. Auf die Idee einer Falle muss man kommen. Eine intelligente Leistung. Aber ist das eine gute Form der Jagd? Können oder wollen wir das akzeptieren? Das große Tier ist nur Opfer der gerissenen, aber im Grunde doch kleinen und schwachen Menschen. Mir jedenfalls will das nicht gefallen, auch wenn die prähistorische Realität aufgezeigt wird.
Am schlimmsten finde ich eine Jagdszene, bei der Pferde mit Feuer und Geschrei auf eine Abbruchkante in der Landschaft zugetrieben werden, um dann in die Tiefe in den Tod zu stürzen. Aus meiner Sicht abstoßend. Vermutlich wurden zu viele Pferde dabei getötet. Man konnte das viele Fleisch gar nicht essen, die Tierkörper nicht verwerten, denke ich mir.
Es zeigt mir außerdem eine Missachtung der Tiere und ihrer Welt.
Der Mensch hat im Laufe seiner Geschichte massenhaften Tod verursacht, nicht nur bei Mammuts oder Pferden, sondern auch gegenüber der eigenen Art. All das hat schon in der Steinzeit begonnen. Die Menschheit hat es bis heute nicht überwunden, wie uns die aktuellen Krieg der letzten Jahre mehr als deutlich zeigen.
Tod im tibetischen Buddhismus
Der tibetische Buddhismus scheint mir eine sehr tiefe Verbundenheit mit dem Tod zu haben. Die Leere, das Nirvana spielen eine bedeutende Rolle in dieser Religion. Die Erfahrung, dass sich alles auflöst, alles verschwindet, dass es eine dauerhafte Substanz oder ein dauerhaftes Sein nicht gibt, sondern nur Zustände eines endlosen Wandels, einer endlosen Veränderung von allem.
Im Zusammenhang mit dem Tod kenne ich aus dem tibetischen Buddhismus das Chöd-Ritual. Diese Praxis habe ich in zwei Seminaren kennengelernt.
Außerdem die Powa-Praxis, bei der man das Bewusstsein hinaus sendet, in das Reich Amitabhas. Dazu habe ich ein Seminar mitgemacht.
Im tibetischen Buddhismus wird die LEERE betont. Alles sei ohne eigene, innere Dauerexistenz – vielmehr sei alles nur Übergang, Wandel bis zum Ende des Lebens. Nichts habe Bestand. Im Westen gilt diese Sicht oft als Nihilismus. Eine gewisse Dauer sieht man nur im Geist, im Bewusstsein, aber das ist eher jenseits vom einzelnen Individuum zu verstehen.
Auf meinem Öl-Gemälde (1998) ist ein Skelett-Tänzer zu sehen. Das Tanz-Ritual kenne ich leider nicht, geschweige denn, dass ich es selbst praktiziert habe.
Tibetischer Tänzer, eigenes Ölgemälde 1998 Todesjahr meines Vaters
Yamantaka; eigenes Thanka – visionäre Malerei
Ich frage mich, warum sich die Tibeter so intensiv mit dem Tod beschäftigt haben. Im Verhältnis dazu ist das „memento mori“ der Christen ja richtig lächerlich, weil so oberflächlich. „Powa“, die Übertragung des Bewusstseins im Tode ist eine Meditation, die man trainieren muss. Das gilt auch für „Chöd“ und andere Meditationstechniken.
Warum haben sie das in Tibet so intensiv verfolgt?
Lag es an der unendlichen, kosmischen Landschaft, in welcher der Einzelne völlig verschwindet?
Lag es an der immer prekären Lebenssituation, denn man lebte nicht im Wohlstand mit prall gefüllten Lebensmittelläden? Was hatten sie schon? Butter-Tee, Tsampa und manchmal etwas Fleisch vom Yak.
Haben die früheren Nomaden, die so einsame und unwirtliche Gegenden besiedelt haben, sich manchmal gefragt, warum sie überhaupt in diese Gegend gezogen sind? Sind solche Gegenden nicht völlig ungeeignet für menschliches Leben? Hätten sie nicht in Afrika bleiben sollen, trommeln und tanzen und nicht mehr?
Die einfachen, tibetischen Nomaden mussten sehen, wie sie mit ihren Tieren überleben konnten. Das Leben war schwer, und flüchtig.
Die Herrschenden waren wie überall. Sie wollten herrschen, nicht arbeiten, aber fressen und huren, das war überall ihr primitives Programm, fressen und huren, damals wie heute.
Die Lamas waren eingebunden in ein Klostersystem, eine Klosterhierarchie mit langen, langen Ritualen. Was sollte man auch sonst tun, den ganzen Tag?
Die Gomtschen, wir würden sie Eremiten nennen, lebten abseits in einer Höhle, einer Klause, würden wir sagen, meditierten über die Leere und das Verlöschen im Nirvana. Wir würden sagen, dass sie nur an Gott dachten und ihre Beziehung zu ihm, ihr Leben war ein „immerwährendes Gebet“, wie man es im orthodoxen Christentum nennt.
Was machten die Gomtschen in den Höhlen?
Können wir es uns auch nur annähernd vorstellen, selbst wenn wir uns intensiv mit den Beschreibungen von Lama Govinda beispielsweise befasst haben sollten?
Die meisten Westler können nicht mal eine halbe Stunde in Stille sitzen, gar nicht zu sprechen von Monaten und Jahren. Manche mögen es bewundern, andere nur pathologisch nennen. Ein äußerst armes Leben auf dem allerniedrigsten Niveau, materiell gesehen, mag uns pathologisch erscheinen. Den inneren Reichtum mögen wir nicht erkennen, oder nicht schätzen. Was sind schon innere Welten? Was sind schon Visionswelten?
Die Perspektive des westlichen Menschen ist das pralle Luxusleben mit viel Essen und berauschenden Getränken, nicht nur Tsampa und Butter-Tee.
Aus der Sicht der Gomtschen – und auch der frühchristlichen Eremiten – ist das moderne Leben ein pathologisches Dasein im Luxus, krank und verwerflich, weil es absolut gottfern ist, Vergänglichkeit und Tod nur verdrängend. Für die frühchristlichen Eremiten sind die heutigen Menschen „Kinder Satans“, denn sie haben sich alle verführen lassen von den Tausenden von Genüssen.
Vermutlich war die tibetische Herrschaftsklasse so dekadent wie alle Herrschaftsklassen. Die einsam lebenden Gomtschen waren der Gegenpol. Sie haben sich intensiv mit dem Sterben und dem Verschwinden befasst, auf dem kontemplativen Weg, wie man es im Westen nennt. Via contemplativa. Die Mystik ist im Westen auch eher eine Randerscheinung für wenige.
Auf den folgenden Seiten ein paar westliche Gemälde zum Thema Tod, die vielleicht für die typisch westliche Sichtweise stehen können. Jeder kann sie für sich deuten.
Selbstbildnis von Hans Thoma mit Amor und dem Tod, das Ich fühlt sich von fremden Mächten beherrscht
Edvard Munch, der Tod und das Kind, 1899 Alles ist Schrecken, alles unheimlich.
Der Strom der Toten
seit Jahrtausenden die vielen Toten
seit der Steinzeit und den Zeiten davor
eine ungeheure Menge von Leibern
die keiner zählen kann und will
das Wasser des dunklen Flusses
ist eine große Masse nur, nichts weiter
alles fließend hinunter zum Meer
verschwindend im Dunklen, im Nichts
kann der Tod die Masse lenken noch?
Und wohin denn, und wozu?
Ein Strom des Lebens und ein
Strom des Todes fließt durch die Zeiten.
Es gibt kein Ziel, keinen Sinn,
nur die Bewegung des Wassers.
Aber wir suchen und suchen
nach höherem Sinn, nach Trost.
Das Ungeheuerliche der Auslöschung,
es bleibt für immer, wie ein eisiger Fluss.
Franz, Lippisch: Der Flösser Tod (Ausschnitt, Mitte),1897 Das endlose, ewige Sterben, ein Wahnsinn.
Das ganze Gemälde
Federzeichnung 1885
Evelyn de Morgan, Engel des Todes, 1881
John Millais, Ophelia, Ausschnitt, 1851
Gustav Klimt, Tod und Leben, 1910-15
Van Gogh, Trauernder alter Mann, 1890
3. Das sichtbare Totenreich in der Natur
Die dunkle Seite am Marienteich.
Das Reich der Göttin Hel im gleißenden Licht. Das helle Totenreich.
Lebe ich heute? Habe ich in diesen Zeiten seit 1951 gelebt?
Wenn ich alte Schlager aus der Zeit um 1938, um 1940 höre, denke ich, dass ich in diesem Leben gar nicht wirklich da war. Aber wo war ich dann?
Das Hier und jetzt, von dem manche immer geredet haben, kam mir schon immer suspekt vor. Hier und jetzt, wo ist das?
Vielleicht bin ich nie richtig auf der Erde angekommen, vielleicht wollte ich das auch nie. Vielleicht wollte ich nur etwas nachholen, was ich im früheren Leben versäumt hatte, gar nicht leben konnte, weil der Tod zu schnell gekommen war. Am Ende war alles nur ein Versuch. Eine Illusion. Maya.
Als ich neulich beim Marienteich war, kam mir alles surreal vor, oder irreal, oder jenseitig. Vielleicht habe ich immer in einer Art von Jenseits gelebt.
Die einzige Musik, die mich in diesem Leben wirklich angesprochen hat, ist die psychedelische gewesen. Es war und ist eine Traumwelt. Man kann psychoaktive Substanzen nehmen, und erlebt die Welt völlig anders. Manche Indianer halten diese Welt für die wahre – und die normale Welt, wie sie jeder kennt, für die falsche. Wer will entscheiden, was stimmt?
So paranoid, wie der Mensch inzwischen geworden ist, lebt er in einer psychotischen Wirklichkeit, hält sie aber für total normal. Meine Wirklichkeit ist nur anders. Verbunden mit früheren Leben und Zeiten. Für mich ist es normal, für einen Psychiater mag es pathologisch sein, obgleich sie im Grunde ja gar kein Konzept einer gesunden Seele haben. Sie können auch deshalb keines haben, weil ihre Welt monodimensional ist, und nicht multidimensional. Vor über fünfzig Jahren wurde ihre beschränkte Wirklichkeit kritisiert, das scheint lange vergessen. Der eindimensionale Mensch. Marcuse. Sie haben sich mit dem materialistischen Weltbild arrangiert. Da gibt es keine Seelen, keine früheren Leben, keine Traumwelten, schon gar nicht irgendwelche Zauberwelt des Schönen und Heiligen. Es bleibt nur oral, anal, genital und absolut banal. Das hat mich schon immer abgestoßen und sehr traurig gemacht. Ich wollte das Zauberhafte, aber es gab nur das Triviale. Ihre multidimensionale Weltoffenheit bilden sie sich heute nur ein, denn die Welt der Träume und Geister lehnen sie ab. Zauberland ist abgebrannt. Sie haben es wie den Urwald zerstört.
Im Wald ist alles
du gehst in den Wald hinein
und siehst sie alle, die Lebenden
und die toten Bäume, die Sterbenden
und die vielen jungen Buchen und Fichten
hoffnungsvoll auf Zukunft wartend
du gehst durch die Innenstadt von Goslar
und siehst sie alle, die Lebenden
die Eilenden und die Langsamen
die alten Krummen, die sich quälen
und die jungen feschen Girls
im Wald betrachtest du ein Zeichen:
die Buche ist schon lange tot
aber der Efeu wuchert um
den toten Stamm herum
ein kräftiges Grün
3.12.24
Die Eiche bei Eilum
auf einem alten Kultplatz bei Eilum
eine markante Eiche steht
seit Jahrzehnten kenne ich sie
seit Jahrzehnten besuche ich sie
eher selten bin ich an dem Ort
hänge Gebetsfäden auf
nun muss ich es sehen:
ein großer Hauptzweig liegt am Boden
der wilde Sturm der letzten Nacht
gebrochen hat er ihn heraus
kündigt es sich schon an
des Baumes baldiges Ende?
Oder ist nur der
Verlust eines Armes?
6.12.24
Eiche bei Eilum
4. Die germanische Göttin Hel und Maria
Eine Göttin des Todes und der jenseitigen Welt gab es sicher seit der Steinzeit. In der germanischen Mythologie kennen wir die Göttin HEL. Leider haben wir nur wenige Quellen. Eine Traditionslinie in unserer Spiritualität haben wir schon gar nicht. Das ist sehr bedauerlich, aber nicht mehr zu ändern, denn wir können die Geschichte Europas nicht rückgängig machen.
Wir müssen, wie ich schon öfter gesagt habe, einen neuen und eigenen Weg suchen.
In Europa haben wir die Marienverehrung. Auch wenn sie nicht im Zentrum des sogenannten Christentums steht, und von so manchen abgelehnt oder sogar belächelt wird, stellt sie aus meiner Sicht einen wichtigen Teil dar. Man denke an die vielen Marienbildnisse, die viele Marienkapellen in Europa. Was steckt dahinter?
Es sind verschiedene Aspekte der Verehrung einer alten, prähistorischen Göttin.
Die Verehrung des reinen Lebens. (der weiße Aspekt)
Die Verehrung der Mutter. (der rote Aspekt)
Der Wunsch nach weiblichem, mütterlichem Trost. („Maria hat geholfen.“)
Das Aufgehobensein bei der Urmutter. (der schwarze Aspekt)
Die himmlische, jenseitige Mutter. Universelle Liebe und ewiges Licht.
Man könnte die Göttin HEL mit den beiden letzten Punkten in Verbindung bringen. Mir scheint das sinnvoll. Jeder muss aber für sich entscheiden, was ihm Sinn und Bedeutung vermittelt. Wem der Name nicht gefällt, der kann auch Hel-ga oder Hulda oder Holle nehmen. Wem das als reine Willkür erscheint, der hat sich vielleicht immer noch nicht von den diktatorischen Vorgaben der Kirche gelöst. Da wurde und wird alles von oben bestimmt! In Zukunft kann und wird das nicht mehr geschehen können.
Vor Jahren habe ich die Erdverbundenheit betont. Aber die Natur ist janusköpfig, hat zwei Seiten. Sie kann auch rücksichtslos, gnadenlos, brutal und vernichtend sein. Diese Tatsache hat mich bewogen, Maria nach außerhalb zu verlagern, also in den jenseitigen, transzendenten Bereich.
Diese Welt kann uns nicht genügen. Wir haben die Sehnsucht nach und die Idee einer anderen Welt, also jenseits aller Brutalitäten, von welcher Seite sie uns auch heimsuchen mögen.
5. Der Kreuzestod ist ein Mythos der Kirche
Vor längerer Zeit gab es im Fernsehen eine Dokumentation über den Tod am Kreuz. Fazit der Sendung: es gab sehr wohl eine Kreuzigung, aber keinen Tod und damit keine Auferstehung.
Schon länger gibt es die Ansicht, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben sei, sondern nur in eine Art Koma gefallen sei. Mithin gab es logischerweise auch keine Auferstehung.
Heute gibt es viele und genaue Untersuchungsmethoden von ungewöhnlichen Fällen, egal um welche es sich da handeln mag. Man zieht alle wissenschaftlichen Register. Das ist gut und richtig.
Eine Kirche, die von Anfang an vor allem eine Institution der Macht war und bis heute ist, hat daran natürlich kein Interesse, vor allem dann nicht, wenn ihr zentraler Mythos auf dem Abfallhaufen der Geschichte landen könnte. Sie meinen, dass ohne den Mythos von der Auferstehung ihr ganzes System kollabieren würde. Das mag sein. Aber ein falsches System, muss das erhalten bleiben?
Seit 2000 Jahren wird das nun geglaubt und weiterhin gepredigt, aber das normale Leben geht seinen Gang, mit allen Gemeinheiten und allen Formen der Gewalt, gegen Menschen, vor allem gegen Frauen, und am Ende gegen die ganze Natur. Insofern hat der ganze schöne Glaube an die Auferstehung nichts erbracht.
Vielleicht hat er manchen Trost gespendet. Vielleicht hat sich mancher sterbende Soldat im Krieg an den Glauben an die Auferstehung geklammert – und ist vielleicht leichter gestorben. Mag sein. So gesehen kann auch ein falscher Mythos sinnvoll sein. Das ist das Paradoxe am Leben, dass das Falsche manchmal richtig sein kann. Und das scheinbar Richtige leider falsch.
Brauchen wir in der zukünftigen Zeit noch diesen Mythos? Brauchen wir ihn, wenn wir voll und ganz akzeptieren, dass menschliches, individuelles Leben zeitlich terminiert ist, dass es im System der Natur terminiert sein muss, da der Kreislauf der Natur nur so funktioniert?