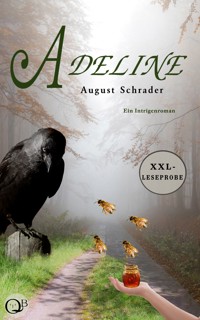Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quality Books Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist eine trügerische Ruhe, die über der beschaulichen, im schönen Ilmtal gelegenen Residenzstadt Weimar im Jahr 1775 liegt; denn im Verborgenen werden dunkle Intrigen gesponnen und unheilvolle Pläne geschmiedet, die nicht nur von höfischen Machtinteressen motiviert sind, sondern bis ins Reich der Leidenschaft hineinreichen. Abseits dieser hässlichen Machenschaften blüht jedoch auch die Liebe in der Stadt; die Liebe dreier Pärchen, so unterschiedlich von Stand und Rang wie gleich in ihrem Los, diese nur im Geheimen leben zu dürfen. Gesellschaftliche Konventionen, aber auch die Machtgelüste der Intriganten beeinflussen ihre Schicksale auf eine Weise, die kaum auf einen glücklichen Ausgang hoffen lässt. Nur ein Bewohner der Residenzstadt fühlt sich in der Lage, das stetig dichter werdende Netz aus Lügen, Intrigen, Verbrechen und dunklen Geheimnissen zu durchdringen. Doch ist die Zeit nicht auf der Seite desjenigen, der den Liebenden seine Hilfe gewährt … denn er, der für sich selbst nicht auf Liebe hoffen darf, ist … ein Todeskandidat! Die Quality Books-Neufassung dieses so spannenden wie bewegenden sechsteiligen Sensationsromans von August Schrader wird Sie durch die Schicksale der einzelnen Protagonisten und die Tragik der Ereignisse schnell in ihren Bann ziehen. „In Dumas’scher Manier schrieb sensationell, hochromantisch, auf Effekt und Nervenkitzel rechnend, der talentvolle und fruchtbare Romanschriftsteller August Schrader, eigentlich Simmel – geboren 01. Oktober 1815 zu Wegeleben bei Halberstadt und gestorben 16. Juni 1878 in Leipzig.“ (Dr. Adolph Kohut in: „Berühmte israelitische Männer und Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit, Bd. 2“)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER
TODESKANDIDAT
Modernisierte Neufassung
des sechsteiligen Romans
von
August Schrader
Band 3 & 4
Quality Books
2018
* * * *
Quality Books
Klassiker in neuem Glanz
Textgrundlage:
Der Todescandidat (Bd. 3 & 4)
August Schrader
Erstdruck: 1855, Leipzig, Verlag von Christian Ernst Kollmann
Neufassung: Marcus Galle
Umschlaggestaltung: Maisa Galle
© 2018 by Quality Books, Hameln
1. Auflage: September 2018
ISBN 978-3-946469-19-3
E-Mail: [email protected]
Für die vollständige Anschrift klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link:
Anschrift
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Herausgebers nicht vervielfältigt, wiederverkauft oder weitergegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Corona Schröter (1751-1802); Sängerin und Schauspielerin; Bekannte von Herzog Carl August und Goethe
Der Todeskandidat (Dritter Band)
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Der Todeskandidat (Vierter Band)
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Impressum (Anschrift)
DER
TODESKANDIDAT
- Dritter Band -
Erstes Kapitel
Die Sonne warf ihre Strahlen bereits schräg zur Erde, als Werner das Feld überschritten hatte und den schattigen Wald betrat. Der Weg schlängelte sich zwischen dichtem Unterholz fort und wurde häufig von kleinen Bächen durchschnitten, die über klarem Kies dahinrannen. Seine Schritte und das leise Rieseln der armseligen Quellen waren die einzigen Geräusche, die die hehre Stille des Waldes unterbrachen.
Nach einer Viertelstunde wurde das Unterholz dichter und der feuchte Boden verwandelte sich in einen weichen Rasenteppich mit bunten, duftenden Waldblumen. Werner fühlte das Bedürfnis, ein wenig zu ruhen; der rasche Gang hatte ihn erschöpft und der Schweiß rann in dicken Tropfen von seiner hohen Stirn. Unschlüssig, ob er nicht lieber das nächste Ziel seiner Wanderung erreichen sollte, als sich auf dem kühlen Boden zu lagern, lehnte er an dem schlanken Stamm einer Buche. Da hörte er plötzlich Stimmen durch den Wald schallen, die ein eifriges Gespräch führten. Dann wieder hörte er helles Gelächter und derbe Flüche. Es war nicht schwer zu erkennen, dass die Männer, die dieses Geräusch verursachten, aus der Richtung kamen, die Werner eingeschlagen hatte, und dass er ihnen bald auf dem schmalen Fußpfad begegnen musste. Die Einsamkeit der Gegend und das Bewusstsein seiner Schwäche rieten ihm, sich nicht der Begegnung mit Menschen auszusetzen, die möglicherweise zur Gesellschaft des Windmüllers gehören konnten. Außerdem besaß er auch in den Papieren einen Schatz, dessen Erhaltung die größte Sorgfalt zur Pflicht machte.
Die Stimmen kamen wirklich näher, und schon im nächsten Augenblick glaubte Werner, das rohe Fluchen Sommers zu erkennen. Ohne weiter darüber nachzudenken, schlüpfte er hinter einen Strauch, der sich drei Schritte vom Weg mit seinen großen Blättern ausbreitete. Hinter dieser Schutzwehr warf er sich in das hohe Gras, das über ihn zusammenschlug und den kleinen Mann völlig bedeckte. Kaum hatte er diesen Platz eingenommen, als er die Worte des Gesprächs deutlich vernehmen konnte, und zugleich erkannte er die Stimmen Sommers und Lucas’.
»Der Teufel soll mich holen, wenn ich einen Schritt weitergehe!«, brüllte Sommer. »Bei dieser Glut hätten wir in der Schenke bleiben sollen.«
»Wir sind bald bei deinem Haus.«
»Oho! In einer halben Stunde denke daran. Wir sind auf den Fußweg geraten, der zur Sägemühle führt – glücklicherweise habe ich den Irrtum noch beizeiten bemerkt. Jetzt lass mich los; ich lege mich hier nieder, um auszuruhen!«, sagte der Windmüller mit stammelnder Zunge. »Welch ein prächtiges Gras hier wächst – hätte ich meine Kuh noch! So, da liege ich, besser als auf meiner Streu zu Hause. Das ist recht, Lucas, lege dich zu mir.«
An den Geräuschen bemerkte Werner, dass die beiden Männer sich auf der andern Seite des Busches gelagert hatten; er war fünf bis sechs Schritte von ihnen getrennt. Mit angehaltenem Atem begann er nun zu lauschen.
»Sommer«, sagte Lucas, »ich glaube, du willst hier deinen Rausch ausschlafen!«
»Nein!«
»Und dennoch.«
»Das ist nicht möglich.«
»Warum?«
»Narr, weil ich keinen Rausch habe!«
»Zehn Krüge Bier und keinen Rausch – Du schwanktest aus der Schenke wie ein Eber, der eine doppelte Ladung Schrot in den Keulen hat.«
»Ich habe mich geärgert!«, murmelte Sommer.
»Geärgert – worüber?«, fragte Lucas lachend.
»Dass ich dem Wirt nicht alle Knochen zerschlagen habe.«
»Das würde dir übel bekommen sein.«
»Mir ist jetzt alles gleich.«
»Was wird aus deiner Frau, aus deinen Kindern?«
»Ja, wenn ich die nicht hätte …«
»Du hast sie nun einmal, und darum sorge!«
»Lucas, lange ertrage ich dieses jammervolle Leben nicht mehr. Selbst wenn ich betrunken bin, kommt mir der Gedanke: Was soll aus dir und deiner Familie werden? Ich muss mich bis zur völligen Sinnlosigkeit berauschen, um auf kurze Zeit mein Elend zu vergessen.«
»Warte bis der Amtmann zurückkommt, und all unsere Not ist beim Teufel!«, sagte Lucas.
»Da werde ich bis zum jüngsten Tag warten müssen.«
»Oho!«
»Denkst du denn, dass wir den Schuft je wiedersehen?«
»Dann besitze ich Mittel, ihn zu zwingen.«
»Der hat unsere Juwelen verkauft und ist allein nach Amerika gegangen. Wir haben dumm gehandelt, dass wir ihm unsern Erwerb ohne Weiteres anvertrauten.«
»Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.«
»Wie lange ist er nun über die versprochene Zeit ausgeblieben.«
»Die Reise nach Frankfurt ist weit; wer kann wissen, was ihn aufhält. Glaube mir, der Amtmann hat Sehnsucht nach seiner Tochter, und ehe er die verlässt, gibt er das ganze Vermögen hin.«
»Nun, ich will das Beste wünschen«, murmelte Sommer; »aber lange kann ich nicht mehr warten.«
»Du hast ja drei Gulden!«, meinte Lucas lachend. »Sieh, ich schleppe dich von einem Tag zum andern durch, bis unser Geldschiff ankommt. Mehr kannst du doch von einem guten Freund nicht fordern. Ich wollte, du hättest die Papiere nicht verloren, denn ich bleibe dabei, dass ein Kerl, wie du einer bist, Geschäfte damit gemacht hätte.«
»Ich erinnere mich zwar, Lucas, dass du mir die Papiere gegeben hast, aber ich will ein Schuft meines Namens sein, wenn ich weiß, wohin sie gekommen sind.«
»Du warst betrunken, wie gewöhnlich.«
»Aber trotzdem habe ich meine Vermutungen.«
»Nun?«
»Der Amtmann hat sie mir gestohlen.«
»Das wäre ein schlechter Streich von ihm.«
»Und wie er mich bestohlen hat, wird er uns alle bestehlen.«
Eine Pause trat ein. Plötzlich begann Lucas wieder:
»Höre, Sommer, ich komme am schlechtesten bei der Geschichte weg, denn ich habe dem Rosskamm die wertvollsten Sachen anvertraut. Hieraus lässt sich schließen, dass ich ihn euch mit vollem Recht empfehlen konnte – wenn ich Vertrauen in ihn setze, durftet ihr es auch. Ich warte noch drei Tage; hat der Bursche dann nichts von sich hören lassen, so tue ich die zu unserer Sicherheit erforderlichen Schritte.«
»Das heißt, du reist ab und kommst auch nicht wieder.«
»Sommer, du bist doch ein schlechter Kerl! Überall witterst du Niederträchtigkeit.«
»Mein lieber Freund«, rief der Windmüller in einem bitteren Ton, »wer die Menschen so kennengelernt hat wie ich, hat wohl allen Grund zu misstrauen, wohin er blickt. Es gab einmal eine Zeit, wo ich die beste Meinung von der ganzen Welt hatte, wo ich jeden für meinen Freund hielt, der mir die Hand drückte und mich anlächelte – aber wie arg bin ich enttäuscht worden! Ich teilte mit und half, wie ich konnte – endlich hatte ich nichts mehr, und als das Unglück über mich hereinbrach, da zogen sich die guten Freunde nicht nur zurück, sie versuchten auch noch, mich von meinem Posten zu drängen, und brachten mich so vollends in den Ruin, dass ich die Gegend verlassen musste, in der ich einst so glücklich gelebt hatte. Ich kam in dieses Land und beging die Tollheit, mich wieder zu verheiraten – kaum glaubte ich mich ein wenig sicher, so ging der Teufelstanz von Neuem los und man brachte mich nach und nach um das Vermögen, das ich mit der Witwe erheiratet hatte.«
»Das ist freilich schlimm!«
»Ah!«, rief Sommer verzweiflungsvoll, »mir sagte einmal jemand, ich sei kein praktischer Mensch …«
»Was heißt das?«, unterbrach ihn Lucas.
»Das heißt, ich sei nicht verschlagen, nicht hartherzig, nicht boshaft, nicht spitzbübisch, mit einem Wort nicht schurkisch genug, um den Leuten so viel abzupressen, wie zu einem bequemen Leben nötig ist. Und wahrlich, dieser Kerl, den ich damals verabscheute, hat recht. Hätte ich es gemacht wie er, ich wäre heute ein gemachter Mann. Er war Advokat und wusste die Leute auf eine so feine Manier auszuziehen, dass sie es erst dann merkten, wenn sie nichts mehr hatten.«
»Also das war ein praktischer Mann?«, fragte Lucas.«
»Ja, mein Freund, der war durch und durch praktisch.«
»Aber kamen denn die Leute nicht dahinter?«
»O man kannte den Burschen; aber er hatte Geld, und dieses Geld brauchte man. Während man mir, der ich durch Ehrlichkeit und Sorglosigkeit arm geworden war, scheu aus dem Weg ging, zog man vor jenem, der mein Vermögen größtenteils geschluckt hatte, ehrerbietig den Hut. Jetzt hatte ich mir nun vorgenommen, praktisch zu werden, und ich trat mit euch in Geschäftsverbindung – da kommt nun der noch praktischere Rosskamm und übertölpelt mich. Was ich unter Not und Mühe und mit einer furchtbaren Herzensangst erobert habe, das nimmt mir dieser Schuft wieder.«
»O nein, so haben wir nicht gewettet!«, rief Lucas. »Der Amtmann muss Rechnung ablegen und mit Heller und Pfennig zahlen oder das ihm anvertraute Gut zurückgeben. Dafür lass mich sorgen, Freund Sommer.«
»Wie dem auch sei – ich werde noch einen Streich auf eigene Hand unternehmen, und misslingt der, so jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ich würde es längst getan haben, wenn ich nicht eine Familie zu versorgen hätte. Aber sehe ich ein, dass ihr mein Leben nichts nützt, so mag es der Teufel hinnehmen.«
»Meiner Treu, Sommer, du bist ganz nüchtern geworden! So verständig habe ich dich noch nie schwatzen gehört. Na, mit der Kugel hat es wohl noch ein wenig Zeit.«
Wiederum trat eine Pause ein, und der lauschende Werner hatte Zeit, Betrachtungen über die Philosophie dieser beiden Gauner anzustellen. Dass sie den Diebstahl im Haus der Oberhofmeisterin begangen hatten, bezweifelte er keine Sekunde mehr, und da er gehört hatte, dass sie das Gestohlene einem Dritten übergeben hatten, konnte er sich auch die Armut des Windmüllers erklären. Der Gedanke an Lucas’ Annäherung erfüllte ihn mit Besorgnis; trotzdem hielt er es aber für geraten, ihr nicht auszuweichen. Seine Unterhaltung mit dem Windmüller hatte ihn belehrt, dass er es mit einem vorsichtigen und verschlagenen Menschen zu tun habe; er kam selbst auf die Vermutung, Lucas habe in der Waldschenke die Szene herbeigeführt, um überhaupt mit ihm anzuknüpfen. Aber, fragte er sich, weshalb war er so erschrocken, als ich ihm meinen Vornamen nannte?
In diesem Augenblick begann das Gespräch wieder.
»He, Sommer, schläfst du?«
»Nein.«
»Du bist ja so still.«
»Ich denke nach.«
»Über was?«
»Über den Buckligen, dem du die Uhr in der Schenke verkauftest. Mir scheint, das war sehr unvorsichtig.«
»Warum?«
»Der Kerl kam mir wie ein Spion vor.«
»Ha, ha, ha«, lachte Lucas, »mir nicht! Die Polizei wird sich nicht eines Menschen bedienen, den man unter Tausenden erkennt. Und wenn er es wäre – was haben wir zu fürchten? Ich habe die Uhr ehrlich gewonnen, dessen ist der Wirt Zeuge – wer kann mir verwehren, dass ich sie verkaufe? Aber sei ohne Sorge – der Bursche wird mich nicht verraten, wenn ich ihn nur einmal gesprochen habe. Ist er vermögend, so wird er mich sogar unterstützen.«
Diese Worte versetzten Werner in die größte Spannung; gewaltsam unterdrückte er einen Hustenanfall, indem er sich den Mund mit dem Schnupftuch verstopfte. Wie ein Knäuel lag er zusammengerollt im Gras und lauschte.
»Kennst du ihn denn?«, fragte Sommer.
»Ob ich ihn kenne!«, rief Lucas. »Er ist sozusagen mein Sohn!«
»Wie, dein Sohn? Du sagtest mir doch, du habest nur eine Tochter?«
»Er ist auch nur mein Pflegesohn.«
»Höre, Lucas, dies ist wieder eine von deinen gewöhnlichen Lügen. Wenn jener Bucklige, den man unter Tausenden erkennt, wie du selbst gesagt hast, dein Sohn ist – warum hast du ihn denn nicht gleich erkannt, als wir in die Wirtsstube traten?«
»Kannst du schweigen, Sommer?«
»Ich dächte, das wüsstest du bereits.«
»Gut, so will ich dir erzählen, in welcher Beziehung ich zu dem Buckligen stehe. Ich hatte es mir schon in der Schenke vorgenommen, aber du warst ja betrunken. Jetzt bist du nüchtern, darum höre, und sage mir, was ich aus der Geschichte für Vorteil ziehen kann – oder noch besser, ob man mir etwas anhaben kann.«
»Mach die Vorrede kurz!«
»Ich fange schon an. Ehe ich in das Sächsische zog, bewohnte ich in der Nähe von Karlsbad mit meiner Frau ein Häuschen. Wir hatten uns ein Jahr zuvor verheiratet und lebten in der größten Armut. Ich war Tagelöhner und verdiente oft nicht das trockene Brot für mich und meine Frau. Das war ein fröhlicher Anfang unsers Ehestandes, nicht wahr? Das Häuschen hatte zwar meine Frau geerbt, aber es war so verschuldet, dass wir nicht den Ziegel auf dem Dach den unsrigen nennen konnten.«
»So haben unsere Häuser dasselbe Schicksal!«, murmelte Sommer. »Wenn es einem gewissen reichen Herrn gefällt, lässt er mir den Wald zur Wohnung anweisen.«
»In derselben Situation war ich«, fuhr Lucas fort. »Da warf sich mir ein glücklicher Zufall in den Weg. Eines Tages kam die Hebeamme unsres Kirchspiels und suchte für eine kranke Dame, welche die Luft unsres Tals genießen wollte, ein Stübchen. Man versprach uns eine hübsche Miete, und wir richteten ein Zimmer ein. Ich hatte zwar meine Vermutungen in Bezug auf die Abmieterin, weil die Hebeamme sie angemeldet hatte – aber was kümmerte es mich; ich wollte Geld verdienen, zumal da meine junge Frau kurz davor stand, zum ersten Mal Mutter zu werden. Gegen Abend kam also die Mieterin, eine schöne, vornehme Dame. Ihr Gesicht konnten wir nicht deutlich erkennen, weil sie es mit einem großen Schleier bedeckt hatte. Nun denke dir den Zufall, Sommer: Zwei Tage später wurde meine Frau von einem toten Kind entbunden, und in der darauffolgenden Nacht hörte ich in dem Stübchen unserer Hausgenossin das Schreien eines zarten Weltbürgers, wie du zu sagen pflegst.«
»Ah, ich merke schon!«, rief Sommer, der sich im Gras emporrichtete und neugierig den Erzähler ansah. »Da wäre ein Geschäft zu machen gewesen.«
»Es ist auch gemacht worden, Freund, und zwar ohne mein Zutun.« Die Hebeamme, die wahrscheinlich eine gute Bezahlung erhalten hatte, war für die Wöchnerin sehr tätig. Außer ihr wusste kein Mensch, was in unserm Haus vorgegangen ist. Sie kam also und sagte: ›Lucas, ich weiß, ihr seid ein armer Schlucker; benutzt die Gelegenheit und verschafft euch ein kleines Vermögen.‹ ›Welche Gelegenheit?‹, fragte ich verwundert. Die Frau nahm mir nun das Versprechen der tiefsten Verschwiegenheit ab, dann sagte sie: ›Ihr habt ein totes Kind; nehmt dafür das hübsche gesunde Kind der vornehmen Dame, und macht die Leute glauben, Eure Frau habe es geboren; Ihr werdet eine hübsche Summe erhalten. Meine Frau war damit zufrieden; ich begrub mein totes Kind in unserm Garten und empfing dafür einen hübschen Schreihals, der kaum zu sättigen war. Kurze Zeit darauf war die vornehme Dame völlig wiederhergestellt. Da kam die Amme wieder und sagte: ›Lucas, hier ist Geld, lasst nächsten Sonntag euer Kind taufen. Doch zuvor unterschreibt Ihr und Eure Frau dieses Papier, wonach ihr gelobt, den stattgefundenen Tausch ewig geheim zu halten, das Kind für euer eigenes auszugeben und zu erziehen, und nie nach der wahren Mutter desselben zu forschen.‹ Warum nicht?, dachte ich. Wäre dein Kind am Leben geblieben, so hättest du es erziehen müssen, ohne einen Pfennig Geld zu bekommen; der Handel ist gut und vorteilhaft, du kannst ihn eingehen. Da, ich nicht schreiben konnte, machte ich drei Kreuze unter die Schrift und schwor, meine Pflicht als Vater zu erfüllen. Ich hielt Kindtaufe, und die vornehme Dame reiste ab. Kein Mensch ahnte den Tausch, und außer dir weiß auch keine Seele davon, denn ich habe mein Versprechen redlich erfüllt. Mithilfe des empfangenen Geldes verbesserte ich nun mein kleines Grundstück und bezahlte meine Schulden, sodass ich nach drei Jahren als ein wohlhabender Mann galt. Die neidischen Nachbarn zerbrachen sich zwar die Köpfe, wie ich das alles in so kurzer Zeit möglich machen konnte; da ich aber Handel mit Getreide trieb, mussten sie glauben, dass ich richtig spekuliert hatte. Während dieser Zeit hatte der hübsche Knabe mit den braunen Haaren und blauen Augen noch eine Schwester bekommen. Ah, Sommer, das war doch etwas anderes! War das Mädchen auch pausbackig und ungeschickt, hatte es auch Flachshaare und graue Augen – es sah doch dem Vater ähnlich und war mein eigenes Fleisch und Blut – kurz, ich hatte das dicke Mädchen lieber als den zarten Jungen.«
»Hat sich denn die Dame nicht wieder sehen lassen?«, fragte Sommer.
»Einmal, und da hat sie noch zahlen müssen.«
»Ganz recht. Bei solchen Leuten muss man praktisch zu Werke gehen. Aber kennst du sie denn?«
»Nein; ich weiß weder ihren Namen noch ihren Stand und würde auch ihr Gesicht nicht wiedererkennen, das sie stets verschleiert hatte. Aber meine Frau würde die Züge wiedererkennen, denn sie hat sie sich genau angesehen, während sie ohne Schleier mit ihr gesprochen hat. Doch nun höre weiter. Um diese Zeit bot man mir eine hübsche Summe für meine Besitzung. Ich verkaufte sie, und da einmal der Handelsgeist in mir erwacht war, zog ich nach P., wo ich einen Kramladen übernahm und Schmuggelgeschäfte nach Österreich machte. Mehr als ein Dutzend verwegene Schmuggler standen in meinen Diensten. Anfangs ging das Ding gut, später aber erlitt ich einige derbe Verluste, denn die Grenzjäger hatten durch Verrat die Fährte meiner Leute entdeckt, und diese mussten ihre Ballen wegwerfen, um sich nicht fangen zu lassen. Ich verlor dreitausend Gulden. Dazu kamen noch andere Nachteile, die dadurch herbeigeführt wurden, dass ich des Schreibens nicht recht kundig war, das ich erst spät und mangelhaft erlernt hatte; aber ich war ein guter Kopfrechner und besaß ein gutes Gedächtnis.«
»Was wurde denn aus dem Kind der vornehmen Dame?«
»Der Junge mochte ungefähr vier Jahre alt sein, als ihm ein kleines Unglück passierte«, fuhr Lucas ruhig fort. »Meiner Frau ging es nämlich wie mir; sie konnte den Balg nicht leiden, weil er hübscher und klüger war als meine eigenen Kinder. Und so kam es denn, dass er mitunter sich selbst überlassen blieb.«
»Das war schlecht, Lucas, denn dem Jungen verdanktest du dein Vermögen. Ohne ihn wärst du ein elender Tagelöhner geblieben.«
»Daran habe ich mich stets erinnert, und dem Jungen ist auch nichts abgegangen, er wurde gut gekleidet und genährt; aber was konnte ich dafür, dass ich ihn nicht so lieb hatte wie die andern Kinder? Der wilde Junge also befand sich einmal allein in einem Zimmer des ersten Stocks – er steigt an das offene Fenster, greift nach einer Weintraube, die nicht weit davon hängt, und stürzt bei dieser Gelegenheit auf das Pflaster der Straße. Ich stand gerade in der Haustür, als der Klumpen herunterfiel. Rasch schleppte ich den armen Bengel in die Stube und ließ einen Arzt kommen. Was in der Welt nur möglich war, wurde angewendet, und wir erhielten den Jungen zwar am Leben, aber er bekam einen Buckel, der stets größer wurde. Der Junge wuchs hinten und vorn aus, anstatt größer zu werden, und dabei veränderte sich sein Gesicht, dass man ihn nach einem halben Jahr nicht wiedererkannte. ›Er wird nicht alt‹, sagten die Ärzte, ›denn bei ihm bildet sich die Schwindsucht aus.‹ Was konnte ich nun dabei tun? Während sich meine Frau mit dem kranken Kind plagte, hatte ich Sorge und Not mit meinem Geschäft. Bald betrog mich ein Schmuggler, bald ein Kaufmann jenseits der Grenze. Doch da ich nun einmal ein reicher Mann werden wollte, ließ ich mich davon nicht abschrecken, sondern wurde nur noch kühner in meinen Unternehmungen. So führte ich einst selbst einen Zug von zwölf Trägern über die Grenze, die teure Ballen geladen hatten. Wäre ich damit glücklich ans Ziel gekommen, ich hätte einen Hauptschlag gemacht. Aber der Teufel musste seine Hand im Spiel gehabt haben, denn obgleich wir neu entdeckte Schleichwege gewählt hatten, griff uns eine Rotte versteckter Grenzjäger an, und alle unsere Ballen fielen ihnen in die Hände.«
»Das nenne ich Unglück!«
»O das ist noch nicht alles!«, rief Lucas. »Als ich sah, dass die Ballen verloren waren, wollte ich wenigstens meine Freiheit retten. Indem ich in einen Seitenweg springen will, tritt mir ein Grenzjäger entgegen. Der Kerl schießt, dass mir die Kugel am Kopf vorbeifährt. Da ich nicht umkehren kann, weil sich auch in dem Hohlweg hinter mir ein Söldner regt, so werfe ich mich auf meinen Gegenmann, um ihn zu entwaffnen und dann zu entwischen. Ich balge mich eine Zeit lang mit ihm und wäre seiner Herr geworden, wenn ihm sein Kamerad nicht zu Hilfe gekommen wäre Man packte mich, band mich mit Stricken und führte mich in das Gefängnis, wo ich drei meiner Träger vorfand. Den einen kennst du ja, er ist dein Freund geworden.«
»Also daher stammt die Freundschaft. Nun, was wurde weiter?«
»Ein Prozess, Freund, der mir bald den Kopf gekostet hätte. Bei der Untersuchung nämlich legte man mir zur Last, ich hätte den Grenzsoldaten verwundet – Sommer, ich habe allerdings mit ihm gerungen, aber der Teufel soll mich holen, wenn ich von einer Verwundung etwas weiß. Dafür wurde ich zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt.«
»Nicht übel!«, meinte Sommer.
»An diese grässliche Zeit werde ich denken, solange mir die Augen offen stehen. Nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier wurde ich behandelt, und dabei musste ich über die Maßen arbeiten. Während dieser Zeit hatte man aber auch mein Vermögen mit Beschlag belegt, und da einer von meinen Leuten ausgesagt hatte, dass er schon lange für mich geschmuggelt habe, so verdammte man mich zu einer Strafe, die mein Vermögen völlig verschlang. Als ich aus dem Zuchthaus entlassen wurde, waren mein Haus und mein Kramladen verkauft, und meine Frau fand ich auf einem Dorf bei D., wo sie bei ihrer Stiefschwester wohnte und um Tagelohn arbeitete, um ihre Kinder zu ernähren. Jetzt waren wir noch schlechter dran als zur Zeit unserer Verheiratung; wir waren bettelarm und hatten eine Herde Kinder zu ernähren. Ich muss dir offen bekennen, Sommer, dass ich die vornehme Dame verwünschte, denn wäre sie nicht gekommen, ich wäre Bauer geblieben und hätte nie den Reiz kennengelernt, der im Besitz des Geldes liegt. Vor zwei Jahren aß ich von einem wohlbesetzten Tisch, jetzt hatte ich kaum ein Stück trockenes Brot. Wäre mir der bucklige Junge unter die Fäuste gefallen, ich glaube, ich hätte ihn misshandelt.«
»Lebte er denn nicht mehr?«
»O ja.«
»Wo befand er sich denn?«
»Meine Frau erzählte mir, dass ihn einer unserer Nachbarn in P. zu sich genommen habe, ein kinderloser Tapezierer.«
»Und da hat er sich gerade den Buckligen gewählt?«, rief Sommer lachend. »Der Tapezierer muss einen sonderbaren Geschmack gehabt haben.«
»Der ganze Kerl war ein sonderbarer Mensch, ich erinnere mich seiner noch. Er gehörte zu den frommen Leuten des Städtchens, die abends in ihren Häusern Betstunden hielten. Jener Tapezierer war als der beste Redner bekannt, und wenn bei ihm eine Zusammenkunft stattfand, so strömte Jung und Alt dorthin, um seine Predigt zu hören. Dadurch, dass er sich gerade des Buckligen annahm, glaubte er, sich ein Plätzchen im Himmel zu sichern. Meine Frau gab ihn bereitwillig hin, weil sie überdies genug zu versorgen hatte. Der fromme Tapezierer hatte gemeint, das gebrechliche Kind verlange eine größere Pflege als die gesunden, und deshalb wollte er es ihr abnehmen, erziehen und seine Profession lehren, die es trotz seiner Schwächlichkeit werde betreiben können.«
Werner, dem kein Wort dieser Erzählung entgangen war, glaubte, seinen Sinnen nicht trauen zu dürfen. Er kannte die erste Zeit seiner Jugend nicht, aber dessen, was Lucas von dem Tapezierer erzählte, erinnerte er sich genau; es passte auf den Mann, der ihn erzogen hatte. Demnach unterlag es keinem Zweifel, dass er das Kind der vornehmen Dame war, von Lucas’ Frau gesäugt und von dem frommen Tapezierer, den er als seinen Pflegevater liebte und ehrte, erzogen. Von seinem Vater, also von Lucas, hatte man ihm erzählt, dass er schlechte Geschäfte gemacht habe und dann nach Amerika ausgewandert sei.
»Hast du denn die Mutter des Kindes nicht wiedergesehen?«, fragte Sommer.
Werner lauschte mit der größten Spannung auf die Beantwortung dieser Frage.
»Höre weiter«, fuhr Lucas ruhig fort. »Meine Lage war damals die traurigste, die es geben kann. Auf dem Dorf, das meine Schwägerin bewohnte, bezahlten die Bauern die Arbeit so schlecht, dass ich trotz der anstrengendsten Tätigkeit die nötigsten Bedürfnisse meiner Familie nicht bestreiten konnte. Ich suchte also in dem eine Stunde entfernten Dresden Arbeit und fand sie.«
»Was machtest du denn in der Stadt?«
»Ich hackte Holz.«
»Eine schöne Beschäftigung für einen Kaufmann.«
»Morgens, ehe noch der Tag graute, ging ich mit meiner Frau zur Stadt, und abends kehrten wir müde und matt heim. So ging dieses traurige Leben eine Zeit lang fort, ohne dass sich etwas Besonderes ereignete. Eines Tages waren wir in der Stadt auf der Suche nach Arbeit. Wir hatten kein Geld und konnten auch keine Gelegenheit finden, etwas zu verdienen. Missmutig saß ich am Tor und verwünschte die ganze elende Welt. Da kommt auf einmal meine Frau, die bei unsern Kunden Nachfrage gehalten hatte, atemlos zu mir gelaufen und sagt, dass sie die vornehme Dame gesehen und gesprochen habe, die uns einst das Kind übergeben hatte. ›Ich war im Zweifel‹, berichtete meine Frau, ›ob es auch dieselbe Dame ist, trotzdem aber redete ich sie an, und sie erschrak dergestalt, dass ich gleich wusste, woran ich war.‹«
»Das hat deine Frau gut gemacht!«, rief Sommer. »Was geschah nun weiter?«
»Sei es nun, dass die Dame das Gewissen plagte, oder sei es, dass sie einen Skandal auf offener Straße befürchtete – kurz, sie willigte in eine Unterredung, die meine Frau von ihr forderte, ein und bestimmte selbst als den Ort der Zusammenkunft das große Kreuz auf der Elbbrücke. Du kannst dir denken, mit welcher Sehnsucht ich den Abend erwartete, wo sie kommen wollte. Dass sie ohne Weigern zahlen würde, um uns loszuwerden, lag außer allem Zweifel – aber ich zweifelte an ihrem Kommen. Eine Frau dieser Art, dachte ich, wird keine Sehnsucht haben, von ihrem Kind etwas zu erfahren.«
»Du hattest ja das Kind nicht mehr.«
»Gleichviel.«
»Wenn sie es nun hätte sehen wollen?«
»Dann würde ich ihr einen von meinen Jungens vorgestellt haben – darauf war ich schon vorbereitet.«
»Sie wusste also nicht, dass der Junge aus dem Fenster gestürzt und bucklig geworden war?«
»Narr, wie konnte sie das wissen, da sie sich nie wieder um uns gekümmert hatte. Und angenommen, sie hätte wirklich den frommen Tapezierer gesprochen – was würde sie von ihm erfahren haben, da er selbst nichts wusste? Alle diese Dinge hatte ich mir reiflich überlegt und meinen Plan darauf gebaut. Endlich wurde es dunkel, und ich war mit meiner Frau auf der Brücke. Wir brauchten nicht lange zu warten, die Dame erschien pünktlich. Gleich nach den ersten Worten unserer Unterredung merkte ich, dass sie von dem Schicksal ihres Kindes nicht nur nichts wusste, sondern dass sie auch keine Lust hatte, je etwas darüber zu erfahren. Das war Wasser auf meine Mühle.«
Das herzlose Weib hatte verdient, dass man es tüchtig ausplünderte.«
»›Madame‹, sagte ich, nachdem ich ihr mein Unglück und den Verlust meines kleinen Vermögens mitgeteilt hatte, ›ich würde längst Europa verlassen haben, wenn ich Geld zur Reise gehabt hätte.‹ ›Sie wollen auswandern?‹, fragte sie rasch. – ›Sobald wie möglich.‹ – ›Wie viel Geld benötigen Sie?‹ Ich forderte natürlich eine hübsche Summe. Nachdem ich ihr geschworen hatte, auch wirklich den versprochenen Gebrauch von dem Geld zu machen, händigte sie mir die Summe ein und verschwand. Neugierig, wohin sie gehen würde, folgte ich ihr in einiger Entfernung; aber ich verlor sie in dem Gedränge aus den Augen und habe sie nie wieder gesehen.«
»Hast du keine Vermutungen?«
»Keine. Soviel begreife ich jedoch, dass ihr an der Bewahrung des Geheimnisses alles liegt.«
»Das steht fest!«, sagte Sommer. »Jene Dame ist verheiratet und das Kind ist die Frucht einer unerlaubten Jugendliebe, wie man sie bei den vornehmen Leuten oft findet. Der Gemahl, vielleicht ein hochgestellter Mann, darf nichts erfahren; er muss glauben, dass er die erste Liebe seiner Gattin ist. Wenn wir uns ihr jetzt nahen könnten, sie sollte die Bewahrung des süßen Geheimnisses teuer bezahlen. Lucas, wenn uns nichts bleibt, so stellen wir Nachforschungen an und beuten diese Sache aus.«
»Ich erkenne die Frau nicht wieder, da ich sie das letzte Mal in der Dunkelheit des Abends gesehen habe. Und wie lange ist das her!«
»Ah, Freund, da gibt es noch andere Mittel, die einem klugen Kopf zu Gebote stehen. Jene Person, wenn sie noch lebt, kann gezwungen werden, dass sie sich bei uns meldet.«
»Wie ist das möglich?«, fragte Lucas gespannt. »Ich kenne ja weder ihren Namen noch ihren Wohnort. Dass ich sie in Dresden gesehen habe, ist kein Beweis, dass sie auch dort wohnen muss.«
»Ah, du Schwachkopf!«, rief Sommer lachend. »Ein Bauer bleibt ein Bauer. Hättest du es verstanden, mit vornehmen Leuten umzugehen, du wärst heute ein ganz anderer Kerl. Wenn man eine solche Quelle besitzt, darf das Geld nie fehlen.«
»Jetzt ist alles zu spät.«
»Es ist nicht zu spät!«, sagte Sommer mit Bestimmtheit. »Jenes Weib ist reich, das liegt auf der Hand, und als herzlose Mutter hat sie eine Züchtigung verdient. Wenn ihr vor Jahren daran lag, das Kind fernzuhalten, so muss ihr jetzt, wo sie vielleicht selbst erwachsene Kinder hat, noch mehr daran liegen. Man hat einen Menschen völlig in seiner Gewalt, wenn man seine Schwächen und Verirrungen kennt.«
»Über das Geschwätz!«, rief Lucas. »Das weiß ich alles und habe es auch zum Teil schon angewendet. Nun, Herr Sommer, wenn Sie wirklich ein so schlauer Kopf sind, wofür man Sie allgemein hält, so geben Sie doch einmal dem Bauern ein Mittel an die Hand, das ihn sicher zum Ziel führt. Sie kennen nun die ganze Geschichte – also raten Sie!«, sagte Lucas höhnend.
»Und wenn ich nun ein Mittel wüsste, was würde mir das einbringen?«
»Wir teilen den Gewinn.«
»Topp, es gilt!«
»Narr«, rief Lucas lachend, »wenn du nicht allwissend bist, kannst du nichts machen. Wohin willst du dich zunächst wenden?«
»An keine andere als an die Dame selbst.«
»Element, hast du denn deinen Verstand völlig vertrunken?«, rief Lucas zornig. »Ich habe dir gesagt, dass ich nichts, gar nichts von ihr weiß und dass ich sie auch nicht wiedererkennen würde, selbst wenn ich sie sähe.«
»Das tut alles nichts zur Sache!«, antwortete Sommer mit großer Ruhe.
»Element, bist du denn blödsinnig?«
»Ich wiederhole dir, dass die Dame sich an uns wenden muss.«
»Sommer, du bist reif für das Tollhaus. Wir wollen gehen und das Gespräch abbrechen, ich ärgere mich sonst zu Tode. Wie kann man einen so offenbaren, handgreiflichen Unsinn aussprechen!«
Lucas war aufgestanden; Sommer zog ihn gewaltsam wieder zu sich hernieder.
»Du lässt mich nicht ausreden, Freund; und doch möchte ich mich dir gefällig zeigen, denn du bist wirklich ein guter Kerl, wenn du auch zwei Jahre im Zuchthaus gesessen hast. Also höre, wie ein gescheiter Mensch, ein ehemaliger Advokat, philosophiert. Die Mutter deines Buckligen ist eine vornehme Dame; hieraus schließe ich, dass sie gebildet ist; eine gebildete Dame liest die Journale, wenigstens die besten unserer Zeit. Was meinst du nun, wenn die schlechte Mutter ein Zeitungsblatt in die Hände bekommt, worin eine Anzeige folgenden Inhalts steht: Die wohlbekannte Dame, die einst in einem Dorf bei Karlsbad einer armen Bauersfrau ein Kind übergab, wird aufgefordert, sich an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit einzufinden, da man ihr in Bezug auf das Kind wichtige Eröffnungen zu machen hat. Sollte sie wider Erwarten ausbleiben, so sieht man sich genötigt, ihr die betreffende Mitteilung durch die Zeitungen zukommen zu lassen. Glaubst du mein Bester, dass die Dame sich pünktlich einfindet, wenn sie dies gelesen hat? Oder glaubst du, sie lässt es darauf ankommen, dass wir den Weg der Öffentlichkeit betreten? Sie wird zittern wie ein Blatt im Wind, denn die einfache Erzählung ihrer saubren Geschichte allein genügt, um sie vor aller Welt grässlich zu kompromittieren. Und darauf, dass man sie nicht kennt, wird sie sich ebenfalls nicht verlassen, denn erstens lässt ihr das böse Gewissen keine Ruhe und zweitens muss sie nach den bisher erfolgten Gelderpressungen annehmen, dass du schlau genug gewesen bist, Erkundigungen über sie einzuziehen. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass sie es nicht vorziehen sollte, sich Gewissheit und Ruhe zu verschaffen. Nun, was meinst du?«
»Sommer, das ist der klügste Einfall, den du in deinem ganzen Leben gehabt hast!«, rief Lucas im Ton der Bewunderung und Überraschung »Was du mir da sagst, leuchtet mir vollkommen ein. Hätte jene Frau keine Furcht gehabt, sie wäre sicherlich nicht auf die Brücke in Dresden gekommen. Gott gebe, dass sie noch lebt.«
»Das setze ich voraus!«, rief der Windmüller lachend.
»Sobald unser Juwelengeschäft geordnet ist, beginnen wir mit dieser weniger gefahrvollen Spekulation.«
»Dummer Tropf, warum hast du dich mir nicht früher mitgeteilt, wir konnten längst die Quelle in Fluss gebracht haben.«
»Habe ich denn an die Geschichte gedacht?«, rief Lucas. »Erst heute, als ich mit dem buckligen Menschen den Uhrenhandel abschloß, fiel sie mir wieder ein. Nicht, um ihn zu besuchen, fragte ich nach seinem Namen, sondern weil mich jeder Bucklige interessiert. Nun denke dir meine Überraschung, als er mir den Namen Werner nennt – dies ist nämlich mein wahrer Name; ich habe ihn aber abgelegt, als ich aus dem Zuchthaus kam. Als ich nun außerdem noch hörte, dass er Ludwig heißt und Tapezierer ist, waren alle Zweifel beseitigt. Ich begreife zwar nicht, wie er in diese Gegend gekommen ist, aber ich verwette meinen Kopf darauf, dass ich das Kind der vornehmen Dame gesprochen habe. Element, es kann doch nicht zwei Menschen geben, die Tapezierer sind und hinten und vorn Höcker haben. In einigen Tagen werde ich den Burschen besuchen und es wird sich alles aufklären.«
»Aber sei vorsichtig, Lucas; gib dich nicht gleich zu erkennen.«
»Warum?«
»Forsche zuvor, wie der Bucklige seinem Vater, für den er dich doch halten muss, gesinnt ist. Dann berichte mir, und ich werde dir sagen, was du ferner zu tun hast. Mir scheint, wir dürfen ihm nicht gestatten, einen Blick in unsere Karte zu werfen. Die Entdeckung des Geheimnisses seiner Geburt können wir ihm immer noch machen, wenn du ihn als Sohn nicht mehr brauchst oder wenn wir ihn zum Verbündeten gegen seine unnatürliche Mutter verwenden müssen. Wir wollen so lange wie möglich allein fechten.«
»Begreifst du nun, warum ich dich mit Gewalt aus der Schenke fortriss? Ich wollte, dass du nüchtern wurdest und dass ich dir dann die Geschichte dieses Buckligen erzählen konnte. Doch nun komm und bringe deinen Kindern das Abendessen – die Sonne steht schon hinter dem Wald. Hier ist das Brot und die Wurst, die ich in der Schenke gekauft habe. Diese Nacht bleibe ich bei dir.«
Die beiden Männer brachen auf. Noch einige Zeit ließen sich die Worte ihres eifrigen Gesprächs in dem ruhigen Wald vernehmen, dann war alles still.
Werner glaubte, die Beute eines lebhaften Traumes zu sein. Er richtete sich empor und rieb sich mit beiden Händen die schweißbedeckte Stirn. Das wilde Lachen Sommers, das aus der Entfernung zu ihm herüberscholl, erinnerte ihn daran, dass er nicht geträumt hatte. Vor sich hinstarrend wiederholte er in Gedanken den Inhalt des Gesprächs, das er ohne es zu wollen belauscht hatte. Die Angaben des Lucas stimmten mit den Verhältnissen seines früheren Lebens, deren er sich erinnern konnte, so genau überein, überhaupt stand alles in einem so richtigen Zusammenhang, dass er den Aufschlüssen über seine Geburt und erste Kindheit vollen Glauben schenken musste. Der Gedanke an die Herzlosigkeit seiner Mutter erfüllte ihn mit Schaudern. Und sie war eine vornehme, gebildete Dame. Wie anders erschien ihm die arme kranke Frau, welche die Sorge um ihre Kinder zu Boden drückte.
Hätte sie treulich ihre Mutterpflichten erfüllt, ich wäre heute ein gesunder Mann!, dachte er mit Tränen eines schmerzlichen Zorns im Auge. Und welch eine herrliche Zukunft eröffnete sich mir! Aber ich bin ein unglücklicher Krüppel, der dem Spott preisgegeben ist, wenn er nicht das Mitleid rege macht. Nicht, um sie zu lieben, möchte ich meine Mutter kennenlernen, sondern um sie zu hassen, um ihr meinen verwahrlosten Körper zu zeigen und ihr zu sagen, dass sie das Elend eines Menschen auf dem Gewissen trägt. Und wenn sie alle Schätze der Welt verwenden wollte – sie würde das Vergehen nicht wieder ausgleichen können, dessen sie sich schuldig gemacht. Fast möchte ich wünschen, dass sie jenen Gaunern zum Opfer fällt.
Wie ein Träumender setzte er seinen Weg fort. Nach einer halben Stunde kam er bei der Sägemühle an. Die geschwätzige Müllerin trat ihm unter der Buche entgegen.
»Ei, Herr Werner, Sie kommen heute spät; man hat Sie erwartet.«
»Wo ist Herr Victor?«, fragte er, indem er sich auf der Steinbank niederließ.
»Vor kaum zehn Minuten hat er sein Pferd bestiegen, um zur Stadt zu reiten.«
»Zur Stadt?«
»Gewiss, er ist gerade erst dort oben auf dem Berg verschwunden.«
»Das begreife ich nicht.«
»O ich begreife es!«, sagte die dicke Frau mit einem geheimnisvollen Lächeln.
»Ist etwas vorgefallen?«
»Nein, das nicht; aber der junge Herr glaubte, es habe sich in der Stadt etwas ereignet, weil Sie nicht eintrafen. Mit welcher Ungeduld ist er hier den ganzen Nachmittag auf und ab gegangen; ich konnte mich kaum ein wenig mit ihm unterhalten. Endlich riss ihm die Geduld. ›Nun kommt er nicht mehr; ich will zur Stadt reiten.‹ Dann ließ er sein Pferd kommen und sprengte davon. Wie gesagt, vor kaum zehn Minuten habe ich ihn noch dort oben auf dem Berg gesehen. Einholen können Sie ihn nicht mehr, denn er ritt sehr rasch. Also ruhen Sie aus und erquicken Sie sich; ich habe ganz frische Milch, die Sie so gern essen.«
Werner nahm den Vorschlag an. Bei dem glühenden Schein der untergehenden Sonne nahm er unter der Buche sein Abendessen ein. Gestärkt brach er zur Heimkehr Richtung Stadt auf. In der Annahme, Victor entweder in der Stadt oder unterwegs anzutreffen, behielt er Nathalies Brief. Die Untersuchung der Papiere, die nach den Erlebnissen des Nachmittags keinen großen Reiz mehr für ihn hatten, wollte er abends in seinem Stübchen vornehmen.
Das Abendrot war verschwunden und die Sterne verbreiteten ein liebliches Licht, als er den Park des fürstlichen Lustschlosses erreichte. Die ganze Gegend war still und ruhig; kein Blatt erzitterte an den majestätischen Bäumen und kein Schritt ließ sich auf dem bestaubten Weg vernehmen. Langsam schritt Werner an dem mit Immergrün durchwachsenen Gitter hin. Er dachte an Gretchen und an das Glück, ihr angehören zu dürfen. Aber bei jedem Schritt mahnte ihn die keuchende Brust an seine Gebrechlichkeit und an die Lieblosigkeit seiner Mutter. Seine Aufregung überwand die Müdigkeit; langsam schritt er auf der ebenen Straße fort, bis er nach einer Stunde die Häuser der Vorstadt erreichte. Erschöpft lehnte er sich an den Stamm einer Pappel und sah zu den schweigenden Häusern hinüber. Kein Fenster derselben war mehr erleuchtet.
Hier wohnt sie, dachte er. Ob sie wohl schon zur Ruhe gegangen ist?
Wie eine Antwort auf diese Frage, ließen sich in dem Schatten, den die Häuserreihe warf, leichte Schritte vernehmen. Werner, der unter dem Schutz der Pappel stand, verschärfte die Kraft seiner Augen, und er sah die Gestalt zweier Personen, die langsam die Straße herunterkamen. Nach einigen Augenblicken konnte er erkennen, dass sie sich zärtlich umschlungen hielten, und wieder einige Augenblicke später hörte er ihr leises Geflüster.
Es waren Gretchen und Wolfgang.
Das Herz bebte dem armen Werner bei diesem Anblick; zum ersten Mal sah er das Mädchen, das er liebte, in den Armen des jungen Mannes. Er musste seine ganze Philosophie zu Hilfe nehmen, um dem gewaltigen Eindruck nicht zu erliegen.
»Gretchen, ich kann noch nicht von dir scheiden!«, flüsterte Wolfgang.
»Liebst du mich denn wirklich so?«, fragte sie mit bebender Stimme.
»Du bist mein Alles in dieser Welt!«
Sie verbarg ihr Köpfchen an seiner Brust. Er umschlang sie und drückte sie fest an sich. Schweigend verblieben sie einige Augenblicke in dieser Stellung, als ob sie in der innigen Umarmung die ganze Glut ihrer Leidenschaft aushauchen wollten. Obgleich Werner von Gretchens Liebe zu dem neuen Legationsrat wusste, obgleich er selbst die Annäherung beider bewirkt hatte, um das Mädchen seiner Liebe glücklich zu machen, so erfüllte ihn der Anblick ihrer Zärtlichkeiten mit einem furchtbaren Schmerz.
Und wer trägt die Schuld, dass ich ein armer, elender Krüppel bin?, fragte er sich. Wer trägt die Schuld, dass ich der Neigung meines Herzens nicht folgen kann? Meine Mutter, meine eigene Mutter! Ich kenne sie nicht, denn ihre Herzlosigkeit hat mich in der zartesten Jugend zur Waise gemacht, hat mich den Händen roher, gefühlloser Menschen übergeben; aber ich verachte sie, ich hasse sie sogar! O wie anders wäre es, wenn sie ihre Mutterpflichten treulich erfüllt hätte!
Er legte die Hand auf die Augen, um die hervorquellenden Tränen zurückzuhalten, die warm über seine mageren Wangen rannen.
Das Geflüster der Liebenden begann wieder.
»Bist du müde von dem Spaziergang, liebes Gretchen?«
»O nein, mein lieber Freund!«
»Wahrhaftig nicht?«
»An deiner Seite könnte ich noch die ganze Nacht gehen.«
»Gretchen, du bist ein Engel!«
»Wäre ich es, ich würde stets unsichtbar bei dir sein.«
»Doch nur, um mich zu belauschen?«, fragte er im Ton zärtlichen Scherzes.
»Wolfgang!«
»Um zu sehen, ob ich nicht mit andern Mädchen kose?«
»Sieh, du kennst mich noch nicht!«, flüsterte sie rasch. »Denn sonst müsstest du wissen, dass mir die Eifersucht fremd ist, dass ich dir unbedingt glaube, wenn du sagst: ›Gretchen, du bist mein Alles auf dieser Welt!‹ Würdest du es mir sagen, wenn du anders dächtest und fühltest? Und würde ich dich nicht kränken, wenn ich dich für falsch hielte? Ich habe mich wohl schon unwillkürlich gefragt: Gibt es wohl nicht schönere und reichere Mädchen, die Wolfgang lieben könnte? Dann flüsterte rasch eine Stimme: Warum ist er denn zu dir gekommen und hat dich geküsst? Warum triffst du ihn denn auf allen deinen Wegen? Er wäre sicher zu einer andern gegangen, wenn sie ihm besser gefallen hätte, als ich ihm gefalle.«
»Ach, gewiss, mein liebes Gretchen, mir gefällt keine besser als du!«
In diesem Augenblick ließ sich das Horn des Wächters hören, der langsam an der Häuserreihe herabkam. Gretchen fuhr erschreckt zusammen.
»Ach Gott, nun müssen wir uns trennen!«, flüsterte sie.
»Wer zwingt uns dazu? Ich habe dir noch so viel zu sagen …«
»Heute noch?«
»Gretchen, ich schleiche mich mit in dein Stübchen – man wird mich nicht hören, da alles schläft.«
Sie schwieg.
»Gestattest du es mir?«
»Ach Gott, könnte ich doch immer bei dir bleiben!«
Er küsste hastig ihren Mund. Dann nahm er ihr das Arbeitskörbchen aus der Hand und flüsterte:«
»Öffne leise die Tür!«
Gretchen besann sich nicht lange. Im nächsten Augenblick rasselte leise der Schlüssel im Schloss, die beiden Liebenden verschwanden wie luftige Schatten und die Tür schloss sich, leise in ihren Angeln kreischend. Dann erschien der Wächter, stieß in das Horn und sang mit tiefer Bassstimme sein Lied ab. Zwei Minuten später blitzte ein Licht in Gretchens Zimmer auf und sie erschien am Fenster, um die einfache, leichte Gardine zusammenzuziehen. Werner, der immer noch unbeweglich an dem Stamm der Pappel lehnte, sah in der weißen Gardine die Schatten zweier Köpfe, die sich einander näherten. Dann verschwanden sie – das matte Licht flimmerte fort.
Mit einem tiefen Seufzer verließ Werner seinen Platz und schlich langsam der Stadt entgegen. Bald stand er vor dem Häuschen der Witwe, bei der er schon seit Jahren gegen einen billigen Mietzins wohnte. Er klopfte. Nach einigen Minuten wurde die Tür geöffnet und eine alte Frau erschien, eine brennende Lampe in der Hand haltend. Der kleine Mann überschritt müde und matt die Schwelle.
»Was ist Euch, Werner?«, fragte die Witwe besorgt. »Seid Ihr krank? Mein Gott, Ihr seht ja so bleich und leidend aus!«, fügte sie mit großer Teilnahme hinzu.
»Ich fühle mich ein wenig unwohl, es ist wahr; aber es wird bald vorübergehen!«, hauchte er mit matter Stimme.
Die Witwe schloss die Tür.
»Hat mich niemand gesucht?«, fragte Werner.
»Ja, ein junger vornehmer Herr war vor kaum einer Stunde hier. Als ich ihm sagte, dass Ihr wahrscheinlich spät nach Haus kommen würdet, wie Ihr mir diesen Morgen mitgeteilt habt, äußerte er, dass er morgen früh wiederkommen wolle.«
Werner schleppte sich mühsam die Treppe hinauf in sein Stübchen. Die Witwe war ihm gefolgt. Er bat sie, die Lampe anzuzünden.
»Wollt Ihr denn nicht zu Bett gehen?«, fragte sie verwundert.
»Ich habe noch ein Viertelstündchen zu lesen, liebe Frau«, antwortete der Tapezierer, der erschöpft in einem alten Lehnsessel lag.
»Mein lieber Freund«, sagte die Alte kopfschüttelnd, »Ihr stürmt auf Eure Gesundheit los, als ob sie aus Eisen wäre. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich rate Euch, fangt eine andere Lebensweise an, sonst seid Ihr verloren.«
»Was kann mir, was kann überhaupt der Welt an meinem elenden Leben liegen, an dem Leben eines verkrüppelten Menschen?«, fragte er mit kalter Ruhe. »Will der Himmel mein Ende, nun denn, so mag er mich zu sich nehmen. Die Erde hat keinen Reiz mehr für mich.«
»Werner, was ist Euch denn begegnet? Ihr seid sonst immer so heiter – und heute sprecht Ihr wie ein Mensch, der an allem verzweifelt.«
»Ich danke für Eure Sorge, liebe Frau; aber wollt Ihr mir einen Gefallen erzeigen, so lasst mich jetzt allein.«
Die gute Frau entfernte sich, indem sie vor sich hinflüsterte:
»Das ist ein sonderbarer Mensch! Er ist krank und dennoch will er lesen. Seit er mit dem Dichter Umgang hat, ist er wie umgewandelt. Ich möchte nur wissen, was er so Wichtiges zu lesen hat, dass er sich der so nötigen Ruhe beraubt. Man muss über das gebrechliche Geschöpf wachen, als ob es ein Kind wäre.«
Sie stieg die Treppe hinab und besorgte im Erdgeschoss einige häusliche Geschäfte. Nach einer Viertelstunde betrat sie leise wieder den Flur vor Werners Stübchen.
»Er ist noch nicht zu Bett gegangen, das Licht schimmert durch das Schlüsselloch!«, flüsterte sie. »Das kann ich nicht verantworten; ich muss ihn gewaltsam zur Ruhe treiben. Still, jetzt fängt er an zu reden – vielleicht fantasiert er schon!«
Die neugierige alte Frau legte das Ohr ans Schlüsselloch und lauschte. Da hörte sie Werner deutlich die Worte sprechen:
»Nein, das ist nicht möglich! Aber hier steht es in deutlichen Worten, die ich bereits zweimal gelesen habe! Alles stimmt genau überein – die Oberhofmeisterin ist meine Mutter!«
Die Lauscherin fuhr bestürzt zurück.
Der Mensch ist wahnsinnig geworden, wenn er nicht in Fieberfantasien redet. Jetzt soll die Oberhofmeisterin, die erste Dame in unserer Stadt, seine Mutter sein!
Sie öffnete die Tür und trat rasch in das Stübchen. Werner lag, den Kopf zurückgebogen, in dem Lehnstuhl und hatte die Augen geschlossen. Vor ihm auf dem Tisch lagen Papiere ausgebreitet.
»Werner! Werner!«, rief die alte Frau, in dem sie ihn rüttelte. »Der arme Mensch sieht bleich aus wie eine Leiche – und wie es in der Brust kocht!«
Der kleine Mann schlug langsam die Augen auf und sah seine Wirtin starr an.
»Ihr seid’s, liebe Frau!«, sagte er matt. »Helft mir – ich will mich niederlegen!«
»Ja, Ihr seid wirklich krank, denn Ihr fantasiert ja schon. Was habt Ihr denn mit der Oberhofmeisterin zu schaffen? Ihr sagt, sie wäre Eure Mutter? Bildet Euch doch nicht so tolles Zeug ein!«
»Ja, ja, ich habe fantasiert!«, murmelte Werner, indem er sich mit übermenschlicher Anstrengung erhob und zitternd die Papiere unter das Kopfkissen seines Betts steckte. Mithilfe der sorgsamen Wirtin legte er sich nieder. Er verbrachte die Nacht in einem unruhigen Schlummer. Am nächsten Morgen holte die Witwe den Arzt, der den Zustand des Kranken für bedenklich erklärte. Um Mittag empfing Wolfgang, den der Kranke zu sich bitten lassen hatte, die verhängnisvollen Papiere.
»Lesen Sie!«, sagte er; »sobald ich kann, gebe ich Ihnen weitere Aufschlüsse!«
Zweites Kapitel