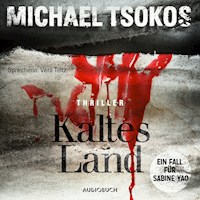12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner und Bestsellerautor Michael Tsokos hat es täglich mit Toten zu tun, die auf spektakuläre Weise ums Leben gekommen sind. Die hier erzählten Todesfälle dienen als Grundlage einer großen SAT.1-Produktion, die unter dem Titel »Dem Tod auf der Spur — Die Fälle des Prof. Tsokos« ausgestrahlt wird. Darin zeigt uns Michael Tsokos, wie faszinierend die Rechtsmedizin ist und dass die Wirklichkeit spannender sein kann als jeder Krimi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Buch
Nahezu täglich hat Professor Dr. Michael Tsokos es mit Toten zu tun, die auf spektakuläre Weise ums Leben gekommen sind – und die Frage aufwerfen: War es Suizid, war es ein Unfall oder war es Mord? In seinem zweiten Buch schildert Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner neue unglaubliche Fälle, die allesamt von ihm selbst untersucht wurden: Ein toter Junge um geben von Kerzen und selbstgemachten Plakaten. Eine Frau mit ausgestochenen Augen. Ein Ehepaar, das tot, aber ohne äußere Verletzungen in der heimischen Wohnung liegt. Hochinformativ und sagenhaft spannend!
»Nach der Lektüre hat man so viel gelernt, dass man beim nächsten Krimi einen Vorsprung vor den Ermittlern hat.«
Brigitte über Dem Tod auf der Spur
Der Autor
Prof. Dr. Michael Tsokos, Jahrgang 1967, leitet das Institut für Rechtsmedizin der Charité und das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin. Als Mitglied der Identifizierungskommission des Bundeskriminalamtes war er an zahlreichen gerichtsmedizinischen Projekten im In- und Ausland beteiligt, u.a. 1998 in Bosnien. Für seinen Einsatz als einer der ersten deutschen Rechtsmediziner bei der Identifizierung deutscher Tsunami-Opfer in Thailand erhielten er und das deutsche Team 2005 den Medienpreis Bambi. Michael Tsokos wurde für seine wissenschaftlichen Leistungen mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Sein erstes Buch, Dem Tod auf der Spur, war wochenlang auf der Bestsellerliste von Spiegel Online.
Von Michael Tsokos ist in unserem Hause bereits erschienen:
Dem Tod auf der Spur. Dreizehn spektakuläre Fälle aus der Rechtsmedizin
Michael Tsokos
unter Mitarbeit von Lothar Strüh
DER TOTENLESER
Neue unglaubliche Fälleaus derRechtsmedizin
Ullstein
Die in diesem Buch geschilderten Fälle aus der Rechtsmedizin entsprechen allesamt den Tatsachen. Alle Namen der genannten Personen und Orte des Geschehens wurden anonymisiert. Etwaige Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten wären rein zufällig. Außerdem sind alle Dialoge und Äußerungen Dritter nicht wortgetreu zitiert, sondern ihrem Sinn und Inhalt nach wiedergegeben.
Besuchen Sie uns im Internet: www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Oktober 2010
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010Umschlaggestaltung: HildenDesign, MünchenUmschlagfoto: Andreas Franke – pb (zeit für den augenblick)®
Satz: KompetenzCenter
eBook: LVD GmbH, Berlin
ISBN 978-3-548-92036-8
Für Linnea, Lucius, Julius, Titus und Anja
Inhalt
Zur Einführung: Was Sie erwartet
9
Rätselhafte Verfolger
13
Lebensgefährliche Trennung
37
Explosive Leidenschaft
55
Ersponnene Präzision
80
Tödliche Lust
92
Grausiges Geheimnis
111
Gewichtige Bergung
141
Für immer vereint
151
Im Griff des Vulkaniers
168
Giftige Leichen
195
Zu klein fürs menschliche Auge
203
Mörderischer Frust
215
Zum Abschluss: Was ich erreichen möchte
244
Danksagung
250
Zur Einführung: Was Sie erwartet
Vor nicht allzu langer Zeit ergab eine psychologische Studie, dass Menschen instinktiv weniger lächeln, wenn sie wissen, dass ihr zufälliges Gegenüber ein Zahnarzt ist. Und zwar nicht, weil Frauen wie Männern bei dem Gedanken an frühere schmerzhafte Erlebnisse beim Zahnarzt das Lachen vergeht, sondern weil sie unbewusst versuchen, ihre Zähne zu verbergen – aus Angst, dem Zahnarzt würden mangelnde Zahnpflege oder Zahnfehlstellungen auffallen.
Was würde wohl eine solche psychologische Studie darüber ergeben, wie sich Menschen verhalten, wenn sich ihr Gegenüber im Zug, an der Bushaltestelle oder auf einer Party als Rechtsmediziner entpuppt? Hätten sie Angst, dass wir Rechtsmediziner schon vom äußeren Anblick in ihnen lesen könnten wie in einem offenen Buch? Dass wir an der scheinbar intakten Körperoberfläche eine fortgeschrittene Arteriosklerose oder das allmähliche Verkalken der Herzkranzgefäße erkennen? Oder vielleicht können wir ja auch an ihren Augen Anzeichen für eine geschädigte Leber finden und damit ihrem übermäßigen Alkoholgenuss auf die Schliche kommen?
Bisher gibt es keine Studie über das menschliche Verhalten im Angesicht eines Rechtsmediziners. Würde es sie geben, wäre das Ergebnis aber wahrscheinlich, dass derjenige, der sich unvermittelt einem Vertreter dieser Berufsgruppe gegenübersieht, den Drang verspürt, ihr oder ihm ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen. Dass wir für den Rest der Bevölkerung eine recht exotische Spezies zu sein scheinen, zeigen allein die Fragen, die mir von Privatpersonen oder bei Interviews mit schöner Regelmäßigkeit gestellt werden: »Wie hält man das nur aus?« »Hat Ihre Berufswahl mit Lust an menschlichen Abgründen zu tun?« »Wie hat Ihr Beruf Ihre Sicht auf die Menschen und die Gesellschaft verändert?« »Glauben Sie trotz der furchtbaren Dinge, die Sie sehen, noch an Gott?«
Was meine Berufswahl und die tägliche Beschäftigung mit dem Tod anbelangt, kann ich Ihnen versichern, dass ich als Rechtsmediziner das, was ich von der Gesellschaft sehe, und die vielen Facetten, in denen der Tod unsere Mitmenschen ereilt, nicht als abgründig empfinde. Ebenso wenig umgeben wir Rechtsmediziner uns mit den Schattenseiten des Lebens, um mit unserer eigenen Existenz klarzukommen. Ich übe diesen Beruf deshalb aus, weil ich mir schlicht keine faszinierendere Tätigkeit vorstellen kann, obwohl ich natürlich nicht weiß, wie ich mich als Internist oder Bauchchirurg fühlen würde. Und allen Kollegen, mit denen ich schon gearbeitet oder gesprochen habe, geht es genauso. Was uns antreibt, ist eine Mischung aus Neugier und dem Wunsch, durch die Aufdeckung der Todesursache einen wichtigen Beitrag zu leisten – sei es zur Aufklärung eines Verbrechens oder um Angehörigen die Ungewissheit zu nehmen.
Trotzdem ist meine Arbeit manchmal ganz und gar kein Vergnügen. Am wenigsten dann, wenn die Unschuldigsten unter uns zu Opfern geworden sind. Jedes unglücklich aus einem Fenster zu Tode gestürzte Kind, jedes Kind, das seine Neugier am Wasser mit dem Tod durch Ertrinken bezahlt hat, weil kein Erwachsener sich in diesem Moment für dessen Beaufsichtigung verantwortlich fühlte, und erst recht jedes kindliche Opfer eines Gewaltverbrechens schlägt mir aufs Gemüt. Da wird es dann auch schon mal schwer, abends abzuschalten und sich mit Freude dem Privatleben zu widmen.
Auch diesen Teil meiner Arbeit erspare ich Ihnen in diesem Buch nicht. In vier Kapiteln geht es um Fälle, in denen Kinder auf meinem Obduktionstisch lagen. Aber hier wie in allen anderen Kapiteln gilt: Auch wenn ich auf grausame Details zu sprechen kommen muss, damit Sie jeweils verstehen, was vorgefallen ist, sind Sie vor Blut- oder Schockeffekten aller Art in Sicherheit.
Bereits im Schlusswort zu meinem ersten Buch Dem Tod auf der Spur habe ich betont, dass die beschriebenen Fälle nur insofern spektakulär sind, »als sie in zugespitzter Weise Phänomene unserer Gesellschaft beleuchten«. Das gilt auch wieder für die folgenden Kapitel. Dabei erzähle ich diesmal noch ausführlicher die Geschichte hinter den jeweiligen Fällen, wodurch der Kontext stärker beleuchtet wird. Und ich versuche Ihnen ein Bild davon zu vermitteln, wie die rechtsmedizinische Untersuchung in das Räderwerk der anderen Ermittlungen eingebettet ist. Unter anderem in einigen kürzeren Kapiteln, die an konkreten Beispielen zentrale und immer wiederkehrende Aspekte der rechtsmedizinischen Arbeit beschreiben. Keine Angst, doziert wird nicht, und vielleicht dienen Ihnen die Anekdoten aus meinem Arbeitsalltag auch als Erholungspausen. Denn dass Ihnen nicht die eine oder andere Geschichte an die Nieren geht, kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber wenn Sie von allem Grausamen und Traurigen verschont werden wollten, hätten Sie wohl kaum zu diesem Buch gegriffen.
Michael Tsokos im Sommer 2010
Rätselhafte Verfolger
Es war Spätsommer, als im Binnenhafen einer norddeutschen Stadt die Leiche eines Mannes aus dem Wasser gezogen wurde. Ein Hafenarbeiter hatte der Polizei gemeldet, dass eine leblose Person ungefähr fünf Meter von der Hafenböschung entfernt im Wasser trieb. Als die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei den Mann herausgezogen hatten, brachen sie noch vom Boot aus per Funk den eingeleiteten Notarzteinsatz ab. Hier wäre jegliche ärztliche Hilfe zu spät gekommen, denn schon ein erster oberflächlicher Blick zeigte, dass längst die Leichenfäulnis eingesetzt hatte.
Die Beamten der Wasserschutzpolizei legten den Toten auf das Deck des Bootes. Er trug Jeans und eine per Reißverschluss geschlossene Windjacke, darunter ein T-Shirt. Der linke Fuß steckte lediglich in einer schwarzen Tennissocke, der rechte Fuß war nackt.
Die Beamten machten sich daran, die völlig durchnässte und verschmutzte Kleidung des Toten auf Ausweispapiere oder andere Identitätshinweise zu durch suchen. In der Innentasche der Jacke wurden sie fündig: Neben ein paar völlig aufgeweichten Geldscheinen fand sich dort ein Personalausweis, ausgestellt auf den Namen Holger Wehnert, achtundzwanzig Jahre alt, wohnhaft in einer Kleinstadt nur wenige Kilometer von dem Binnenhafen entfernt. Das Alter von achtundzwanzig Jahren mochte zwar zu dem Toten passen, die Gesichtszüge der Wasserleiche aber waren aufgrund der fortgeschrittenen Leichenfäulnis nicht mehr zu erkennen. Damit schied ein Vergleich mit dem Foto auf dem Personalausweis aus. Die Beamten gaben die Personalien Wehnerts an die Einsatzzentrale weiter, damit von dort aus überprüft werden konnte, ob diese Person vielleicht bereits »polizeilich in Erscheinung getreten« war. Im Klartext: ob ihn jemand als vermisst gemeldet hatte oder Vorstrafen oder gar ein aktueller Haftbefehl gegen ihn vorlagen.
Als die Wasserschutzpolizisten den Toten nun genauer untersuchten, entdeckten sie schlitzförmige Stoffdefekte im Brustbereich des T-Shirts. Also schob einer der Beamten das T-Shirt des Mannes hoch: Der Mann hatte mehrere Stichverletzungen in der Brust. Damit war der Tote im Hafen ein Fall für die Mordkommission …
Zwei Stunden später wurde der Tote im Institut für Rechtsmedizin eingeliefert, wo bereits die zuständige Staatsanwältin und die zwei mit diesem Fall betrauten Beamten der diensthabenden Mordkommission anwesend waren sowie ein Fotograf der Spurensicherung. Bei Opfern von potentiellen Tötungsdelikten ist in der Regel ein Vertreter der Staatsanwaltschaft bei der Obduktion anwesend. Nach der Strafprozessordnung (StPO) liegt es zwar im persönlichen Ermessen des zuständigen Staatsanwalts (oder der Staatsanwältin), an einer Obduktion teilzunehmen, in Berlin ist dies jedoch immer der Fall, wenn der Verdacht auf ein Tötungsdelikt im Raum steht. Außerdem besucht er oder sie auch noch vorher den Tatort beziehungsweise Leichenfundort, um sich selbst ein Bild zu machen, statt sich auf Berichte und Fotos zu verlassen.
Auf jeden Fall sind bei der Obduktion die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei anwesend, weil der Informationsaustausch so deutlich einfacher ist. Beispiels weise kann der Obduzent dem anwesenden Kommissar relevante Details gleich am Leichnam demonstrieren.
Bei der äußeren Leichenschau konnte ich vor allem präzisieren, was auch die Wasserschutzpolizisten schon gesehen hatten: Die vier leicht schräg gestellten, zwischen 1,2 und 1,8 Zentimeter langen Stoffdefekte in Jacke und T-Shirt korrespondierten wie zu erwarten mit vier Stichverletzungen in der Brust des Mannes. Da der Tote sich in dieser Bekleidung längere Zeit im Wasser befunden hatte, war es nicht weiter verwunderlich, dass die entsprechenden Kleidungsstücke keine Blutflecken aufwiesen. Der Stoff war jeweils glatt durchtrennt und nicht etwa an den Rändern gerissen, was für ein scharfes Messer als mutmaßliche Tatwaffe sprach. Ansonsten gab es keine Anzeichen für Schnitte oder Stiche, weder an der Oberbekleidung des Toten noch an seiner Jeans. An dem im Wasser ausgeblichenen schwarzen Kunstledergürtel hing eine Messergürteltasche aus Leder. Ein dazugehöriges Messer gab es nicht.
Während der Leichenschau erhielt einer der anwesenden Ermittler den Anruf eines Kollegen, der wichtige neue Informationen hatte:
Alfred Wehnert, der Vater von Holger Wehnert, hatte elf Tage zuvor bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Dabei hatte er unter anderem erzählt, dass sich sein Sohn in den letzten Wochen vor seinem Verschwinden sehr eigenartig und völlig anders als sonst verhalten habe: Holger Wehnert rief seinen Vater in dieser Zeit einige Dutzend Male an, manchmal auch mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden und behauptete immer wieder und »in wirren Sätzen«, dass verschiedene Personen ihn unablässig beobachten und verfolgen würden. Sein Vater hatte ihm anfangs geraten, zur Polizei zu gehen, doch das lehnte Holger Wehnert strikt ab. Seine Anrufe wurden von Mal zu Mal bizarrer, bis er irgendwann die Vermutung äußerte, bei seinen Verfolgern könnte es sich um Agenten eines ausländischen Geheimdienstes handeln, die ihn rekrutieren und im Falle seiner Weigerung ganz sicher töten wollten. Daraufhin riet sein Vater ihm dringend, einen Nervenarzt aufzu suchen. Kurz darauf rissen die befremdlichen Anrufe seines Sohnes so unvermittelt ab, wie sie begonnen hatten.
Bevor Alfred Wehnert seinen Sohn schließlich bei der Polizei als vermisst meldete, hatte er noch drei Tage lang vergeblich versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Doch konnte er ihn weder telefonisch erreichen, noch traf er ihn in seiner Wohnung an. Auch in dem Tonstudio, in dem Holger Wehnert als Tontechniker arbeitete, wusste keiner der Kollegen etwas über seinen möglichen Verbleib – er war seit über einer Woche nicht mehr zur Arbeit erschienen. Das alles hörte sich einigermaßen undurchsichtig an, und weder die Ermittler noch ich wussten so recht, was wir von der Geschichte halten sollten.
Immerhin hatte der Vater bei der Vermisstenanzeige zwei wertvolle Hinweise gegeben, an denen wir überprüfen konnten, ob es sich tatsächlich um seinen Sohn handelte. Holger Wehnert besaß zwei auffällige körper liche Merkmale: einen in seine rechte Leistengegend tätowierten blauen Delphin und eine dritte Brustwarze unter seiner eigentlichen linken Brustwarze.
Der von Christopher Lee gespielte Auftragskiller und Bond-Gegenspieler Scaramanga tritt nicht nur dadurch hervor, dass er seine Opfer mit einer goldenen Pistolenkugel aus einer goldenen Pistole erschießt, sondern er hat auch eine akzessorische Mamille. Diesen Umstand nutzt Roger Moore alias James Bond aus, indem er sich ein Plastikimitat dieser zusätzlichen Brustwarze auf die Brust klebt und sich so als Scaramanga ausgibt.
Bei unserem Toten war die dritte Brustwarze allerdings echt, es handelte sich also zweifelsfrei um Holger Wehnert, zumal auch das Tattoo vorhanden war. Ohne den entsprechenden Hinweis hätte man bei der Leichenfäulnis des Toten diese akzessorische Mamille allerdings auch für einen kleinen, die Hautoberfläche etwas überragenden Leberfleck halten können.
Nachdem nun auch die Identität eindeutig geklärt war, begannen wir mit der eigentlichen Obduktion.
Wasserleichen sind wirklich kein schöner Anblick, und der vor mir auf dem Obduktionstisch liegende Holger Wehnert machte hierbei keine Ausnahme. Ganze Flächen seiner Haut waren graugrün verfärbt, teilweise hatten sich Hautpartien abgelöst und hingen am Körper wie dünne, dunkle Flickenteppiche. An der Haut von Händen, Füßen und Ohren, aber auch über den Knien und Ellenbogengelenken hatte sich »Waschhaut« gebildet, die jeder – allerdings in deutlich abgeschwächter Form – aus eigener Erfahrung kennt, wenn er sich mal längere Zeit in der Badewanne, dem Schwimmbad oder im Meer aufgehalten hat. Waschhaut entsteht dadurch, dass die oberste Hautschicht, die aus abgestorbenen Hautzellen bestehende Hornhaut, aufquillt und sich daher leicht mit Wasser vollsaugt. An den Körperstellen, an denen die Hornhautschicht am dicksten ist, also an den Fußsohlen und den Innenseiten der Fingerspitzen, bildet sie sich zuerst. Nach frühestens einem Tag »Wasserliegezeit« ist die Hornschicht der gesamten Handinnenfläche und Fußsohlen in Waschhaut umgewandelt und kreideweiß verfärbt. Erst nach vielen Tagen im Wasser breitet sie sich auch auf die Streckseite der Hände und Füße aus. Üblicherweise erst nach Wochen, in sehr warmem Wasser allerdings schon nach ein paar Tagen (zum Beispiel, wenn der Tote in einer Badewanne liegt, in die über den laufenden Wasserhahn ständig warmes Wasser nachfließt), löst sich die gesamte Haut der Finger- und Zehenspitzen einschließlich der Nägel ab. Ein solcher Anblick bringt auch hartgesottene Todesermittler manchmal dazu, den Obduktionssaal für ein paar Minuten zu verlassen, um frische Luft zu schnappen.
An den Handinnenflächen unseres Toten zeigte sich zusätzlich ein dünner, glitschig-grüner Algenfilm – »wie bei einem Korallenriff«, staunte einer der Mordermittler und wollte wissen, wie lange der Mann dafür im Wasser gelegen haben musste. Diese Frage war nur schwer zu beantworten. Denn weder Leichenfäulnis, Waschhautbildung noch die Besiedlung von Wasserleichen durch Algen oder andere marine Flora folgen nachvollziehbaren Gesetzmäßigkeiten. Mehrere Tage musste er allerdings im Wasser gelegen haben, sonst hätte man den Algenbewuchs nicht mit bloßem Auge erkennen können.
Die graugrüne Brust- und Bauchhaut des Toten sah aus, als hätte ein Laie mit unruhiger Hand ein braunschwarzes Spinnennetz darauf tätowiert. Dieses Artefakt aber war keine Tätowierung, sondern durch die fort geschrittene Leichenfäulnis hervorgerufen. Hier zeichneten sich die unter der Haut gelegenen Blutgefäße ab, in denen sich, wie im gesamten Körper, der rote Blutfarbstoff während des Fäulnisprozesses dunkel verfärbt.
Der größte Teil der Kopfhaare war nicht mehr vorhanden, was daran lag, dass sich beim Aufquellen die Struktur der Kopfhaut lockert und die Kopfhaare nach einiger Zeit ausfallen.
An der Innenseite des linken Handgelenks fanden wir vier Schnittverletzungen, die bis zu fünf Zentimetern lang, aber nicht sehr tief waren. Das war eine überraschende Entdeckung, die für die Beurteilung der Todesumstände von zentraler Bedeutung sein konnte. Denn solche oberfläch lichen Verletzungen am Handgelenk sind oft Hinweis auf einen Suizid: Bevor sich jemand beispielsweise die Pulsadern aufschneidet, ritzt er sich zunächst nur vorsichtig die Haut. Einen Beweis, dass es sich hier um derartige »Probierschnitte« handelte, hatten wir aber nicht, die Mordtheorie war damit also noch keineswegs widerlegt.
Auf der Suche nach weiteren rechtsmedizinischen Hinweisen wandte ich mich den Stichverletzungen in der Brust zu. Die vier Einstiche lagen jeweils nicht weiter als zwei Zentimeter voneinander entfernt und verliefen leicht schräg zur Körperlängsachse. Trotz der Leichenfäulnis war an den Rändern der Wunden noch gut zu erkennen, dass auch Haut und Unterhautfettgewebe »glatt«, also mit einem scharfen Werkzeug wie einem Messer, durchtrennt worden waren.
Ich öffnete die Brust- und Bauchhöhle und suchte als Erstes nach Hinweisen auf die Tiefe der Stiche. Anders als in der Haut und im Gewebe darunter zeigten sich im Brustbein nur zwei Stichverletzungen. Die zwei oberen waren demnach nur oberflächlich. Die Wucht der unteren Bruststiche dagegen musste gewaltig gewesen sein, da das Brustbein hier jeweils durchbohrt war. Im Gegensatz zu den Schnitten am Handgelenk sahen diese Stichverletzungen wieder eher nach Fremdeinwirkung aus. Wer sticht sich selbst mit solcher Brutalität in die Brust?
»Also doch Mord?«, fragte einer der Ermittler.
Diese Frage ließ sich im weiteren Verlauf der Obduktion eindeutig beantworten:
Abgesehen von den oben näher beschriebenen Stich-und Schnittverletzungen, gab es keinerlei Zeichen äußerer Gewalteinwirkung. Wäre Holger Wehnert erstochen worden, hätten wir Abwehrverletzungen finden müssen – Stiche oder zumindest Schnitte oder Kratzer an den Armen, die entstehen, während der Angegriffene sich zu schützen versucht.
Ebenfalls für einen Suizid sprachen neben den Probierschnitten am linken Handgelenk die Anordnung der Bruststiche: parallel und für die eigene Hand gut erreichbar; auch der Verlauf der Stichkanäle passte zu der Armbewegung und zu der Achsstellung des Messers, wie sie beim Selbst-Zustechen zu erwarten sind – vorausgesetzt, Holger Wehnert war Rechtshänder.
Als Todesursache konnten wir »ein inneres Verbluten durch Herz- und Lungenstich« festhalten. Sowohl die Herzstichverletzung als auch der Stich in die rechte Brusthöhle mit Verletzung der rechten Lunge waren geeignet, den Tod innerhalb kürzester Zeit herbeizuführen. Holger Wehnert konnte die Verletzungen bestenfalls wenige Minuten überlebt haben. Allerdings war nicht auszuschließen, dass er, unmittelbar nachdem er sich die Stichverletzungen selbst zugefügt hatte, ins Wasser gestürzt und dort ertrunken war, bevor die Stiche ihn ge tötet hätten. Das hatte aber auch keine Relevanz für die weiteren Ermittlungen.
Relevant war das zentrale Obduktionsresultat: Es war Suizid, kein Mord.
Nachdem ich die Obduktion von Holger Wehnert beendet hatte, diskutierte ich den Fall mit der anwesenden Staatsanwältin und den beiden Beamten der Mordkommission. Währenddessen wog eine Sektionsassistentin die einzelnen Organe, trug die Gewichte in ein Protokoll blatt ein und ließ die Organe danach in der geöffneten Brust- und Bauchhöhle des Leichnams verschwinden, um diesen später mit einer Naht zu verschließen.
Wir waren uns einig, dass es sehr gut möglich war, dass die Tatwaffe aus dem leeren Messertäschchen an Wehnerts Gürtel stammte, aber das zu beweisen würde wohl nicht mehr möglich sein. Das Hafengelände abzusuchen oder gar im Hafenbecken von Polizeitauchern danach suchen zu lassen erschien aussichtslos. Da es sich nach dem Ergebnis der Obduktion um einen Suizid handelte, interessierte die Ermittler auch weniger die Tatwaffe als das eigentliche Motiv für diesen so extrem brutal ausgeführten Freitod.
Dass sich Wehnert die Schnittverletzungen am Handgelenk selbst zugefügt haben musste, war aufgrund ihrer Beschaffenheit für alle Beteiligten leicht nachzuvollziehen. Einem sich wehrenden Opfer gegen seinen Willen mehrere Schnittverletzungen in solch einheitlicher Anordnung und in der gleichen Tiefe – also mit derselben Intensität und Kraft – beizubringen ist nicht möglich.
Schwerer zu akzeptieren waren die Stichverletzungen in der Brust. Einer der Kommissare fragte dann auch, ob es denn überhaupt möglich sei, dass sich ein Mensch viermal ein Messer in die Brust rammt, zweimal davon mit so großer Wucht wie hier. Für jemanden, der nicht ständig mit außergewöhnlichen Todesarten und -umständen zu tun hat, ist ein derart brutales Vorgehen kaum vorstellbar. Fakt ist aber, dass wir bei Suiziden noch ganz andere Folgen von Gewaltexzessen gegen den eigenen Körper zu sehen bekommen. Mehrfach haben wir in den letzten Jahren in der Berliner Rechtsmedizin Suizidenten untersucht, die sich selbst zehnmal oder öfter tief in die Kehle geschnitten hatten, bis diese schließlich durchtrennt war, oder sich mehrfach in Kopf und Brust schossen, weil die ersten Schüsse nicht tödlich waren – jedenfalls nicht sofort. Natürlich besteht in allen diesen Fällen zunächst immer der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, und nur eine Obduktion kann letztlich Klarheit bringen, was geschehen ist.
Trotzdem stellt sich natürlich immer die Frage: War um tötet sich jemand auf derart brutale Weise? Gab es in unserem Fall einen direkten Zusammenhang zu dem, was Holger Wehnert seinem Vater am Telefon erzählt hatte?
»Ich habe mal gehört, dass Suizidenten oft ihre Brust entblößen, wenn sie sich in die Brust schießen«, sagte einer der Kommissare. »Ist das bei Messerstichen nicht auch so?« Tatsächlich steht es so in vielen Lehrbüchern der Rechtsmedizin und Kriminalistik, aber in der Praxis gibt es immer wieder Ausnahmen von dieser Regel. Und welcher Suizident hält sich in seinem verzweifelten und oft verwirrten Zustand schon an irgendwelche Lehrbuchregeln?
Gibt es wirklich keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, entfällt normalerweise die Notwendigkeit weiterer Ermittlungen. Allenfalls werden noch offene Fragen geklärt. Wegen Wehnerts Angaben seinem Vater gegenüber gab es in diesem Fall allerdings noch Klärungsbedarf. Auch wenn es so schien, als hätten die vermeintlichen Verfolger nur in seinem Kopf existiert, musste seinen Behauptungen doch nachgegangen werden.
Zunächst sollten die Ermittler den Vater und weitere Zeugen aus dem unmittelbaren privaten und beruflichen Umfeld von Holger Wehnert befragen. Sobald das Ergebnis unserer chemisch-toxikologischen Untersuchungen vorlag, würde man entscheiden, ob das Todesermittlungsverfahren eingestellt werden konnte.
Vier Tage nach der Obduktion rief mich einer der beiden Kommissare an, um über den Stand der Ermittlungen zu berichten. Holger Wehnert war tatsächlich Rechtshänder gewesen, woran ich nach der Obduktion aber auch keine Zweifel gehegt hatte.
Noch am Tag der Obduktion hatten die Beamten den Vater aufgesucht und ihm die Nachricht vom Tod seines Sohnes überbracht. Alfred Wehnert hatte zwar recht gefasst reagiert, an einen Suizid seines Sohnes wollte er jedoch nicht glauben. Abgesehen von den letzten Wochen vor seinem Verschwinden sei er immer »ein sehr fröhlicher Mensch« gewesen. Auf einen möglichen Drogenkonsum seines Sohnes angesprochen, erzählte der Vater freimütig, sein Sohn habe gelegentlich Cannabis konsumiert, sich aber nie auf Härteres eingelassen.
Und dann erzählte er den Beamten noch von einem ungewöhnlichen Telefonanruf: Einen Tag vor dem Verschwinden seines Sohnes habe ihn jemand auf dem Handy angerufen – mit unterdrückter Nummer wie auch sein Sohn immer. Am anderen Ende der Leitung habe eine männliche Stimme »seltsam und unverständlich gebrabbelt, wie wenn einer den Mund voll hat oder kaut«. Obwohl sich die Stimme nicht wirklich erkennen ließ, hegte Alfred Wehnert schon zum damaligen Zeitpunkt keine Zweifel, dass dies ein Lebenszeichen von seinem Sohn war – das letzte, wie sich dann bald herausstellen sollte.
Dass Alfred Wehnert mit seiner Vermutung recht hatte, wurde klar, als er den Kriminalbeamten ein weiteres Detail verriet: »Im Hintergrund habe ich Geräusche gehört – so wie das Tuten von Schiffen.«
Die Befragung der Arbeitskollegen förderte weitere Puzzleteile zutage: Sechs Wochen vor seinem plötzlichen Verschwinden hatte Wehnert auf einer Technoparty als Bühnentechniker gearbeitet. Einer Kollegin erzählte er später, dass ihm bei dieser Veranstaltung ein Konzertbesucher ein Trinkhorn gereicht hatte. Aus dem habe er einen »seltsamen Met« getrunken, und seitdem gehe es ihm »total beschissen«. Eines Abends rief er plötzlich bei ihr zu Hause an und sagte: »Ich glaube, die sind hinter mir her.« Wen er mit »die« meinte, habe er ihr nicht sagen wollen, sondern stattdessen abrupt aufgelegt.
Obwohl ihr das merkwürdig vorgekommen war, dachte sie nicht weiter darüber nach und reiste am nächsten Tag für eine knapp siebenwöchige Konzerttournee ab.
Seitdem hatte sie Wehnert nicht mehr gesehen oder gesprochen.
Ein anderer Arbeitskollege hatte Wehnert eines Abends nach der Arbeit in seinem Auto mit nach Hause genommen. Unvermittelt fing Holger Wehnert während der Fahrt an, auf vorbeifahrende Autos zu zeigen und zu behaupten, dass darin Leute säßen, die ihn töten wollten. Zudem erklärte er, dass die scheinbar normalen Blink-und Bremslichter der vor ihnen fahrenden Wagen in Wirklichkeit an ihn gerichtete »Geheimsignale« seien. Dem Kollegen wurde Wehnerts Verhalten bald zu bunt, weshalb er ihn kurzerhand aus seinem Auto warf. Das bereute er allerdings zum Zeitpunkt seiner Befragung sichtlich, wie mir der Beamte am Telefon berichtete.
Auch die Freunde von Wehnert erzählten, dass er sich in den letzten Wochen vor seinem Tode zunehmend verändert hatte. Aus der vorher eher gepflegten Erscheinung sei innerhalb kürzester Zeit nur noch »ein Schatten seiner selbst« geworden. »Er schien völlig neben sich zu stehen«, formulierte es eine Freundin. An gemeinsamen Abenden habe er völlig gehetzt gewirkt, sei immer wieder aufgestanden und habe, versteckt hinter den Gardinen, aus den Fensterscheiben hinaus auf die Straße gesehen und unzusammenhängendes Zeug gemurmelt. Manchmal sei er plötzlich aufgesprungen und habe das Licht im Zimmer gelöscht, um es nach einigen Minuten wieder anzuschalten. Sein Verhalten war ihr unheimlich, und sie wurde das Gefühl nicht los, dass Holger Wehnert sich auf irgendetwas eingelassen hatte, gegen das er sich nicht wehren konnte und das ihn jetzt einholen würde. Und damit sollte sie recht behalten …
Die Erklärung, nach der wir suchten, kam am darauffolgenden Tag aus unserem toxikologischen Labor, allerdings nicht durch die chemisch-toxikologischen Analysen von Blut, Urin, Mageninhalt und Lebergewebe, denn dort war das Resultat überall negativ. Das bedeutete, dass Holger Wehnert zum Zeitpunkt seines Todes nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen gestanden hatte. Den entscheidenden Hinweis und letztlich auch die Lösung des Rätsels, warum er sich in den letzten Wochen vor seinem Tode völlig paranoid verhalten und unter Wahnvorstellungen gelitten hatte, lieferte uns die Analyse seiner Kopfhaare: Holger Wehnert hatte etwa sechs bis sieben Wochen vor seinem Tode Lysergsäurediethylamid konsumiert – kurz: LSD.
Haare sind wie ein Archiv. In ihnen lagern sich die Abbauprodukte von Drogen ab, so dass deren Konsum noch Monate, wenn nicht Jahre später nachweisbar ist. In Blut und Urin finden sich Drogen und ihre Spuren dagegen höchstens noch achtundvierzig Stunden, weshalb sich mit entsprechenden Proben ein länger zurückliegender Drogenkonsum nicht feststellen lässt.
Kopfhaare wachsen etwa einen Zentimeter pro Monat. Entsprechend zeigt uns die Länge der Haare, wann der Betreffende welche Substanzen zu sich genommen hat. Hat jemand zum Beispiel sechs Zentimeter lange Kopfhaare, können wir sehr präzise sagen, wie oft und wann genau er welche Droge in den letzten sechs Monaten vor der Untersuchung konsumiert hat. Man kann so auch Aussagen von Beschuldigten überprüfen, die zum Beispiel angeben, in den letzten drei Monaten »clean« gewesen zu sein. Sagen sie die Wahrheit, werden wir in den ersten drei Zentimetern (von der Haarwurzel an) keine Spuren von Drogen finden.
In den meisten Fällen wird die Haaranalyse eingesetzt, um einen chronischen, also regelmäßig und über einen längeren Zeitraum stattgefundenen Drogenkonsum nachzuweisen. Doch hat sich die toxikologische Forschung in den letzten Jahren so rasant entwickelt, und die Analysemethoden sind so ausgefeilt geworden, dass auch ein viele Wochen oder Monate zurückliegender einmaliger Konsum einer Droge oder eines Medikamentes noch nachgewiesen werden kann. Diese Möglichkeit findet zunehmend Anwendung zum Nachweis von K.-o.-Tropfen bei Sexualstraftaten, also verschiedener Schlaf-und Beruhigungsmittel, mit denen Opfer betäubt und damit wehrlos gemacht werden.
Mittels Haaranalyse lassen sich nicht nur illegale Drogen wie Heroin, Kokain, Tetrahydrocannabinol (der Wirk stoff von Cannabis), LSD, Ecstasy oder andere synthetisch hergestellte Drogen (»Designerdrogen«) nachweisen, sondern auch Medikamente. Wenn beispielsweise bei einem Psychiatriepatienten das verschriebene Psychopharmakon nicht anschlägt, kann per Haaranalyse überprüft werden, ob er das Medikament überhaupt regelmäßig eingenommen hat oder die Einnahme nur vorgibt.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Haaranalyse sind fast unbegrenzt. Davon profitiert beispielsweise die Arbeitsmedizin (etwa unter der Fragestellung, ob ein Arbeitnehmer, der mit Gefahrstoffen umgeht oder sie transportiert, möglicherweise drogenabhängig ist und damit ungeeignet für diese verantwortungsvolle Aufgabe) sowie die Neugeborenenmedizin (um etwa festzustellen, ob nach mütterlichem Konsum während der Schwangerschaft auch Drogen in den Blutkreislauf des Kindes gelangt sind). Aber auch bei der Überprüfung der Schuldfähigkeit werden in manchen Fällen Haaranalysen durchgeführt, zum Beispiel um herauszufinden, ob eine Persönlichkeitsveränderung bei einem Angeklagten Folge einer Drogenabhängigkeit sein kann. Aussagen hierzu lassen sich in den meist erst Monate nach der eigentlichen Tat stattfindenden Gerichtsverhandlungen nämlich nicht mehr über Blut oder Urin treffen.
Ein weiteres Einsatzgebiet der Haaranalyse ist die sogenannte Drogenabstinenzkontrolle: Solche Kontrollen werden von den Führerscheinbehörden in Auftrag gegeben, wenn jemand beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt wurde.
Seit ein paar Jahren ist auch der Nachweis sogenannter »Alkoholismusmarker« in Haaren möglich, was neben
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.