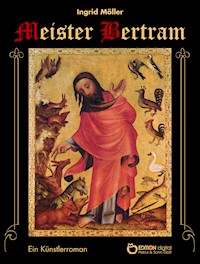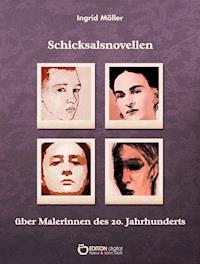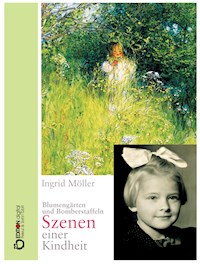5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adrian Ludwig Richter (1803-1884) war der Sohn eines Dresdner Kupferstechers. Als Kind schon beobachtet er die Erwachsenen um sich herum, hört ihren Gesprächen zu und grübelt dabei, wie sein eigener Lebensweg einmal aussehen mag. So mühsam plagen wie sein Vater möchte er sich nicht. Ein großer Held möchte er werden, einer der Kriegshelden, die alle Welt rühmt. Er schwärmt für Napoleon, den er in Dresden hoch zu Pferd sieht. Zum 10. Geburtstag wünscht er sich, ein Schlachtfeld mit eigenen Augen zu sehen. Der Schock ist so groß, dass er sich in die Welt der Märchen flüchtet. Später - zum Maler und Kupferstecher ausgebildet - sucht er sein Glück in der Feme, besonders in Rom, wo er viele deutsche Kollegen trifft. Zurückgekommen in die Heimat, wächst sein Ruhm. Doch zufrieden mit sich ist er selten. Sein Lebensweg führt über Höhen und Tiefen, Irrtümer und Selbstzweifel. Falsche Einschätzungen müssen über Bord geworfen werden. Er schafft eine friedliche Gegenwelt in seinen Bildern und zahlreichen Druckgrafiken, die in Alben „Fürs Haus“ weite Verbreitung fanden und besonders die Kinder begeisterten. Seine Lebenserinnerungen verraten viel über ihn, auch wenn er sie nicht mehr zuende bringen konnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Heldengedicht
Napoleon in Dresden
Böse Vorzeichen
Besatzungszeit
Ein entsetzlicher Geburtstagswunsch
Zeichenfieber und Märchenzauber
Bei den Großeltern
Lehrjahre
Fernweh
Ein verlockendes Angebot
Von fürstlicher Gnade und Ungnade
Brotarbeit und Fernweh
Unterwegs ins Land der Sehnsucht
Am Ziel der Wünsche – Rom
Die Deutsch–Römer
Abschied vom Süden
Wieder daheim
Auf eigenen Füßen
Auf der Albrechtsburg in Meißen
Ein böser Traum und ein neuer Anfang
Ingrid Möller
E-Books von Ingrid Möller
Impressum
Ingrid Möller
Der Traum vom Glück ohne Ende
Aus dem Leben des Malers Adrian Ludwig Richter
2., erweiterte Auflage
ISBN 978-3-95655-060-7 (E–Book)
ISBN 978-3-95655-937-2 (Buch)
© 2018 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E–Mail: verlag@edition–digital.de Internet: http://www.edition–digital.de
Das Heldengedicht
Stille herrscht in dem engen Raum. Nur das Kratzen auf der Kupfertafel und das Brummen einer Fliege sind zu hören. Beides in unterschiedlichen Abständen.
Adrian Ludwig hört beides nicht. Mit aufgestützten Ellenbogen ist er ganz in sein Schulbuch vertieft.
„Vater“, sagt er leise nach einem langen Schweigen, „die erste Strophe kann ich schon. Soll ich sie mal aufsagen?“
Karl August Richter nimmt die Mütze ab. Beim Arbeiten hat er sie immer auf, damit ihm die Haare nicht ins Gesicht fallen. Wenn er sie abnimmt, bedeutet es, dass er bereit ist, eine Pause einzulegen. Bedächtig legt er die Radiernadel aus der Hand und nickt Adrian Ludwig aufmunternd zu.
„Gut. Ich höre!“
Der Junge klappt das Buch zu. Gerade und gewichtig stellt er sich vor den Vater hin. Vor Eifer ist sein Kopf ganz rot. Er gibt sich Mühe, seiner piepsigen Stimme männliche Festigkeit zu geben.
„Schlachtfeld! –––
Wo der Todesengel würgte,
Wo der Deutsche seine Kraft verbürgte,
Heil'ger Boden! dich grüßt mein Gesang!
Frankreichs stolze Adler sahst du zittern,
Sahst des Wüthrichs Eisenkraft zersplittern,
Die sich frech die halbe Welt bezwang.
Euch! Ihr Namen der gefall'nen Helden –“
Adrian Ludwig beißt sich auf die Unterlippe. Wie ging es doch bloß weiter?!
„Euch – ihr Namen der gefall'nen Hel–den –“, wiederholt er leise.
„Eben wusste ich es noch.– Das dürft Ihr mir glauben!“
Kläglich klingt seine Stimme jetzt, ganz unheldisch. Er hat sich vor seinem Vater blamiert. Schlaff und hilflos hängen ihm die Arme herab, wie gebrochene Flügel. Die Augen betteln um Nachsicht. Er ist den Tränen nahe.
Der Vater schweigt und sieht seinen Sohn nachdenklich an.
„Das habt ihr wirklich auf?“
In seiner Stimme liegt Wehmut.
„Ja!“, sagt Adrian Ludwig voll Eifer. „Es ist doch ein sehr schönes Gedicht, nicht wahr! Ich versteh selbst nicht, warum ich es nicht weiter behalten habe. Unser Lehrer sagt, es hat ein Mann geschrieben, der Theodor Körner heißt und Dresdner ist wie wir. Er ist ein richtiger Held, der im größten Kampfgetümmel kein bisschen Bange hat.“
Der Vater winkt den Jungen zu sich heran und sieht ihm in die klaren unschuldigen Augen.
„Ach Junge“, sagt er traurig, „weißt du überhaupt, wovon du da sprichst?“
„Natürlich!“, strahlt der Kleine, „Von der großartigsten Sache der Welt – vom Krieg!“
Der Vater zuckt zusammen. „Dann erklär mir doch mal, was du über den Krieg weißt!“
Adrian Ludwig ist froh, dass der Vater ihn nicht getadelt hat und gibt sich nun alle Mühe, die Scharte wieder auszuwetzen.
„Viel weiß ich vom Krieg. Es fängt damit an, dass plötzlich ein Komet am Himmel steht. Ein Stern mit einem sooo langen Schweif.“
Er umschreibt mit dem Arm einen Kreisbogen. „Nachts geschieht das natürlich, wenn es ganz dunkel ist. Und wenn die Leute den Kometen sehen, wissen sie, dass ein Krieg kommt.“
„Und weiter?“
„Dann nähen die Schneider hübsche bunte Uniformen. Die Schmiede hämmern Säbel und machen Schießeisen. Die Pferdezüchter bringen den Tieren bei, im Pulverdampf keine Angst zu haben. Alle Männer eilen zu den Waffen und warten gespannt darauf, dass der Feind kommt.“
„Und wie erkennen sie den Feind?“
„Ganz einfach: seine Uniform ist anders. Und er kann nicht richtig sprechen.“
„Wie – nicht richtig sprechen?“
„Na, nicht deutsch. Er redet Kauderwelsch – sagt unser Lehrer.“
„Aha! Und dann?“
„Dann ist alles ganz einfach, wie bei den Zinnsoldaten: Es werden Schlachtenordnungen aufgestellt. Der Feldherr im langen Rock auf dem besten Pferd gibt das Kommando – und schon geht es los! Zu Fuß und zu Ross stürmen sie aufeinander los. Die Säbel rasseln. Das Pulver dampft. Die Schüsse knallen. Peng! Peng! So hauen sie die Feinde in Stücke und schreien vor Begeisterung.“
Aus dem Gesicht des Vaters ist jeder Anflug von Lächeln gewichen. Entsetzt betrachtet er seinen Sohn.
„Meinst du wirklich, sie schreien nur vor Begeisterung?“
„Natürlich!“, sagt Adrian Ludwig stolz, „Warum denn sonst?!“
„Vielleicht, weil sie selbst verwundet sind und ihre Schmerzen nicht aushalten können!“
Der Junge schüttelt lachend den Kopf. „Niemals, Vater, sie sind doch Helden! Sie sind jederzeit bereit, fürs Vaterland zu sterben und der Tod auf dem Schlachtfeld ist der ehrenhafteste Tod.“
Als der Vater immer noch nicht überzeugt zu sein scheint, sagt Adrian Ludwig mit Nachdruck:
„Vor lauter Begeisterung merken die überhaupt keine Schmerzen!“
Karl August Richter seufzt. Was für ein Bild vom Leben wird den Kindern da bloß in die kleinen Köpfe gepflanzt! Adrian Ludwig ist noch nicht einmal zehn! Wie nur soll solch Unkraut wieder aus den Köpfen kommen? Nur durch die brutale Wirklichkeit? Ein schrecklicher Gedanke!
„Ob wir das alles wohl auch mal erleben, Vater? Hier in Dresden? – Vielleicht haben wir ja das Glück. Unser Lehrer sagt: Die Franzosen sind so frech, denen ist glatt zuzutrauen, dass sie überall hinkommen, also auch hierher.“
Der Vater packt Adrian Ludwig an den Schultern und schüttelt ihn. „Wach auf, Junge! Menschen sind keine Zinnsoldaten! Wünsch dir um Gottes willen nicht, das je zu erleben! Mal nicht den Teufel an die Wand!“
Adrian Ludwig stutzt. Wie kann das sein: Der Lehrer sagt es so, und der Vater ganz anders. Wie soll man sich da zurechtfinden?
Er schwankt, wem er mehr glauben soll.
Das Gespräch ist beendet. Der Vater hat seine Mütze wieder aufgesetzt, greift zur Radiernadel und ziseliert die Häkchen ins Kupfer, die in der Summe dann die Baumkronen in den Landschaftsbildern ausmachen. Eine mühevolle Arbeit. Tag für Tag. Solange Adrian Ludwig zurückdenken kann, saß der Vater so da.
Zum ersten Mal in seinem Leben stellt Adrian Ludwig jetzt seinen Vater als Vorbild infrage. Ist er etwa ein Duckmäuser? Würde er etwa, wenn die Franzosen wirklich kämen, in ein Mauseloch kriechen und warten, bis die Gefahr vorüber ist?
Adrian Ludwig beobachtet seinen Vater voller Zweifel und Argwohn. Welch entsetzlicher Gedanke, einen Vater zu haben, der nicht darauf brennt, sich als Held auf dem Feld der Ehre zu bewähren!
Womöglich würde er auch dann, wenn alle zu den Waffen eilen, noch hier sitzen bleiben, die schlaffe Mütze auf dem Kopf, die Radiernadel in der Hand und über die Kupferplatte gebeugt an der soundsovielten Landschaft stricheln. Auf einmal verachtet Adrian Ludwig diese Arbeiten, die Bäumchen, die so kleinteilig sind wie Häkelmaschen, das Laubwerk wie Ringellöckchen, alles friedlich und verträumt. Und noch nicht einmal von ihm selbst entworfen. Nein, der Vater schindet sich ab für seinen einstigen Lehrer Adrian Zingg. Dessen Name erscheint dann auch im Druck, nicht der des Vaters.
Von diesem Adrian Zingg hab ich meinen Vornamen, er hat mich über das Taufbecken gehalten, fällt dem Jungen plötzlich ein. Eine Vorbestimmung? Heißt das, ich soll mein Leben genauso zubringen wie Vater? Nach dem Willen des anderen Adrian?
„Na“, sagt der Vater plötzlich, „guckst du Löcher in die Luft?“
Der Junge fühlt sich ertappt. Ahnt der Vater seine aufsässigen Gedanken? Es heißt doch: Du sollst Vater und Mutter ehren...
Ach, das Gedicht! Schnell schlägt er das Buch wieder auf. Den Rohrstock des Lehrers möchte er nicht zu spüren bekommen. Aber vor seinem Vater wird er das schöne Gedicht nicht noch einmal aufsagen. Dann schon lieber vor Fips, dem Spitz aus dem Nachbarhaus.
Napoleon in Dresden
Heute ist Pfingstsonnabend. Das Kalenderblatt meldet den 16. Mai 1812. Heute soll Napoleon Bonaparte leibhaftig Dresden durchqueren auf seinem Feldzug nach Russland.
Seit dem frühen Morgen hat Adrian Ludwig am Fenster Posten bezogen, auch wenn die Truppen erst gegen Abend erwartet werden. Die Aussicht ist günstig: Hinweg über Stadtgraben, Wälle, Stadtmauer, Schanzen und hohe Bäume lässt sich die ganze Amalienstraße bis zum Pirnaischen Tor überblicken und nach rechts den Elbberg hinab bis zur Neustadt. Vorbeikommen wird Napoleon hier allerdings nicht, aber Adrian Ludwig wird es nicht entgehen, wenn die Einwohner in Scharen aufbrechen, um dem Schauspiel beizuwohnen.
„Müssen wir nicht los, Vater?“, fragt er wohl schon zum zehnten Mal.
„Nein, noch nicht!“
Immer die gleiche monotone Antwort. Da wird die Geduld auf eine harte Probe gestellt.
„Vater! Jetzt sind schon ganz viele unterwegs! Sie werden uns die besten Plätze wegnehmen!“
„Das werden Spaziergänger sein, die vom Stammtisch kommen!“
Ist der Vater denn durch nichts aus der Ruhe zu bringen! Kann er sich denn für gar nichts begeistern?
Erst nach dem Mittagsschläfchen fängt der Vater an, sich langsam und umständlich umzuziehen. Auch für Adrian Ludwig liegen endlich die Ausgehsachen bereit.
Draußen wimmelt es von Menschen. Je näher sie der Innenstadt kommen, desto größer wird das Gedränge. Die Bürgergarde bildet Spalier an den Straßenrändern.
„Lass uns man hier stehen bleiben“, sagt der Vater am großen Platz vor dem Zwinger. Und wieder heißt es: warten und geduldig sein.
Zu beobachten gibt es allerdings so einiges. Straßenkehrer spicken Papierfetzen auf. Fliegende Händler verkaufen Brezeln und heiße Würstchen. Berittene Beobachter galoppieren vorbei. Eine Dame mit auffällig geschnürter Taille droht in Ohnmacht zu fallen. Gerade noch rechtzeitig findet ihr Begleiter das Riechfläschchen in ihrem Pompadour. Oh, diese Hitze!
„Aber, meine Liebe, wer geht da auch ohne Sonnenschirm aus!“
Ein Säugling schreit. Ein Hund schlängelt sich durch die Menge und beschnüffelt jeden. Ganz bestürzt wirkt er, weil er sich nicht alle Gerüche merken kann.
„Achtung!“
Ein Raunen geht durch die Menge. Irgendeine wichtige Nachricht muss durchgesickert sein. Alle spitzen die Ohren.
„Von Freiberg her werden sie kommen!“
Von Südwesten also, über Freital. Aber wusste man das nicht schon längst?
Adrian Ludwig ist umringt von Mänteln, Rockschößen und Seidenkleidern. Viel sehen kann er nicht. Ein vielstimmiges Gemurmel mit einzelnen Satzfetzen dringt an sein Ohr. Unterschiedliche Gerüche umnebeln ihn. So hat er sich das nicht vorgestellt. Gut, dass Vater nicht auf mich gehört hat, denkt er. Mir ist schon jetzt ganz schlecht. Hoffentlich nimmt Vater mich nachher auf die Schultern.
„Die Höhen des Rosstals sind schwarz vor Menschen!“, heißt es plötzlich, „Bald müssen sie hier sein!“
Die Spannung steigt. Die Gespräche werden abgebrochen. Schließlich sind Trommelgerassel und Feldmusik aus der Ferne zu hören. Die Vorhut rückt an, völlig mit Staub überpudert. Es folgen die Regimenter. Darüber beginnt es zu dämmern. Fackeln werden entzündet und Metallkörbe mit brennenden Kienkloben an den Straßenrändern aufgestellt. Der rötliche Feuerschein reißt die angestrahlten Gestalten aus dem Dunkel und lässt Gesichter und bunte Uniformen aufleuchten. Welch ein Schauspiel!
Adrian Ludwig ist hellwach. Der Vater hat ihn hochgehoben, damit er alles genau sehen kann. So, ja genauso hat er sich Helden vorgestellt: bunt und imposant.
Ich muss mir alles genau merken, überlegt er, zu Haus mal ich dann alles in mein Skizzenheft. Mit Farben natürlich. Wenn ich nur alles behalten könnte! Und er starrt auf die prunkvollen Garden, die polnischen Ulanen mit den silbernen Kokarden. Immer exotischer wird der Zug. Auch Mamelucken sind dabei. Schließlich der Höhepunkt: die Karosse mit dem Kaiserpaar!
Trompeten schmettern, Trommeln rasseln, alle Glocken der Stadt läuten, Kanonen donnern. Manche Leute schreien: „Vivat!“, oder „Vive l'Impereur!“. Manche aber pressen die Lippen zusammen.
Was nun noch kommt, ist von geringerem Interesse: Nachhut, Feldküche, Marketenderinnen. Die Menge zerstreut sich.
Adrian Ludwig lässt sich widerwillig von seinem Vater an die Hand nehmen. Er hätte nichts dagegen, wenn er ihn tragen würde. Er ist so müde, dass er richtig taumelt. So lange darf er sonst nie auf sein.
Die Bilder aber flimmern noch immer vor seinen Augen, bunt und wild durcheinander.
„Ist das jetzt jeden Tag so?“, fragt er.
„Tja, eine Weile werden wir wohl noch Zuschauer am Rande des Weltgeschehens sein.“
Das klingt rätselhaft. Adrian Ludwig aber ist zu müde, um es sich erklären zu lassen. Jedenfalls wird es nicht langweilig werden. Vielleicht bringt es sogar schulfrei mit sich! Denn wenn jetzt hier ständig Truppen durchziehen, kann man die Kinder schlecht auf den Schulweg schicken.
Er muss jetzt wieder an die Prunkkarosse denken, an die Vivatrufe und die verkniffenen Gesichter. Irgendetwas passt da nicht zusammen. Aber was?
„Vater?“, fragt er matt, „Sind die Franzosen nicht eigentlich unsere Feinde? Wieso begrüßen wir sie dann?“
„Wir haben sie nicht begrüßt. Wir haben sie nur besichtigt.“
Wo soll denn da der Unterschied sein?
„Aber die Leute haben doch gejubelt.“
„Nicht alle. Wir auch nicht.“
Nachdenken strengt an. Adrian Ludwig kämpft gegen die Müdigkeit. „Das müsst Ihr mir morgen mal genau erklären, Vater, das mit Freund und Feind.“
„Das wird mir schwerfallen“, sagt der Vater und trägt den eigentlich viel zu großen Jungen nun doch noch die letzten paar Schritte.
Böse Vorzeichen
Ein neues Jahr ist angebrochen. Das Jahr 1813.
Adrian Ludwig öffnet ein Seitenfenster und lässt die dicken Schneeflocken auf die flach ausgestreckte Hand fallen. Wie sachte und leicht sie herabgleiten! Schnell zieht er die Hand zurück und beobachtet, wie die glitzernden Sterne sich auflösen und zu Wasserperlen zerrinnen. Jetzt ist ihm die Hand ganz kalt geworden. Die nächsten Schneeflocken werden sich länger halten. Er wiederholt sein Spiel, bis er einen Kneifer hat, nun schließt er das Fenster. Richtig blau ist die Hand geworden. Das zwickt!
Bei Schmerzen ist es immer gut, sich abzulenken. Er sieht hinauf in den grauen Himmel, aus dem scheinbar endlose Mengen dicker Flocken fallen. Ob es da oben wirklich eine Frau Holle gibt?
Seitdem der Schulbetrieb wegen der unruhigen Zeiten eingestellt ist, liest er viel. Kalendergeschichten, Bilderbögen, vor allem aber Märchen.
Viel war los in letzter Zeit. Truppendurchzüge. Feuerwerk. Illuminationen. Monarcheneinzüge. Jetzt ist es ruhiger. Das liegt wohl am strengen Winter.
Vom langen Hochgucken und dem gleichmäßigen Rhythmus des Flockenfallens ist Adrian Ludwig ganz schwindlig geworden. Er steht auf, atmet tief durch und sieht so ganz nebenbei auf die Straße hinab.
Sieht er richtig? Er reibt sich die Augen. Was ist denn das? Was für seltsame Gestalten kommen denn da über die Elbbrücke? Wenn es doch bloß nicht so dick schneien würde, es ist ja nichts genau zu sehen! Er reibt und haucht gegen die Fensterscheibe, bis er ein Loch mit Klarsicht und Eisblumenumrandung hat. Er bemüht sich, das seltsame Bild zu deuten. Frauen mit Einkaufskörben sind es nicht. Männer mit Pellerinen auch nicht. Wie Vermummte sehen sie aus, wie Bettler, die sich gegen die Kälte irgendwelche Pferdedecken umgehängt haben. Und sie gehen nicht. Sie humpeln. Nur ganz langsam kommen sie näher. Dem Jungen werden die seltsamen Gestalten immer unheimlicher. So viele Bettler auf einmal? Das kann es doch nicht geben!
„Vater! Mutter!“, ruft er aufgeregt, „Kommt bloß mal! Was sind das da hinten für Spukgestalten?“
Die Mutter kommt als erste und stürzt ans Fenster. Entsetzt schlägt sie die Hände vors Gesicht und bricht in Tränen aus.
„Mein Gott, wie entsetzlich! Karl August, sieh mal! Nein – mir wird ganz übel!“
Inzwischen ist auch der Vater am Fenster und sieht hinaus auf den Zug von Elendsgestalten, der scheinbar ohne Ende ist.
„Wir sollten ihnen Brot und heißen Tee bringen!“, sagt die Mutter. „Und wem von den vielen willst du das geben?“, fragt der Vater tonlos, „Du bist kein Wundertäter. Die nichts abbekommen, werden über dich herfallen. Es sind so viele wie Schneeflocken vom Himmel fallen. Dagegen sind wir machtlos.“
„Aber wenn jeder ein bisschen – ich meine, das ist doch Christenpflicht!“
„Sie sind völlig erschöpft. Sie brauchten eine Bleibe. Und ärztliche Hilfe. Wer weiß, wielange sie sich in der Kälte schon so herumschleppen!“
Die Mutter hört nicht zu, sie ist längst in die Speisekammer gelaufen und kommt mit einem Brot zurück. „Bitte, Karl August, bring es ihnen! Es ist besser, wenig als gar nichts zu tun. Es könnten unsere Verwandten sein. Auch Deutsche waren dabei.“
Zögernd nimmt der Vater das Brot und geht. Die Mutter hat den Wassertopf aufgesetzt. Zum Teeaufgießen. Dann kehrt sie zum Fenster zurück. Stumm vor Entsetzen.
„Bitte, erklärt mir doch endlich, wer diese Leute sind!“, bittet Adrian Ludwig mit ängstlicher Stimme.
Die Mutter seufzt tief, setzt sich auf den Schemel am Erkerfenster und zieht Adrian Ludwig zu sich auf den Schoß. Wie früher, wenn sie ihm Geschichten erzählte. „Kannst du dir das wirklich nicht denken? Überleg doch mal!“
Jetzt sind die Gestalten ganz nahe. Reste von Uniformen werden erkennbar.
„Nein!“ Adrian Ludwig springt hoch und starrt seine Mutter entsetzt an. „Ihr wollt doch nicht etwa sagen –“, er bringt es kaum heraus „– es seien Soldaten?“
„Ja, mein Junge, dieselben, die du damals so bewundert hast wegen der schneidigen Uniformen und der strammen Haltung.“
„Nein!“, wehrt Adrian Ludwig sich. „Das ist ganz unmöglich!“
Er zieht die Tischschublade auf und holt die bunten Tuschzeichnungen heraus. Er hat sie damals in der ersten Begeisterung gemalt. Heldengestalten. Recken. Auf stolzen Pferden. Lustige Trommler und Pfeifer vorneweg. Er breitet die Zeichnungen vor seiner Mutter aus. Wie zum Beweis.
„Das können doch nicht dieselben Menschen sein! Niemals!“