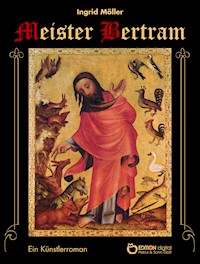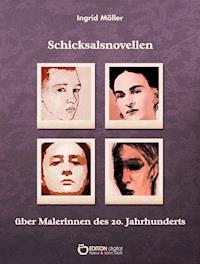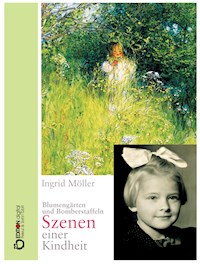8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zugegeben, von einem der bekanntesten Maler des holländischen Barock kennt man nur knapp 40 Bilder. Zugegeben, von seinem Leben weiß man nicht sehr viel. Und dennoch gelingt es Ingrid Möller, das Leben dieses Jan Vermeer aus Delft und seiner Frau Catarina, oft auch Trijntjen genannt, in kräftigen und leuchtenden Farben zu malen. Alles beginnt mit einem schönen Fest, einem Hochzeitsfest: Hell und wärmend fällt das Sonnenlicht des Frühjahrstages durch die hohen Fenster, deren Scheiben in kleine bleigefasste Quadrate geteilt sind. Es fällt in einen Raum, in dem alles blitzsauber ist - vom schachbrettartigen Fliesenfußboden bis unter die braune Balkendecke. Es lässt den Wein in den bauchigen Gläsern funkeln, die kostbaren Seidenroben schillern und die Augen der Gäste strahlen. Es gibt den Farben Leuchtkraft. Grellrot prangt der Hummer auf dem blank geriebenen Silberteller, orange und gelb heben sich die Apfelsinen- und Zitronenstücke von den blauweißen Fayenceschüsseln ab, und - kunstvoll zusammengebastelt - schmückt das Federkleid eines Truthahns die Mitte der Tafel. Die Augen sollen mitessen, und das mit doppeltem Recht, wenn sie Malern gehören. „Haben wir ein Glück mit dem Wetter“, sagt der Hausherr Reynier Vermeer vergnügt, „besser könnte man es sich gar nicht wünschen.“ „Ein gutes Omen für einen so bedeutungsvollen Tag“, nickt der greise Ohm Pieters. Doch seine Frau, die rundliche Geertje, sagt: „Ach was, an unserm Hochzeitstag hat es in Strömen gegossen, und sind wir etwa nicht glücklich geworden?“ Herausfordernd hochgereckt, das Doppelkinn an den gestärkten Mühlradkragen gepresst, wartet sie auf die öffentliche Bestätigung durch ihren Mann. Dem macht es Spaß, die Antwort hinauszuzögern. In seinem hageren Gesicht verlagern sich die Falten zu einer gewichtigen Miene, hinter der der Schalk lauert. „Und wie!“, bestätigt er dann mit einem Ernst, der die Gesellschaft zum Lachen bringt. Schon dringt der Duft gebratenen Geflügels verführerisch aus der Küche herüber, sodass den Gästen das Wasser im Mund zusammenläuft. Ob auch Tauben dabei sind? Gleich wird man auftragen. Jetzt ist der richtige Augenblick, denkt Leonard Bramer und gibt sich einen Ruck. Jetzt! Und dann beginnt er seine Hochzeitsrede, die er mit einem effektvollen Schluss und einem wertvollen Geschenk für die Braut beendet – einem Perlohrgehänge, das im Weiteren noch eine wichtige Rolle spielen wird. Nach der Lektüre dieses Vermeer-Romans sieht man seine Bilder mit anderen, wissenderen Augen an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Ingrid Möller
Das Haus an der Voldersgracht
Ein Vermeer-Roman
ISBN 978-3-95655-058-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1977 im Prisma-Verlag Zenner und Gürchott, Leipzig.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung des Bildes „Straße in Delft“ von Jan Vermeer van Delft.
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Hell und wärmend fällt das Sonnenlicht des Frühjahrstages durch die hohen Fenster, deren Scheiben in kleine bleigefasste Quadrate geteilt sind. Es fällt in einen Raum, in dem alles blitzsauber ist — vom schachbrettartigen Fliesenfußboden bis unter die braune Balkendecke. Es lässt den Wein in den bauchigen Gläsern funkeln, die kostbaren Seidenroben schillern und die Augen der Gäste strahlen. Es gibt den Farben Leuchtkraft. Grellrot prangt der Hummer auf dem blank geriebenen Silberteller, orange und gelb heben sich die Apfelsinen- und Zitronenstücke von den blauweißen Fayenceschüsseln ab, und — kunstvoll zusammengebastelt — schmückt das Federkleid eines Truthahns die Mitte der Tafel. Die Augen sollen mitessen, und das mit doppeltem Recht, wenn sie Malern gehören.
»Haben wir ein Glück mit dem Wetter«, sagt der Hausherr Reynier Vermeer vergnügt, »besser könnte man es sich gar nicht wünschen.«
»Ein gutes Omen für einen so bedeutungsvollen Tag«, nickt der greise Ohm Pieters. Doch seine Frau, die rundliche Geertje, sagt:
»Ach was, an unserm Hochzeitstag hat es in Strömen gegossen, und sind wir etwa nicht glücklich geworden?« Herausfordernd hochgereckt, das Doppelkinn an den gestärkten Mühlradkragen gepresst, wartet sie auf die öffentliche Bestätigung durch ihren Mann. Dem macht es Spaß, die Antwort hinauszuzögern. In seinem hageren Gesicht verlagern sich die Falten zu einer gewichtigen Miene, hinter der der Schalk lauert.
»Und wie!«, bestätigt er dann mit einem Ernst, der die Gesellschaft zum Lachen bringt.
Schon dringt der Duft gebratenen Geflügels verführerisch aus der Küche herüber, sodass den Gästen das Wasser im Mund zusammenläuft. Ob auch Tauben dabei sind? Gleich wird man auftragen. Jetzt ist der richtige Augenblick, denkt Leonard Bramer und gibt sich einen Ruck. Jetzt!
Umständlich räuspert er sich, zupft an den Enden seines nach neuester Mode flach aufliegenden Spitzenkragens und streicht wohlgefällig über die Wölbung seines Bauches, um zu fühlen, ob die Schärpe auch richtig glatt ist, die Schärpe, auf die er so stolz ist und die allen unmissverständlich kundtut, dass er Mitglied einer der vier Delfter Schützengilden ist. Bramer steht auf, reckt sich und gewinnt so das Aussehen eines Achtung gebietenden Mannes, der sich seines Wertes voll bewusst ist. Augenblicklich verebben die Gespräche, alle Blicke wenden sich ihm zu.
Doch ausgerechnet jetzt beginnen die Turmuhren Delfts zu schlagen. Mit Sekundenvorsprung die Uhr der hohen Nieuwe Kerk, dann die des gegenüberliegenden Stadthuis, die der Oude Kerk, des Schiedamer Tors. Unwillkürlich horchen alle auf den vielstimmigen Klang, auf das unterschiedliche Tönen, wie die Schallwellen anschwellen, sich mit anderen mischen und abklingen, feierlich tief die einen, hoch und dünn die anderen.
Leonard Bramer wartet, bis der letzte Ton des nachhinkenden Bimmelglöckchens verschwebt ist. Die Verzögerung kann die erstrebte Spannung nur steigern. Er ist ein Meister der Regie.
»Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsgäste«, beginnt er seine wohlabgewogene Ansprache, »wir sind heute zusammengekommen, um teilzuhaben an der Freude eines jungen Paares. — Vielleicht sagt ihr, dass ich als alter Junggeselle diese Freude gar nicht zu beurteilen wisse. Vielleicht glaubt ihr auch dem Sprichwort, das da sagt ,Vier en liefde treken sterck / en beletten menich werk‘ (Wo die Liebe schleichet ein, alle Künst vertrieben sein). Nein, Freunde, wo bliebe die Kunst, wenn es die Liebe nicht gäbe! Und wie schnell wäre eine Liebe vergessen, wenn ihr nicht durch die Kunst ein Denkmal gesetzt würde!
Seht auf Catarina, unsere entzückende Braut! Auf wie viel Bildern, die unser Jan im Laufe seines Lebens malen wird, werden wir sie wiedererkennen? Denn dies, meine Freunde, ist ein Vermögen, das uns Künstler über andere Berufe erhebt: Wir können dem Augenblick Dauer, dem Flüchtigen Beständigkeit und dem Verborgenen Sichtbarkeit verleihen. Wenn du — Catarina — einst alt geworden bist, wird deine jugendliche Schönheit weiter bestehen auf der Leinwand.
Du, Jan, wirst als Maler eine große Zukunft haben, wenn du die Möglichkeiten nutzt, die in dir liegen. Mögest du deine Gaben nie vergeuden und der Gefahr des bequemen Erfolges entgehen!
Doch nicht den Ruhm der Kunst will ich singen, sondern den Ruhm dieser Stunde: Lasst mich, liebe Freunde, dieses Glas erheben, um Fortuna zu danken, die uns so frohe und glückliche Stunden zu spenden bereit ist. Möge die launische Göttin des Glücks dem jungen Paare stets gewogen bleiben! Denn lang ist ein Menschenleben — und es ist doppelt lang, wenn ein Schatten darauf liegt.«
Der Duft des Gebratenen wird immer verlockender. Der einzige, der nicht heimlich Witterung aufnimmt, ist der Redner selbst. Mit anscheinend ungeteiltem Interesse verfolgt er, wie der Wein nachgeschenkt wird, ergreift sein Glas abermals und fährt fort:
»Dies zweite Glas lasst uns erheben auf Amor, den Unberechenbaren, der seine Pfeile abschoss auf diese beiden jungen Leute und sie vereinte durch jenes Band, das niemand sieht und das doch fester bindet als jede sichtbare Kette. Trinken wir auf den Götterknaben, dessen Pfeile verletzen, denen aber doch niemand ernstlich ausweicht!«
Bei diesen Worten hält Bramer das Glas einem Gemälde entgegen, auf dem ein nackter blond gelockter Knabe ernsthaft Köcher und Bogen vorweist. Diese Pointe war gar nicht eingeplant. Gut, dass sie mir eingefallen ist, denkt Bramer selbstzufrieden. An den Wänden hängen so viele Bilder neben- und übereinander, dass es schon ein glücklicher Zufall war, gerade dieses im rechten Augenblick zu entdecken.
Genießerisch lässt der Sprecher den Wein über die Zunge laufen, setzt das Glas ab und füllt es aus der Karaffe nach, um es mit der triumphalen Gebärde eines Schauspielers erneut zu erheben: »Auf Venus, die Göttin der Schönheit und der Liebe! Opfern wir ihn, damit sie — die geheimnisvoll Schaumgeborene — unserem Paar treu bleiben möge!«
Gehorsam trinken die Gäste.
»Wenn Bramer alle Götter des Olymps zu Zeugen fordert, liegen wir unter dem Tisch, bevor wir was Festes zwischen die Kusen kriegen«, flüstert Caral Fabritius seiner Frau zu.
Doch jetzt hat Bramers Stimme etwas Beschwörendes, das auch die Gelangweilten neugierig macht.
»... Zwei Menschen schließen sich zusammen zu einem Paar. Vorher jeder ein einzelner, werden sie einander zugehörig und durch den anderen erst zu einem Ganzen. Möget ihr, Catarina und Jan, einander unentbehrlich werden, wie eine Hand für die andere unentbehrlich ist, oder wie ...«
In der spannungsvollen Pause, die jetzt entsteht, fingert Bramer etwas aus der Tiefe seiner Gewandtasche, das bald als ziseliertes Lederkästlein erkennbar wird. Während er es langsam und bedeutungsvoll öffnet, setzt er den Satz fort, wobei er jedem Wort besonderen Nachdruck verleiht: »... wie ein Perlohrgehänge nur in Verbindung mit dem zweiten sinnvoll ist. Gestattet, dass ich es der Braut überreiche zur Erhöhung ihrer Schönheit — soweit das möglich ist — und zur Erinnerung an diesen Tag! Halte es in Ehren, Catarina. Es sei dir ein Symbol deiner Zusammengehörigkeit mit Jan, und es möge dir ein Glücksbringer sein wie den alten Ägyptern der Skarabäus.«
Alle recken die Hälse, um zu sehen, wie der noble Spender das kostbare Kleinod an Catarinas Ohrläppchen befestigt. Ein »Oh« und »Ah« geht durch die Runde. »Wie groß die Perlen sind!« — »Und nicht rund, sondern oval!« — »Welch ein Schimmer!« — »Aus welchem Meer mögen sie stammen?« — »Sie müssen ja ein kleines Vermögen gekostet haben!« So schwirren die Ausrufe durcheinander.
Leonard Bramer lehnt sich zurück. Die Überraschung ist ihm gelungen, und jetzt ist es nicht seine Sache, auf indirekte Fragen einzugehen. Mögen sie rätseln, wie er zu dem Schmuck gekommen ist ...
Fünf Wochen ist es her. Ein Markttag. Unschlüssig darüber, was er als Hochzeitsgeschenk aussuchen sollte, schlenderte Leonard Bramer durch die Straßen. Keinen Stand ließ er unbeachtet, an dem etwas geboten wurde, was das Auge erfreuen kann: Stoffe, Spitzenkragen. Fayencegeschirr, Messingleuchter — aber bei keinem dieser Stücke hatte seine innere Stimme ihm Halt geboten. Was er suchte, war nicht irgendein Geschenk — es sollte etwas Besonderes sein, etwas, was keiner von ihm erwartete, und etwas, das einen höheren Sinn hatte und das er als Höhepunkt einer Festansprache überreichen wollte. Das eben machte die Sache so schwierig! Wäre er ein guter Musikant gewesen, hätte er ein Saiteninstrument nehmen und es nach der Darbietung dem Paar überreichen können. Hinge bei den Vermeers nicht das ganze Haus voller Gemälde, hätte er mit einem eigenen Bild Ehre einlegen können. Aber so?
Bramer zuckte die Achseln und grübelte weiter. Mitten auf der Warmoes-Brücke vor dem Westerschen Silverpant blieb er plötzlich stehen. Schmuck — ja — Schmuck könnte es sein! Und so nahm er Richtung auf die Gasse der Goldkrämer. Zu Sybrant van der Velden wollte er gehen, ihn kannte er seit seiner Kindheit. Der alte Mann hatte viel Unglück gehabt. Mit seiner Ehrlichkeit kam er nicht gegen die jüngeren und wendigen Konkurrenten auf.
»Goedendag Mijnheer Bramer!« Die Freude des Alten war ehrlich. »Wollt Ihr etwa etwas kaufen?«
»Gewiss, wenn Ihr das Richtige für mich habt.«
»Ein Geschenk für eine Dame«, forschte der Juwelier und begann, mit Samt ausgeschlagene Kästchen hervorzuholen.
»Mijnheer van der Velden, Ihr seid doch der letzte, der über Feste und Vorgänge in der Stadt nicht Bescheid wüsste, also ist Euch auch zu Ohren gekommen, dass ich am fünften April Zeuge beim Aufgebot des jungen Vermeer war. Daraus folgt: Ich werde auch zur Hochzeitsfeier eingeladen, und daraus folgt weiter: Ich brauche ein Geschenk. Und nun sagt ruhig, Ihr hättet’s nie erraten!«
Geschmeichelt lächelte der Alte: »Nun ja, in meinem Beruf muss man manchmal das Gras wachsen hören, aber meine Ohren lassen nach.«
»Was habt Ihr also anzubieten?«, drängte Bramer.
»Eine gute Sache will gut bedacht sein!« Sybrant van der Velden verstand sich darauf, auf sanfte Art zurechtzuweisen.
»Nehmt — bitte sehr — erst einmal Platz! Und nun beschreibt mir die Braut. Ist sie blond, brünett, dunkel? Nicht jeder Schmuck passt zu jeder Frau — ich frage nicht aus Neugier.«
Bramer musste überlegen. »Ich glaube wohl, sie ist blond — nein eher mittelblond, und hat blaue Augen oder — auf jeden Fall ist sie jung und hübsch, und ich wüsste nicht, was ihr nicht stehen sollte.«
»Hm«, der Alte blieb umständlich. Zu selten kam ein Kunde, mit dem er sich ausführlich unterhalten konnte.
»— vielleicht ein Ring mit Aquamarinen? Sie haben die Farbe der Augen, falls sie wirklich blau sind.«
Bramer drehte den prismatisch geschliffenen Stein hin und her, um das Licht darin spielen zu lassen. Die Klarheit dieses hellen Blaus ließ an Wasser, an Himmel denken. Aber war es nicht dem Bräutigam vorbehalten, einen Ring zu schenken? Er legte ihn auf den Tisch zurück.
Der Juwelier brachte eine Goldspange, eine feine Filigranarbeit. Kunstvoll schlangen sich die Drähte zu Spiralen und Schneckenhauswindungen.
»Ist das Eure Arbeit?«, fragte Bramer verwundert. »Dann könnt Ihr dem Herrgott für Eure guten Augen dankbar sein.«
»Zusammen mit der Lupe geht es noch mit meinen Augen. Dieses Stück habe ich allerdings schon vor Jahren angefertigt. Wollte es erst nicht verkaufen. Für meine Tochter aufheben.«
»Ich weiß es zu schätzen, dass Ihr es mir anbietet. Ich bin Euch ein schwieriger Kunde.«
»Schwierige Kunden sind gute Kunden. Sie beweisen Geschmack. Lassen sich nichts aufschwatzen.«
Bramer sah, wie die Hände des Alten zu zittern begannen. Die Angst, dass der Kunde gehen könnte, ohne etwas zu kaufen, stand ihm im Gesicht.
»Man trägt jetzt Perlschnüre im Haar — vielleicht darf es so etwas sein«, schlug der Juwelier vor. Was in aller Welt nennt dieser Mensch denn bloß etwas Besonderes, dachte er insgeheim. Bramer wog die Kette in den Händen. Zuviel Perlen, überlegte er, zu viel Gulden. Aber Perlen, ja, die wären richtig. Ihr Schimmer — es muss eine andere Verwendungsart geben! Ring? Nein! Armband? Nein! Bramer sah sich wieder um, öffnete selbst Schubfächer, kümmerte sich nicht um den Alten. Und da geschah es, dass er dieses Perlohrgehänge entdeckte, das gerade so bewundert wird. Doch der Juwelier war keineswegs bereit, es zu verkaufen. Vielmehr schien er erschrocken darüber, dass Bramer es überhaupt gefunden hatte. Bramer aber gab seinen Entschluss nicht auf: Dieses Schmuckstück wollte er — nichts anderes. Der Juwelier wand sich, es sei eine Sonderanfertigung, die noch nicht abgeholt sei, er dürfe sie nicht verkaufen. Bramer, der gewohnt war zu erreichen, was er sich in den Kopf gesetzt hatte, war erregt aus dem Laden gegangen und hatte den Juwelier seinen Gewissensbissen überlassen. Einen Tag später aber stand van der Velden bei Bramer in der Tür, mit dem Schmuck. »Mijnheer Bramer — verzeiht — ich habe mich entschlossen — Euch das Ohrgehänge zu überlassen«, stammelte er, »es hat vor Jahren ein Marineoffizier in Arbeit gegeben — für seine Braut — ein weit gereister Mann — hat sich nie wieder blicken lassen«, und mit einer Miene, als müsse er sich selbst die Überzeugung aufzwingen, setzte er hinzu: »Vermutlich ist er längst gefallen — gegen die Engländer — da fallen ja viele, sagt man ...«
»Na also!«, rief Bramer aus, »dann ist doch alles in bester Ordnung! Keiner kann von Euch erwarten, dass Ihr jahrelang unabgeholte Bestellungen liegen lasst. Es ist doch Euer Geld, das dann festfriert.«
Darauf wurde der Preis ausgehandelt — kein hoher Preis — und Bramer hatte das Ohrgehänge ...
Es steht ihr wirklich gut, denkt Bramer jetzt, und Catarina denkt dasselbe, während sie sich in dem kleinen venezianischen Wandspiegel betrachtet, den Brautjungfer Cornelia aus dem Nebenzimmer geholt hat. Vor Stolz und Freude ist sie rot geworden bis unter den Haaransatz. Welch ein Geschenk! Und das ihr, die sie doch als Fremde in diese Stadt kommt!
»Wundervoll sind die Perlen, Mijnheer Bramer«, jubelt sie, »und ebenso wundervoll war Eure Rede! Ihr wisst die Worte zu setzen wie ein Dichter. Ich danke für beides. — Ihr dürft Euch als geküsst betrachten!«
»Betrachten? Nur betrachten?«, entrüstet sich Bramer mit Bassstimme. »Glaubt Ihr denn wirklich, Mefrouwe Vermeer, dass ich die Absicht so leicht für die Tat nehme? Jetzt gibt es kein Zurück: Steht zu Euerm Wort!«
Mit einem kurzen, unsicheren Blick zu Vermeer holt Catarina sich die Erlaubnis und haucht einen flüchtigen Kuss auf Bramers Wange. Erleichtert setzt sie sich auf ihren Platz zurück. Doch was ist mit Jan? Warum bewundert er sie nicht? Warum streift er sie mit keinem Blick? — Ob er so gern Hühnerkeulen isst, dass er darüber alles andere vergisst? Catarina wird bewusst, wie wenig sie ihn noch kennt.
Doch Vermeer kaut nicht nur an den Hühnerkeulen, er kaut gleichzeitig an unbequemen Gedanken, die er verbergen möchte. Gedanken, die ihn erschrecken und die ihn nicht mehr loslassen.
Bramer, grübelt er, Leonard Bramer — es ist, als sähe ich dich heute zum ersten Mal! Warum nur? Wie ist es möglich, dass sich die Empfindungen für einen Menschen so plötzlich ändern können! Du warst mir als Kind der Inbegriff alles Erstrebenswerten. Du warst Maler: Ich wollte es auch werden. Du warst durch die Welt gereist und wusstest die tollsten Abenteuer zu erzählen: Ich wollte werden wie du. Und jetzt? Vermeer seufzt. In ihm sind Abwehr und Missbehagen, Zweifel über Zweifel! Ist Bramer wirklich der große Maler, für den man ihn hält — selbst im Regentenhaus der Oranier? Wird sein Name die Jahrhunderte überdauern? Ist seine Kunst nicht ebenso wie eben seine Rede war: geschmeidig, voll greller Lichtkontraste, auf Effekte berechnet! Kein Licht, das von innen kommt — wie bei Rembrandt, und doch soll es Leute geben, die beider Bilder verwechseln!... Vermeer knackt einen Gelenkknochen auseinander, ohne seine Überlegungen zu unterbrechen. Hat Bramer selbst beherzigt, was er mir nahelegt, ist er dem bequemen Erfolg ausgewichen? Gewiss nicht! Er macht sich groß, weil er zu gefallen und zu blenden weiß. Ob es ihm bewusst ist, ob er nicht fürchtet, durchschaut zu werden?
Vermeer beobachtet, wie Bramer zwischen zwei Fleischhappen bald diesem und bald jenem aus der Tischrunde zutrinkt, der ihm gerade seine Bewunderung ausspricht. Wie er es genießt, hofiert zu werden! Wie er sich in seinem Ruhm sonnt!
Nein, überlegt Vermeer weiter, der ist so sehr in sich selbst vernarrt, dass er sich für das Maß aller Dinge hält. Mein Vorbild kann er nicht sein, nicht mehr sein! So vermessen es sein mag, wenn ich — ein Geselle noch — einen Mann in meiner Achtung herabsetze, der so eine gewichtige Stimme in der Lucasgilde hat. Eins schwöre ich: Ich werde gegen Euch antreten, Mijnheer Bramer. Arbeiten will ich, hart sein gegen mich. Meinen Erfolg werde ich mir nicht leicht machen. Er wird jeder Prüfung standhalten müssen. Anders ist er ohne Wert!
»Du hast als einziger mein Ohrgehänge noch nicht bewundert!« Catarinas vorwurfsvolle Stimme schreckt Vermeer aus seinen Gedanken. »Gefällt es dir etwa nicht?«
Es würde mir besser gefallen, wenn ich es dir hätte schenken können, möchte er antworten, doch laut werden lässt er seinen Missmut nicht. Catarina müsste ihn für kleinlich und eifersüchtig und wohl auch für undankbar halten.
»Perlen sollen Geheimnisse hüten — heißt es — ich hoffe nur, sie murmeln dir keine ins Ohr, die du mir vorenthältst.« Er lacht aufgeräumt. »Nein, Meisje, sei ganz beruhigt: sie stehen dir ausgezeichnet!«
Übermütig und ein bisschen kokett reckt Catarina den Hals, dass die Perlen pendeln und die Ringellöckchen vor den Ohren wippen. Das hochgesteckte Haar leuchtet zwischen Blond und Kastanienbraun.
Meine Frau! denkt Vermeer, daran muss ich mich erst gewöhnen.
»Kneif mich, Trijntjen«, flüstert er, »damit ich weiß, dass ich nicht träume!«
»Ich werde mich hüten«, antwortet sie, »denn mir scheint, du träumst wirklich, und zwar nicht unangenehm!«
Sie hat nicht ganz unrecht. Vermeer träumt. In Gedanken spannt er einen Rahmen um sie und lässt sie zu einem Bild werden.
Wie dieses helle Blau sie kleidet! Wie der breite Schulterkragen die schmale Taille betont! — Ein wie guter Maler müsste man sein, um all diese Reize einzufangen! Wäre nicht allein der Versuch vermessen?
Um sie herum summen die Gespräche, ohne sie zu berühren. Wie unter einer Glasglocke scheinen beide von ihrer Umwelt gelöst. Sie sehen sich an. Sie gehören einander. Doch einen Augenblick später zerbricht der Zauber. Ein Wort holt sie in die Gesellschaft der anderen zurück.
Küchenmägde räumen Speisereste und Knochenteller weg, füllen Wein nach und stellen ein Bierfass zum Anzapfen bereit.
»Na endlich«, lobt der Hausherr, »findet ihr nicht auch, dass wir uns schon viel zu lange mit dem Essen aufgehalten haben?«
»Wie wahr, wie wahr!«, murmelt Ohm Pieters und verfolgt mit lechzender Zunge, wie das Bier in die Krüge zischt. Er hat nichts im Sinn mit dem Wein, der aus dem Welschland oder womöglich aus dem verhassten Spanien kommt und als vornehm gilt. Bier ist doch ein anderer Saft! Da kennt man die Leute persönlich, die ihn brauen. Jeder nach eigenem Rezept. Vor fünfzig Jahren —als Ohm Pieters noch jung war—, da konnte man stolz sein auf Delft und seine Brauereien! An die hundert gab es damals. Doch dann kam der Krieg mit den Spaniern. Sie nahmen ein Zehntel der Einkünfte und unterbanden die Ausfuhr. Als Holland sich befreit hatte, waren die Haarlemer, Dordrechter und selbst die Bredaer den Delftern zuvorgekommen. Eine Affenschande, schimpft Ohm Pieters in sich hinein, heute sind es nur noch um die zwanzig Brauereien in der Stadt.
Mit beiden Händen umspannt er den Trinkkrug, damit nur ja nicht ein Tropfen des hochgeschätzten Gebräus verloren geht. Wenn es nicht so laut wäre, könnte man hören, wie es die hagere Kehle hinuntergluckst. Mit einem Laut des Behagens streift er mit dem Handrücken den Schaum aus den Bartstoppeln.
Auch Reynier Vermeer, der Hausherr, wird lebendig. Er erzählt das große Abenteuer seines Lebens: die Geschichte von der gefährlichen Prügelei, bei der er fast zum Mörder geworden wäre. Achtundzwanzig Jahre liegt das Ereignis zurück, und seitdem wird es bei jeder Familienfeier im Hause ,Mechelen‘ zum besten gegeben. Jedes Mal ein bisschen anders, mit neuen Ausschmückungen, von deren Wahrheitsgehalt der Erzähler aber offensichtlich selbst überzeugt ist.
Belustigt hört Catarina zu. Sie sucht Ähnlichkeiten zwischen ihrem Mann und seinem Vater. Wie er wohl im. Alter sein wird? Ob er — wenn ihre Kinder heiraten werden — auch so dasitzen und von seiner Jugend schwärmen wird? Und prahlen, was er einstmals für ein ganzer Kerl war! Bei dieser Vorstellung muss Catarina lachen. Es ist einfach nicht vorzustellen. Zu fern liegt der Jugend das Alter. Umgekehrt muss es wohl anders sein. Reynier Vermeer jedenfalls erzählt seine Geschichte so taufrisch, als habe sich alles erst gestern zugetragen. Selbst die Wochentage gibt er vor, noch genau zu wissen, und das dazugehörige Wetter. Na, ob er sich das nicht selbst einredet!
Die Tischordnung lockert sich. Die Älteren hocken zusammen, um gemeinsame Erinnerungen aufzufrischen. Die Jüngeren suchen Bewegung bei Tanz und Spiel, bei Zerstreuungen, die nicht vom Gestern zehren.
Vorüber ist die blaue Stunde. Gelbliche Bienenwachskerzen brennen in den Tischleuchtern. Im Kamin prasseln große Buchenscheite. Jetzt, wo die Klarheit des Tages der geheimnisvollen Dämmerung gewichen ist, wird es erst recht gemütlich. Es ist die Schummerstunde, in der die Großmütter am Spinnrocken sitzen und den Enkeln Märchen und Spukgeschichten erzählen, die Stunde, in der im Hochsommer samtene Fledermäuse geräuschlos ihre gezackten Flugbahnen ziehen und die alte Mär aufleben lassen, dass in ihnen die Seelen der Verstorbenen weiterleben. Doch noch ist das Frühjahr kaum vorüber. Die einzigen Schatten, die hier über die Wände huschen, sind die Schatten der lebhaften Hochzeitsgäste — gespenstisch vergrößert durch den Abstand zwischen Licht und Wand. Wärme und Güte strahlt das Kerzenlicht auf die Gesichter, als leuchteten sie von innen heraus — ganz so, wie Hollands zur Zeit größter Maler — Rembrandt van Rijn — sie wiedergibt.
Catarina und Vermeer werden in den Trubel einbezogen. Gerade werden sie in ein großes Geflecht aus Weidenruten gezerrt, das die Form einer Fischreuse hat. Verdutzt gucken sie sich an.
»Was soll das nun wieder?«
»Keine Ahnung!« Abwarten! Brautjungfer Cornelia stellt sich neben den Korb, rafft den Rock und verbeugt sich mit einem Knicks gegen das Publikum. Keck trägt sie ihr Gedicht vor:
»O süße Sklaverei!
Sie stellen sich allhier
Nur Ruh und lauter Lust
Mit großer Hoffnung für.
Die Reuse ist das Bett,
Danach so viele streben,
Danach mit brünstigem
Verlangen sich begeben —«
»Natürlich! Daher weht also der Wind!«, flüstert Catarina ihrem Mann zu. »Keine Hochzeit ohne Anzüglichkeiten!« Vermeer aber lacht nur und hört weiter zu:
»— Der Eingang ist sehr weit,
Der Ausgang aber eng.
Zuerst ein großer Ernst,
Hernach ein schwach Gedräng.
Inwendig ist viel Lärm
Und wunderliche Ränke,
Dass sich der Beste auch
Darüber heftig kränke —«
»Liebster«, tuschelt Catarina wieder, »die wollen uns die Laune verderben!«
»Nicht ärgern, Trijntjen«, flüsterte Vermeer zurück, »neidisch sind sie, nichts als neidisch!«
Die Belehrung geht weiter:
»Davon muss jedermann
Genug gewitzet sein,
Dennoch will jedermann
Daran und auch hinein!
Ein jeder meint hier fest,
Das Beste aufzudecken,
Er werde nichts
Als Freud und Honig schlecken.
Doch — wenn er erst gepflücket,
Das Blümlein seiner Braut,
Wird aller Süßigkeit
Betrübtes Ziel geschaut
Es ist ein stählern Recht,
Man kann nicht wiederkehren,
Drum mancher anders sich
muss lassen dann belehren.
Das Joch liegt an dem Hals,
Und wer nicht beugen kann.
Heißt leicht ein tolles Weib
Und störrisch’ Ehemann —«
»Nun reicht’s aber bald!« schimpfte Catarina halblaut.
»— Der Pfahl, woran der Korb
Mit Stricken ist gebunden,
Wird nur der bleiche Tod ...«
»Jan, halt mir die Ohren zu!« Catarina wird heftig, schlingt die Arme um seinen Hals und küsst ihn, zum Trotz aller Schwarzseherei.
»Trijntjen!«, tadelt ihre Mutter, »Trijntjen, benimm dich!«
»Vor dem Tod wird jedes gute Benehmen überflüssig!« rechtfertigt Catarina sich.
Etwas verwirrt bringt Cornelia den Vers zu Ende. Sie hatte sich mehr Zustimmung versprochen. Schließlich ist das doch keine selbst gedrechselte Reimerei, sondern von einem anerkannten Dichter geschrieben, von Jacob Cats! Das muss sie Catarina noch unbedingt beibringen. Dann wird sie wohl dumm gucken, denn über Dichter spottet man nicht!
Und so fällt der Abgangsknicks der Brautjungfer Cornelia etwas oberflächlich aus. Wer lässt sich schon gern kränken!
Catarina geht zum Kamin hinüber, streckt dem Feuer die Hände entgegen, als wären sie kalt. Die Flammen züngeln hell an den Rändern der oben liegenden Scheite entlang, bis sie in einem abgespaltenen Span eine Angriffsfläche gefunden haben, um aufzulodern. Dann geht es ihnen wie den Kloben darunter: sie werden vom Feuer aufgezehrt, bewahren glühend noch ein Weilchen ihre Form, um dann in einen Gluthaufen zusammenzusinken, auf den mit Rumpeln, Knistern und Funkensprühen die halb verbrannten Stücke nachrutschen. Würziger Harzgeruch steigt aus der Flamme hoch.
Dieses Gedicht! Dieses verflixte Gedicht! Es geht Catarina nicht aus dem Sinn. Gewiss war es als Spaß gemeint, aber es lag ein Ernst darin, der sie bedrückt. Ist es nicht wirklich so, dass sie sich diesem Mann mit Namen Joannes Vermeer auf Gedeih und Verderb ausgeliefert hat? Kennt sie ihn gut genug, um sicher zu sein, dass sie es nie bereuen wird? Wie viele Menschen haben sich in dieser Frage schon geirrt. Auch ihre Eltern ... Sie war damals zehn Jahre alt, als sie sich trennten. Sie blieb mit ihrer Schwester bei der Mutter, der Bruder beim Vater. Gewiss, ihre Mutter — Maria Tins — war eine Frau, die genug Energie aufbrachte, das Leben allein zu meistern — aber wie bitter muss für sie die Erkenntnis gewesen sein, als sie sich eingestehen musste, dass sie sich in dieser entscheidenden Lebensfrage geirrt hatte!
Catarina läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Nur das nicht! Niemand kann in die Zukunft sehen, niemand kann einem anderen Menschen ins Herz sehen. Außerdem können Menschen sich ändern. Insgeheim bekreuzigt sie sich: Möge die Muttergottes sie vor solchem Kummer bewahren! Möge Bramers Wort für sie Gültigkeit haben und bewahren: Vorher jeder ein Einzelner, schließen sich zwei Menschen zusammen zu einem Paar ... einander unentbehrlich, wie ein Perlohrgehänge erst in Verbindung mit dem zweiten sinnvoll ist.
»Nanu Trijntjen! Erst so viel Hitze — und jetzt stehst du da, als ob du frierst!« Vermeer legt den Arm um ihre Schulter. »Komm, lass uns tanzen!«
Catarina nickt und stellt sich in die Ausgangsposition. Mit einem sicheren Gefühl für Rhythmus umtanzt sie Vermeer mit possierlichen Sprüngen. »Auf dem Lande wurde immer nach dem Dudelsack getanzt«, sagt sie dabei, »eigentlich war das viel lustiger als nach der Fiedel!«
»Von Katzendärmen könnte man eigentlich auch nur Katzenmusik erwarten. «
»Oh, Jan«, lacht Catarina, »manchmal kannst du sogar Witze machen!« Stunde um Stunde ist vergangen. Schon graut am Horizont der erste Schimmer des neuen Tages.
Reynier Vermeer gähnt unverhohlen. Niemand beachtet es. Seine Frau, Dignum Balthasarsz, versäumt es, neue Kerzen auf die Messingleuchter zu stecken. Niemanden stört es.
Catarina sieht blass und übernächtig aus. Vermeer zuckt die Achseln. Man kann die Gäste schließlich nicht hinauswerfen. Sie machen keine Anstalten, sich zu verabschieden.
Lärmend, wenn auch mit schwerer Zunge, schwärmt Leonard Bramer vom lichten Lande Italia, wo die Weine so feurig wie die Frauen sind: »Freunde, war das ein Leben! Ein Künstler gehört nach Italien — sage ich euch — Venedig! Florenz! Mantua! Siena! Bologna! Neapel! Padua! — Ihr wisst nicht, was diese Namen bedeuten! Meine Fußspuren — überall sind da meine Fußspuren! Und Rom! Ach Rom!« Bramer seufzt tief und schmerzlich.
»Da gab es eine Kneipe ,Della rossa‘. Ich war Stammkunde. Eines Tages sitz ich dort mit einem päpstlichen Bäcker — Tommaso hieß er — und dem Mailänder Kollegen Giovanni Antonio di Francesco. Wir kommen ins Handgemenge mit einem flämischen Maler — nannte sich da großmächtig ,Leonardo‘ —, na eigentlich mehr ein Säbelgemenge, und damit die Geschichte noch internationaler wird, mischt sich als Friedensstifter noch Claude Lorrain ein. Aber das ist ihm schlecht bekommen — sag ich euch —, bekam ’ne hübsche Kopfwunde, und uns steckte der Carabiniere hinter Gitter. — Herrlich! — In Rom trifft sich die Welt!«
Bramer lallt alte Bentlieder von damals. Plötzlich sackt sein Körper gegen den rechten Nachbarn. Abraham Dissius fängt ihn auf, setzt ihn zurück gegen die Stuhllehne, schüttelt ihn durch. Vergebens! Dahin ist alle Würde! »Wir müssen ihn nach Hause bringen, solange wir noch dazu in der Lage sind«, entscheidet er.
Damit ist das Fanal zum Aufbruch gegeben. Muhme Geertje versetzt ihrem Pieters einen unsanften Rippenstoß, sodass der im Anschwellen begriffene Schnarchlaut in seiner Kehle jäh abreißt. Erschreckt reißt er die Augen auf, ohne zu sehen, und greift mit den Händen ins Leere, als ob er nach den Bettkanten tastet.
»Komm! ’s wird höchste Zeit!«, befiehlt Geertje, und widerspruchslos lässt sich der Alte wie ein Kind an die Hand nehmen.
Die Gäste sind gegangen. Vermeer und Catarina sehen ihnen vom Fenster her nach, wie sie in unterschiedlicher Richtung den großen Marktplatz überqueren, und horchen, wie die Schritte und Stimmen allmählich verhallen. Die Eltern verriegeln die Haustür. Irgendwo miaut eine Katze.
Nach so viel Trubel hat die Stille etwas Beklemmendes. Niedergebrannt sind die Kerzen und haben bizarre Gebilde um sich getropft. Ein Rest Brombeerpastete steht da wie eine Ruine, deren einstige Pracht nur zu erahnen ist. Halb geleerte Gläser und Zinnteller geben ein trostloses Bild. Tabakqualm steckt in den Vorhängen. Die Stühle sind durcheinandergeraten. Verstreut liegen Geschenke herum.
»Die Gäste sind weg, Trijntjen«, bricht Vermeer das Schweigen, »und sie kommen auch nicht wieder.«
»Und wir sind allein — das meinst du doch?«
Verlegen nestelt sie an den Ösen in der Taille, an denen modegerecht der Saum des äußeren Rocks festgehakt ist.
Vermeer geht langsam auf sie zu. »In der Fischreuse hast du mich geküsst, als ob du diesen Augenblick gar nicht erwarten könntest.«
Catarina sieht zu ihm auf. »Ach, Jan — plötzlich hatte ich Angst vor all dem Ungewissen, das vor uns liegt. — Wird unsere Liebe reichen für ein ganzes Menschenleben?«
»Sie wird!« Vermeer nimmt ihre Hände in die seinen und zieht sie an sich, »was sollen solche Grillen an diesem Tag?«
Catarina lehnt den Kopf an seine Schulter: »Hast du nie gehört, dass fast jede Braut während der Trauung weint. Rat mal warum!« Ohne eine Antwort abzuwarten, redet sie weiter, wie zu sich selbst: »Weil so viel Schicksalhaftes darin liegt, in dem Versprechen: auf Lebenszeit. Es beglückt und bestürzt zugleich.«
Vermeer streicht ihr wortlos das Haar aus der Stirn und hält ihren Kopf in den Händen. Langsam neigt er sich über ihr Gesicht. Begehren spricht aus dem dunklen Blick. Er hebt sie hoch und trägt sie über die Schwelle des Zimmers, in dem sie wohnen werden. Erst vor den Samtvorhängen des zweischläfrigen Betts setzt er sie ab und lässt sie in die weichen Federkissen gleiten. Unter Flüstern und Küssen löst er die Kleider von ihr, zieht Schleifen und Nadeln aus dem Haar und nimmt das Ohrgehänge ab.
»Das wenigstens könntest du mir lassen!«, wehrt sich Catarina.
Vermeer aber schüttelt den Kopf. »Ganz will ich dich! Nichts darfst du mir vorenthalten!« Behutsam legt er den Schmuck auf die Eckkommode und streift dann seine Kleider ab.
Eine Stunde später löst sich Catarina aus den Armen ihres schlafenden Mannes, klettert geräuschlos aus dem in die Wandnische eingebauten Bettkasten und schlüpft in die Hauspantoffeln. Das Zimmer liegt im Zwielicht zwischen Mondschein und Morgengrauen. Nur in den Umrissen sind die Möbel zu erkennen. Es ist kalt. Das Kaminfeuer ist ausgebrannt, und die Kälte eines langen Winters steckt noch im Gemäuer. Catarina zieht die pelzbesetzte Hausjacke fester um den Leib und schleicht schrittweise auf das abgedunkelte Fenster zu. Sie öffnet einen Flügel und atmet tief die frische Luft ein, die sich wie ein feuchtes Tuch auf ihr Gesicht legt. Es wäre vernünftiger zu schlafen, aber sie kann es nicht. Alle Geräusche im Haus sind fremd. Doppelt fremd ist alles bei Nacht. Sie muss erst vertraut werden mit der neuen Umgebung.
Unter dem Fenster gluckst leise das Wasser der Voldersgracht. Catarina lehnt sich hinaus. Silbrig schimmert das Mondlicht auf seiner Oberfläche und lässt den Verlauf erkennen. Schnurgerade abgestochen sind die Kanäle, eingebettet in Ufermauern und hin und wieder überwölbt von einem Brückenbogen.
Als dunkle Silhouette ragt der Staffelgiebel des gegenüberliegenden Oudmanshuis in den helleren Himmel. Dass es aus leuchtendem Backstein gebaut ist, sieht man nicht. Das Mondlicht löscht die Farben aus. Nur Hell und Dunkel und Grautöne lässt es zu. Catarina schließt den Fensterflügel. Delft ist schön. Sie wird sich hier schnell einleben!
In diesem Bewusstsein setzt sie sich in den blauen weich gepolsterten Lehnstuhl. Noch hat der Alltag nicht angefangen, noch hat er keine Macht über sie. Diese Stunde gehört ihr und ihren Träumen.
Vorher jeder ein Einzelner, schließen sich zwei Menschen zusammen zu einem Paar ... das Ohrgehänge. Catarina holt es und rückt den Sessel so, dass sie sich im Spiegel sehen kann. Wie geheimnisvoll die Perlen schimmern! Wie viel sie gemeinsam haben mit dem Mondlicht! Wie sie zusammenpassen: die Perlen und das Mondlicht. Beide haben das gleiche geheimnisvolle Silberlicht. Sie strahlen es nicht aus, sie geben es nur zurück! Catarina befestigt den Schmuck und sieht in den Spiegel. Ist sie das wirklich? Dieses fremde Gesicht gehört ihr? Es ist bleicher und schöner als am lichten Tag.
Wie viel Gesichter hat ein Mensch, fragt sie verwundert in den Spiegel hinein. Irgendein Philosoph soll einmal gesagt haben, man könnte nicht zweimal in den gleichen Fluss sehen — wie viel weniger zweimal in das gleiche Gesicht! Alles ändert sich. — Es muss wohl so sein.
Das Mädchen mit der Perle
2. Kapitel
Es geht nicht recht voran mit dem Bild. Bei allem Fleiß nicht. Unwillig wühlt Vermeer in den Skizzenblättern, die über den ganzen Tisch verstreut liegen: Kompositionsstudien nach Jacob van Loo, Bewegungszeichnungen nach Rembrandt van Rijn — doch was nützt das alles! Es reimt sich nicht zu einem Neuen zusammen. Alles zu schulmeisterlich, zu blutlos! Doch das Bild muss gemalt werden. Die Aufnahme als Meister in die St.-Lucas-Gilde hängt davon ab. Deshalb muss es auch ein Thema sein, das den bildungsbeflissenen Dekanen zusagt, ein Thema aus der antiken Mythologie. Vermeer hat sich für ,Diana mit den Nymphen‘ entschieden. Eine Gruppe anmutiger Frauen — was könnte leichter sein, hatte er gedacht. Doch wie viel Möglichkeiten des Sitzens, Sichneigens und Hockens gibt es! Alles soll zueinander stimmen!
Mit drei schnellen Schritten ist er an der Tür.
»Trijntjen!«, ruft er unüberhörbar die Treppe hinunter, »komm doch eben mal!«
Catarina bäckt gerade Kringel in siedendem Fett, als sie Vermeer rufen hört. »Ausgerechnet jetzt!«, seufzt sie, hakt den Kessel von der Kette des Rauchfangs und rückt mit dem Fuß den Metallständer heran, um den Kessel daraufzustellen. Doch ihre Bewegung war zu hastig, die Kelle rutscht klatschend in das Fett. Es spritzt auf, und Catarina spürt einen brennenden Schmerz auf der Hand.
»Trijntjen!« Vermeers Stimme wird ungeduldig, »wo bleibst du denn bloß!«
»Ich komm doch schon«, ruft sie zurück, »ich hab mich nur verbrannt.«
»Ungeschick lässt grüßen — mir scheint, du musst noch viel lernen als Hausfrau.«
Catarina schluckt ihre Tränen hinunter und sagt nichts.
Vermeer rückt ihr einen Sessel vor die Füße. »Setz dich mal nach halb rechts, den Kopf zum Fenster — ja — und den rechten Fuß vor — ja — so bleib mal sitzen!«
Es ist still im Raum. Nur die Fliegen summen, und ab und zu quietscht die Zeichenkohle auf dem Blatt. Kein Wort wird gewechselt. Vermeer arbeitet mit einer Konzentration, die an Verbissenheit grenzt.
Auf Catarinas Hand zeichnet sich ein großer roter Fleck ab. Sicher wird es eine Brandblase!
»Nicht die Kopfhaltung verändern, Trijntjen!«, tadelt Vermeer. Catarina hebt den Kopf ein wenig an.
Die Sonnenkringel tanzen auf den Fliesen des Fußbodens. Sie tanzen wie an dem Tage, als ihre Aufnahme in dieses Haus gefeiert wurde. Damals war alles warm und sonnig. Es war eben kein Alltag wie jetzt. Sie konnte damals nicht wissen, was alles von ihr verlangt würde. Sie hatte es sich einfacher vorgestellt. Wenn ich einen Wunsch freihätte — wie im Märchen —, überlegt sie bitter, dann wünschte ich mir, in drei Personen aufgespalten zu werden. Denn jetzt soll ich für jeden im Haus eine andere sein: für die Schwiegermutter eine flinke Magd, für den Schwiegervater ein ebenso flinker Laufbursche und für Jan eine reglos-geduldige Gliederpuppe zum Abzeichnen — und das alles gleichzeitig! Catarina denkt an zu Hause, an die Mutter. Was sie wohl jetzt gerade tut?
»Trijntjen!«
Catarina schrickt zusammen, es ist die Stimme der Schwiegermutter.
»Ja — ich bin im Atelier!«, ruft sie zurück.
»Denk daran, dass du den Fisch besorgst — und kauf ihn nicht zu teuer!«
»Ja, Mutter!«
Wenn Jan mit seiner Zeichnung doch bloß bald fertig wäre! Sie muss noch zum Fischmarkt! Heute ist Freitag, da hat ein Fischgericht auf dem Tisch zu stehen. Das braucht seine Zeit. Geh ich nun zum heimischen Fischmarkt am Oude Delf in der Nieuwstraat oder zum Seefischmarkt bei der Fleischhalle? überlegt sie. Ach, ich werde Plattfisch holen und dazu Kerbel vom Kräutermarkt gleich daneben. Es wird noch genug da sein, denn nach dem Gesetz muss jeder zehnte Fisch, den die Delfter fangen, in der Stadt bleiben. Gewiss, beschließt sie, ich nehme einfach Plattfisch, auch wenn ich zu hören bekomme, dass grüne Heringe billiger gewesen wären. Die Feilscherei um jeden Stuiver ist Catarina verhasst.
Die Haustür klappt. Aus dem Stimmengewirr entnimmt Catarina, dass der Buchdrucker Dissius gekommen ist. Ihn schickt der Himmel, denkt sie, jetzt wird Jan mich aus der Starre erlösen.
Die Treppenbohlen knarren unter dem Gewicht des Buchdruckers. Ihm braucht niemand den Weg zu zeigen. Er wohnt in der Nähe und kennt sich in diesem Haus aus.
»Tag, ihr beiden!«, grüßt er von der Schwelle her, »wie geht’s so? Stör ich?«
Vermeer legt den Kohlestift aus der Hand und geht dem Buchdrucker entgegen: »Ganz im Gegenteil!«
Catarina streckt sich nach dem langen Stillsitzen und will mit freundlichem Nicken an Dissius vorbei. Doch Dissius hält sie am Ärmel fest. »Begrüßt man so Gäste!«
»Ach, ich müsste längst auf dem Markt sein. Du weißt ja, Jan vergisst Zeit und Stunde über der Arbeit. — Wenn du mich jetzt loslässt, kaufe ich den Fisch ein Stück größer und lade dich ein!«
»Mit dem Zoll bin ich einverstanden — kannst passieren!«
Catarina ist zufrieden. Gut hat sie das hingebogen: einen Gast, der vor der Mahlzeit kommt, muss man einladen — so verlangt es die Höflichkeit —, und man kann ihm kein ärmliches Mahl vorsetzen. Sie hat also Gründe, einen besonders schönen Fisch auszusuchen.
Als die Tür hinter ihr eingeklinkt ist, rückt Vermeer seinen Lieblingssessel mit dem blaugrauen Rhombenmuster zurecht, ohne die Löwenköpfe an der Lehne zu berühren. Er kann eine Ablenkung vertragen. Dissius weiß immer allerlei Neuigkeiten. Heute setzt er sich hastiger, als es seine Art ist, blickt aufgeregt in alle Zimmerecken, als ob es einen unerwünschten Zuhörer geben könne, und kriecht mit dem Kopf nahe an Vermeer heran. Mit gedämpfter Stimme raunt er: »Jan, etwas Furchtbares ist passiert: Marten Tromp ist tot!«
»Weißt du das sicher?«
»Leider! Es wird sich nicht lange verheimlichen lassen, aber ich bin gebeten worden, den Mund zu halten, bis die amtliche Verlautbarung herausgegeben und vom Ausrufer unter der Stadtglocke verlesen wurde.«
»Wie ist das bloß möglich gewesen! Weißt du Genaues?«
»Es heißt, er hat am 10. August bei Ter Heyde die feindliche Linie durchbrochen und wurde danach umzingelt und fiel.«
»Mein Gott! Ist das ein Schlag! Wir hatten nie einen erfolgreicheren Admiral!«
»Ja, man hatte so sehr gehofft, dass er in diesem Sommer nur eine Pechsträhne hatte, bei Nieuwpoort und Katwyk — aber einmal erwischt es jeden. Pech für uns alle.«
Vermeer schüttelt noch immer ungläubig den Kopf.
»Ich kann mich noch erinnern, als ich zur Schule kam, wurde uns Marten Tromp als bedeutendster Sohn unserer Stadt gerühmt. Damals war es, als er vor Downs die fünfmal stärkere spanische Armada vernichtete. — Kürzlich wollte jemand von dreiunddreißig Seesiegen in seiner Laufbahn wissen.«
»Die Engländer haben eben auch nicht geschlafen. Vielleicht haben wir uns zu sicher gefühlt. Und in Blake hat Cromwell wohl einen fähigen Mann.«
»Und einen gelehrigen, der Tromp die halbkreisförmige Öffnung des Geschwaders schnell abgesehen hat!«
»Das ist wohl immer so: Keine List der sogenannten Kriegskunst bleibt lange auf einer Seite, und so werden die Mittel immer gefährlicher.«
Beide Männer sitzen stumm da und denken nach. Natürlich wussten sie, dass die Engländer nach der Hinrichtung ihres Königs und der Erklärung zur Republik eine Bedrohung für die Republik der Nordstaaten bedeuteten. Als die englische Regierung die Navigationsakte herausgab, musste Holland sich wehren. Seit einem Jahr standen sich die Kriegsschiffe gegenüber. Aber stets war in allen Berichten betont worden, wie stark und wie überlegen die eigene Flotte sei. Auch sie hatten es geglaubt. Und nun diese Wendung! Dissius steht auf und geht im Zimmer umher. Die Katze springt erstaunt vom sonnigen Fensterbrett. Draußen blöken Tiere, die zum Beestenmarkt getrieben werden. Dissius sieht den Tisch mit den Skizzen.
»Ach, Jan, wir beide passen nicht in diese Welt, sitzen da wie die Trauerklöße, reden über Hollands Gedeih und Verderb, und hinterher malst du deine Dianen weiter — hätten wir einen Funken Geschäftsgeist, würdest du dir schleunigst ein Bildnis des Admirals besorgen, einen Druckstock danach schneiden oder es auf ’ne Kupferplatte ätzen, und ich würde fleißig Abzüge machen: einhundert oder zweihundert — je nachdem, wie viel zahlungskräftige Teilnehmer zur Beisetzung zu erwarten sind. Denn sicher wird er in Delft beerdigt, in seiner Heimatstadt.« Dissius lacht bitter. »Hinterher würden wir dann das Geld zählen und darum beten, dass noch recht viele Helden fallen, damit unser Geschäft blüht.«
»Der Haken ist nur«, antwortet Vermeer, »dass wir eben nicht solche Glücksritter sind, die sich rühmen, aus jeder Lage das Beste zu machen ...«
»... und dabei nur an ihrer Nasenspitze entlangsehen!«, fällt Dissius ihm ins Wort. »Glaub mir, diese Sorte Zeitgenossen wird uns noch übel mitspielen. Was unsere Väter bitter erkämpft haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit, werden sie stückweise verhökern. Dann werden sie die Gulden auf die Bank bringen und begeistert zusehen, wie die großen Gulden immer mehr kleine gebären, ohne dass sie noch irgendwas mit Arbeit zu tun hätten.«
»Doch bevor Handel und Wandel im Müßiggang erstickt sind, geht es ihnen gut. Wir dagegen werden unsern letzten Stuiver in die Arbeit stecken und dabei nur gerade so das Leben fristen. Ist das nicht auch dumm?«
»Dumm vielleicht, aber wir können uns nicht anders machen als wir sind. Du so wenig wie ich. — Wenn eines Tages ganz Delft in Trümmer sinken würde, würden viele deiner Kollegen auf diesen Trümmern sitzen und die Ruinen ,naturgetreu‘ malen, denn Sensationen verkaufen sich gut. Du, Jan, wärst nicht unter ihnen!«
Vermeer weiß es selbst. Genau das wäre der bequeme Weg zum Erfolg, ein billiger Weg zu einem billigen Erfolg.
Sie hören Catarina die Treppe heraufkommen und gehen ihr entgegen. Fisch will heiß gegessen werden!
»Ach, Trijntjen«, ruft Dissius plötzlich aus, »ich habe dir ja noch was zu lesen mitgebracht, damit du nicht geistig aushungerst.«
»Das ist sehr aufmerksam — aber erst mal wollen wir uns vor dem leiblichen Hungertod bewahren!«
»Warum sind Frauen nur so nüchtern?«, seufzt Dissius.
»Weil die Männer sie in jahrhundertelanger Erziehungsarbeit so verbogen haben«, versetzt Catarina schlagfertig. »Alles ist so von den Männern eingerichtet, dass es für die Männer gut ist.«
»Trijntjen, Trijntjen! Was sind das für ketzerische Gedanken in einem so hübschen Kopf«, wundert sich Dissius, »du bist eine Frau mit dem Verstand eines Mannes.«
»Genau das ist mein Pech«, sagt Catarina kläglich, »das reimt sich nicht zusammen. Zum Gehorchen kann man gar nicht dumm genug sein.«
»Was sind das wieder für dumme Flausen!«, schimpft Vermeers Mutter vom Tisch her, »Jan, du solltest unserer lieben Catarina klarmachen, dass die Frau dem Mann untertan zu sein hat. Schließlich ist sie aus seiner Rippe geschaffen worden, und dabei wird sich unser Herrgott sein Teil gedacht haben!«
»Gewiss, liebe Frau Mutter«, sagt Catarina, »er wusste, dass wir es nötig haben, aus einem haltbaren und dehnbaren Rohstoff gefertigt zu werden — und das ist eine Rippe im Verhältnis zu einem Lehmklumpen. Ein Regenguss und der Lehmklumpen ist hin!«
Dissius lacht von Herzen. Vater Reynier schmunzelt. Vermeer kennt solche Späße. Mutter Dignum aber bleibt vor Empörung der kleine, runde Mund offen. Was die Jugend sich heute alles herausnimmt! Es wird ein schlimmes Ende nehmen!
Inzwischen haben alle Platz genommen. Auf dem Tisch dampft der Fisch in dem würzigen Sud. Vater Reynier lässt das Tischgebet kurz ausfallen, damit nichts abkühlt. Das Gericht ist so wohlgelungen, dass Mutter Dignum für eine Weile vergisst, dass sie so vieles an ihrer Schwiegertochter auszusetzen hat.
Mit sichtlichem Behagen wischt Dissius sich den Mund ab.
»Das Rezept, Trijntjen, solltest du mal meiner Wirtschafterin verraten«, wünscht er sich, »bei mir schmeckt der Fisch immer nach rein gar nichts.«
»Ich bezweifle aber, dass deine Dame einen Rat von mir annimmt«, gibt Catarina zu bedenken, »versuchen kann ich’s ja.«
»Hast du die Bilderrahmen eigentlich schon vom Schreiner geholt, Trijntjen?«, erkundigt sich Vater Reynier.
»Nein, Vater, heute Nachmittag sollen sie fertig sein.«
»Bei welchem Schreiner lasst ihr arbeiten?«, fragt Dissius, »Habt ihr schon gehört, dass Schreiner Meurens Tochter Lina sich erhängt hat?«
»W-a-s!« Alle sehen ihn fassungslos an.
»Das hübsche Mädchen?«
»Allerdings! — Auf dem Wäscheboden hat man sie gefunden.«
Mutter Dignum fasst sich zuerst. »Sie hat es eben zu weit getrieben mit dem jungen Mannsvolk! Ich sag’s ja immer: Es nimmt kein gutes Ende mit den jungen Dingern.«
»Ich finde es erschütternd«, widerspricht Dissius heftig, »warum konnte ihr starrköpfiger Vater sie nicht den Mann heiraten lassen, dem sie sich heimlich verlobt hatte!«
Aber Dignum Vermeer findet das ganz in Ordnung. »Er musste ja schließlich an sein Geschäft denken. Und sie hätte das auch tun sollen. Als ob es nicht genug Schreinergesellen gäbe! Aber nein, einen Schreiberling vom Rathaus muss sie sich aussuchen. Das hat sie nun davon!« In sachlichem Ton wendet sie sich ihrem Mann zu: »Reynier, dann können wir natürlich nicht mehr bei Meuren arbeiten lassen, wenn das so ist!«
»Was hat denn das nun wieder mit den Bilderrahmen zu tun?«, fragt Catarina verständnislos.
»Na, erlaube mal«, entrüstet sich Dignum, »mit solchen Leuten kann man doch nicht mehr verkehren!«
»Ihr meint«, versucht Catarina zu verstehen, »weil der Vater so herzlos war, seine eigene Tochter ins Verderben zu stürzen?«
»Ach«, sagt die Schwiegermutter verächtlich, »du verdrehst auch alles! Ich meine natürlich, dass man mit den Angehörigen einer Selbstmörderin nicht reden kann. Selbstmord ist ein Verbrechen!«
»Und einen Menschen soweit zu treiben — das ist wohl völlig in Ordnung?« Catarina regt sich furchtbar auf. Sie stellt sich das junge Mädchen vor, wie sie es zuletzt gesehen hat. Was muss das arme Ding durchgemacht haben! Wie viel Verzweiflung gehört dazu, an sich selbst Hand anzulegen. Grauenvoll! — Und jetzt wird man die Leiche jenseits der Kirchhofsmauer beim Schrei der Sünderglocke verscharren, ohne Segen, ohne Teilnahme, ohne Barmherzigkeit. Die braven Bürger werden sich noch braver fühlen und selbstzufrieden beten: ,Herr, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie diese hier‘, und sie werden es richtig finden, dass sie sich selbst gerichtet hat, ein Sünder weniger! Auch das ist im Grunde nichts anderes als eine Hexenverbrennung, denkt Catarina bitter. Leise und unsäglich traurig sagt sie dann: »Verzeiht, Mutter, Ihr findet es anmaßend, wenn ich es ausspreche, aber mir scheint: Ihr habt keine Güte!«
Dignum sieht Catarina völlig verwirrt an. Wäre jene nicht so ernsthaft zerknirscht, würde sie es ihr wohl heimzahlen. So aber spürt sie ganz unerwartet ein Schuldbewusstsein aufkeimen, das sie niederkämpfen muss. »Aber Trijntjen«, rechtfertigt sich die Schwiegermutter mehr erstaunt als böse, »was redest du bloß! Jeder denkt doch so darüber, hier in Delft ebenso wie bei euch in Gouda!«
»Bitte, zankt euch nicht um eine Sache, die euch gar nichts angeht«, mischt sich Vermeer ein, »es ist eben geschehen, und kein Gerede — so oder so — kann es ungeschehen machen.«
Catarina möchte wohl noch fragen, woher Dignum van der Meer es wissen will, dass alle so darüber denken, da sie doch gerade eben erst von dem Vorfall gehört hat, aber sie sieht ein, dass es zwecklos ist, auch Vermeer noch zu erzürnen. So räumt sie wortlos die Teller vom Tisch und bringt sie zum Abwaschen in die Küche.
Dort setzt sie das Geschirr ab und rückt den Kübel zurecht. Wie einfach das Leben für Menschen wie Jans Mutter ist, geht es ihr durch den Kopf. Für jede Lebenslage haben sie ein fertiges Urteil bei der Hand. Sie ersparen sich jedes Kopfzerbrechen und jedes Mitgefühl. Sie ziehen auch nicht die Lehre daraus, dass sie ihren Teil dazu beitragen müssten, eine Wiederholung zu verhindern. Sie versuchen überhaupt nicht, sich vorzustellen, welches entsetzliche Drama sich da in ihrer nächsten Nähe abgespielt hat. Das Widersinnigste aber ist: Auf der Bühne würden sie ein solches Drama schön finden und blutige Tränen darüber vergießen.
Auf der Schwelle ins Wohnzimmer prallt sie fast mit Dissius zusammen, der sich verabschieden möchte.
»Trijntjen, du warst so lustig und munter, als du herkamst«, sagt er leise, »schade, dass du es nicht mehr bist! Und — wenn ich dir einen Rat geben darf — versuch nicht deine Schwiegereltern zu ändern, du verärgerst sie nur und machst dir selbst das Leben sauer. — Hier ist das Buch, das ich dir mitgebracht habe. Vielleicht lenkt es dich ein bisschen ab.«
»Danke!« Catarina antwortet lauter, damit es nicht den Anschein hat, als dürften die anderen es nicht hören, »sobald ich ein Stündchen Zeit finde, werde ich es lesen.«
»Kannst du noch einen Augenblick warten, Abraham?«, wendet sich Vermeer an seinen Freund, »ich packe nur meine Skizzenblätter zusammen und geh ein Stück mit dir. Mir fällt gerade ein, dass ich mal mit Carel Fabritius darüber reden sollte. Es scheint, also ob ich allein nicht über den toten Punkt hinwegkomme. Ein Unbefangener sieht leichter, woran es hapert.«
»Die Nymphen machen dir wohl sehr zu schaffen«, lacht Dissius, »man soll sich nicht mit mehreren Frauen zugleich einlassen.«
Die Haustür schlägt hinter den beiden Männern zu. Die alten Vermeers gönnen sich ein Ruhestündchen. Catarina räumt in der Küche auf. Sie beeilt sich. Vielleicht gewinnt sie dann Zeit, sich das Buch anzusehen.
Oben, in Vermeers Arbeitszimmer, sitzt sie mit angezogenen Beinen auf dem Sessel mit den Löwenköpfen und dem Rhombenmusterbezug. Neugierig blättert sie in dem Buch. Es ist eine Übersetzung aus dem Italienischen:
Sonette von Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici — wer war das doch, überlegt sie, ach ja, der Florentiner, den sie ,il Magnifico‘ — den Prächtigen — nannten, für den Leonardo und Michelangelo gearbeitet haben. Ein Lesezeichen rutscht heraus, und das Buch fällt in der Mitte auf. Catarina liest, um den Klang der Worte zu erfassen, laut:
»Es liegt in der Natur von Verliebten, / sich traurigen Gedanken und der Melancholie hinzugeben, / welche, inmitten von Tränen und Seufzern, / ihrem Liebeshunger als Nahrung dienen, / und das, während gleichzeitig / die stärkste Lust / und eine unermessliche Süßigkeit des Gefühls sie durchflutet. / Der Grund dafür ist, glaub ich: Dass Liebe, wenn sie einzigartig und anhaltend ist, / aus einer mächtigen Einbildungskraft schöpft.«
Catarina lässt das Buch in den Schoß fallen. Es klingt sehr gefühlvoll und tiefsinnig, aber ich kann nichts damit anfangen, denkt sie. Warum hat Dissius wohl das Lesezeichen gerade an diese Stelle gelegt? — Denkt er, ich sei deshalb nicht mehr so lustig und munter, weil ich mit dem Zustand des Verliebtseins nicht fertig werde? — Komisch! — Heute müsste er wohl gemerkt haben, dass es viel nüchternere und alltäglichere Dinge sind, die mir zu schaffen machen.
Sie streift sich mit den Fußspitzen die Schuhe von den Hacken und wickelt die untergesteckten Füße mit dem Rock ein. Zusammengekringelt wie eine vor Behagen schnurrende Katze genießt sie es, allein zu sein. Weit geöffnet ist das Fenster zum Grooten Marctveld. In der Nieuwe Kerk wird Orgel gespielt. Catarina horcht darauf, aber der Straßenlärm verschluckt die leiseren Passagen. Wie lange war sie nicht mehr in einer Kirche! Alle Stadtkirchen sind Kirchen der Reformierten. Katholiken müssen zur Andacht in ein Dorf gehen. Deshalb auch wurden sie in Schipluyden getraut. Dirk Scholl scheint wirklich ein ausgezeichneter Organist zu sein — man müsste es besser hören können. Warum sollte sie nicht einfach hinübergehen und zuhören! In einer Kirche, die so groß und weiträumig ist, dass die Delfter dort mit Kindern und Hunden spazierengehen, wird niemand auf sie achten!