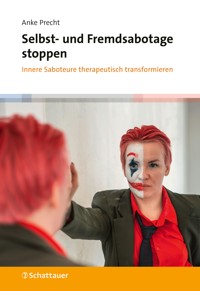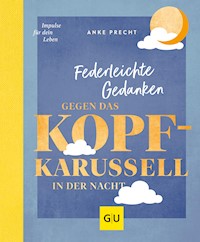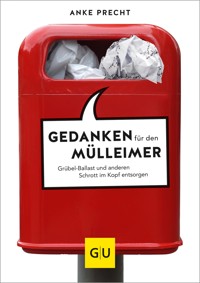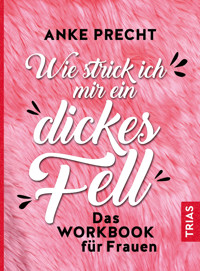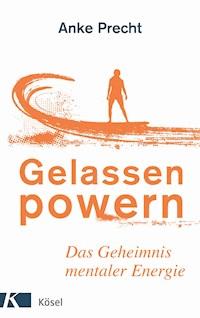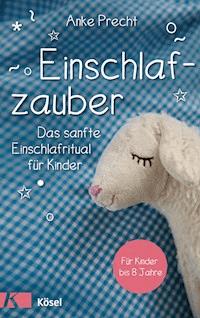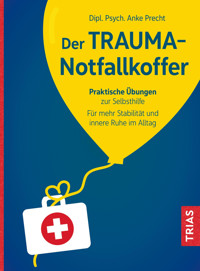
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
Erste Hilfe bei Trauma
Traumata sind sehr vielfältig und reichen vom Bindungstrauma bis zur Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Viele werden durch Trigger immer wieder neu aktiviert und machen dadurch den Betroffenen das Leben schwer. Häufig werden traumatisierte Menschen von heftigen Gefühlen wie Angst und Wut überschwemmt. Andere spüren sich gar nicht mehr richtig, greifen gar zu Suchtmitteln oder neigen zu selbstverletzendem Verhalten.
Um die Symptome von Traumafolgestörungen zu lindern, bietet der Trauma-Notfallkoffer:
- Alles Wissenswerte, um Traumata zu verstehen,
- Vielfältige Möglichkeiten zur Selbsthilfe,
- Praktische Übungen und Tipps aus der therapeutischen Praxis.
Für mehr Stabilität und innere Ruhe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Trauma-Notfallkoffer
Anke Precht
1. Auflage 2023
30 Abbildungen
Dank
Als ich in den 90er-Jahren Psychologie studierte, steckte die Traumatherapie noch in den Kinderschuhen. An der Uni hörte ich überhaupt nichts davon! Seitdem ist unglaublich viel passiert. Konnte man früher Menschen mit Traumafolgestörungen psychotherapeutisch nur wenig helfen, können sie jetzt wieder gesund werden und ein glückliches Leben führen. Sogar schwerste seelische Verletzungen können heilen und sich in Stärke verwandeln. Viele Psychologen und Ärzte haben in den letzten 30 Jahren Pionierarbeit geleistet und Methoden erforscht und praktisch entwickelt, die genau das ermöglichen. Bei vielen von ihnen durfte ich persönlich lernen, und ich bin ihnen für immer dankbar dafür, dass sie ihr Wissen so großzügig geteilt haben. Agnes Kaiser-Rekkas, Fred Gallo, Peter Levine, Maggie Philipps, Arne Hofmann, Luise Reddemann und Michaela Huber, aber auch Jeanne Achterberg, Wolf Büntig und Stan Lifschitz waren wundervolle Lehrer*innen, die mich inspiriert und immer wieder ermutigt haben. Ich trage ihr Wissen weiter, so gut ich es kann.
Gleichzeitig bin ich den Menschen, die mit ihren Erfahrungen in meine Praxis gekommen sind und mir ihre Geschichten erzählt haben, mir vertraut und mich auch manches Mal gefordert haben, zutiefst dankbar. Sie waren meine wertvollsten Lehrer. Wir haben schwere, aber auch wundervolle Erfahrungen gemacht. Gelacht und manchmal auch geweint, und nicht nur erlebt, was die Seele bewegt und was sie aushalten kann – wir waren auch Zeugen, was zu lösen bereit und in der Lage die Seele ist, über wie viel Kraft sie verfügt und über welchen großen und wilden Lebenswillen, und wie genau sie sich erinnert an das, was sie in der Tiefe immer war und ist, ganz egal, wie sehr sie verletzt wurde. Sie wartet, bis sie sich wieder entfalten kann. Meine Arbeit und die Menschen, die zu mir kommen, beschenken mich immer wieder aufs Neue. Danke dafür, jedem Einzelnen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
viele Menschen leiden unter den Folgen eines Traumas. Manche wissen von ihrem Trauma und erleben immer wieder Momente, in denen sie sich daran erinnern. Andere sind sich ihres Traumas nicht bewusst, erleben aber immer wieder unerklärliche Gefühle oder Schmerzen, die sie nicht einordnen können und die sie nicht verstehen.
Traumata können tiefe Spuren in der Seele eines Menschen hinterlassen. Und doch sie sind heilbar. Das ist die gute Nachricht. Egal, wie tief ein Mensch verletzt wurde: Seelische Wunden können wieder heilen. Zurück bleibt nicht der Mensch, den es vorher gab – sondern ein gereifter und stärkerer Mensch. Einer, der an den Erfahrungen, die er gemacht hat, gewachsen ist.
Der Weg dahin ist nicht immer einfach. Viele Therapien versprechen Heilung von Traumata, nicht alle können dieses Versprechen einhalten. Damit du weißt, wie du eine gute Therapie findest und welche Kriterien du bei der Suche beachten solltest, habe ich deshalb das Kapitel ▶ »Welche Therapien helfen« genau dieser Frage gewidmet. Heilung ist möglich, und es lohnt sich, den Weg zu gehen. Heilung ist möglich. Für jeden, der betroffen ist, auch für dich.
Bis es so weit ist, und solange du in deinem Alltag immer noch Folgen eines Traumas spürst oder einfach erlebst, dass du immer wieder einmal in Gefühlszustände hineinrutschst, die dich belasten und die schwer auszuhalten sind, kannst du viel für dich tun. Dafür ist dieses Buch da. Ich habe hier meine Erfahrungen zusammengetragen, die ich in über 20 Jahren mit vielen Patientinnen und Patienten gesammelt habe, welche ihre Traumata in bewundernswerter Weise getragen und überwunden haben. Ich durfte viele bewegende Heilungsprozesse miterleben und habe nie ausgelernt. Neben dem, was wir in der Therapie getan und erreicht haben, haben viele Menschen eigene Ideen und Strategien entwickelt und mitgebracht. Viele davon sind in dieses Buch eingeflossen.
Warum aber sollte man sich um die Folgen eines Traumas kümmern? Es ist wichtig, traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit zu bearbeiten, weil sie die Tendenz haben, sich immer wieder in das gegenwärtige Leben einzuschleichen. Plötzlich tauchen Gefühle auf, die gar nichts mit einer aktuellen Lebenssituation zu tun haben, sondern nur durch sie ausgelöst werden, zum Beispiel während eines Streits. Dann empfindet man die alten Gefühle, die eigentlich Erinnerungen sind, als real und als aus der Gegenwart entstanden. Das macht das Leben oft schwer, und es ist sinnvoll, das zu ändern. Warum traumatischen Erfahrungen in der Gegenwart zurückkehren, erfährst du im Kapitel ▶ »Verschiedene Arten von Traumata«. Dort erfährst du auch, woran du erkennen kannst, ob du an einem Trauma leidest, was die klassischen Zeichen dafür sind, wie man sie verstehen kann und warum das so ist. Und du wirst erfahren, dass auch Umstände zu Traumata führen können, die nichts mit Gewalt oder Naturkatastrophen zu tun haben.
Während ein unbearbeitetes Trauma einen Menschen schwächt, bewirkt ein geheiltes Trauma genau das Gegenteil: Menschen, die ein Trauma hinter sich gelassen haben, emotional und körperlich, gehen gestärkt aus dem Verarbeitungsprozess hervor. Wir sprechen dann von posttraumatischem Wachstum und ich bin sicher: Es gibt auf der Welt keinen wahrhaftig starken Menschen mit einer leichten Vergangenheit. Nicht selten sind gerade jene Menschen, denen die Lebensfreude aus allen Poren strömt und die auch in schwierigen oder dramatischen Situationen klar und wahrhaftig belastbar bleiben, solche, die in ihrer Vergangenheit schon viele Verluste erlitten und viele Verletzungen erlebt haben. Traumata fordern uns auf, über sie hinauszuwachsen. Sie werfen uns so weit aus unserer Komfortzone, dass wir uns eine Zeitlang nicht mehr zurechtfinden. Dann aber, wenn wir mit unserem Wachstum aufgeholt haben, sind wir nicht nur stärker als das Trauma – wir sind auch viel stärker als jemals zuvor und in der Regel auch glücklicher und erfüllter.
Darum geht es in diesem Buch um etwas grundlegend Positives. Deshalb schauen wir auch nach den Schutzfaktoren der Seele. Denn nicht jeder Mensch wird gleichermaßen in einer bestimmten Situation verletzt. Im Kapitel ▶ »Resilienz« erfährst du, wie du widerstandsfähig, man sagt auch resilient, wirst. Umgangssprachlich könnte man sagen: wie du dir ein dickes Fell zulegst. Aber keins von der Sorte, die alles abprallen lässt. Sondern eins, das dich weiterhin sensibel und liebevoll sein lässt, dich aber zugleich weniger verletzbar macht. Es lässt dich spüren, dass du auch in schwierigen Situationen handeln und etwas tun kannst, dass du nicht machtlos bist und dass du Stärken hast, die du jetzt jederzeit nutzen kannst.
Im dritten Kapitel widmen wir uns dann dem zentralen Thema dieses Buchs, dem ▶ Notfallkoffer. Er wird ab sofort immer für dich da sein, wenn du von belastenden Gefühlen eingeholt wirst. Er hilft dir, wenn dich etwas triggert und wenn du verzweifelt bist. Er birgt alle guten Geheimnisse, die dir Kraft geben, dich ins »Hier und Jetzt« holen, die dir helfen, aus einer Krise auszusteigen, dich zu fangen, dich zu stabilisieren, dich auf gute Weise selbst zu spüren und Flashbacks zu stoppen. Der Notfallkoffer ist dein Werkzeug für den Umgang mit einem Trauma, bevor dieses vollständig geheilt ist und sich in Stärke verwandelt hat. Den Koffer zu packen ist wie eine Schatzsuche, und ich bin sicher, dass du dabei Freude haben wirst.
Der Notfallkoffer ist immer da, wenn du ihn brauchst. Er erweitert sich und er wird dir dabei helfen, nach und nach stabiler, präsenter und glücklicher zu werden, weil du merkst: Die belastenden Seeleninhalte sind vielleicht noch da. Aber sie beherrschen dich nicht mehr. Du kannst das Leben leben, in dem du bist, und die Gegenwart immer leichter von der Vergangenheit trennen.
Übrigens spricht man im englischen Sprachraum nicht von Traumaopfern, sondern von »trauma survivors«, also Überlebenden. Diese Formulierung gefällt mir viel besser. Traumata sind Situationen, die das Überleben körperlich oder seelisch gefährden. Und diese Situationen zu überleben, ist schon eine Leistung. Wenn wir nun einen Schritt weitergehen und die Traumata verarbeiten, sodass wir sie los- und in der Vergangenheit zurücklassen können, nachdem wir aus ihnen gelernt haben und gewachsen sind, so ist noch viel mehr passiert als nur das Überleben: Wir leben intensiver und erfüllter als vorher, wir werden weise und leicht.
Zu dieser Reise möchte ich dich als Leserin oder Leser herzlich einladen. Den Weg, auf den du dich begibst, sind viele Menschen vor dir schon gegangen. Viele Menschen haben die schweren Erfahrungen ihres Lebens hinter sich gelassen. Sie sind der lebende Beweis dafür, dass das möglich ist. Du kannst den Traumanotfallkoffer nutzen, wenn du merkst: Die Vergangenheit hat zu viel Macht über dich. Du kannst ihn auch begleitend zu einer Therapie nutzen, wenn du dir zusätzlich selbst in schwierigen Situationen helfen möchtest. Er kann dir aber auch dabei helfen, insgesamt ausgeglichener zu werden und dich noch besser selbst zu entwickeln. Und natürlich kannst du parallel dein eigenes dickes Fell stärken, deine Resilienz. Damit das möglichst leicht geht, enthält das Buch neben etwas Theorie viele praktische Strategien, die einfach umsetzbar und wirksam sind.
Das Leben ist wundervoll. Es beschenkt uns reichlich, aber es schont uns nicht. Wir erleben Licht und Schatten und sind immer wieder eingeladen, den Schatten zu erleuchten und uns zu erweitern und zu lernen. Ein Weg, der im östlichen Verständnis zu tiefer Weisheit und Glück führt, meint im westlichen seelische Gesundheit, Ausgeglichenheit und innere Kraft.
Wer und wie auch immer du bist: Als Mensch kannst du in jedem Moment wachsen und dich weiterentwickeln. Die Reise ist niemals zu Ende. Die Seele ist immer bereit, Altes zurückzulassen und sich zu entfalten. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange du schon an etwas leidest, wie lange du schon wartest. Ich lade dich ein, das Helle zu stärken und herauszufinden, wie du der Mensch werden kannst, der du sein möchtest. Alles, was du sein kannst, ist schon angelegt wie die Pflanze in einem Samen, der auf Regen wartet. Vielleicht ist heute der Moment, an dem du damit beginnst den Garten zu pflegen und zu bewässern, damit das Gute, das Starke, das Sanfte und das Weise in dir wachsen kann! Dafür wünsche ich dir den Mut, dir selbst zu begegnen, das Vertrauen in die Kraft deiner Seele und in deine Liebe und letztlich auch in das Leben selbst, auch wenn wir es oft nicht verstehen.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Dank
Liebe Leserin, lieber Leser,
Trauma und Traumafolgestörungen
Was versteht man unter einem Trauma?
Was ein Trauma ist – und was nicht
Verschiedene Arten von Trauma
Erfahrungen von körperlicher Gewalt
Erfahrungen von sexueller Gewalt
Erfahrungen von seelischer Gewalt
Bindungstraumata
Unfälle
Traumata im medizinischen Kontext
Naturkatastrophen
Hitze, Kälte, Geräusche, Licht
Schwere Verluste
Verlassen-Sein
Sekundäre Traumata
Was passiert im Gehirn?
Wie reagiert das Gehirn auf ein traumatisches Erlebnis?
Frühe Traumata
Was passiert im Körper?
Was passiert in der Psyche?
Ich bin viele
Wie häufig sind Traumata?
Was sind die Folgen von Traumata?
Traumafolgen
Der normaler Verarbeitungsprozess braucht Zeit
Daueralarm als Traumafolgestörung
Posttraumatisches Wachstum
Welche Faktoren gefährden, welche schützen?
Gefährdende Faktoren
Schützende Faktoren
Einfache und komplexe Traumafolgestörungen
Trigger holen das Trauma zurück
Diagnosen bei Traumafolgestörungen
Einfache posttraumatische Belastungsstörung (PTSD)
Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (DESNOS)
Dissoziative Störung
Wie kann ein Trauma heilen?
Meistens geschieht Heilung von selbst
Welche Therapien helfen
Ganz viel kannst du selbst für dich erreichen!
Warum leiden wir unter Traumata?
Was bewirkt Selbsthilfe?
Resilienz
Die neun Resilienzbausteine
Die Selbst- und Außenwahrnehmung
Im Hier und jetzt
Selbstfürsorge
Positiver Umgang mit Zweifeln und Bewertungen
Gedanken beherrschen
Gefühle und Impulse kontrollieren
Positive Ausrichtung – Ressourcenorientierung
Zielfokussierung
Übung Zielfokussierung
Sinnorientierung
Bindungs- und Beziehungskompetenz
Neues wagen
Vegetative Balance
Das Puzzle ist fertig
Stärke deine Resilienz
Körper
Die Ernährung
Bewegung
Schlaf und Powernaps
Atmung und Entspannung
Psyche – Geist und Gefühle
Die Wahrnehmungsübung – nicht nur für den Notfallkoffer gut!
Die Komfortzone verlassen
Lernen
TV, Netflix, Social Media und Co.
Dankbarkeit
Freude und Spaß
Natur
Beziehungen
Komm in Kontakt
Nahe Beziehungen
Deine Umgebung
Wie mit Erinnerungen umgehen?
Der Notfallkoffer – es geht los!
Der Weg aus der Ausnahmesituation
Gebrauchsanweisung für den Notfallkoffer
Gebrauch in Notsituationen
Gebrauch zur Stärkung
Aus dem Notfallkoffer wählen
Der Notfallkoffer verändert sich
Der Notfallkoffer gehört nur dir
Der Koffer sollte immer vollständig sein
Der Zeitpunkt des Packens
Den Notfallkoffer finden
Packe deinen Koffer
Wie und wann?
Es geht los: Suche deine Schätze zusammen
Erinnerung an einen besonderen Menschen
Erinnerung an Wohlfühlorte
Herzensdinge
Schöne Sachen
Ein Lieblingskleidungsstück
Sticker, Bilder und Karten
Selbstgemalte Bilder, Gedichte oder Texte
Fotos
Dinge, die geliebte Menschen geschrieben haben
Geschenke von besonderen Menschen
Farbstifte, Füllfederhalter, Wolle, Knetmasse …
Der Brief an dich selbst
Eine Liste mit allem, was du an dir magst
Eine Liste mit allem, was du kannst
Eine Liste mit allem, was du schon geschafft hast
Stimmen von Menschen, die du liebst und die dich lieben
Musik und Geräusche
Liste von Dingen, die du gern isst oder trinkst
Feine süße Sachen
Chililutscher und Chilibonbons
Wärmflasche, Kirschkernsäckchen oder ein Eispad
Duschschwamm und Duschgel
Riechfläschchen mit Ammoniak oder ähnlich Scharfem
Ein Duft, der zurückbringt
Dekorative Kosmetik
Ein Rhythmusinstrument
Musikinstrumente
Meditationsanleitung oder Autosuggestionen
Menschen, die du anrufen kannst
Tätigkeiten, die dich glücklich machen
Medikamente, die du im Notfall nehmen sollst
Eine Zigarette
Bewegung
Atmen
Michels Atemübung
Die Wahrnehmungsübung
Wahrnehmungsübung
Meridianklopfen
Das Nervensystem beruhigen
Deine persönlichen Listen zum Heraustrennen
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
Trauma und Traumafolgestörungen
Traumata gibt es viele. Nicht jedes führt zu einer Traumafolgestörung. Erfahre hier alles Wichtige zu Entstehung und Folgen von Traumata.
Was versteht man unter einem Trauma?
Nicht alles ist ein Trauma, was so genannt wird. Dafür aber manches, was man darunter nicht verstehen würde.
Das Wort »Trauma« ist schon lange in der Umgangssprache angekommen. Kürzlich sagte mir eine Patientin, die Zugfahrt zu mir sei traumatisch gewesen. Was sie meinte, war nicht etwa ein Unfall oder eine Katastrophe unterwegs, sondern eine sehr anstrengende und nervige Fahrt. So, wie viele Menschen es heutzutage erleben, die mit der Bahn fahren. Der Zug war extrem voll, die Wagenreihung umgekehrt, und sie hatte ihren reservierten Platz nicht erreicht und musste fast eine Stunde lang stehen. Einen Anschluss hatte sie auch verpasst, und sie war erschöpft und genervt angekommen. Das ist kein Trauma. Denn, ob etwas ein Trauma ist, hängt davon ab, wie einschneidend eine Erfahrung ist und wie sie verarbeitet wird.
Was ein Trauma ist – und was nicht
Ein Trauma muss nicht unbedingt eine unfassbar schreckliche Katastrophe sein. Auch eher banale Erfahrungen können zu einem Trauma werden. Nicht jede Erfahrung wirkt auf jeden Menschen gleich. Es ist also ein bisschen komplizierter, und in diesem Abschnitt beschäftigen wir uns damit, was eine Erfahrung zu einem Trauma macht.
Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen von Trauma, auch in Fachkreisen. Klar ist: Ein Trauma ist entweder eine starke Verletzung oder eine massive seelische Erschütterung, die in dem Moment, in dem sie passiert, für den betroffenen Menschen nicht bewältigbar ist. Das heißt: etwas geschieht, es fühlt sich schlimm an, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Gleichzeitig sind keine Möglichkeiten vorhanden, aus der Situation zu entkommen oder sie zu verändern. Das muss nicht bedeuten, dass es objektiv keine Möglichkeit gibt. Subjektiv ist keine bewusst, und das reicht, um eine Erfahrung zum Trauma werden zu lassen.
So habe ich als Kind beim Spielen auf Felsen am Meer in Norwegen eine traumatische Erfahrung gemacht: Meine Familie baute gerade etwa hundert Meter weiter das Nachtlager in unserem Campingbus auf, während ich am Abbruch des Felsens nach kleinen Muscheln suchte. Da rutschte ich an einer besonders glitschigen Stelle den nassen Felsen hinunter und fiel ins eiskalte Wasser des Atlantiks. Ich versuchte, wieder hinaufzuklettern, aber an dem algenbewachsenen Stein rutschten meine Finger ab, die Felsen schnitten meine Hände auf. Ich schrie, aber niemand war nah genug, um mich zu hören, meine Schreie gingen im Geräusch der Wellen unter. Die nassen Kleider, die ich trug, zogen mich nach unten, jede anrollende Welle trieb mich an den Felsen, ich versuchte mich festzuhalten, ohne Erfolg, die abziehende Welle zog mich ein Stück mit heraus. Ich war in Todesangst, schrie, versuchte zu klettern, verletzte mich dabei, und machte einfach immer weiter. Da kam ein Angler zurück ans Meer. Er hatte ein Teil seiner Ausrüstung vergessen und das bemerkt, als er schon auf der Heimfahrt war. Er sah mich, und mit Hilfe seiner Angelrute, an der ich mich festhalten konnte, zog er mich aus dem Meer.
Später wurde mir klar: Ich hätte an dem Felsen entlangschwimmen können, parallel zur Küste. Ich war als Kind eine ordentliche Schwimmerin und es gab immer wieder kleine Buchten an der Küste, wo ich hätte an Land gehen können. Die nächste war nur etwa 300 Meter entfernt gewesen. Ich hätte mich retten können, aber ich wusste es nicht.
Entscheidend für die Frage, ob eine Erfahrung zu einem Trauma wird oder nicht, ist also weniger die Erfahrung an sich, das heißt, weniger die Frage, was genau passiert ist – sondern die bewusste Überzeugung einer massiven Bedrohung der eigenen Sicherheit, gegen die man nichts ausrichten kann.
Verschiedene Arten von Trauma
Ganz unterschiedliche Erfahrungen können deshalb als traumatisch erlebt werden. Manche gehören zu Ereignissen, die jeder als traumatisch bezeichnen und wahrscheinlich auch erleben würde. Andere Erlebnisse finden manche Menschen eher harmlos, während andere massiv von ihnen verletzt werden. Die Umstände und die eigene Situation geben den Ausschlag.
Erfahrungen von körperlicher Gewalt
Erfahrungen körperlicher Gewalt können auf unterschiedliche Weise gemacht werden: Das Erleben von Krieg oder Folter, aber auch das Großwerden in Familien, in denen Gewalt an der Tagesordnung ist, führen zu tiefen Verletzungen und verursachen häufig schwere Traumata. Auch Schlägereien, Konflikte, das Hineingeraten in eine heftige Auseinandersetzung, mit der man vielleicht gar nichts zu tun hat, aber in der man fürchtet, etwas abzubekommen, ein Polizeieinsatz, den man miterlebt, können traumatisierend wirken. Ein Überfall auf der Straße, bei dem man ausgeraubt wird, ein Raubüberfall, bei dem man mit einer Waffe bedroht wird, Erfahrungen terroristischer Anschläge, die Beziehung zu einem Partner, der in bestimmten Situationen körperliche Gewalt anwendet. Und auch das Großwerden in einer sozialen Umgebung, in der Gewalt häufig vorkommt, wie zum Beispiel in einem Stadtviertel, in dem Überfälle oder Schießereien an der Tagesordnung sind, kann traumatisieren. Und manchmal traumatisiert auch die Erfahrung eines Wohnungseinbruchs, bei dem der Raum verletzt wurde, in dem man sich sicher fühlt – unabhängig davon, ob man während des Einbruchs zuhause war oder nicht.
Erfahrungen von sexueller Gewalt
Sexuelle Gewalt muss nicht mit körperlicher Gewalt einhergehen, um Schaden anzurichten. Oft wird nach einem sexuellen Übergriff gefragt, ob sich das Opfer gewehrt habe oder ob ihm eine Waffe an den Hals gehalten worden sei. Auch, wenn das nicht der Fall war, können schwere Traumata entstehen. Unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen kann es unmöglich sein, sich zu wehren. Wenn ein Täter sich in einer hierarchisch übergeordneten Position befindet, das Opfer von ihm abhängig ist oder wenn beide sich in einem Vertrauensverhältnis befinden, kann das Opfer sich aufgrund sozialer Blockaden oft nicht wehren, wenn sexuelle Handlungen beginnen. Kurz gesagt: Wann immer es kein ganz klares und frei entschiedenes »Ja« zu einer sexuellen Handlung gibt, ist sie ein Übergriff, ein No-Go, das traumatisch wirken kann: Ob der Täter ein Vorgesetzter, eine Lehrerin, ein Pfarrer, ein älterer Jugendlicher oder ein Verwandter ist, spielt dabei keine Rolle. Die »Me-Too«-Debatte« hat gezeigt, wie verführerisch es für mächtige Menschen sein kann, ihre Macht auch auszunutzen.
Erfahrungen von seelischer Gewalt
Seelische Gewalt ist objektiv noch schwerer festzustellen. Wird in der Schule ein Kind gemobbt, beschimpft, öffentlich gedemütigt oder in den sozialen Medien bloßgestellt, ist die Sache klar. Wenn aber ein Kind immer wieder indirekt als dumm oder böse oder unfähig dargestellt wird, zum Beispiel, indem seine Eltern immer wieder begeistert über das Nachbarkind sprechen, das so ganz anders ist und irgendwie in allem viel besser, ist die Situation weniger eindeutig. Entscheidend ist dann die subjektive Erfahrung des Betroffenen. Wie hat das Kind die Situation erlebt?
Auch in Beziehungen entwickelt sich manchmal seelische Gewalt. Wenn ein Partner ständig kleingehalten wird oder wenn der andere auf unerwünschtes Verhalten mit Liebesentzug reagiert, kann das traumatisch wirken.
Double-Binds
Besonders perfide sind die sogenannten Double-Binds. Das sind Strukturen, in denen ein Partner zwei Möglichkeiten hat, die ihm beide zum Nachteil werden. Double-Binds finden sich überwiegend in Liebesbeziehungen und in Eltern-Kind-Beziehungen. »Ich sehe dich ja fast nie«, könnte eine alte Mutter vorwurfsvoll sagen. Und wenn dann der Sohn donnerstags mit einem Kuchen vor der Tür steht, fragt sie: »Hast du denn nichts zu tun? Du bist doch nicht etwa schon wieder arbeitslos?«
Eine Großmutter hat die Familie zum Essen eingeladen und nötigt alle, noch eine zweite Portion zu nehmen. Brav tun sie es, weil sie wissen, dass die Großmutter sonst gekränkt ist. »Schmeckt es euch nicht?«, fragt sie in solchen Situationen immer wieder. Dann, während die Enkeltochter die zweite Portion isst, die sie eigentlich gar nicht mehr wollte, schaut die Großmutter sie an, zieht kritisch die Augenbrauen hoch und stellt fest: »Hast du zugenommen? Das steht dir aber gar nicht.«
Double-Binds machen die Beteiligten schier verrückt. Sie können zu Bindungstraumata führen, zu denen ich im nächsten Abschnitt noch mehr sage.
Missachtung
Auch missachtet zu werden, kann traumatisieren. Im Zusammenhang mit Mobbing spricht man heute vom Ghosting – ein Mensch wird behandelt, als sei er ein Geist, also unsichtbar, also gar nicht vorhanden. Auch in Familien geschieht das immer wieder: Wenn ein Elternteil tagelang nicht mit einem Kind spricht, weil das in seinen Augen etwas falsch gemacht hat. Wenn ein Kind bei Entscheidungen nie berücksichtigt wird. Wenn sich in einer Partnerschaft nach einem Streit einer von beiden tagelang zurückzieht, nicht ans Telefon geht und auch keine Nachrichten beantwortet.
Eltern-Kind-Beziehung
Eine weitere Kategorie seelischer Gewalt erscheint auf den ersten Blick als das genaue Gegenteil von Gewalt. Eher wirkt es von außen und häufig auch aus Sicht der Betroffenen als eine Form besonders starker Liebe. Psychologen sprechen von symbiotischer Liebe. Das ist eine Liebe, in der die Grenzen zwischen der Personen nicht mehr klar ist. Wer das Kind beleidigt, beleidigt auch den Vater, der nimmt das persönlich und macht sofort Ärger, anstatt seinem Kind zu zeigen, wie es mit einer Beleidigung am besten umgeht. Oder eine Mutter lässt ein Kind keinen Moment allein, sie ist überzeugt, ohne sie könne es nicht sein, nicht einschlafen, sich nicht beruhigen. Es brauche sie. Aber in Wirklichkeit braucht sie das Kind und das Gefühl, von ihm gebraucht zu werden. Sie lässt es nicht frei.
Eine zweite Form dieser ungesunden Art elterlicher Liebe beobachten wir in letzter Zeit immer häufiger: Es ist die Freundschaft von Eltern mit ihren Kindern. Der Arzt und Psychotherapeut Wolf Büntig sagte in seinen Seminaren immer wieder: »Freundschaft mit Kindern ist die heute am weitesten verbreitete Form von Kindesmissbrauch.« Warum? Eltern haben ihren Kindern gegenüber eine große Verantwortung: Sie müssen sie in das Leben einführen, befähigen, mit diesem Leben selbstständig zurechtzukommen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ungesunden Verführungen zu widerstehen. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Beziehung, in der zwar beide gleich wertvoll sind, die Eltern aber mehr zu sagen haben als die Kinder und im Zweifel Entscheidungen treffen müssen, die den Kindern nicht gefallen: das Zimmer aufräumen, den Fernseher ausschalten, kein Handy haben, Hausaufgaben machen, ins Bett gehen. Diese Entscheidungen müssen Eltern durchsetzen, und daraus ergeben sich zwangsläufig Konflikte, die Eltern wie Kinder aushalten müssen.
Eltern, die die Freunde ihrer Kinder sind, begeben sich auf Augenhöhe. Sie haben Spaß mit ihren Kindern, aber sie stehen nicht mehr als diejenigen zur Verfügung, die die unangenehmen Entscheidungen treffen und dafür von den Kindern manchmal auch gehasst werden. Das ist aber wichtig, damit Kinder sich von ihren Eltern differenzieren und eines Tages ihren eigenen Weg suchen, der ganz anders als der ihrer Eltern sein kann. Behandeln Eltern ihre Kinder wie Gleichberechtigte (Achtung: Das bedeutet nicht »Gleichwertige«! Das sind Kinder so oder so, auch wenn sie weniger Rechte haben), dann nehmen sie ihnen die Chance, sich an den Eltern zu reiben und sich von ihnen zu differenzieren. Sie nehmen ihnen einen Teil ihrer Selbstständigkeit, manchmal auch einen Teil ihrer Fähigkeiten, die sich eben oft in Auseinandersetzungen entwickeln und nicht im harmonischen Miteinander, in dem alles in Ordnung ist und nichts erwartet wird.
In diesen Fällen benutzen Eltern ihre Kinder indirekt für ihr eigenes Wohlergehen. Denn es ist natürlich viel angenehmer, eine konfliktfreie Zeit miteinander zu verbringen und Kinder zu haben, die einen toll finden, als Kinder, die sauer auf einen sind und die Eltern der besten Freunde viel cooler und netter finden. Auch das kann bei Kindern zu Traumafolgestörungen führen, obwohl es in keiner Situation zu einer spürbaren Auseinandersetzung kam, ganz im Gegenteil. Es hat aber die Führung gefehlt, die Sicherheit gibt. Kinder, die die Freunde ihrer Eltern waren, haben häufig kein solides Fundament und sind Herausforderungen gegenüber nicht gut aufgestellt, wenn sie sie später allein meistern müssen.