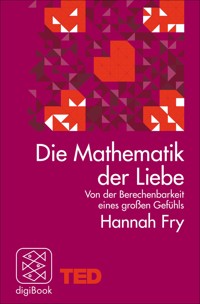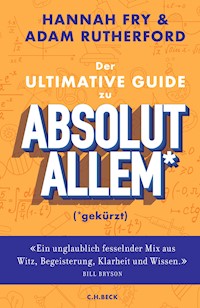
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von den Anfängen des Lebens auf der Erde bis zu den seltsamen Außerirdischen in weit entfernten Galaxien, von den dunkelsten Tiefen der Unendlichkeit bis zu den hellsten Einsichten unseres Geistes - auf einer spannenden Reise durch Zeit und Raum erzählen Hannah Fry und Adam Rutherford die komplette Geschichte unseres Universums, wobei sie lediglich einige langweilige Dinge weglassen. Unser Gehirn hat sich so entwickelt, dass es uns alle möglichen Dinge sagt, die sich intuitiv richtig anfühlen, aber einfach nicht wahr sind: Die Erde sieht flach aus, die Sterne scheinen fest am Himmelszelt zu stehen, ein Tag hat 24 Stunden... Dieses Buch ist vollgestopft mit Geschichten darüber, wie die Dinge tatsächlich funktionieren. Mit der Kraft der Wissenschaft zeigen uns Rutherford und Fry, wie wir unser Primatenhirn umgehen können. Sie nehmen uns mit auf eine Reise vom Ursprung der Zeit und des Raums über Planeten, Galaxien, die Evolution, die Dinosaurier bis hin zu unserem Verstand. Dabei ringen sie mit einigen haarsträubenden Fragen, die nur die Wissenschaft beantworten kann:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hannah Fry &Adam Rutherford
Der ultimative Guide zu absolut Allem*
(*gekürzt)
Aus dem Englischen von Hans-Peter Remmler
C.H.BECK
Zum Buch
«Eine unglaublich fesselnder Mix aus Witz, Begeisterung, Klarheit und Wissen.»
– Bill Bryson
Von den Anfängen des Lebens auf der Erde bis zu seltsamen Außerirdischen in weit entfernten Galaxien, von den dunkelsten Tiefen der Unendlichkeit bis zu den hellsten Winkeln unseres Geistes – auf einer spannenden Reise durch Zeit und Raum erzählen Hannah Fry und Adam Rutherford die komplette Geschichte unseres Universums, wobei sie lediglich einige langweilige Dinge weglassen.
«Adam Rutherford und Hannah Fry haben die Gabe, das Leben, die Zahlen und die Kräfte, die im Universum wirken, noch reicher, seltsamer, lustiger und wunderbarer erscheinen zu lassen.»
– Stephen Fry
Über die Autoren
Hannah Fry ist außerordentliche Professorin für Mathematik am University College of London, Science-Autorin und Radiojournalistin. Bei C.H.Beck ist von ihr lieferbar: Hello World. Was Algorithmen können und wie sie unser Leben verändern (22019).
Adam Rutherford ist Genetiker am University College of London, Science-Autor und Journalist. Zusammen mit Hannah Fry ist er regelmäßig auf BBC 4 in dem erfolgreichen Wissenschaftspodcast «The Curious Cases of Rutherford & Fry» zu hören.
Inhalt
Einführung
KAPITEL 1: Unendliche Möglichkeiten
Absolut Alles
Zu viel Wissen kann gefährlich sein
Der Kreis des Wissens
Der Schrottplatz-Tornado
KAPITEL 2: Das Leben, das Universum und der ganze Rest
Unheimliche Begegnung der fantasielosen Art
Auf die Größe kommt es an
Ein fremdartiger Familienstammbaum
Die Chroniken des Krustentiers
Es ist nicht leicht, so groß zu sein
Über Sinn und Unsinn bestimmter Vergleiche
Wie hoch kann ein Alien springen?
Tot, zerschmettert oder zerplatzt
Wir wollen glauben
KAPITEL 3: Der perfekte Kreis
Wie sieht eine vierdimensionale Kugel aus?
Gibt es das perfekt runde Objekt?
Woher wissen wir, dass die Erde keine Scheibe ist?
Ist die Erde überhaupt eine Kugel?
Kugeln im Weltraum
KAPITEL 4: Steinalt (noch älter als die Stones)
Wie fing die Erde an?
Vor wie langer Zeit entstand die Erde?
Die sechs Jahrtausende alte Erde
KAPITEL 5: Eine kurze Geschichte der Zeit
Wie spät ist es?
Was ist eine Sekunde?
Eine wacklige Welt
«Das ist Relativität»
Die innere Uhr
Das ewige Flusspferd
30 Meter im freien Fall
Navigieren im Strom der Zeit
KAPITEL 6: Wir sind so frei – oder nicht?
Gedankenkontrolle durch hypnotischen Zombifizierungszauber
Schnell und früh denken
Der Dämon
Chaos
Im Reich der Quanten
Viele Welten
Schicksal oder Freiheit?
KAPITEL 7:Die magische Orchidee
Das Ende ist nah, aber es gibt ein Danach
Wir wissen, was wir mögen, und wir mögen, was wir wissen
Paranormale Aktivität
Sind wir alle Einfaltspinsel?
Publikationsverzerrung – Ab in die Schublade
Hauptsache keine Langeweile
KAPITEL 8:Liebt mich mein Hund?
Als Darwins französischer Freund das Gesicht eines alten Mannes mit Elektroschocks traktierte
Niemand liest mein P-P-P-Pokerface
Überraschung!
Emotionale Bandbreite
Andere Lebewesen
Menschen, Tiere, Emotionen
Ist das Liebe?
Liebt mich mein Hund?
KAPITEL 9:Das Universum durchs Schlüsselloch
Die vier Fs
Riechen oder nicht riechen, das ist hier die Frage
Wie man eine tödliche Krankheit riechen kann
Zeit für einen kleinen Sehtest
Ich sehe was, was du nicht siehst …
Jenseits des Sichtbaren
Director’s Cut
Der wahre Leitfaden für die Wirklichkeit
Dank
Bildnachweis
Quellen
Gewidmet dem National Health Service, der uns beiden, während wir dieses Buch schrieben, das Leben gerettet hat
Einführung
Schließen Sie die Augen.
Okay, zugegeben, zum Lesen eines Buches empfiehlt es sich eher, die Augen offen zu haben. Wenn Sie eine gedruckte Ausgabe des Buchs in Händen halten, werden Sie die Augen sicherlich in ein paar Sekunden wieder öffnen müssen – wäre dem nicht so, könnten Sie den Rest dessen, was wir Ihnen erzählen wollen, schließlich gar nicht lesen, logisch.
Aber für den Moment: Schließen Sie bitte die Augen.
Während dieses kurzen Moments der Dunkelheit hat sich nicht viel verändert. Die Wörter sind auf der Seite geblieben, und das Buch hielten Sie zum Glück noch immer in den Händen, als Sie die Augen öffneten. Als Sie sie heute Morgen nach einer hoffentlich angenehmen Nachtruhe öffneten, war es heller Tag, und Sie fanden ziemlich alles exakt so vor, wie es war, als Sie am Abend zuvor die Augen schlossen. Die Wirklichkeit bleibt bestehen, ganz gleich, ob Sie dieser Wirklichkeit Beachtung schenken oder nicht. All das mag überaus offensichtlich erscheinen, banal geradezu. Aber das ist eine Tatsache, die wir alle irgendwann erst einmal lernen mussten.
Wenn Sie das nächste Mal mit einem Baby spielen, nehmen Sie ein Spielzeug und verstecken es vor den Augen des Babys unter einer Decke. Wenn das Kind noch keine sechs Monate alt ist, wird es die Decke nicht wegziehen, um wieder an sein Spielzeug zu kommen, ganz egal, wie viel Freude ihm das Spielzeug vorher bereitet hat. Das liegt nicht etwa daran, dass das Baby nicht in der Lage wäre, die Decke zu greifen und wegzuziehen – es liegt daran, dass das Baby im Unterschied zu Ihnen schlicht nicht erkennt, dass das Spielzeug noch existiert. Für den winzigen Verstand des Säuglings hat sich das Spielzeug in dem Moment, da es unter der Decke verschwand, einfach in Wohlgefallen aufgelöst. Genau deshalb haben Kleinkinder so viel Spaß am Guck-guck-Spiel. Dieses Spiel spielen die Menschen überall auf der Welt, in jeder Kultur. Wenn Sie sich die Hände vors Gesicht halten, glaubt ein ganz junger, noch kaum entwickelter Verstand tatsächlich, dass Sie einfach nicht mehr da sind, vielleicht sogar, dass es Sie gar nicht mehr gibt. Wenn Sie die Hände wieder vom Gesicht nehmen, zeigt sich am Lachen des Babys die Freude, mit der es feststellt, dass Sie sich doch nicht in Nichts aufgelöst haben.
Dieses Guck-guck-Spiel veranschaulicht sehr schön, wie schlecht der Mensch dafür ausgerüstet ist, das Universum zu begreifen – und alles, was dazugehört. Wir kommen nicht mit einem angeborenen Verständnis der Wirklichkeit, die uns umgibt, auf die Welt. Wir müssen erst einmal lernen, dass Dinge – und Menschen – nicht einfach «nicht mehr da sind», wenn wir sie nicht sehen. Bei Babys ist dies ein bedeutender Entwicklungsschritt, den die Fachleute als «Objektpermanenz» bezeichnen. Viele andere Lebewesen tun diesen Entwicklungsschritt niemals. Ein Krokodil kann ruhiggestellt werden, indem man ihm die Augen verdeckt. Manche Vögel werden völlig ruhig, wenn Sie eine Decke über den Käfig legen. Es geht nicht bloß darum, dass Dunkelheit auf die Tiere beruhigend wirkt; sie erkennen gar nicht, dass der nervige Mensch auf der anderen Seite der Gitterstäbe und der Decke überhaupt noch da ist.
Warum sollten sie sich auch über Objektpermanenz das Hirn zermartern? Der primäre Antrieb nahezu jedes Organismus, der jemals existiert hat, besteht seit jeher darin, nicht zu sterben – oder jedenfalls nicht, bevor er eine Chance zur Reproduktion hatte. Die allermeisten Lebewesen auf der Erde beschäftigen sich nicht im Geringsten mit der Frage, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Mistkäfer orientieren sich des Nachts mithilfe der Sterne unserer Milchstraße, interessieren sich aber nur mäßig für galaktische Strukturen oder für die Tatsache, dass es für den Großteil der Masse des Universums (bisher jedenfalls) keine Erklärung gibt.[1] Die winzigen Milben, die in unseren Augenbrauen leben, können mit dem Begriff des symbiotischen Kommensalismus herzlich wenig anfangen, der es ihnen gestattet, sich ganz unscheinbar von uns zu ernähren. Bis gerade eben waren sie sich dieser Wesen vermutlich auch noch nicht bewusst, aber sie sind definitiv da. Eine Pfauenhenne interessiert sich kein bisschen für die komplexen Gleichungen, die erklären, wieso sie diese albernen Schwanzfedern des Pfauenhahns so unwiderstehlich sexy findet – sie gefallen ihr einfach irgendwie.
Nur ein Lebewesen hat jemals solche Fragen gestellt – der Mensch, also wir. Irgendwann in den letzten grob geschätzt hunderttausend Jahren entwickelten ein paar weitgehend unbehaarte Affen Neugier an so ziemlich allem. Die Gehirne dieser Primaten wuchsen im Lauf von Jahrmillionen immer weiter, und irgendwann begannen sie, Dinge zu tun, die zuvor noch kein Tier getan hatte. Sie begannen zu zeichnen, zu malen, Musik zu machen – und Guck-guck zu spielen.
Wir sollten das allerdings tunlichst nicht überbewerten. Prähistorisches Leben war, verglichen mit heute, noch immer eine ziemlich armselige Angelegenheit – das hauptsächliche Bestreben von allem und jedem bestand schlicht darin, zu überleben. Unsere Vorfahren jedoch hatten sich einen Schritt vom Rest der Natur wegbewegt und dachten nicht mehr nur an die unmittelbaren Fragen des Überlebens, sondern an das ganze Universum und ihren Platz darin. Allerdings sind wir nach wie vor Affen – Primaten – und befassen uns im Denken wie im Körperlichen grundsätzlich und überwiegend damit, am Leben zu bleiben und uns fortzupflanzen. Physikalisch und genetisch haben wir uns in der letzten Viertelmillion Jahre nicht allzu sehr verändert. Nehmen Sie eine Frau oder einen Mann aus Afrika von vor 300.000 Jahren und setzen Sie diesen frühen Menschen in eine Zeitmaschine, richten Sie ihn ein bisschen nett her, verpassen ihm einen Haarschnitt und stecken Sie ihn in ein paar hübsche Klamotten, und er würde in einer Menschenmenge heutiger Zeiten nicht weiter auffallen. Der Großteil unserer biologischen Hardware hat sich seit den Zeiten, in denen keine der hochfliegenden Ideen, wie unser Universum wohl gestrickt sein mag, irgendjemanden interessierte, so gut wie überhaupt nicht verändert.
Das bedeutet vor allem, dass unsere Sinne uns regelmäßig im Stich lassen. Wir reagieren spontan auf schnelle, unerwartete Bewegungen, obwohl wir uns schon lange nicht mehr Tag für Tag vor gefräßigen Raubtieren in Acht nehmen müssen, die uns auf den Fersen wären und uns zu verspeisen beabsichtigten. Wir haben Lust auf süße, salzige und fettreiche Speisen – eine völlig vernünftige Strategie für Jäger und Sammler, die uns half, kalorienreiche Nahrung zu bevorzugen, als Nahrung knapp war, die aber alles andere als vernünftig ist, wenn man die Option hat, sich nach jedem Cheeseburger auch noch ein Eis zu genehmigen.
Diese evolutionären Altlasten gehen über unsere Instinkte hinaus; sie wirken sich auch auf unsere Intuition aus. Wenn Sie unsere ungebildeten Vorfahren nach der Gestalt der Erde gefragt hätten, hätten diese vermutlich steif und fest behauptet, dass sie flach sei. Es ergibt ja auch Sinn, dass sie flach ist. Sie sieht ziemlich flach aus – und wenn sie nicht flach wäre, würden wir doch gewiss einfach von ihr herunterpurzeln. Sie ist aber kein bisschen flach. In Kapitel 3 werden wir unseren klumpigen Felsbrocken genauer unter die Lupe nehmen und feststellen, dass er nicht nur nicht flach, sondern auch noch nicht einmal eine exakte Kugel ist: Aufgrund ihrer Rotation ist die Erde ein abgeplattetes Sphäroid – sie sieht im Prinzip also aus wie ein Ball, dem ein wenig Luft fehlt –, an den Polen etwas abgeflacht und ein wenig dicklich um die Mitte herum.
Aus unserer Perspektive sieht es eindeutig so aus, als würde sich die Sonne um die Erde drehen: Jeden Tag in den letzten 4,54 Milliarden Jahren ist sie am Morgen hier aufgegangen, zügig über den Himmel gewandert und dort wieder untergegangen. In Wirklichkeit jedoch dreht sich die Erde um die Sonne – und auch dies nicht auf einer perfekten Kreisbahn. Aus unserer Sicht steht die Sonne also an einem festen Punkt im Weltraum, während wir um sie herumflitzen. In Wirklichkeit aber kreist die Sonne und mit ihr unser gesamtes Sonnensystem schwindelerregende 827.000 Stundenkilometer schnell um einen Punkt im Zentrum der Milchstraße und legt in jedem galaktischen Jahr (das entspricht 250 Millionen Erdenjahren) eine komplette Runde zurück. Niemand von uns bekommt davon irgendetwas mit, während wir es uns lesend im Liegestuhl gemütlich gemacht haben.
Die Neugier mag die Menschen sehr wohl von anderen Geschöpfen unterscheiden, aber Neugier allein genügt nicht. Wenn wir Menschen neugierige Fragen über die Geheimnisse der Wirklichkeit stellen, haben wir nicht spontan und ohne weiteres die richtigen Antworten parat; ohne Ende sind die Mythen, die wir gesponnen haben, um das Wesen der Natur zu erklären. Die Wikinger waren der Ansicht, der ohrenbetäubende Klang des Donners wäre das Werk Thors, wenn er in seinem von Ziegen gezogenen Streitwagen über den Himmel brettert, und sein furchterregender Hammer Mjölnir wäre der Ursprung des Blitzes.[2] Die Kurnai, ein australischer Aborigine-Stamm, hielten das Südlicht, das wir als Aurora Australis kennen, für Buschfeuer in der Geisterwelt.
An solche Geschichten von Göttern, Geistern und Geißböcken glauben bis heute Milliarden Menschen auf allen Kontinenten. So gerne man diese Mythen belächeln mag: Intuitiv ergeben sie irgendwie einen Sinn, und die Intuition ist ein machtvolles Ding. Wir können gar nicht anders, als das Universum durch die Brille des Menschen zu betrachten. In Wirklichkeit jedoch ist vieles eben nicht so, wie es uns erscheint. Sie werden in diesem Buch noch erfahren, dass ein Tag nicht aus 24 Stunden besteht. Und dass ein Jahr nicht aus 365 (Komma zwei fünf) Tagen besteht. Wenn wir unseren Heimatstern bestaunen, wie er bei einem pittoresken Sonnenuntergang über dem Horizont zu schweben scheint, dann befindet er sich eigentlich schon unterhalb des Horizonts; die Erdatmosphäre erzeugt eine Krümmung des Lichts, sodass wir die Sonne sehen, obwohl sie eigentlich schon untergegangen ist. Auch ist der Verzehr von Süßigkeiten und Kuchen nicht der Grund, warum die Kids bei Partys ausflippen.[3] Jedes Jahr ertrinken mehr Menschen in der Badewanne, als durch Terroristen und Haie zusammengenommen zu Tode kommen, aber keine Regierung ist – bislang jedenfalls – auf die Idee verfallen, Gesetze zur Regelung von Badezeiten einzuführen.
Wie man es auch dreht und wendet: Die Intuition ist ein miserabler Ratgeber.
Und irgendwann wurde dies auch uns neugierigen Affen klar. Wir schufen die Naturwissenschaften und die Mathematik im Bestreben, unsere begrenzte menschliche Sichtweise hinter uns zu lassen und die Welt so zu sehen, wie sie objektiv ist, nicht nur so, wie wir sie erleben. Wir erkannten die Grenzen unserer Sinne und fanden Möglichkeiten, diese zu erweitern, um auch über das enge Spektrum unseres Gesichtssinns hinaussehen zu können, um zu hören, was unsere Ohren nicht zu hören vermögen, und Entfernungen messen zu können, die über die für uns sichtbaren Horizonte hinausgehen, vom unvorstellbar Riesigen bis hin zum unendlich Winzigen.
Seitdem streben wir danach zu erfahren, wie die Wirklichkeit wirklich und wahrhaftig ist. Genau das macht Wissenschaft aus. Das treiben wir seit Hunderten, wenn nicht Tausenden Jahren, wenn auch nicht immer mit Erfolg. Sich über frühere Versuche lustig zu machen ist leicht, und mitunter bewegen sie sich in der Nähe der erwähnten Götter und Geißböcke. Platon glaubte, wir könnten sehen dank unsichtbarer, von unserem Auge ausgehender Strahlen, die alles ins Visier und unter die Lupe nähmen, was in ihr Blickfeld gerät. Aber schließlich hatte er keine Theorien über das elektromagnetische Spektrum oder die neuronale Phototransduktion. Frühe Biologen glaubten, im Sperma existiere ein Homunkulus, eine winzige Ausgabe eines Menschen, und der Frau käme lediglich die Aufgabe zu, als Behältnis zu dienen und diesen Mini-Menschen auszubrüten, bis er sich zu einem lebensgroßen und geburtsreifen Baby entwickelt hatte. Isaac Newton war Alchimist und verwandte deutlich mehr Mühe darauf, Blei in Gold zu verwandeln, als auf seine Arbeiten zur Mechanik des Kosmos. Galileo war nicht bloß Astronom, sondern auch Astrologe, und wenn das Geld knapp war, fertigte er für zahlende Kundschaft Horoskope an. Van Helmont, der Begründer der Gaschemie, war überzeugt, Mäuse würden aus dem Nichts ins Leben treten; man müsse dafür lediglich Weizensamen und ein schweißgetränktes Hemd in eine Vase stopfen und das Ganze 21 Tage lang im feuchten Keller ruhen lassen.
Im Lauf der Zeit haben die Naturwissenschaften eine Unmenge Dinge vollkommen falsch verstanden. Man könnte fast sagen, es ist geradezu die Aufgabe der Wissenschaft, sich zu irren; denn der Irrtum ist der Punkt, von dem man ausgehen kann, um sich beim nächsten Mal weniger zu irren. Und nach ein paar Runden hat man’s eben kapiert und irrt sich nicht mehr. Insgesamt betrachtet krümmt sich der Bogen der Geschichte in Richtung des Fortschritts. Wir haben gewaltige Kulturen errichtet, die über Jahrhunderte Bestand hatten. Wir haben die Natur verändert, wir haben Tiere und Nutzpflanzen gezüchtet, die Milliarden Menschen ernähren. Wir haben dank Mathematik und Technik Bauwerke geschaffen, die Jahrtausende überdauern, und wir haben Schiffe gebaut, die es uns ermöglichen, den gesamten Erdball zu überqueren (und dabei nebenher bestätigen können, dass es tatsächlich ein Ball ist). Wir haben Raumschiffe konstruiert, die die Dynamik des Sonnensystems beherrschen und zu fremden Welten reisen können, Milliarden von Kilometern entfernt. Und wir haben sogar einen ganzen Planeten mit Robotern bevölkert. In nicht allzu ferner Zukunft wird einer oder eine von uns die gesamte Intelligenz aller Menschen vor unserer Zeit in sich versammeln, den Fuß auf jenen Planeten setzen und zum ersten Primaten auf dem Mars werden.
All dies verdient, gefeiert zu werden. Naturwissenschaften und Mathematik sind ein Werkzeugkasten – der ultimative Geräteschuppen, vollgestopft mit den wunderbarsten Instrumenten und Ideen, absonderlichen Apparaten und genialen Gerätschaften, die unsere Möglichkeiten und Sinne erweitern, auf dass wir immer mehr von der Wirklichkeit zu erkennen vermögen.
Dieses Buch ist ein Guide, der uns zeigt, wie wir versuchen, unser Primatenhirn zu unterdrücken und das Universum so zu sehen, wie es wirklich ist, und eben nicht so, wie wir es wahrnehmen. Es geht um den Unterschied zwischen dem, was sich intuitiv wahr anfühlt, und dem, was die Wissenschaft als wahr erkannt hat. Nicht selten ist diese wissenschaftliche Wahrheit viel schwerer zu glauben.
Ihre beiden Reiseführer, weitgehend unbehaarte Primaten wie wir alle, stammen aus ganz unterschiedlichen Feldern der Wissenschaft. Hannah ist Mathematikerin, spezialisiert darauf, kolossale Datenberge zu verarbeiten, um bestimmte menschliche Verhaltensmuster zu begreifen. Adam ist Genetiker und nimmt die DNA unter die Lupe, um zu erkennen, was lebende Organismen anstellen, um sich anzupassen und zu überleben, und wie sich das Leben auf der Erde in all seiner Pracht überhaupt entwickelt hat. Wie alle anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen wir einfach nur herauszufinden, wie die Dinge funktionieren. Bisweilen unterliegen die Leute der irrigen Annahme, bei der Wissenschaft handle es sich um einen Hort des Wissens – nicht selten lehren sie diese irrige Annahme sogar. Immerhin steckt ja das Wort «Wissen» in Wissenschaft. Aber in der Wissenschaft geht es nicht um Wissen. Es geht um Nichtwissen und darum, einen Weg zu finden, wie man herausfindet, was man nicht weiß.
Dieses Buch präsentiert Antworten auf Fragen, die auf den ersten Blick kinderleicht, albern oder ganz und gar rätselhaft erscheinen. Wie könnten Aliens aussehen? Liebt mich mein Hund? Und was tut ein Weltuntergangskult, der sich vollkommen einer bevorstehenden Apokalypse verschrieben hat, wenn die Apokalypse dann doch nicht kommt?
Die Fragen als solche sind einigermaßen unkompliziert (okay, die mit dem Weltuntergangskult vielleicht nicht so ganz); aber bei der Suche nach Antworten stellen wir fest, dass sie uns zufällig die wahren Geheimnisse des Universums verraten, diejenigen, die wir nur zu erkennen vermögen, wenn wir unser Primatenhirn ausschalten und uns der Hilfsmittel bedienen, die wir erfunden haben, um unsere evolutionär bedingten Blockaden zu überwinden. Es sind Fragen, deren Antworten enthüllen, wie wenig wir in Wirklichkeit unseren Instinkten vertrauen können und wie weit die Wissenschaft uns befähigt hat, über uns selbst hinauszuwachsen, wenn wir solche Fragen angehen.
Dieses Buch bietet Geschichten über das Universum und darüber, wie wir es zu begreifen versuchen – es erfasst alle großen Begriffe wie Zeit, Raum, Raumzeit und Unendlichkeit, und so zeitlose Fragen wie beispielsweise: «Wie spät ist es?» Nicht im Sinn von «Ich müsste längst im Bett liegen» oder «Wäre es nicht an der Zeit, dass du dieses Buch in die Bibliothek zurückbringst?» Sondern: Was ist das wahre, universelle, zweifelsfreie, absolute Maß für die Art und Weise, in der die Gegenwart irgendwie zwischen bereits geschehenen und in Zukunft noch geschehenden Dingen auftaucht? Die Antwort führt uns auf eine Reise, auf der wir risikofreudigen Seefahrern, nervösen Bankern, uralten Korallen, Einstein und Weltraum-Lasern begegnen werden. Aber wir erzählen auch Geschichten darüber, wie es kommt, dass wir Menschen so anfällig für Irrtümer sind und wie wir diese Irrtümer überwinden. Sie drehen sich darum, wie die Evolution uns mit wunderbaren Sinnen ausgestattet hat, die uns täuschen können und tatsächlich täuschen, aber auch mit einem Gehirn, das uns in die Lage versetzt, in den Wundern des Universums zu schwelgen und uns von all dem Ballast zu befreien, den wir in unseren Köpfen mit uns herumschleppen.
Es ist ein Buch über unsere Lieblingsgeschichten – darüber, wie es kommt, dass wir die Dinge wissen, die wir wissen, von unseren Versuchen und Fehltritten auf dem Pfad zu jenem immer weiter anwachsenden Wissen. Wir berichten von Irrtümern, Egos, Einsichten, der Weisheit und den Vorurteilen von Wissenschaftlern und Forschern; von harter Arbeit, Tragödien, Sackgassen, Zufallstreffern und der einen oder anderen wirklich, wirklich grottenfalschen Entscheidung – das alles sind Teile des Puzzles unserer Geschichte, das uns an den Punkt geführt hat, an dem wir heute stehen. Das Buch ist eine Lobeshymne auf den Irrtum als Weg zur Überwindung des Irrtums; es lehrt uns, dass es nicht immer einfach ist, seine Meinung zu ändern, dass aber die Bereitschaft, seine Meinung zu ändern, eine große Tugend darstellt (ganz generell, aber insbesondere in der Wissenschaft). Es ist eine Reise durch Zeit und Raum, durch unseren Körper und unser Gehirn, es zeigt, wie unsere unfassbar machtvollen Emotionen unsere Sicht auf die Wirklichkeit prägen und wie uns unser Verstand immer wieder Streiche spielt. Alles in allem wird aus diesen Geschichten die größte aller Geschichten: wie eine Spezies weitgehend unbehaarter Primaten, ausgestattet mit einer einzigartigen und angeborenen Neugier, beschloss, sich nicht damit zufriedenzugeben, die Dinge zu sehen, wie sie zu sein scheinen, sondern stattdessen suchend und fragend herumzustochern in der Substanz und im Gefüge des Universums und allem, was sich darin befindet.
Die Wirklichkeit ist nicht so, wie sie zu sein scheint; wenn Sie jedoch bereit und willens sind, sich auf die Suche nach ihr zu begeben, ist dieses Buch der ultimative Guide, der ihnen zeigt, wie die besten jemals erfunden Werkzeuge uns ermöglichen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind.
Fußnoten
1 Diese Entdeckung gelang den Wissenschaftlern, indem sie Mistkäfern winzige Hüte aufsetzten und dann beobachteten, wie sie im Dunkeln völlig die Orientierung verloren. Wissenschaft ist also nicht zwangsläufig immer Hightech oder von immenser Komplexität. Manchmal muss man einfach bloß einem Insekt einen Hut aufsetzen.
2 Jeden Abend pflegte Thor die beiden Ziegenböcke mit Namen Tanngrisnir und Tanngnjóstr zu verzehren, um sie am nächsten Morgen vermittels Mjölnir wieder zum Leben zu erwecken. Zugegeben: Darauf muss man erst einmal kommen.
3 Nach den zuverlässigsten uns vorliegenden Daten flippen Kinder bei Partys einfach so aus, völlig unabhängig davon, was sie essen. Wissenschaftler führten Tests mit Kindern durch: Sie gaben ihnen zuckerfreies Essen, erzählten aber den Eltern, das Essen und die Getränke der Kinder seien zuckerhaltig; die Eltern schätzten das Verhalten der Kinder negativer ein, dabei unterschied es sich in Wirklichkeit nicht vom üblichen Verhalten. So gesehen sind es die Eltern, die sich bei Partys eher danebenbenehmen als die Kids; die Kids sind einfach bloß Kids auf Partys.
KAPITEL 1
Unendliche Möglichkeiten
Ein verbrauchter, dabei gar nicht unangenehmer Geruch erfüllt die Luft. Die Decke hängt tief und verleitet dazu, sie mit den Fingerspitzen berühren zu wollen. An vier der sechs Wände, die uns umgeben, stehen Reihen in Leder gebundener Bücher, staubige, zerknitterte Seiten und uralte Tinte, die seit Jahren, vielleicht seit Jahrhunderten keine Sonne mehr gesehen hat.
Der Raum, von dem die Rede ist, ist nichts Einmaliges. Durch kleine Lüftungsschächte erspähen wir weitere Galerien über und unter uns, eine nach der anderen, unendlich weit in die Ferne reichend. Flure auf unserer Etage, in die wir durch Türen in den beiden anderen Wänden gelangen, winden sich in weitere sechseckige Galerien, jede einzelne identisch mit dem Raum, in dem wir uns befinden. Galerien vollgepackt mit Büchern, jedes vollgepackt mit Wörtern.
Das ist keine gewöhnliche Bibliothek. Sie stehen irgendwo in einer unvorstellbar riesigen Bienenwabe, einem Labyrinth des geschriebenen Wortes. Irgendwo inmitten dieser Mauern befindet sich ein Exemplar jedes einzelnen Buchs, das je geschrieben wurde, und auch ein Exemplar jedes Buchs, das es irgendwann geben wird – oder geben könnte. Vergessen Sie für einen Moment die bescheidenen Seiten, die Sie gerade lesen. Diese Bibliothek ist der wahre, der einzig wahre Guide zu absolut Allem.
Es ist die Bibliothek von Babel, eine literarische Fiktion, erdacht und geschaffen von dem argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges. Sie steht im Mittelpunkt einer Kurzgeschichte gleichen Namens, geschrieben im Jahr 1941. Darin geht es um ein Universum, in dem jedes nur mögliche Ding schriftlich festgehalten wurde – eine Geschichte, die mit einer einzigen Idee spielt: Wenn man auf irgendeine Weise Zugang zu absolut Allem hätte, wie viel könnte man dann wissen?
Absolut Alles
Die Bücher in Borges’ unvorstellbar riesiger Bibliothek sind angefüllt mit jeder nur denkbaren Kombination von Buchstaben, Leerzeichen, Punkten und Kommas – all jenen, aus denen Wörter und Sätze entstehen, und noch viele mehr, aus denen nichts dergleichen entsteht. Die Bibliothek umfasst alles, was irgendjemand gesprochen, gedacht oder geschrieben hat – und jemals sprechen, denken oder schreiben wird – in jeder vorstellbaren Reihenfolge, mit sämtlichen beliebigen Aneinanderreihungen bedeutungsloser Buchstabenfolgen dazwischen. In Borges’ eigenen Worten wäre in den endlosen Regalen dieser Bibliothek Folgendes verborgen:
Die bis ins Einzelne gehende Geschichte der Zukunft, Aischylos’ Die Ägypter, der geheime und der wahre Name Roms, meine Träume und Wachträume am frühen Morgen des 14. August 1934, der Beweis des Fermatschen Satzes, der vollständige Katalog der Bibliothek, und der Beweis der Ungenauigkeit dieses Katalogs.
Es ist eine fantastische Idee. Aber die Bibliothek von Babel ist nicht bloß eine von Borges erdachte Fiktion. Es gibt sie wirklich.
Oder jedenfalls eine Version davon. Im Jahr 2015 erstellte Jonathan Basile, Student an der Emory University in Atlanta im Bundesstaat Georgia, die Bibliothek von Babel – in digitaler Form und mit einigen notwendigen praktischen Einschränkungen.
Stellen Sie sich einen Moment lang eine Bibliothek vor, auf deren Seiten nur Wörter mit fünf Buchstaben enthalten sind. Es wäre nicht sehr schwer – allerdings auch nicht sehr unterhaltsam –, diese Buchstabenkombinationen selbst niederzuschreiben.
aaaaa
aaaab
aaaac
…
Und immer so weiter. Ziemlich bald würde Ihnen die Tinte bzw. die Druckerfarbe ausgehen. Wenn Sie sämtliche Kombinationen aus fünf Buchstaben mit Schriftgröße 12 untereinander auf Endlospapier ausdrucken wollten, wäre Ihr Ausdruck fast 100 Kilometer lang.
Und das sind nur die Kombinationen aus fünf Buchstaben, nicht etwa die jeweils 410 Seiten langen Bände, die sich Borges ausgedacht hat. Jonathan Basile erkannte ziemlich schnell, dass es schlicht nicht möglich sein würde, alles nacheinander durchzugehen. Es würde nicht nur ewig dauern, so etwas zusammenzustellen, eine Buchstabe für Buchstabe aufgebaute digitale Bibliothek würde so viel Speicherplatz brauchen, dass selbst ein Raum von der Größe des gesamten beobachtbaren Universums, vom Boden bis zur Decke komplett ausgefüllt mit Speicherfestplatten, nicht ausreichen würde, um Borges’ Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Basile musste einen Weg finden, die Sache abzukürzen. Zuerst entschied er, seine Bibliothek solle nur jede Seite Geschriebenes enthalten, nicht jedes mögliche Buch. Auch das ist noch ein Unterfangen grotesken Ausmaßes: Jede theoretisch mögliche Seite mit 3200 Zeichen, aufgebaut aus 26 Buchstaben nebst Leerzeichen, Kommas und Punkten. Aber es lässt sich zumindest geringfügig leichter verwirklichen.[1]
Dann kam er auf eine äußerst clevere Idee, die es ihm ersparte, seine nächsten Fantastilliarden Lebenszyklen mit dem Niederschreiben der gesamten Bibliothek zu verbringen. Basiles unendliche Bibliothek ist, genau wie diejenige Borges’, aus virtuellen Sechsecken aufgebaut – jeweils vier Wände mit Büchern (und zwei Türen zu den angrenzenden Räumen), dann die weitere Unterteilung in Regale, Bände, Seiten. Die Seiten im Innern der Bibliothek sind so geordnet, dass es für jede einzelne davon eine eigene und eindeutige Zuordnungszahl gibt. Das folgende Beispiel zeigt etwa die erste Zeile in Sechseck A, Wand 3, Regal 4, Band 26, Seite 307:
pvezicayz.flbjxdaaylquxetwhxeypo,e,tuziudwu,rcbdnhvsuedclbvgub,sthscevzjn.dvwc
Zugegeben, es gibt wohl aufregendere Stellen in der Bibliothek.
Allerdings ist die Beziehung zwischen der Referenznummer und dem Text, den sie bezeichnet, das Merkmal, das die Bibliothek überhaupt erst möglich macht. Basiles Trick war es, diese eindeutige Referenznummer zum Erzeugen eines Codes zu nutzen, der nur auf eine einzige Weise entziffert werden kann: ein Algorithmus also, der zuverlässig eine Seite mit individuellem Textinhalt aus einer eindeutigen Referenznummer generiert.
In den Fußnoten finden Sie noch etwas mehr Informationen zur Funktionsweise von Basiles Algorithmus.[2] Wichtig ist aber: Jede Seitenzahl in der Bibliothek hat eine unauslöschliche Verbindung zu einer einzelnen Textseite. Sie brauchen dem Algorithmus nur eine Referenznummer anzugeben, und er liefert Ihnen die dazugehörige Textseite – umgekehrt gilt dasselbe.
Die Hauptarbeit erledigt also der Algorithmus, nicht der Bibliothekar. Niemand muss irgendetwas langwierig eingeben, jede Seite ist von vornherein vorgegeben, der Algorithmus ruft sie nur noch ab. Jede Seite existiert also bereits – und wartet nur darauf, dass sie jemand aus dem Regal zieht.
Der erste Absatz dieses Kapitels steht dort. Wenn Sie es nicht glauben: Er befindet sich – das englische Original, wohlgemerkt – im Sechseck mit der Referenzendnummer 993qh, an Wand 3, in Regal 4, Band 20 auf Seite 352. Wir, die Autoren, haben das nicht dahin gestellt. Es war bereits dort:
lmgumfkwwomyzzoxpj,qyoynhdaqhtslvacnaicu varzkdjzzazvmppap bteq ezlblbsjjaesejhtz vv.b,uc.ofrx.ul gidtfhqpwikgygk,kvq. rosf. bgdeurubwp,eqns.huyiyrnz.cocddh q.,,znuav. wvqwwcwohn chmrwua stale but not unpleasant smell fills your nostrils. the ceiling hangs low, tempting you to touch it with your outstretched fingers. along four of the six walls that surround you are rows of leat herbound books, dusty creased pages and a ncient ink that hasnt seen sunlight for years, maybe centuries.foxvpx.krv,.pwsmwv iuyuhkdrcx,,wplknvo,dsopqcrmhduenco rnpb vdwd.xxxgsareodhjnjzf.xsxkf,aaofbmvcqlzlk ktkweib.xhc.r,pbfkdcxhsznrjocvlaqvbn.,j.
Wir haben uns bei der Formulierung dieses Absatzes durchaus Mühe gegeben, es ist deshalb irgendwie ärgerlich, feststellen zu müssen, dass irgendein anonymes Stückchen Code ihn, offenbar ohne jede Mühe, schon einmal geschrieben hat. Natürlich ist es unsinnig, sich über die Unendlichkeit aufzuregen. Irgendwo in Basiles virtueller Bibliothek wartet eine Seite nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden: Sie besteht komplett aus Leerzeichen, nur mittendrin steht Ihr Name. Es gibt eine Seite mit der Geschichte Ihres heutigen Tages. Es gibt eine Seite, auf der steht der Name Ihrer ersten großen Liebe und wie Sie sich kennengelernt haben, und es gibt eine Seite, auf der beschrieben ist, wie Sie Ihren aktuellen Partner bzw. Ihre Partnerin mit einer Bratpfanne erschlagen. Es gibt eine Seite mit der anmutig geschriebenen Geschichte eines Hundes namens Molly, und es gibt eine, auf der minutiös die Umstände Ihres Todes dargelegt sind. Es gibt weitere mit jeder nur denkbaren Geschichte, die über Sie geschrieben werden könnte, und nur ein Detail stimmt nicht ganz, etwa die falschen Schreibweisen Ihres Namens – und das Ganze auch auf Französisch, Deutsch, Kreolisch, Italienisch und was das lateinische Alphabet sonst noch alles hergibt. Es gibt, kurz gesagt, eine Website, die bereits existiert und die Gesamtheit allen menschlichen Wissens umfasst.
Die Arecibo-Botschaft
Die Erzeugung von Codes, die nur auf eine einzige Weise entzifferbar sind, ist ein gängiges Thema in der Mathematik. Im Jahr 1974 unternahmen zwei Männer im Namen der gesamten Menschheit den Versuch, mithilfe eines solchen Codes Kontakt mit außerirdischen Lebensformen aufzunehmen.
Der Kontakt mit Außerirdischen wird möglicherweise zum bedeutendsten Ereignis in der Geschichte der Menschheit werden. Dabei stellt sich die Frage: Wie sollte unsere erste Botschaft genau aussehen? Wer jemals einen Lobby- oder «Networking»-Empfang über sich ergehen lassen musste, weiß, wie quälend und belastend die Frage sein kann, was man sagen soll, wenn man einen mittelgroßen Saal voller Leute betritt, die grundsätzlich die gleichen Interessen haben wie man selbst. Was also sollte die Nachricht besagen – global in der Bandbreite, intergalaktisch in der Zielsetzung –, wenn wir anderen Bewohnern des Universums mitteilen möchten, dass es uns gibt?
Die Astrophysiker Frank Drake und Carl Sagan hatten eine Idee. Sie bastelten eine geniale codierte Botschaft der ganzen Menschheit, und am 16. November 1974 wurde sie via FM vom riesigen Radioteleskop in Arecibo (Puerto Rico) ins All geschickt.
Was stand in der Botschaft? Es ist schließlich schon schwer genug, einem Hund beizubringen, dass er die menschliche Sprache versteht, von der Vorstellung der eigenen Spezies gegenüber einer außerirdischen Zivilisation ganz zu schweigen. Aber Drake und Sagen waren nicht auf den Kopf gefallen, und sie dachten sich Wege aus, wie Nachrichten mithilfe der Universalität der Mathematik vermittelt werden könnten. Primzahlen sind nur durch 1 und sich selbst teilbar. Das gilt auf der Erde, das gilt auf dem Saturn, und das gilt auch auf bislang unentdeckten Planeten im Pferdekopfnebel im Sternbild Orion. Also verwendeten Drake und Sagan Primzahlen für die Codierung ihrer Nachricht. Die Botschaft bestand aus einer Folge von 1679 binären Bits. Die beiden dachten sich, eine Zivilisation, die gescheit genug ist, das Signal zu empfangen, muss auch über ausreichende mathematische Kenntnisse verfügen, um zu erkennen, dass 1679 eine Semiprime ist, d.h. nur durch genau zwei Primzahlen teilbar, in unserem Fall 23 und 73.
Stellen Sie sich die Situation vor. Ein außerirdischer Astronom empfängt dieses seltsame Signal aus den Tiefen des Weltalls. Nach reiflicher Überlegung fällt ihm auf, dass die Botschaft aus 1679 Bits besteht. Der Astronom kratzt sich an einem seiner zahlreichen Köpfe und kommt dann auf die Idee, als Nächstes diese Bits in einem 23 × 73 Einzelbits großen Raster anzuordnen. Und da, beim Hammer des Grabthar, setzt sich vor seinen 17 Augen ein Bild zusammen.
Auf diesem gewahrt der außerirdische Astronom Darstellungen unseres Sonnensystems, wobei eine menschliche Figur den vom Zentralgestirn aus gesehen dritten Planeten besonders hervorhebt, unseren Heimatplaneten also. Er sieht auf dem Bild auch die Ordnungszahlen der Elemente Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Phosphor, die die DNA bilden, die zusätzlich als abgeflachte Doppelhelix dargestellt ist. Zu sehen ist außerdem die Zahl 4,3 Milliarden – die Erdbevölkerung im Jahr 1974. Der Außerirdische würde diese ganz und gar wundersame Erläuterung einer für ihn selbst fremdartigen Zivilisation sehen, und er – oder es – würde alsbald und dringlich Kontakt mit seinen Anführern aufnehmen. An dieser Stelle würden – vorausgesetzt, wir haben aus den Werken der Science-Fiction irgendwelche Lehren gezogen – Botschafter auf die Reise geschickt, auf dass man mit dem Erdenvolk Freundschaft schließen möge (oder vielleicht auch, um es zu vernichten).
All das klingt nach einem hochbedeutenden Moment. Auf eine Handvoll winziger Vorbehalte sei allerdings hingewiesen. Nichts Weltbewegendes. Zuerst einmal war es nicht wirklich eine Botschaft ans gesamte Universum. Eine entsprechende Übertragung würde nämlich mehr Energie erfordern, als uns überhaupt auf der Erde zur Verfügung steht. Vielmehr zielte die Botschaft, was auch viel praktischer ist, auf einen Sternhaufen am Rande der Milchstraße – also eher so, als würde man mit der Taschenlampe in Richtung eines Modellstädtchens im Nachbarland leuchten.
Winziger Vorbehalt Nummer zwei: So sieht das Bild tatsächlich aus.
Erkennen Sie darauf das Sonnensystem? Die Doppelhelix? Nein? Wir auch nicht. Eine Eins mit Sternchen fürs Bemühen, liebe Leute. Für die Siebzigerjahre-Grafik: Sorry, setzen, Sechs.
Ironischerweise sieht das Ganze weniger aus wie eine Botschaft von einer fremden Welt – eher schon wie ein Screenshot aus «Space Invaders», einem Ballerspiel aus der Steinzeit der Videospiele Ende der Siebzigerjahre. Die Größe des dargestellten Menschen sollte maßstäblich der Durchschnittsgröße eines Amerikaners entsprechen – ein vielsagender Fall von interplanetarer Kurzsichtigkeit, denn die Hälfte aller Amerikaner ist im Schnitt schlappe 14 Zentimeter kleiner als dieses Männchen. Und das Ganze war, kaum losgeschickt, auch bereits wieder überholt. Der Punkt ganz rechts stellt (wie jeder sofort erkennt) Pluto dar. Damals war Pluto der neunte Planet unseres Sonnensystems. 2006 allerdings wurde er zum «Zwergplaneten» degradiert und aus der Champions League der Planeten hinausgeworfen. Wenn die Aliens das alles durchschaut und die Botschaft entschlüsselt hätten, dachten sie sich vermutlich: «Das Bild ist totaler Humbug; um die Typen machen wir besser einen großen Bogen.»
Und als Sahnehäubchen sei erwähnt: Wenn die Botschaft an ihrem Ziel eintrifft, in 21.000 Lichtjahren Entfernung, also heute in 21.000 Jahren, sind die angepeilten Sterne gar nicht mehr dort, sondern ganz woanders. Und wir sind bis dahin alle tot.
Kurzum: nette Idee, miese Umsetzung.
Zu viel Wissen kann gefährlich sein
Die Bibliothek von Babel ist fürwahr eine stattliche Sammlung – die Mutter aller Sammlungen, wenn man so will. Dabei ist es nicht einmal die einzige totale Bibliothek. Jonathan Basile hat auch eine Bibliothek zusammengestellt, die jede mögliche Kombination von Pixeln enthält. Sie zu durchsuchen ist nicht gerade einfach, aber irgendwo da drin steckt auch ein Bild von Ihnen, wie Sie gerade einen Elfmeter verwandeln, auf der Oberfläche des Saturnmonds Enceladus; im Tor steht ein riesiger Leguan, auf dem Spielfeld Han Solo, Lizzo und Charles Darwin, flankiert von Marie Curie in einem aufblasbaren T-Rex-Kostüm, einem Löwen in einem Marie-Curie-Kostüm und George Clooney, der nichts anhat außer falschen Wimpern. Das Bild gibt es.
Sie könnten vielleicht denken, es wäre doch eine gute Sache, zur Gesamtheit des menschlichen Wissens Zugang zu haben. Ein Heilmittel gegen alle bekannten Krebsarten gibt es dort, gehen Sie einfach hin und holen Sie es ab. Paradoxerweise jedoch gibt Ihnen ein kompletter Leitfaden für absolut alles in Wirklichkeit herzlich wenig.
In Borges’ ursprünglicher Geschichte geht es eigentlich um Generationen von Bibliothekaren und Bibliothekarinnen. Ehedem waren sie voller Optimismus, da sie doch die Antworten auf alle Fragen zur Hand hatten, aber allmählich wurden sie von der Erkenntnis in den Wahnsinn getrieben, dass alles zu haben mehr Fluch als Segen war. Dass irgendwo in all den Seiten verborgen alles Wissen steht, mag wohl sein – es zu finden, ist eine ganz andere Geschichte. Die Signale gehen in einem Meer von Nebengeräuschen unter.
Erinnern Sie sich kurz an das Beispiel mit allen möglichen Kombinationen aus fünf Buchstaben. Ausgedruckt wäre das Ganze, wie erwähnt, eine knapp 100 Kilometer lange Schlange aus Druckerpapier, aber auf 99,91 Prozent davon würde völlig sinnfreies, unverständliches Zeug stehen. Die echten Wörter würden, wenn jedes in einer eigenen Zeile steht, gerade einmal 260 Seiten füllen. Das wäre ungefähr so, als würden Sie die Seiten dieses Buchs irgendwo über die Strecke von Stuttgart nach Ulm verteilen. Bitte tun Sie’s nicht. Es gehört sich nicht, Abfall – auch Altpapier – einfach irgendwo hinzuschmeißen.
Derartige Bibliotheken sind nicht etwa Aufbewahrungsort und Quelle allen menschlichen Wissens, sie sind ein einziges unüberschaubares Chaos. Setzen Sie auf den eigenen Verstand und schauen Sie einfach selbst nach.[3] Wenn Sie in Jonathan Basiles Bibliothek blättern, sehen Sie dort Seite für Seite nichts weiter als beliebig und vollkommen sinnfrei aneinandergereihte Buchstaben – Sie werden kaum ein einziges zusammenhängendes Wort entdecken können. Borges berichtet von einer Legende, die Bibliothekare unter sich gerne hinter vorgehaltener Hand erzählen. Darin geht es um einen Mann, der vor fünfhundert Jahren ein Buch in die Hände bekam, das stolze zwei Seiten lesbaren Text enthielt. Im Gegensatz dazu war das längste lesbare Wort, das Basile selbst bei seiner ganzen Sucherei gefunden hat, das Wort «dog» – Hund.
Wenn Sie sich so schnell durch die Bücher der Bibliothek von Babel klicken, dass Sie nur eine Sekunde pro Buch brauchen, kommen Sie nach ca. 104668 Jahren zum Ende. Dummerweise wird die Erde schon in rund 1010 Jahren von der Sonne verschlungen werden (wie in Kapitel 7 besprochen, ohne jede Spur von Weltuntergangsfantasie) – dabei also viel Vergnügen.
Und selbst für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie auf etwas Verständliches stoßen: Woher wollen Sie wissen, dass es wahr ist? Alle Seiten, auf denen die Heilung vom Krebs beschrieben ist, oder Geschichten über Ihren Tod, sind absolut nicht zu unterscheiden von der gigantischen Anzahl Seiten, die plausibel erscheinen, aber in einem einzigen entscheidenden Detail falsch liegen. Aus alledem ergibt sich eine merkwürdige, kontraintuitive Schlussfolgerung. Eine Bibliothek, die sämtliches denkbare Wissen enthält, könnte genauso gut keine Spur von Wissen enthalten.
Der Kreis des Wissens
Vollständige Bibliotheken müssen nicht aus Buchstaben oder Pixeln zusammengestellt sein: Sie können auch aus Zahlen bestehen. Denken Sie an das Vorzeigeobjekt der Mathematik schlechthin, die Zahl pi, üblicherweise mit dem griechischen Buchstaben π geschrieben. Sie ist eine irrationale Zahl, d.h., sie ist nicht als Bruch darstellbar. Die Ziffern, 3,14159… usw. setzen sich unendlich fort, ohne dass ein sich wiederholendes Muster auftritt. Soweit wir heute sagen können, ist hinter dem Komma jede folgende Ziffer so wahrscheinlich wie jede andere.[4] Wenn Sie an einer beliebigen Stelle in dieser unendlichen Liste eine Ziffer herausgreifen, ist die Chance auf eine 0 exakt gleich groß wie auf eine 1 oder 2 oder 3 oder 4 usw.
Für Ziffernfolgen scheint dasselbe zu gelten. Nehmen Sie zwei beliebige aufeinanderfolgende Ziffern, dann kommt jede zweistellige Zahl mit gleicher Wahrscheinlichkeit bzw. Häufigkeit vor, sei es nun 15 oder 21. Oder 03. Oder 58. Dasselbe Spiel funktioniert auch bei dreistelligen Ziffernfolgen. 876 tritt genauso wahrscheinlich oder häufig auf wie 420, 999, 124 oder 753.
Wenn jede Ziffernfolge gleich wahrscheinlich ist und Sie dieses Spiel endlos weitertreiben, dann muss jede mögliche Ziffernfolge irgendwann irgendwo auftauchen, zumindest ein Mal. Hinter dem Komma der Zahl π verbirgt sich eine numerische Bibliothek von Babel.