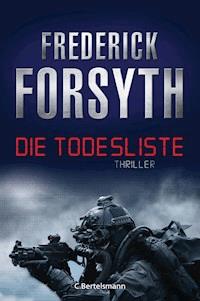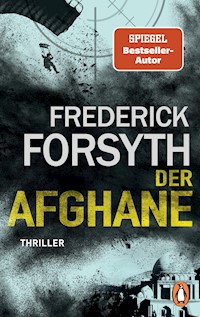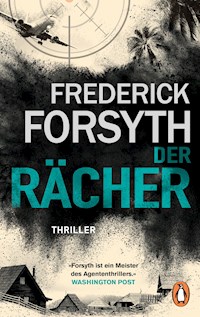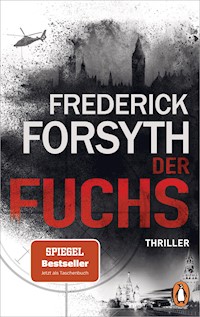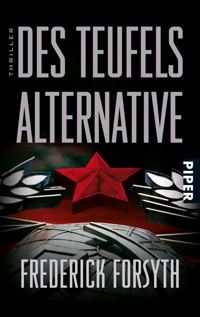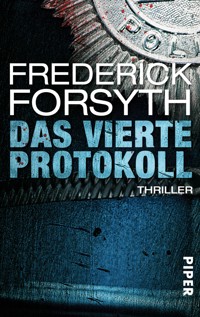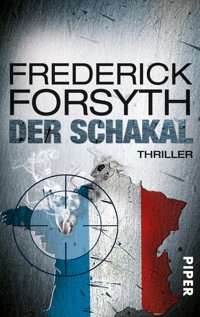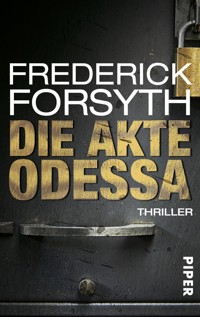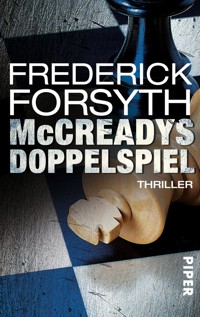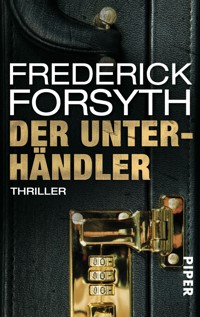
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Sohn des amerikanischen Präsidenten wird entführt. Der Unterhändler Quinn – er gilt als der Beste seines Fachs – wird gebeten, Kontakt mit den Entführern aufzunehmen. Schnell merkt er, dass er es mit keinem gewöhnlichen Fall von Entführung zu tun hat. Das ganze Spiel scheint Teil eines weltweiten Komplotts von Rüstungslobbyisten, die die Friedensverhandlungen der Großmächte für immer beenden wollen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 824
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen von Christian Spiel und Rudolf Hermstein
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96438-8
© 1989 Frederick Forsyth Titel der englischen Originalausgabe: "The Negotiator", Bantam Press, London 1984 Deutschsprachige Ausgabe: © 1989 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur Umschlagmotiv: iStockphoto/Alexander Oshvintsev, Olga Nikonova/Shutterstock Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
PERSONEN DER HANDLUNG
Amerikaner
John F. Cormack, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
Michael Odell, Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika
Jim (James) Donaldson, Secretary of State (Außenminister)
Morton Stannard, Secretary of Defense (Verteidigungsminister)
Bill Walters, Attorney General (Justizminister)
Hubert Reed, Secretary of the Treasury (Finanzminister)
Brad Johnson, National Security Advisor (Nationaler Sicherheitsberater)
Don (Donald) Edmonds, Director of the Federal Bureau of Investigation (Direktor des FBI)
Philip Kelly, Assistant Director, Criminal Investigative Division (CID), FBI(Stellvertretender Direktor des FBI, kriminalpolizeiliche Abteilung)
Kevin Brown, Deputy Assistant Director, Criminal Investigative Division,
FBI(zweiter stellvertretender Direktor des FBI, kriminalpolizeiliche Abteilung)
Lee Alexander, Director, Central Intelligence Agency (Direktor der CIA)
David Weintraub, Assistent Deputy Director (Operations), Central Intelligence Agency (Stellvertretender Direktor der CIA, Operationen)
Buck (Oliver) Revell, Executive Assistant Director (Investigations) des FBI
Quinn, der Unterhändler
Duncan McCrea, CIA-Einsatzagent
Irving Moss, gefeuerter ehemaliger CIA-Agent
Sam (Samantha) Somerville, FBI-Einsatzagentin
Charles Fairweather, Botschafter der Vereinigten Staaten in London
Patrick Seymour, Rechtsberater an der Botschaft der Vereinigten Staaten in London
Lou Collins, Verbindungsmann der CIA in London
Cyrus V. Miller, Ölmagnat
Melville Scanlon, Großreeder
Lionel Cobb, Rüstungsindustrieller
Ben Salkind, Rüstungsindustrieller
Lionel Moir, Rüstungsindustrieller
Creighton Burbank, Director, Secret Service (Direktor des Secret Service)
Robert Easterhouse, freischaffender Sicherheitsberater und Saudi-Arabien-Experte
Steve Pyle, General-Manager der Saudi Arabian Investment Bank
Andy Laing, Angestellter der Saudi Arabian Investment Bank
Simon (Cormack), amerikanischer Student am Balliol College, Universität Oxford
Engländer
Margaret Thatcher, Premierministerin
Sir Harry Marriott, Home Secretary (Innenminister)
Sir Peter Imbert, Commissioner, Metropolitan Police (Chef der Polizei des Großraums London)
Nigel Cramer, Deputy Assistant Commissioner, Specialist Operations Department, Metropolitan Police (zweiter stellvertretender Commissioner der Metropolitan Police, S. O. -Abteilung)
Commander Peter Williams, Investigation Officer, Specialist Operations Department, Metropolitan Police (Leitender Ermittlungsbeamter, S.O.-Abteilung der Metropolitan Police)
Julian Hayman, Chef einer Personenschutz-Firma
Russen
Michail Sergejewitsch Gorbatschow, Generalsekretär der KPdSU
Wladimir Krjutschkow, Vorsitzender des KGB
Pavel Kerkorjan, Oberst KGB-Resident in Belgrad
Wadim Wassiljewitsch Kirpitschenko, Erster Stellvertretender Leiter des Ersten Hauptdirektorats des KGB
Iwan Koslow, Marschall der UdSSR, sowjetischer Generalstabschef
Generalmajor Semskow, Chefplaner im sowjetischen Generalstab
Andrej, KGB-Einsatzagent
Kontinentaleuropäer
Kuyper, belgischer Kleinkrimineller
Albert van Eyck, Direktor des Vergnügungsparks in Walibi, Belgien
Dieter Lutz, Hamburger Journalist
Hans Moritz, Dortmunder Brauereibesitzer
Horst Lenzlinger, Oldenburger Waffenhändler
Werner Bernhardt, ehemaliger Kongosöldner
Papa de Groot, holländischer Provinzpolizeichef
Chefinspektor Dykstra, Kriminalbeamter der holländischen Provinzpolizei
Prolog
Kurz vor dem Regen kam der Traum wieder. Den Regen hörte er nicht. Schlafend wurde er von dem Traum übermannt.
Da war die Lichtung wieder, in dem Wald hoch über Taormina. Er trat zwischen den Bäumen hinaus und ging, wie abgemacht, langsam auf die Mitte der Lichtung zu. Der Aktenkoffer war in seiner rechten Hand. Als er die Stelle erreicht hatte, stellte er den Aktenkoffer auf die Erde, trat ein paar Schritte zurück und ließ sich auf die Knie nieder. Wie abgemacht. Das Köfferchen enthielt eine Milliarde Lire.
Es hatte sechs Wochen gedauert, bis die Freilassung des Kindes ausgehandelt war – schneller als in den meisten Fällen. Manchmal zogen sie sich monatelang hin. Sechs Wochen lang hatte er neben dem Experten aus der Carabinieri-Zentrale in Rom gesessen, ebenfalls ein Sizilianer, aber auf der Seite der Guten, und hatte ihn in Fragen der Taktik beraten. Die mündlichen Verhandlungen hatte der Carabinieri-Offizier geführt. Schließlich hatte man sich auf die Bedingungen für die Freilassung der Juwelierstochter aus Mailand geeinigt, die aus der Sommervilla der Familie nahe dem Strand von Cefalù entführt worden war. Nicht ganz eine Million Dollar nach einer ursprünglichen Forderung in fünffacher Höhe, aber schließlich war die Mafia darauf eingegangen.
Auf der anderen Seite der Lichtung tauchte ein Mann auf, unrasiert, maskiert, über dessen Schulter eine Lupara-Schrotflinte hing. An einer Hand führte er das zehnjährige Mädchen. Sie war barfuß, blaß, wirkte verängstigt, schien aber unversehrt zu sein. Zumindest körperlich. Die beiden kamen auf ihn zu. Er sah, daß die Augen des Banditen ihn durch die Maske anstarrten und dann rasch den Wald hinter ihm absuchten.
Der Mafioso blieb neben dem Aktenkoffer stehen und befahl dem Mädchen knurrend, das gleiche zu tun. Sie gehorchte. Doch sie starrte mit ihren großen, dunklen Augen zu ihrem Retter hin. Nicht mehr lange, Baby, es ist ja gleich vorbei.
Der Bandit zählte rasch die Bündel der Geldscheine in dem Köfferchen, bis er sich überzeugt hatte, daß man ihn nicht betrogen hatte. Der hochgewachsene Mann und das Mädchen blickten einander an. Er zwinkerte ihr zu; über ihr Gesicht huschte ein Lächeln. Der Bandit schloß den Aktenkoffer und machte sich rückwärtsgehend zu seiner Seite der Lichtung auf. Als er die Bäume erreicht hatte, geschah es.
Es war nicht der Carabiniere aus Rom, sondern der Schwachkopf vom Ort. Gewehrfeuer knatterte los, der Bandit mit dem Aktenkoffer stolperte und stürzte zu Boden. Natürlich hatten sich seine Komplizen hinter ihm verteilt, von den Pinien gedeckt. Sie feuerten zurück. Binnen einer Sekunde fetzte ein Kugelhagel über die Lichtung. Er brüllte »HINLEGEN …« auf italienisch, aber sie hörte ihn nicht oder war in Panik geraten und versuchte auf ihn zuzulaufen. Er sprang hoch und warf sich ihr über die sieben Meter, die sie trennten, entgegen.
Er schaffte es beinahe. Er sah sie vor sich, dicht vor seinen Fingerspitzen, nur ein paar Zentimeter vor seiner ausgestreckten rechten Hand, die sie herunterreißen wollte aufs Gras, in Sicherheit, er sah die schreckliche Angst in ihren großen Augen, die kleinen weißen Zähne in dem zum Schrei geöffneten Mund … und dann die karmesinrote Rose, die vorne an ihrem dünnen Baumwollkleidchen aufblühte. Dann sank sie wie in den Rücken gestoßen auf die Erde, und er erinnerte sich, wie er sich über sie geworfen und sie mit seinem Körper gedeckt hatte, bis die Schießerei aufhörte und die Mafiosi sich durch den Wald davonmachten. Er dachte daran zurück, wie er auf der Erde gehockt, den kleinen, schlaffen Körper in seinen Armen gewiegt und weinend zu den konsternierten und verspätete Entschuldigungen stammelnden Ortspolizisten hingebrüllt hatte: »Nein, o nein, großer Gott, nicht noch einmal …«
1. Kapitel
November 1989
Der Winter war in diesem Jahr früh gekommen. Bereits Ende des Monats fegten die ersten Vorboten, getragen von einem bitterkalten Wind aus den Steppen im Nordosten, über die Dächer, um Moskaus Widerstandskraft zu prüfen.
Das Hauptquartier des sowjetischen Generalstabs befindet sich an der Uliza Frunse, ein graues Steingebäude aus den dreißiger Jahren, vis-à-vis seiner Dependance, einem viel moderneren, achtstöckigen Hochhaus auf der anderen Straßenseite. In der obersten Etage des alten Baus stand der sowjetische Generalstabschef am Fenster. Er starrte hinaus in das eisige Schneetreiben, und seine Stimmung war so trübe wie der nahende Winter.
Marschall Iwan K. Koslow war siebenundsechzig, zwei Jahre über das vorgeschriebene Pensionsalter hinaus, doch in der Sowjetunion hielten – wie überall sonst auch – diejenigen, die die Vorschriften erfanden, den Gedanken für abwegig, daß diese auch für sie selbst gelten sollten. Zu Beginn des Jahres hatte er zur allgemeinen Überraschung in der Militärhierarchie den altgedienten Marschall Achromejew abgelöst. Die beiden Männer waren so verschieden wie Tag und Nacht. Achromejew war ein kleiner, stockdürrer Intellektueller gewesen, Koslow hingegen ein gutmütig-derber, weißhaariger Riese, ein Soldat vom Scheitel bis zur Sohle, Sohn, Enkel und Neffe von Soldaten. Obwohl vor seiner Beförderung nur der dritte unter den Ersten Stellvertretenden Generalstabschefs, hatte er die beiden ranghöheren vor ihm übersprungen, und diese waren ohne Aufsehen in Pension gegangen. Niemand hatte den geringsten Zweifel, warum er an die Spitze gelangt war. Von 1987 bis 1989 hatte er unauffällig und sachverständig den Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan geleitet, ein Unternehmen ohne Skandale, ohne größere Niederlagen und – vor allem – ohne nationalen Gesichtsverlust, obwohl die Wölfe Allahs den ganzen Weg bis zum Salang-Paß nach den Fersen der Russen geschnappt hatten. Die Operation hatte ihm in Moskau hohes Ansehen verschafft und den Generalsekretär persönlich auf ihn aufmerksam werden lassen.
Doch während er seine Pflicht getan und sich den Marschallstab verdient hatte, tat er einen geheimen Schwur: Nie wieder würde er einen Rückzug seiner geliebten russischen Armee kommandieren – denn trotz der aufwendigen Public-Relations-Kampagne war das Unternehmen Afghanistan eine Niederlage gewesen. Eine weitere drohende Niederlage war der Grund seiner düsteren Stimmung, als er durch die Doppelglasscheibe hinausstarrte auf die winzigen Eispartikel, die in Abständen am Fenster vorüberstoben.
Der auf seinem Schreibtisch liegende Bericht, in seinem Auftrag verfaßt von einem der aufgewecktesten seiner Schützlinge, einem jungen Generalmajor, den er aus Kabul mitgebracht und in den Generalstab aufgenommen hatte, war schuld an seiner schlechten Laune. Kaminsky war ein Akademiker, ein tiefschürfender Denker und zugleich ein Organisationsgenie, weswegen ihm der Marschall den zweithöchsten Posten im Bereich Logistik zugeteilt hatte. Wie alle Offiziere mit Fronterfahrung wußte Koslow besser als die meisten anderen, daß Schlachten nicht durch Mut oder opferbereiten Einsatz oder auch nur von intelligenten Generälen gewonnen werden; sie werden gewonnen, wenn das richtige Gerät zur richtigen Zeit am richtigen Ort und obendrein in ausreichender Menge zur Verfügung steht.
Er erinnerte sich mit Bitterkeit an seine Erlebnisse als neunzehnjähriger Panzergrenadier, als die hervorragend ausgerüsteten deutschen Truppen die Verteidigungsstellungen des »Mutterlandes« niedergewalzt hatten, während die Rote Armee, durch die stalinistischen Säuberungen ausgeblutet und mit Ladenhütern ausgerüstet, den Vormarsch aufzuhalten versuchte. Sein eigener Vater war bei dem Versuch gefallen, eine unhaltbare Stellung bei Smolensk zu verteidigen und mit Repetiergewehren die vorwärtsdonnernden Panzerregimenter Guderians aufzuhalten. Das nächste Mal, so schwor er sich, werden wir über die richtige Ausrüstung verfügen, und zwar in reichlichem Maße. Diesem Ziel hatte er einen großen Teil seiner Karriere gewidmet, und nun unterstanden ihm die fünf Waffengattungen der Sowjetunion, die Armee, die Kriegsmarine, die Luftwaffe, die Strategischen Raketenstreitkräfte und die Luftverteidigung. Und sie alle waren, wie er dem dreihundert Seiten umfassenden Bericht auf seinem Schreibtisch entnehmen mußte, von einer Niederlage bedroht.
Er hatte ihn bereits zweimal gelesen, nachts in seiner spartanisch eingerichteten Wohnung, abseits des Kutusowsk-Prospekts, und dann noch einmal an diesem Vormittag in seinem Dienstzimmer, wo er um 7Uhr eingetroffen war und gleich den Telefonhörer neben den Apparat gelegt hatte, um nicht gestört zu werden. Nun trat er vom Fenster weg, ging zu dem breiten Schreibtisch am Ende des hufeisenförmigen Konferenztisches und nahm sich noch einmal die letzten Seiten des Konvoluts vor.
ZUSAMMENFASSUNG: Es geht also nicht darum, daß nach den Voraussagen in den nächsten zwanzig oder dreißig Jahren die Erdölvorräte dieses Planeten zur Neige gehen werden, sondern darum, daß die Ressourcen der Sowjetunion in den nächsten sieben oder acht Jahren mit Sicherheit erschöpft sind. Der Schlüssel zu diesem Faktum findet sich in der Tabelle der nachgewiesenen Reserven weiter vorne in diesem Bericht und insbesondere in der mit R/P-Verhältnis bezeichneten Zahlenreihe. Das Verhältnis von Reserven zu Produktion ergibt sich, wenn man die Jahresproduktion eines ölfördernden Landes nimmt und dessen bekannte Reserven durch diese Zahl dividiert, in der Regel ausgedrückt in Milliarden Barrel.
Die Zahlen vom Jahresende 1985 – leider handelt es sich um westliche Zahlenangaben, da wir uns trotz meiner engen Kontakte zu unserer Ölindustrie noch immer auf Informationen aus dem Westen stützen müssen, wenn wir uns darüber Klarheit verschaffen wollen, was in Sibirien vor sich geht – zeigen, daß wir in diesem Jahr 4,4Milliarden Barrel Rohöl gefördert haben, was bedeutet, daß wir bei gleichbleibender Produktion weitere vierzehn Jahre fördern können. Aber das ist eine allzu optimistische Annahme, da wir seither unsere Produktion und damit den Abbau der Erdölvorräte steigern mußten. Heute verfügen wir nur noch über Reserven für sieben bis acht Jahre.
Die Bedarfssteigerung hat zwei Gründe. Der eine liegt in der anwachsenden Industrieproduktion, namentlich auf dem Verbrauchsgütersektor, wie sie vom Politbüro seit der Einführung der neuen Wirtschaftsreformen gefordert wird, der andere in der Ineffizienz dieser Industriezweige, nicht nur der traditionellen, sondern auch der neuen. Unsere Fertigungsindustrie krankt an einer gewaltigen Ineffizienz im Energieeinsatz, und dazu kommt in zahlreichen Fällen noch der Verstärkungseffekt durch eine veraltete maschinelle Ausstattung. Beispielsweise hat ein russisches Auto das dreifache Gewicht seines amerikanischen Pendants, nicht nur wegen unserer strengen Winter, wie offiziell behauptet wird, sondern weil unsere Stahlwerke nicht genügend Feinblech produzieren können. Mithin wird für die Fertigung des Wagens ein höherer Prozentsatz des aus Erdöl gewonnenen Stroms gebraucht als im Westen, und zudem verbraucht der Wagen, wenn er erst in den Verkehr gelangt ist, noch mehr Benzin.
ALTERNATIVEN:Kernkraftwerke produzieren elf Prozent der in der UdSSR erzeugten Elektrizität, und unsere Planer hatten damit gerechnet, daß bis zum Jahr 2000 zwanzig Prozent oder mehr von Reaktoren produziert wird. Bis Tschernobyl. Leider wurden vierzig Prozent unseres Atomstroms von Werken des gleichen Typs wie dem in Tschernobyl erzeugt. Seither sind die meisten davon wegen »technischer Veränderungen« stillgelegt worden – in Wirklichkeit ist es äußerst unwahrscheinlich, daß sie wieder in Betrieb gehen werden –, und der geplante Bau weiterer Anlagen wurde gestrichen. Ergebnis: Unsere Stromerzeugung durch Kernkraftwerke hat keinen zweistelligen Prozentanteil erreicht, sondern ist auf sieben Prozent gesunken und sinkt weiter.
Wir verfügen über die größten Erdgasreserven auf der Welt, doch leider befinden sich die Gasvorkommen hauptsächlich in Sibirien mit seinen extremen Witterungsbedingungen, und es ist nicht damit getan, das Gas einfach aus dem Boden zu holen. Wir brauchen – haben aber nicht – eine gewaltige Infrastruktur aus Pipelines und Verteilungsnetzen, um es aus Sibirien in unsere Städte, Fabriken und Kraftwerke zu transportieren.
Sie werden sich vielleicht erinnern, daß wir in den frühen siebziger Jahren, als nach dem Jom-Kippur-Krieg die Ölpreise in schwindelerregende Höhen getrieben wurden, das Angebot machten, Westeuropa langfristig mit Erdgas zu versorgen. Mit Hilfe der Vorfinanzierung für den Bau der Rohrleitungen, die uns die Europäer zugesagt hatten, wäre es möglich gewesen, das notwendige Verteilungsnetz einzurichten. Doch da Amerika davon keine Vorteile gehabt hätte, torpedierten die USA diese Initiative mit der Androhung verschiedenster Wirtschaftssanktionen gegen jedes Land, das mit uns kooperieren würde. Damit war das Projekt gestorben. Heute, nach dem Einsetzen des sogenannten »Tauwetters«, wäre ein solches Vorhaben vielleicht politisch durchzusetzen, doch im Augenblick sind die Ölpreise im Westen niedrig, und unser Erdgas wird nicht gebraucht. Bis der weltweite Rückgang der Erdölförderung im Westen den Preis abermals auf eine Höhe getrieben hat, die unser Erdgas wieder interessant macht, ist es für die UdSSR viel zu spät.
Somit ist keine der beiden denkbaren Alternativen von praktischer Bedeutung. Erdgas und Kernenergie werden unsere Probleme nicht lösen. Unsere Industrie wie auch die unserer Partner, die in ihrer Energieversorgung von uns abhängig sind, ist untrennbar mit Brenn- und industriellen Grundstoffen auf Erdölbasis verbunden.
DIE VERBÜNDETEN: Eine kurze Nebenbemerkung zu unseren Verbündeten in Mitteleuropa, den Staaten, die von Propagandisten im Westen als unsere »Satelliten« bezeichnet werden. Obwohl sich ihre Gesamt-Erdölförderung – hauptsächlich aus dem kleinen rumänischen Fördergebiet in Ploesti – immerhin auf 173Millionen Barrel pro Jahr beläuft, ist dies im Vergleich zu ihrem Bedarf ein Tropfen im Ozean. Der Restbedarf wird von uns gedeckt und das ist einer der Faktoren, die sie in unserem Lager halten. Um die Belastung für uns etwas zu mildern, haben wir zwar ein paar Tauschgeschäfte zwischen ihnen und Ländern im Nahen Osten sanktioniert, doch sollten sie irgendwann einmal von unserem Öl unabhängig – und damit vom Westen abhängig – werden, wäre es sicher nur eine Frage der Zeit, und zwar einer kurzen Zeitspanne, bis die DDR, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und sogar Rumänien dem Zugriff des kapitalistischen Lagers anheimfielen. Von Kuba ganz zu schweigen.
SCHLUSSFOLGERUNGEN …
Marschall Koslow blickte hoch und auf die Uhr an der Wand. 11Uhr. Die Zeremonie draußen auf dem Flughafen mußte in Kürze beginnen. Er hatte es vorgezogen, ihr fernzubleiben, da er keine Lust hatte, um Amerikaner herumzuscharwenzeln. Er streckte sich, stand auf und ging wieder ans Fenster, den Kaminsky-Bericht in der Hand, der – noch immer – den Vermerk STRENG GEHEIM trug, und Koslow wußte jetzt, daß es dabei bleiben mußte. Das Papier barg viel zuviel Zündstoff, als daß er es im Gebäude des Generalstabs zirkulieren lassen durfte.
In früheren Zeiten hätte ein Stabsoffizier, der so freimütig schrieb wie Kaminsky, seine Karriere in Mikronen messen können, doch Iwan Koslow, obwohl auf beinahe jedem Gebiet ein hartgesottener Traditionalist, hatte Offenheit noch nie bestraft. Diese Offenheit war so ungefähr das einzige, was er auch am Generalsekretär zu schätzen wußte; obwohl er für dessen neumodische Ideen, den Bauern Fernsehapparate und den Hausfrauen Waschmaschinen zu geben, nichts übrig hatte, mußte er einräumen, daß man vor Michail Gorbatschow frei heraus sprechen konnte, ohne daß man eine einfache Fahrkarte nach Jakutien verpaßt bekam.
Der Bericht war ein Schock für ihn gewesen. Er hatte zwar gewußt, daß die Wirtschaft des Landes seit Einführung der Perestrojka nicht besser funktionierte als vorher, doch als Soldat hatte er seine Tage innerhalb der geschlossenen Gesellschaft der militärischen Hierarchie verbracht, und das Militär hatte von jeher vorrangigen Anspruch auf Ressourcen, Versorgungsgüter und Technologien gehabt und war so der einzige Bereich in der Sowjetunion gewesen, wo eine Qualitätskontrolle praktiziert werden konnte. Daß die Haartrockner für die Zivilbevölkerung lebensgefährlich und die Schuhe undicht waren, hatte Koslow wenig gekümmert. Aber jetzt war eine Krise eingetreten, von der nicht einmal das Militär verschont bleiben konnte. Er wußte, das dicke Ende des Berichts lag in den Schlußfolgerungen. Am Fenster stehend, nahm er die Lektüre wieder auf.
SCHLUSSFOLGERUNGEN: Die Aussichten, die sich uns bieten, nur vier an der Zahl, sind äußerst düster.
1. Wir können unsere Ölproduktion auf der gegenwärtigen Höhe halten, in der Gewißheit, daß die Quellen in spätestens acht Jahren versiegen werden, und wir dann auf dem Weltmarkt als Käufer auftreten müssen. Das würde im ungünstigsten, nämlich in dem Augenblick geschehen, da die globalen Ölpreise ihren unvermeidlichen, gnadenlosen Anstieg beginnen und eine nie gekannte Höhe erreichen werden.
Unter diesen Bedingungen durch Käufe auch nur einen Teil unseres Bedarfs zu decken, würde unsere gesamten Reserven an Hartwährungen sowie die Einnahmen aus den Verkäufen von Gold und Diamanten aus Sibirien aufzehren. Für die notwendigen Importe von Getreide und Hochtechnologie, dem eigentlichen Rückgrat der vom Politbüro mit solcher Vehemenz betriebenen industriellen Modernisierung, würde nichts übrigbleiben.
Auch Kompensationsgeschäfte könnten unsere Situation nicht erleichtern. Mehr als fünfundfünfzig Prozent der Weltreserven an Erdöl befinden sich in fünf Ländern des Nahen Ostens und in der Neutralen Zone, deren Eigenbedarf in Relation zu ihren Ressourcen verschwindend gering ist, und diese Staaten werden schon bald wieder am Drücker sein. Da, abgesehen von Waffen und einigen Rohstoffen, sowjetische Produkte im Nahen Osten nicht gefragt sind, können wir auf Tauschgeschäfte zur Deckung unseres Ölbedarfs nicht hoffen. Wir werden mit harter Währung zahlen müssen, und dazu sind wir nicht in der Lage.
Schließlich ist das strategische Risiko einer Abhängigkeit von ausländischen Ölzufuhren zu bedenken, vor allem angesichts der Regime in den in Frage kommenden fünf nahöstlichen Staaten und ihrer bisherigen Politik.
2. Wir könnten unsere bestehenden Produktionsanlagen technisch verbessern und auf den neuesten Stand bringen, um eine höhere Effizienz zu erzielen und damit den Verbrauch zu senken, ohne Verzicht leisten zu müssen. Unsere Produktionsanlagen sind veraltet, in einem sehr schlechten Allgemeinzustand, und das Gewinnungspotential unserer großen Ölfelder wird laufend durch eine überhöhte Tagesförderung beeinträchtigt.
(So geben wir beispielsweise in unseren besten Fördergebieten drei amerikanische Dollar aus, um einen Produktionsausfall in Höhe von einem Dollar zu vermeiden. Im Vergleich zu den amerikanischen Raffinerien verbrauchen die unseren für die Produktion einer Tonne Treibstoff das Dreifache an Energie. Um unser Öl für ein weiteres Jahrzehnt zu »strecken«, müßten wir unsere gesamten Fördereinrichtungen, die Raffinerien und die Rohrleitungsinfrastruktur auf Vordermann bringen. Wir müßten damit sofort beginnen, und die Kosten wären astronomisch.
3. Wir könnten unsere gesamten Anstrengungen auf die Verbesserung unserer Offshore-Bohrtechnologie richten. Die Arktis ist das Gebiet, wo wir am ehesten neues Öl finden könnten. Die Förderungsprobleme sind dort jedoch viel gewaltiger als selbst in Sibirien. Für den Transport vom Bohrloch bis zum Verbraucher ist keinerlei Infrastruktur vorhanden, und selbst die Explorationsprogramme hinken fünf Jahre hinter der Planung her. Auch in diesem Fall wären gewaltige Mittel erforderlich.
4. Wir könnten auf Erdgas zurückgreifen. Wie bereits festgestellt, verfügen wir hier über die größten Reserven der Erde, in nahezu unbegrenzter Menge. Aber auch hier müßten wir enorme Mittel für Förderung, Technologie, ausgebildete Fachkräfte, Rohrleitungsinfrastruktur und die Umstellung von Hunderttausenden Fabriken auf den Einsatz dieses Energieträgers aufwenden.
Und schließlich ergibt sich unausweichlich die Frage: Woher sollten die Mittel, die in den Optionen zwei, drei und vier erwähnt werden, kommen? Angesichts der Notwendigkeit, unsere Devisenbestände für Getreideeinfuhren zur Ernährung unserer Bevölkerung zu verwenden, und angesichts der Entschlossenheit des Politbüros, den Rest für Importe von Hochtechnologie auszugeben, liegt es auf der Hand, daß die Mittel durch Einsparungen aufgebracht werden müßten. Und da das Politbüro außerdem zur Modernisierung der Industrie entschlossen ist, könnte es der Versuchung ausgesetzt sein, das Militärbudget genauer unter die Lupe zu nehmen.
Ich verbleibe, Genosse General,
hochachtungsvoll
PJOTR V. KAMINSKY, Generalmajor
Marschall Koslow fluchte leise, klappte die Akte zu und starrte hinab auf die Straße. Die Graupelschauer hatten zwar aufgehört, aber der Wind blies noch immer bitter kalt; Koslow beobachtete die winzigen Fußgänger acht Etagen tiefer, wie sie ihre Tschapkas mit den herabgeklappten Ohrenschützern festhielten und mit gesenkten Köpfen die Frunse-Straße entlangeilten.
Es war beinahe fünfundvierzig Jahre her, als er, damals ein dreiundzwanzigjähriger Leutnant der motorisierten Schützen, unter Marschall Tschuikow nach Berlin hineingebraust und auf das Dach der Reichskanzlei geklettert war, um die letzte Hakenkreuzfahne herunterzuholen, die dort noch wehte. Ein Foto dieser Aktion wurde sogar in mehreren historischen Darstellungen abgebildet. Seither hatte er sich mühsam Schritt für Schritt hochgedient, war während des Aufstands von 1956 in Ungarn, während des Grenzkonflikts mit China am Ussuri gewesen, hatte in der DDR Garnisonsdienst geleistet und war dann zum Fernöstlichen Kommando in Chaborowsk, später zum Oberkommando Süd in Baku versetzt und schließlich in den Generalstab geholt worden. Er hatte seine Schuldigkeit getan, die eiskalten Nächte auf fernen Außenposten des Imperiums ertragen, hatte sich von seiner ersten Frau scheiden lassen, die ihn nicht begleiten wollte, und die zweite begraben, die im Fernen Osten gestorben war. Er hatte erlebt, daß seine Tochter nicht, wie er gehofft, einen Soldaten, sondern einen Bergbauingenieur heiratete, und daß sein Sohn es ablehnte, ebenfalls zur Armee zu gehen. Und in diesen fünfundvierzig Jahren war er Zeuge gewesen, wie die Sowjetarmee zu dem heranwuchs, was er als die beste Streitmacht auf unserem Planeten betrachtete, der Verteidigung der Rodina, der Heimat, und der Vernichtung seiner Feinde geweiht.
Wie so mancher traditionell Denkende glaubte auch er, daß eines Tages diese Waffen, für die die Massen sich abgerackert hatten und über die er und seine Männer nun verfügten, eingesetzt werden müßten, und für ihn kam es nicht in Frage, daß irgendeine Konstellation von Umständen oder von Männern seine geliebte Armee schwächte, solange er dieses Kommando innehatte. Er war der Partei zwar tief ergeben – sonst wäre er nicht dort hingelangt, wo er war –, aber wenn irgend jemand, und wäre es der Mann, der jetzt die Partei führte, glauben sollte, man könnte Milliarden Rubel aus dem Militärbudget streichen, wäre er vielleicht gezwungen, seine Loyalität gegenüber diesen Männern zu überdenken.
Je mehr er über die abschließenden Seiten des Berichts nachsann, um so stärker wurde der Gedanke, daß Kaminsky, so intelligent er auch war, eine mögliche fünfte Option übersehen haben könnte. Wenn die Sowjetunion eine überreichlich sprudelnde Rohölquelle unter ihre politische Kontrolle bringen, ein Gebiet, das sich derzeit außerhalb ihrer eigenen Grenzen befand … wenn sie und nur sie allein dieses Rohöl zu einem Preis importieren könnte, den sie sich leisten, das heißt, den sie diktieren konnte … und zwar, ehe ihre eigenen Vorräte zur Neige gingen …
Er legte den Bericht auf den Konferenztisch und ging durch den Raum zu der Weltkarte, die die Hälfte der Wand, den Fenstern gegenüber, einnahm. Er betrachtete sie angelegentlich, während die Uhr auf die Mittagsstunde zutickte. Immer wieder fiel sein Blick auf ein bestimmtes Gebiet. Schließlich trat er an den Schreibtisch, legte den Hörer wieder auf und rief seinen Adjutanten an.
»Bitten Sie Generalmajor Semskow, zu mir zu kommen – jetzt gleich«, sagte er.
Er setzte sich auf den hochlehnigen Stuhl hinter seinem Schreibtisch, nahm die Fernbedienung in die Hand und schaltete den Fernsehapparat links von ihm an. Das Bild von Kanal Eins erschien und wurde klar – die angekündigte Live-Übertragung vom Prominentenflughafen Wnukowo, außerhalb von Moskau.
United States Air Force One, die Maschine des Präsidenten, stand da, aufgetankt und bereit, zur Startbahn zu rollen. Es war die neue Boeing 747, die in diesem Jahr die alte und ausgediente 707 abgelöst hatte und ohne Zwischenlandung von Moskau zurück nach Washington fliegen konnte, was die alten Boeing 707 nie geschafft hatten. Männer vom 89th Military Airlift Wing, die das Geschwader des Präsidenten auf der Air-Force-Basis Andrews bewachten und warteten, umstanden die Maschine für den Fall, daß ein allzu enthusiastischer Russe nahe genug heranzukommen versuchte, um etwas daran zu befestigen oder einen verstohlenen Blick ins Innere zu werfen. Doch die Russen benahmen sich wie perfekte Gentlemen, was sie schon während der ganzen dreitägigen Visite getan hatten.
Ein paar Meter vom Ende einer der Tragflächen entfernt befand sich ein Podium mit einem Lesepult in der Mitte. Dahinter stand der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Sergejewitsch Gorbatschow, und brachte gerade seine Abschiedsansprache zu Ende. Neben ihm saß, ohne Hut, das stahlgraue Haar von der bitterkalten Brise zerzaust, sein Gast, John F. Cormack, Präsident der Vereinigten Staaten. Rechts und links wurden die beiden Männer von den zwölf übrigen Mitgliedern des Politbüros flankiert.
Vor dem Podium hatte eine Ehrengarde der Miliz, der Zivilpolizei aus dem Innenministerium, dem MVD, Aufstellung genommen, dazu eine weitere, vom Grenztruppendirektorat des KGB gestellt. Um dem Ganzen auch etwas Volksnahes zu geben, bildeten zweihundert Ingenieure, Techniker und Angehörige des Flughafenpersonals an der vierten Seite des leeren Platzes eine Zuschauermenge. Am wichtigsten für den Redner waren jedoch die Batterien der Fernsehkameras, die Fotoreporter und die Journalisten zwischen den beiden Ehrengarden. Denn dies war ein bedeutungsschwangeres Ereignis.
Kurz nach seiner Amtsübernahme im letzten Januar hatte John F. Cormack, Überraschungssieger bei den Wahlen im November, zu verstehen gegeben, daß er den Generalsekretär gerne kennenlernen würde und bereit wäre, nach Moskau zu fliegen. Michail Gorbatschow hatte alsbald sein Einverständnis erklärt und nun, während der vergangenen drei Tage, zu seiner Befriedigung festgestellt, daß dieser hochgewachsene, streng dreinblickende, doch im Grund sehr menschliche ehemalige Professor anscheinend ein Mann war, mit dem er, um Mrs.Thatcher zu zitieren, »Geschäfte machen« konnte.
So war Gorbatschow, gegen den Rat seiner Sicherheits- und ideologischen Berater, ein Risiko eingegangen. Er hatte dem persönlichen Wunsch des Präsidenten entsprochen, man möge ihm gestatten, sich live übers Fernsehen an die Bürger der Sowjetunion zu wenden, ohne daß zuvor der Text seiner Rede zur Billigung vorgelegt wurde. In der Sowjetunion gibt es praktisch keine Live-Sendungen; fast alles wird erst redigiert und überprüft, bevor es schließlich für die Öffentlichkeit freigegeben wird.
Bevor Michail Gorbatschow Cormacks sonderbarem Ersuchen stattgab, hatte er sich mit den Fachleuten vom staatlichen Fernsehen beraten. Sie waren ebenso überrascht wie er, meinten aber, daß erstens nur ganz wenige Sowjetbürger den Amerikaner ohne Übersetzung verstehen würden (und diese konnte notfalls entschärft werden, wenn Cormack zu weit ging), und daß man zweitens die Ansprache in einer acht bis zehn Sekunden langen »Schleife« halten und sie mit ein paar Sekunden Verzögerung übertragen könnte. Und falls er wirklich zu weit ginge, ließe sich ein plötzlicher Ausfall der Übertragung inszenieren. Schließlich wurde vereinbart, daß der Generalsekretär, wenn er einen solchen Abbruch wünschte, sich nur mit dem Zeigefinger am Kinn zu kratzen brauchte. Das übrige würden die Techniker erledigen. Dies konnte natürlich nicht für die drei amerikanischen TV-Teams oder das der BBC gelten, aber das wäre gleichgültig, da ihre Aufnahmen die sowjetische Bevölkerung niemals erreichen würden.
Nachdem Michail Gorbatschow seine Ansprache mit einer Bekundung des Goodwills gegenüber dem amerikanischen Volk und seiner fortdauernden Hoffnung auf Frieden zwischen den USA und der UdSSR beendet hatte, blickte er zu seinem Gast hin. John F. Cormack erhob sich. Der Russe deutete auf das Lesepult und das Mikrofon, übergab dem Präsidenten das Wort und setzte sich neben den Mittelplatz. Der Präsident trat hinter das Mikrofon. Notizen für seine Rede waren nicht zu sehen. Er hob nur den Kopf, blickte direkt in das Auge der sowjetischen Kamera und begann zu sprechen.
»Männer, Frauen und Kinder der UdSSR …« In seinem Dienstzimmer riß es Marschall Koslow auf seinem Stuhl nach vorne. Er starrte wie gebannt auf den Bildschirm, sah, wie auf dem Podium Michail Gorbatschows Augenbrauen zuckten, ehe er seine Fassung zurückgewann. In einer Übertragungskabine hinter der Kamera des Sowjetfernsehens legte ein junger Mann, den man für einen Harvard-Abgänger hätte halten können, die Hand über ein Mikrofon und flüsterte einem hochgestellten Beamten neben ihm eine Frage zu, doch dieser schüttelte den Kopf. John F. Cormack sprach nämlich keineswegs englisch, sondern in einem flüssigen Russisch.
Er beherrschte die Sprache nicht, hatte jedoch vor seinem Abflug in die UdSSR hinter der verschlossenen Tür eines Schlafzimmers im Weißen Haus eine fünfhundert Worte umfassende Ansprache auf russisch auswendig gelernt und sie mit Hilfe von Tonbändern und mit Unterstützung eines Sprachlehrers so lange eingeübt, bis er sie ohne jedes Stocken und mit perfekter Aussprache vortragen konnte, ohne auch nur ein einziges Wort davon zu verstehen. Selbst für einen ehemaligen Professor von einer der amerikanischen Eliteuniversitäten war das eine Glanzleistung.
»Vor fünfzig Jahren«, begann er, »wurde dieses Land, Ihre geliebte Heimat, mit einem Krieg überzogen. Ihre Männer kämpften und starben auf dem Schlachtfeld oder lebten wie Wölfe in ihren eigenen Wäldern. Ihre Frauen und Kinder mußten in Kellern hausen und sich mit armseligen Bissen ernähren. Millionen Menschen kamen um. Ihr Land wurde verwüstet. Obwohl meinem Land so etwas nie widerfahren ist, gebe ich Ihnen mein Wort, daß ich verstehen kann, wie sehr Sie den Krieg hassen und fürchten müssen.
Seit fünfundvierzig Jahren richten wir, die Russen wie die Amerikaner, Mauern zwischen uns auf, reden wir uns ein, daß der andere der nächste Aggressor sein werde. Wir haben Berge aufgehäuft – Berge aus Stahl, aus Geschützen und Panzern, aus Schiffen, Flugzeugen und Bomben. Und die Mauern der Lügen wurden immer höher gebaut, um die Berge aus Stahl zu rechtfertigen. Es gibt Leute, die behaupten, wir brauchen all diese Waffen, weil sie eines Tages notwendig sein werden, damit wir einander vernichten können. No ja skaschu: my poidjom drugim putjom.«
Es war beinahe zu hören, wie die Zuhörer auf dem Flughafen den Atem anhielten. Diesen Satz – »Aber ich sage, wir werden, wir müssen einen anderen Weg einschlagen« – hatte Präsident Cormack bei Lenin entlehnt, und jedes Schulkind in der UdSSR kannte ihn. Das russische Wort »put« bedeutet Straße, Weg oder auch – Kurs, Richtung. Dann fuhr er mit dem anschaulichen Bild des Weges fort: »Ich meine den Weg der schrittweisen Abrüstung und des Friedens. Wir haben nur einen einzigen Planeten, auf dem wir leben können, und es ist ein herrlicher Planet. Wir können entweder gemeinsam auf ihm leben oder gemeinsam auf ihm sterben.«
Leise ging die Tür von Marschall Koslows Dienstzimmer auf und schloß sich dann wieder. Ein Offizier Anfang fünfzig, ebenfalls ein Protegé Koslows und das As seines Planungsstabs, war eingetreten und beobachtete stumm den Fernsehschirm in der Ecke.
Der amerikanische Präsident kam zum Ende seiner Ansprache. »Es wird nicht einfach sein, diese Straße zu beschreiten. Sie wird steinig und voller Schlaglöcher sein. Doch an ihrem Ende warten Friede und Sicherheit für Sie und für uns. Denn wenn wir ausreichend Waffen haben, um uns verteidigen, aber nicht genug, um einander angreifen zu können, und wenn beide Seiten dies wissen und verifizieren können, dann können wir unseren Kindern und Enkeln eine Welt übergeben, die wirklich frei ist von der schrecklichen Furcht, die diese vergangenen fünfzig Jahre geprägt hat. Wenn Sie diese Straße mit mir gehen wollen, dann werde ich sie im Namen des amerikanischen Volkes mit Ihnen gehen. Und darauf, Michail Sergejewitsch, gebe ich Ihnen meine Hand.«
Präsident Cormack wandte sich Generalsekretär Gorbatschow zu und streckte ihm die Rechte entgegen. Der Russe, obwohl selbst ein Experte in Public Relations, hatte keine andere Wahl, als aufzustehen und gleichfalls die Hand auszustrecken. Dann zog er breit lächelnd mit dem linken Arm den Amerikaner in eine ungestüme Umarmung.
Die Russen sind ein eigener Menschenschlag, anfällig für Verfolgungswahn und Fremdenfeindlichkeit, doch zugleich auch zu Gefühlsüberschwang neigend. Die Arbeiter vom Flughafen brachen als erste das Schweigen. Heftiger Applaus brandete auf, dann setzten Jubelrufe ein, und ein paar Sekunden später flogen die ersten Tschapkas durch die Luft, als die Zivilisten, sonst bis zur Perfektion gedrillt, aus dem Häuschen gerieten. Dann folgten die Milizionäre; in »Rührt-Euch!«-Position hielten sie mit der linken Hand ihre Gewehre, schwenkten ihre grauen Mützen mit dem roten Band und brachen ebenfalls in Begeisterungsrufe aus.
Die Grenzsoldaten vom KGB blickten auf ihren Chef neben dem Podium, General Wladimir Krjutschkow. Unsicher, wie er sich verhalten sollte, während sich die Mitglieder des Politbüros erhoben, stand er ebenfalls auf und schloß sich dem Beifallsklatschen an. Die Grenzsoldaten nahmen dies – irrtümlich, wie sich zeigen sollte – als einen Wink und stimmten in den Jubel der Milizionäre ein. Überall im Bereich von fünf Zeitzonen taten 80Millionen sowjetischer Männer und Frauen etwas Ähnliches.
»Tschort wosmi …« Marschall Koslow griff nach der Fernbedienung und schaltete abrupt den Fernsehapparat aus.
»Unser geliebter Generalsekretär«, murmelte Generalmajor Semskow. Der Marschall nickte mehrmals mit einem gallbitteren Ausdruck auf dem Gesicht. Zuerst die unheilkündenden Prophezeiungen des Kaminsky-Berichts und jetzt das. Er erhob sich, kam um den Schreibtisch herum und nahm den Bericht zur Hand.
»Sie nehmen das mit und lesen es«, sagte er. »Es ist als HÖCHST GEHEIM eingestuft und wird es auch bleiben. Es gibt nur zwei Exemplare davon, und das zweite behalte ich. Beachten Sie vor allem, was Kaminsky in seinen Schlußfolgerungen zu sagen hat.«
Semskow nickte. Nach der grimmigen Miene des Marschalls zu schließen, ging es um mehr als nur um die Lektüre eines Berichts. Semskow war nur ein einfacher Oberst gewesen, als er Marschall Koslow auffiel, der damals zu einer Rahmenübung in der DDR weilte.
Zu dieser Übung hatten auch Manöver gehört, an der die sowjetischen Streitkräfte in der DDR auf der einen und die Volksarmee auf der anderen Seite teilgenommen hatten. Die DDR-Soldaten hatten die Rolle angreifender amerikanischer Truppen übernommen und in früheren Fällen ihren sowjetischen Waffenbrüdern übel mitgespielt. Diesmal waren die Russen dank Semskows erfolgreicher Planung haushoch überlegen gewesen. Kaum war Marschall Koslow Generalstabschef geworden, holte er den brillanten Planer in seinen eigenen Stab. Jetzt führte er den Jüngeren zu der Karte an der Wand.
»Wenn Sie mit der Lektüre fertig sind, werden Sie ein Papier ausarbeiten, das wie ein Plan für einen speziellen Krisenfall aussieht, in Wirklichkeit aber ein Plan für die Invasion und Okkupation eines fremden Landes ist, genauestens ausgearbeitet bis auf den letzten Mann, das letzte Geschütz, die letzte Kugel. Sie werden dafür vielleicht ein ganzes Jahr brauchen.«
Generalmajor Semskow hob die Augenbrauen.
»Doch wohl kaum so lange, Genosse Marschall. Ich habe zu meiner Verfügung …«
»Sie haben zu Ihrer Verfügung nichts als Ihre eigenen Augen und Hände, Ihr eigenes Gehirn. Sie werden sich bei niemandem Rat holen, mit niemand anderem darüber Gespräche führen. Sie werden allein arbeiten, ohne Unterstützung. Es wird Monate in Anspruch nehmen, und am Ende nur ein einziges Exemplar geben.«
»Verstehe, und dieses Land …?«
Der Marschall tippte auf die Weltkarte. »Hier. Dieses Land muß uns eines Tages gehören.«
Houston, die Kapitale der amerikanischen Ölindustrie – und, wie manche meinen, der Ölwirtschaft der Welt – ist insofern eine merkwürdige Stadt, als sie nicht ein, sondern zwei Zentren hat. Im Osten erhebt sich Downtown, das Handels-, Banken-, Konzern- und Industriezentrum, aus der Ferne betrachtet eine Ansammlung schimmernder Türme, die aus der konturlosen südwesttexanischen Ebene zu einem blaßblauen Himmel emporsteigen. Im Westen liegt Galleria, das Einkaufs-, Restaurant- und Freizeitzentrum, beherrscht von den Post-, Oak-, Westin- und Transco-Türmen. Dort findet man auch die Galleria selbst, das größte überdachte Einkaufszentrum der Welt.
Diese beiden Herzen der Stadt starren einander über vier Meilen einstöckiger Wohnhäuser und Grünflächen wie Revolverhelden an, stets bereit, sich um die Vorherrschaft zu duellieren.
Architektonisch wird Downtown von seinem höchsten Wolkenkratzer, dem der Texas Commerce, beherrscht, fünfundsiebzig Stockwerke aus grauen Marmorplatten und dunklem, grauem Glas, mit über dreihundertzehn Metern das höchste Bauwerk westlich des Mississippi. Das zweithöchste ist der Allied Bank Tower, ein mit fünfundsechzig Stockwerken spitz zulaufender Turm aus grünem Spiegelglas. Um sie herum stehen weitere Wolkenkratzer verschiedener Konstruktionen: neugotische Hochzeitstorten, spiegelverglaste Bleistifte und die schlicht ausgeflippten.
Nur wenig niedriger als der Wolkenkratzer der Allied Bank ist das Gebäude der Pan Global, dessen zehn oberste Etagen die Erbauerin und Eigentümerin des Turms beherbergen, die Pan Global Oil Corporation, unter den Ölgesellschaften der USA an achtundzwanzigster Stelle und die achtgrößte in Houston. Mit einem Gesamtvermögen von 3,25Milliarden Dollar wurde Pan Global nur von Shell, Tenneco, Conoco, Enron, Coastal Texas Eastern, Transco und Pennzoil übertroffen. Doch in einer Hinsicht unterschied sie sich von all den anderen Konzernen: Pan Global war noch immer im Besitz ihres betagten Gründers. Er hatte zwar Aktionäre und neben sich Mitglieder des Board, aber das Heft in der Hand behalten, und niemand konnte seiner Macht innerhalb seiner eigenen Gesellschaft Fesseln anlegen.
Zwölf Stunden, nachdem Marschall Koslow seinen Planungsoffizier instruiert hatte, und acht Zeitzonen westlich von Moskau stand Cyrus V. Miller an dem von der Decke bis zum Boden reichenden Spiegelglasfenster seiner Penthouse-Suite auf seinem eigenen Wolkenkratzer und blickte nach Westen. Vier Meilen entfernt starrte durch den Dunst dieses Nachmittags spät im November der Transco Tower herüber. Cyrus V. Miller blieb noch eine Weile stehen, ging dann über den flauschigen Teppichboden zu seinem Schreibtisch zurück und vertiefte sich wieder in den Bericht, der darauf lag.
Vierzig Jahre früher, als sein Erfolg begann, hatte Miller gelernt, daß Information Macht bedeutet. Zu wissen, was vor sich geht, und, wichtiger noch, zu wissen, was demnächst geschehen wird, verschafft einem mehr Macht als ein politisches Amt oder sogar Geld. Damals hatte er in seiner aufstrebenden Firma eine Forschungs- und Statistikabteilung eingerichtet und sie mit den aufgewecktesten und intelligentesten Analytikern besetzt, die aus den Universitäten seines Landes kamen. Als dann das Computer-Zeitalter anbrach, hatte er seine F-und-S-Abteilung mit den jeweils neuesten Datenbank-Modellen vollgestopft, in denen eine Unmenge Informationen über die Ölbranche und andere Industriezweige, die wirtschaftliche Leistung der USA, Markttrends, wissenschaftliche Neuentwicklungen und Menschen gespeichert waren – Hunderttausende von Leuten aus jedem Lebensbereich, die ihm eventuell eines Tages von Nutzen sein könnten.
Der Bericht vor ihm stammte von Dixon, einem jungen Absolventen der Texas State University, einem Mann mit scharfem Verstand, den er zehn Jahre vorher angestellt und der sich zusammen mit dem Konzern weiter entwickelt hatte. Trotz des Supergehalts, das ich ihm zahle, dachte Miller, hat mir der Analytiker hier keinen Text vorgelegt, der mich beruhigen soll. Aber er wußte das zu schätzen. Zum fünften Male nahm er sich Dixons Schlußfolgerungen vor.
Das Fazit, Sir, sieht so aus, daß der freien Welt schlicht und einfach das Öl ausgeht. Wegen der Entschlossenheit mehrerer aufeinanderfolgender Regierungen, die Fiktion aufrechtzuerhalten, die gegenwärtige Situation des »billigen Öls« werde in alle Ewigkeit fortdauern, wird diese Tatsache von der breiten Masse der amerikanischen Bevölkerung derzeit nicht wahrgenommen.
Der Beweis für die »Erschöpfungstheorie« findet sich in der Tabelle der globalen Ölreserven, weiter vorne beigelegt. Von den heute einundvierzig ölproduzierenden Staaten verfügen nur zehn über bekannte Reserven, die länger als dreißig Jahre reichen. Selbst dieses Bild ist noch optimistisch, da für diese Zeitspanne eine Produktion auf dem heutigen Stand zugrunde gelegt wird. Tatsache aber ist, daß der Ölverbrauch und damit die Ölförderung steigt, und da den Produzenten mit knappen Reserven das Öl vorher ausgehen wird, wird die übrige Förderung anziehen, um das Minus auszugleichen. Sicherer wäre also die Annahme, daß – bis auf zehn – in allen ölproduzierenden Staaten die Vorräte binnen zwanzig Jahren erschöpft sein werden.
Es ist schlicht undenkbar, daß rechtzeitig alternative Energiequellen verfügbar werden. In den nächsten drei Dekaden heißt es für die freie Welt: Öl oder wirtschaftlicher Untergang.
Die amerikanische Position ist katastrophal und wird immer katastrophaler. In der Zeit, als die damals mächtigen OPEC-Staaten den Rohölpreis von zwei auf vierzig Dollar pro Barrel hochtrieben, gewährten die amerikanischen Regierungen vernünftigerweise der heimischen Ölindustrie jedwede Förderung, zu explorieren und möglichst viel Öl aus einheimischen Reserven zu fördern und zu verarbeiten. Seit dem Niedergang der OPEC und dem drastischen Produktionsanstieg in Saudi-Arabien 1985 badet Washington buchstäblich in billigem Öl aus dem Nahen Osten und hat zugelassen, daß die einheimische Ölindustrie austrocknet. Diese Kurzsichtigkeit wird zu einem bitteren Erwachen führen.
Die amerikanische Reaktion auf das billige Öl war und ist: gestiegene Nachfrage, höhere Einfuhr von Rohöl- und Ölprodukten und schrumpfende Inlandsproduktion, eine scharfe Beschneidung der Exploration, umfassende Stillegungen von Raffinerien und eine schlimmere Arbeitslosigkeit als 1932. Selbst wenn Amerika sofort ein Crash-Programm mit massiven Investitionen und umfassenden Produktionsanreizen in Angriff nähme, würde es zehn Jahre dauern, das Reservoir an geschulten Fachkräften aufzufüllen, die Fördereinrichtungen wieder in Betrieb zu setzen oder ganz zu erneuern und die Aufgabe anzupacken, unsere inzwischen totale Abhängigkeit von nahöstlichem Öl auf ein erträgliches Maß zurückzuführen. Bis dato spricht nichts dafür, daß Washington beabsichtigt, einen solchen Wiederaufstieg der amerikanischen Ölproduktion zu fördern.
Dafür gibt es drei Gründe – und alle sind falsch.
1) Neues Öl, in den USA aufgespürt, würde zwanzig Dollar pro Barrel kosten, während saudiarabisch-kuwaitisches Öl Produktionskosten von zehn bis fünfzehn Cent pro Barrel verursacht und uns als Käufer sechzehn Dollar pro Barrel kostet. Man nimmt an, daß dieser Zustand andauern werde. Er wird es nicht.
2) Es wird angenommen, daß die Araber und insbesondere die Saudis auch weiterhin gewaltige Mengen an amerikanischer Technologie, an amerikanischen Waffen, Waren und Dienstleistungen für ihre eigene soziale und militärische Infrastruktur kaufen und damit ihre Petrodollars zu uns zurückschleusen werden. Das jedoch werden sie nicht tun. Ihre Infrastruktur ist heute so gut wie komplett, sie wissen nicht, wofür sie ihre Dollars noch ausgeben sollen, und ihre vor kurzem (1986 und 1988) abgeschlossenen Tornado-Geschäfte mit Großbritannien haben uns als Waffenlieferanten auf die zweite Stelle verdrängt.
3) Es wird angenommen, daß die nahöstlichen Königreiche und Scheichtümer gute und loyale Verbündete seien, die sich niemals gegen uns wenden, die Preise nicht wieder hochtreiben und deren Regime sich für ewige Zeiten an der Macht halten werden. Ihre brutale Erpressungspolitik gegenüber Amerika, von 1973 bis 1985, zeigt aber, wie es um ihre freundschaftliche Gesinnung bestellt ist, und in einer so instabilen Weltgegend wie dem Nahen Osten kann jedes Regime stürzen, ehe die Woche vorbei ist.
Cyrus V. Miller starrte die Blätter an. Es gefiel ihm nicht, was er da las, aber er wußte, daß es die Wahrheit war. Als amerikanischer Ölproduzent und Verarbeiter von Rohöl hatte er – wie er es sah – in den vergangenen vier Jahren grausam gelitten, und trotz aller Anstrengungen, die die Lobby der Ölindustrie unternommen hatte, hatte sich der Kongreß nicht erweichen lassen, im Arctic National Wildlife Range in Alaska, wo die Aussichten, neues Öl zu entdecken, am verheißungsvollsten waren, Pachtland bereitzustellen. Miller haßte Washington und alle seine Werke.
Er warf einen Blick auf seine Uhr. Halb fünf, dann drückte er eine Taste auf seiner Schreibtisch-Konsole. An der gegenüberliegenden Seite des Raumes glitt eine Schiebewand aus Teakholz geräuschlos beiseite, und ein Fernsehgerät wurde sichtbar. Miller wählte den Kanal von Cable News Network und erwischte gerade die Schlagzeilenmeldung des Tages.
Die Air Force One schwebte über der Landebahn der Andrew Base außerhalb von Washington, wirkte wie in der Luft aufgehängt, bis die Räder sanft auf der Landebahn aufsetzten und sie wieder mit amerikanischem Boden verbunden war. Während sie bremste, und der massive Rumpf sich von der Landebahn weg- und auf der eine Meile langen Rollbahn zu den Flughafengebäuden hindrehte, wurde das Bild der Maschine von dem des hastig brabbelnden Nachrichtensprechers verdrängt, der noch einmal über die Rede des Präsidenten kurz vor dem Abflug aus Moskau, zwölf Stunden vorher, berichtete.
Wie um die Echtheit dieses Berichts zu beweisen, brachte das CNN-Aufnahmeteam – da noch zehn Minuten blieben, bis die Boeing ausgerollt war – die auf russisch gehaltene Ansprache des Präsidenten mit den englischen Untertiteln, das Schreien und Jubeln der Flughafenarbeiter und Milizionäre und das Bild Michail. Gorbatschows, wie er den Amerikaner überschwenglich umarmte. Cyrus V. Millers nebelgraue Augen blinzelten nicht, verbargen sogar hier in diesem Raum, wo er mit sich allein war, seinen Haß auf den Großbürger aus Neuengland, der sich ein Jahr zuvor unerwartet an die Spitze gesetzt und die Präsidentschaft errungen hatte und nun rascher eine Entspannung im Verhältnis zu Rußland ansteuerte, als selbst Reagan es je gewagt hatte. Als Präsident Cormack in der Tür der Air Force One erschien und die Hymne »Hail to the Chief« intoniert wurde, schaltete Miller mit verächtlicher Miene den Fernsehapparat ab.
»Kommunisten-Arschkriecher!« knurrte er und wandte sich wieder Dixons Bericht zu.
Genau besehen ist die Zwanzig-Jahre-Frist für das Versiegen des Öls bei den einundvierzig Ölproduzenten der Welt bis auf zehn bedeutungslos. Das Hochtreiben der Preise wird in zehn Jahren oder schon früher einsetzen. Ein unlängst vorgelegter Bericht aus der Harvard University sagte einen Preis von über fünfzig Dollar pro Barrel noch vor 1999 gegenüber sechzehn Dollar pro Barrel heute voraus. Dieser Bericht wurde unterdrückt, war aber ohnedies zu optimistisch gehalten. Welche Auswirkungen solche Preise auf die Amerikaner haben werden, ist eine alptraumhafte Vorstellung. Was werden sie tun, wenn sie erfahren, daß sie zwei Dollar für eine Gallone Benzin zahlen müssen? Wie wird der Farmer reagieren, wenn er erfährt, daß er seine Schweine nicht füttern, sein Getreide nicht ernten, ja, nicht einmal im bitterkalten nördlichen Winter sein Haus heizen kann? Wir werden in unserem Land eine soziale Revolution erleben.
Selbst wenn Washington grünes Licht für eine massive Wiederbelebung der amerikanischen Ölproduktion gäbe, hätten wir dennoch beim derzeitigen Verbrauchsniveau nur für fünf Jahre Reserven. Europa ist sogar noch schlechter dran; abgesehen vom kleinen Norwegen (eines der zehn Länder mit Reserven für dreißig Jahre oder mehr, allerdings auf einer sehr kleinen Offshore-Förderung basierend) verfügt Europa über Reserven für drei Jahre. Die Länder des Pazifischen Beckens sind vollkommen von importiertem Öl abhängig und haben gewaltige Hartwährungsüberschüsse. Das Ergebnis? Abgesehen von Mexiko, Venezuela und Libyen werden wir alle unsere Hoffnungen auf dieselbe Versorgungsquelle richten – die sechs produzierenden Gebiete im Nahen Osten.
Der Iran, der Irak, Abu Dhabi und die Neutrale Zone verfügen über Öl, aber zwei Staaten besitzen mehr als die übrigen zusammen – Saudi-Arabien und das benachbarte Kuwait, und Saudi-Arabien wird in der OPEC das entscheidende Wort haben. Mit 1,3Milliarden Barrel Jahresproduktion heute und einem Anteil an der Weltproduktion, der in dem Maße steigen muß, wie der der anderen einunddreißig Ölproduzenten zurückgeht, mit Reserven für mehr als hundert Jahre wird Saudi-Arabien den Welterdölpreis diktieren – und damit über Amerika bestimmen.
Angesichts der abzusehenden Ölpreissteigerungen werden die USA mit einer Ölimportrechnung von täglich 450Millionen Dollar konfrontiert sein – zu bezahlen an Saudi-Arabien und sein Anhängsel Kuwait. Und das bedeutet, daß die Öllieferanten im Nahen Osten wahrscheinlich zu Eigentümern eben jener amerikanischen Industrien werden, deren Bedarf sie decken. Trotz ihrer Modernität, Technologie, militärischen Macht und ihres Lebensstandards werden die USA wirtschaftlich, finanziell, strategisch und damit politisch von einem bevölkerungsarmen, rückständigen, halbnomadischen, korrupten und unberechenbaren Land abhängig sein, auf das sie keinen Einfluß haben.
Cyrus V. Miller klappte den Bericht zu, lehnte sich zurück und blickte zur Decke hinauf. Wenn irgend jemand die Frechheit besessen hätte, ihm ins Gesicht zu sagen, daß er im politischen Denken Amerikas zu den Ultrarechten gehörte, hätte er vehement widersprochen. Er wählte zwar von jeher republikanisch, hatte sich aber nie sehr für die Politik interessiert, oder doch nur insofern, als sie die Ölindustrie tangierte. Die politische Partei, der er anhing, war die der Patrioten. Miller liebte seinen Wahlheimatstaat Texas und das Land seiner Geburt mit einer Intensität, die ihm manchmal geradezu den Atem benahm.
Mit seinen siebenundsiebzig Jahren war er unfähig zu erkennen, daß sein Amerika in vielem seinem eigenen Hirn entsprungen war: ein weißes, angelsächsisch-protestantisches Amerika traditioneller Werte und eines primitiven Chauvinismus. Nein, versicherte er dem Allmächtigen mehrmals täglich im Gebet, gegen Juden, Katholiken, Hispanics oder Schwarze habe er nichts – schließlich beschäftigte er ja auf seiner herrschaftlichen Ranch im Hill Country außerhalb von Houston acht weibliche Hausangestellte, die spanisch sprachen, von mehreren Schwarzen in den Gärten ganz zu schweigen –, solange sie wußten, wo sie hingehörten.
Er starrte zur Decke hinauf und versuchte, sich an den Namen eines Mannes zu erinnern, eines Mannes, den er ungefähr zwei Jahre vorher bei einer Tagung in Dallas kennengelernt und der ihm erzählt hatte, er lebe und arbeite in Saudi-Arabien. Sie hatten sich zwar nur kurz miteinander unterhalten, aber der Mann hatte Eindruck auf ihn gemacht. Er sah ihn in der Erinnerung klar vor sich: mit ungefähr ein Meter achtzig eine Spur kleiner als Miller, athletisch, straff wie eine gespannte Feder, ruhig, wachsam, nachdenklich, ein Mann mit einem gewaltigen Schatz an Erfahrungen aus dem Nahen Osten. Er hinkte, stützte sich beim Gehen auf einen Stock mit silbernem Knauf und hatte irgend etwas mit Computern zu tun. Je länger Miller sich zu erinnern versuchte, desto mehr fiel ihm ein. Sie hatten sich über Computer, über die Vorzüge seiner Honeywells unterhalten, aber der Mann hatte dem IBM-Produkt den Vorzug gegeben. Ein paar Minuten später rief Miller seine Forschungsabteilung an und diktierte, was ihm eingefallen war.
»Stellen Sie fest, wo er sich aufhält!« befahl er.
Es war bereits dunkel an der spanischen Südküste, jenem Teil, der den Namen Costa del Sol trägt. Obwohl die Touristen-Saison schon einige Zeit zurücklag, waren die hundert Meilen der Küste von Malaga bis Gibraltar von einer funkelnden Lichterkette erhellt, die von den Bergen hinter der Küste wohl wie eine feurige Schlange wirkte, wie sie sich durch Torremolinos, Mijas, Fuengirola, Marbella, Estepona, Puerto Duquesa und weiter nach La Linea und zum »Felsen« dahinwand. Auf der Autobahn Malaga – Cadiz, die durch den Streifen Flachland zwischen den Bergen und den Stränden führt, zuckten pausenlos die Scheinwerfer von Pkws und Lastwagen auf.
In den Bergen hinter der Küste nahe an ihrem westlichen Ende, zwischen Estepona und Puerto Duquesa, erstreckt sich das Weinanbaugebiet des südlichen Andalusien, wo nicht der Sherry des westlich davon gelegenen Jerez, sondern ein aromatisch-herzhafter Rotwein gekeltert wird. Zentrum dieses Gebiets ist die Kleinstadt Manilva, nur ein paar Meilen von der Küste entfernt, aber mit einem prachtvollen Ausblick auf das Meer im Süden. Manilva ist von einigen kleinen Dörfern, oder eher Weilern, umringt. Hier sind die Menschen zu Hause, die die Felder an den Hängen bestellen und sich um die Rebstöcke kümmern.
In einem dieser Dörfer, Alcantara del Rio, kehrten die Männer von den Feldern zurück, müde nach einem langen Arbeitstag. Die Traubenernte war schon lange eingebracht, doch die Rebstöcke mußten beschnitten werden, ehe der Winter kam. Es war schwere Arbeit, die man im Rücken und in den Schultern spürte. Deshalb besuchten die meisten, ehe sie zu ihren verstreuten Häusern heimgingen, auf ein Glas und ein Schwätzchen die einzige Cantina desDorfes.
Alcantara del Rio hatte außer Ruhe und Frieden nicht viel zu bieten. Es gab eine kleine weißgekalkte Dorfkirche, betreut von einem betagten Priester, der seine letzten Jahre damit verbrachte, für die Frauen und Kinder die Messe zu lesen, während die männlichen Mitglieder seiner Herde leider Gottes am Sonntagvormittag der Kneipe den Vorzug gaben. Die Kinder gingen nach Manilva zur Schule. Außer den vier Dutzend weißgekalkten Häuschen gab es nur noch die Bar Antonio, in der sich nun die Arbeiter aus den Weingärten drängten. Manche arbeiteten für landwirtschaftliche Kooperativen, die ihren Sitz woanders, meilenweit entfernt, hatten; andere besaßen ihr eigenes Stückchen Land, waren fleißig und lebten bescheiden von ihrer Hände Arbeit – je nachdem, wie die Ernte ausfiel und welche Preise die Käufer in den Städten zu zahlen bereit waren.
Der hochgewachsene Mann kam als letzter herein, nickte den Anwesenden grüßend zu und setzte sich auf seinen gewohnten Platz in der Ecke. Er war ein ganzes Stück größer als die anderen Männer hier, schlaksig, ein Mittvierziger mit einem zerfurchten Gesicht und Augen, aus denen der Humor funkelte. Manche der Bauern sprachen ihn mit »Señor« an, doch Antonio gebrauchte eine vertraulichere Anrede, als er mit einer Karaffe Wein und einem Glas herbeigeeilt kam.
»Muy Buenos, amigo. Va bien?«
»Ola, Tonio«, sagte der große Mann leichthin, »si, va bien.«
Er drehte sich um, als plötzlich laute Musik aus dem Fernsehapparat über der Theke drang. Es waren die Abendnachrichten der TVE, und die Männer in der Kneipe verstummten, um die wichtigsten Tagesereignisse mitzubekommen. Zuerst erschien der Nachrichtensprecher und schilderte kurz die Abreise des US-Präsidenten Cormack aus Moskau. Dann wechselte das Bild nach Wnukowo, wo der Präsident vor das Mikrofon trat. Das Fernsehen brachte keine Untertitel, sondern statt dessen eine Übersetzung aus dem Off. Die Männer in der Cantina lauschten aufmerksam. Als John F. Cormack seinen letzten Satz sprach und Gorbatschow die Hand entgegenstreckte, schwenkte die Kamera (es war das BBC-Team, das für sämtliche westeuropäischen TV-Stationen berichtete) über die jubelnden Flughafenarbeiter, dann über die Milizionäre und die KGB-Männer. Der spanische Nachrichtensprecher erschien wieder auf dem Bildschirm. Antonio wandte sich dem hochgewachsenen Mann zu.
»Es un buen hombre, Señor Cormack«, sagte er mit einem breiten Lächeln und schlug dem Gast gratulierend auf den Rücken, als wäre er gewissermaßen Miteigentümer des Mannes aus dem Weißen Haus.
»Si«, sagte der hochgewachsene Mann und nickte nachdenklich, »es un buen hombre.«
Cyrus V. Miller war nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Er stammte von armen Farmern in Colorado ab und hatte als Junge miterlebt, wie das kleine Besitztum seines Vaters von einer Bergwerksgesellschaft aufgekauft und von ihren technischen Anlagen verwüstet wurde. Nach dem Motto handelnd, daß man sich den Stärkeren anschließen muß, wenn man sie nicht besiegen kann, hatte sich der junge Mann mühsam durch die Colorado School of Mining in Denver gearbeitet und sie 1933 mit einem Diplom und den Kleidern, die er auf dem Leib trug, verlassen. Da ihn während seines Studiums das Erdöl mehr fasziniert hatte als Grubengestein, machte er sich nach Süden, nach Texas, auf. Damals war noch die Zeit der »wildcatter«, die spekulativ nach Öl bohrten, und der Pachtverträge, die nicht durch Planungsauflagen und ökologische Bedenken belastet waren.
1936 hatte er ein billiges Pachtgrundstück entdeckt. Es war von Texaco aufgegeben worden, weil man wohl, wie er annahm, an der verkehrten Stelle gebohrt hatte. Er überredete einen »toolpusher« mit einem eigenen Bohrturm zum Mitmachen, brachte mit Schmeicheleien eine Bank dazu, ihm einen Kredit gegen die landwirtschaftlichen Nutzungsrechte zu gewähren, und drei Monate später sprudelte das Öl – in rauhen Mengen. Er zahlte seinen Teilhaber aus, mietete selbst Bohrtürme und erwarb weiteren Pachtgrund. Nach dem Kriegseintritt Amerikas, 1941, liefen die Bohrtürme auf vollen Touren, und er wurde ein reicher Mann. Aber er wollte noch höher hinaus, und so wie er den Krieg von 1939 hatte kommen sehen, erspähte er 1944 etwas, was sein Interesse weckte. Ein Engländer namens Frank Whittle hatte einen Flugzeugmotor ohne Propeller und von gewaltiger Leistung erfunden. Miller fragte sich, mit welchem Treibstoff er wohl angetrieben würde.
1945 fand er heraus, daß Boeing/Lockheed die Rechte an Whittles Düsentriebwerk erworben hatten und daß es sich bei dem Treibstoff keineswegs um Benzin mit hoher Oktanzahl, sondern um minderwertiges Kerosin handelte. Er steckte den größten Teil seiner Mittel in eine kalifornische Raffinerie mit einfacher Produktionstechnik und trat an Boeing/Lockheed heran, die gerade zu dieser Zeit der herablassenden Arroganz der großen Ölgesellschaften überdrüssig wurden. Miller bot ihnen seine Anlage an, und gemeinsam entwickelten sie den neuen Treibstoff Aviation Turbin Fuel – AVTUR. Millers Lowtech-Raffinerie war gerade die richtige Anlage für die Produktion von AVTUR, und kaum waren die ersten Proben da, brach der Koreakrieg aus. Als die Sabre-Düsenjäger die chinesischen MiGs zum Kampf stellten, hatte das Düsenzeitalter begonnen. Pan Global hob ab, und Miller kehrte nach Texas zurück.
Damals heiratete er auch. Maybelle war im Vergleich zu ihm nur ein Püppchen, aber sie führte dreißig Ehejahre lang das Regiment über sein Haus und über ihn selbst, und Miller liebte sie abgöttisch. Sie bekamen keine Kinder – Maybelle glaubte, sie sei dafür zu klein gebaut und zu zart –, und er fand sich damit ab, glücklich, ihr jeden Wunsch zu erfüllen, den sie sich nur ausdenken konnte. Als sie 1980 starb, war er untröstlich. Dann entdeckte er- Gott. Er wandte sich keiner Religionsgemeinschaft zu, nur Gott. Er begann, zum Allmächtigen zu sprechen und entdeckte, daß der Herr auch zu ihm sprach, ihn persönlich beriet, wie er am besten seinen Reichtum mehren und Texas und den Vereinigten Staaten dienen könnte. Es entging vermutlich Millers Aufmerksamkeit, daß die göttlichen Ratschläge immer genauso ausfielen, wie er sie hören wollte, und daß der Schöpfer unverzagt seine, Millers, chauvinistische Denkart, seine Voreingenommenheit und Selbstgerechtigkeit teilte. Er achtete wie von jeher darauf, das Karikaturistenklischee des Texaners zu meiden, blieb Nichtraucher, ein mäßiger Trinker, keusch, konservativ in Kleidung und Ausdrucksweise, ein Mann, der eine gleichbleibende Höflichkeit wahrte und schmutzige Reden verabscheute.
Seine Sprechanlage summte.
»Der Name des Mannes, den Sie suchen, Mr.Miller. Als Sie ihn kennenlernten, arbeitete er für IBM in Saudi-Arabien. IBM bestätigt, daß es sich um denselben Mann handeln muß. Er ist dort ausgestiegen und arbeitet heute als freischaffender Sicherheitsberater. Sein Name ist Easterhouse – Oberst Robert Easterhouse.«
»Machen Sie ihn ausfindig«, sagte Miller. »Lassen Sie ihn holen, egal, was es kostet. Bringen Sie mir den Mann.«
2. Kapitel
November 1990
Marschall Koslow saß gelassen an seinem Schreibtisch und musterte die vier Männer, die den Längsteil des T-förmigen Konferenztisches säumten. Alle vier lasen die streng geheimen Akten, die sie vor sich liegen hatten; alle vier waren Männer, denen er trauen konnte, denen er trauen mußte, denn seine Karriere stand auf dem Spiel – und vielleicht noch mehr.
Unmittelbar links neben ihm saß der Stellvertretende Chef des Stabes (Süd), der hier bei ihm in Moskau arbeitete, aber den Oberbefehl über das südliche Viertel der UdSSR mit seinen volkreichen moslemischen Teilrepubliken und seiner Grenze mit Rumänien, der Türkei, dem Iran und Afghanistan innehatte. Sein Nebenmann war der Chef des Oberkommandos Süd in Baku, der in der Annahme nach Moskau geflogen war, es handle sich um eine routinemäßige Stabsbesprechung. Aber diese Konferenz war alles andere als Routine. Ehe er vor sieben Jahren als Erster Stellvertreter nach Moskau gekommen war, hatte Koslow selbst das Kommando in Baku geführt, und der Mann, der jetzt hier am Tisch saß und den Suworow-Plan las, war auf Koslows Betreiben befördert worden.
Diesen beiden gegenüber saßen die anderen beiden Männer, ebenfalls in die Lektüre vertieft. Dem Marschall am nächsten saß ein Mann, dessen Loyalität und Engagement von größter Wichtigkeit sein würden, sollte der Suworow-Plan jemals verwirklicht werden der Stellvertretende Chef des GRU, des Nachrichtendienstes der sowjetischen Streitkräfte. Der GRU, der ständig mit seinem größeren Rivalen, dem KGB, im Streit lag, war für alle nachrichtendienstlichen Operationen des Militärs im In- und Ausland, für die Gegenspionage und für die innere Sicherheit der Streitkräfte verantwortlich. Außerdem – und das war für den Suworow-Plan noch wichtiger – unterstanden dem GRU die Truppen besonderer Bestimmung, die Spezialverbände, deren Aktionen in der Startphase des Suworow-Plans sollte er je Wirklichkeit werden – den Ausschlag geben würden. Die Spezialverbände waren es gewesen, die im Winter 1979 auf dem Flughafen Kabul gelandet waren, den Präsidentenpalast gestürmt, den afghanischen Staatspräsidenten ermordet und die sowjetische Marionette Babrak Kamal eingesetzt hatten, die prompt einen zurückdatierten Aufruf an die sowjetischen Streitkräfte herausgegeben hatte, sie sollten ins Land kommen und den »Unruhen« ein Ende bereiten.
Koslow hatte sich für den Stellvertreter entschieden, weil der Chef des GRU ein ehemaliger KGB-Mann war, den man dem Generalstab oktroyiert hatte, und niemand hatte den geringsten Zweifel, daß er andauernd zu seinen alten Kameraden beim KGB rannte und ihnen alles hinterbrachte, womit er dem Oberkommando schaden konnte. Der GRU-Mann war quer durch Moskau mit dem Auto vom GRU-Gebäude unmittelbar nördlich des Zentralflughafens gekommen.
Neben dem GRU-Mann saß einer, der aus seinem Hauptquartier in den nördlichen Vororten gekommen war und dessen Leute für Koslow unentbehrlich sein würden: der Stellvertretende Kommandeur der Luftlandetruppen oder Luftangriffstruppen, der Fallschirmjäger, die nach dem Suworow-Plan über einem Dutzend Städte abspringen und diese für die vorgesehene Luftbrücke einnehmen sollten. Im Augenblick war kein Anlaß, die Truppen der Landesluftverteidigung ins Spiel zu bringen, da ja keine Invasion der UdSSR bevorstand, ebensowenig die Strategischen Raketentruppen, denn Raketen würde man keine brauchen. Was Motorisierte Schützen, Artillerie und Gepanzerte Fahrzeuge betraf, so verfügte das Oberkommando Süd hier selbst über die nötigen Verbände.
Der GRU