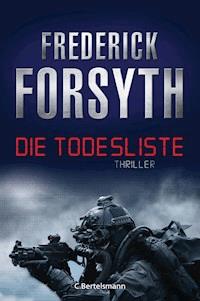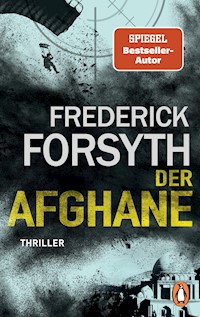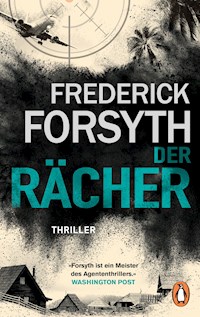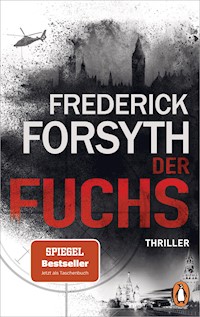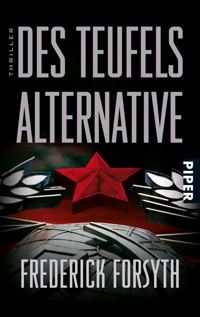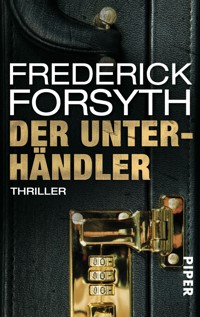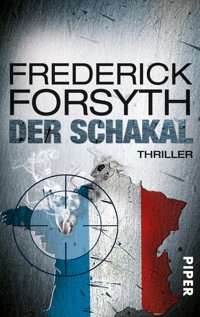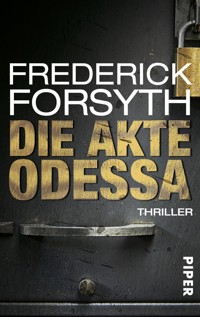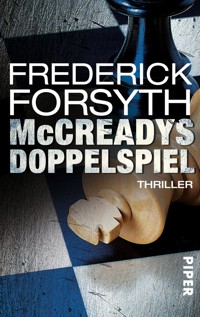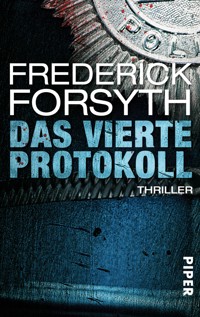
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei einem Einbruch im vornehmen Londoner West End wird nicht nur ein wertvolles Diamantendiadem gestohlen, sondern auch geheimes NATO-Material, das weit kostbarer ist. Eine undichte Stelle im Verteidigungsministerium? Was bedeutet das Codewort »Aurora«? Und wer ist »Chelsea«? Als Topagent John Preston sich ans Werk macht, scheint sich in einem dramatischen Höhepunkt das Geheimnis zu enthüllen. In Moskau hecken derweil ein ehemaliger britischer Meisterspion und der mächtigste Mann im Kreml hinter dem Rücken des KGB einen teuflischen Plan aus …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Shane Richard, fünf Jahre alt, ohne dessen liebevolles Zutun dieses Buch in der Hälfte der Zeit geschrieben worden wäre
Übersetzung aus dem Englischen von Rolf und Hedda Soellner
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96437-1
© 1984 Frederick Forsyth Titel der englischen Originalausgabe: "The Fourth Protocol", Hutchinson & Co. Ltd., London 1984 Deutschsprachige Ausgabe: © 1984 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur Umschlagmotiv: Julian Love/Corbis Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Erster Teil
1. Kapitel
Schlag Mitternacht würde er sich die Glen-Juwelen holen, hatte der Mann in Grau beschlossen. Vorausgesetzt, sie waren dann noch im Safe der Wohnung und die Besitzer verreist. Das mußte er feststellen. Also wartete und wachte er. Um halb acht wurde seine Geduld belohnt.
Die große Limousine schoß mit der geschmeidigen Kraft, die ihr Name versprach, aus der Tiefgarage. Am Ausgang des Tunnels verharrte sie sekundenlang, während der Fahrer nach rechts und links schaute, dann bog sie in die Straße ein und fuhr Richtung Hyde Park Comer.
Jim Rawlings, der gegenüber dem Luxuswohnblock in einer ausgeliehenen Chauffeurlivree am Steuer eines gemieteten Volvo Estate saß, stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Ein rascher Blick über die Belgravia Street hatte ihm gezeigt, was er sehen wollte: Der Mann hatte am Steuer gesessen, seine Frau neben ihm. Der Motor des Volvo lief bereits, und die Heizung war eingeschaltet. Rawlings legte die automatische Gangschaltung ein, manövrierte den Volvo aus der Reihe der parkenden Wagen heraus und fuhr hinter dem Daimler-Jaguar her.
Es war ein frischer, schöner Morgen. Über dem Green Park im Osten lag ein blasser Lichtschimmer, und die Straßenbeleuchtung brannte noch. Rawlings war seit fünf Uhr auf dein Posten, und die wenigen Passanten hatten keine Notiz von ihm genommen. In Belgravia, dem reichsten Viertel des Londoner West End, erregt ein Chauffeur in einem großen Wagen keinerlei Aufmerksamkeit, schon gar nicht mit vier Koffern und einem Picknickkorb im Heckteil, am Morgen des 31.Dezember. Viele reiche Leute verließen die Hauptstadt, um Silvester in ihren Landhäusern zu feiern.
Am Hyde Park Corner war er fünfzig Yards hinter dem Jaguar und ließ einem Lastwagen die Vorfahrt. In der Park Lane befürchtete er einen Augenblick lang, das Paar im Jaguar könne an der dortigen Filiale der Coutts Bank halten und den Diamantschmuck im Nachtsafe deponieren.
Am Marble Arch atmete er ein zweites Mal erleichtert auf. Die Limousine vor ihm war nicht um das Denkmal herum und über die Gegenspur der Park Lane nach Süden, zur Bank, gefahren. Sie brauste geradewegs zum Great Cumberland Place, dann über Gloucester Place weiter nach Norden. Die Besitzer der Luxuswohnung im achten Stock von Fontenoy House hinterlegten also die Dinger nicht bei Coutts; sie hatten sie entweder im Wagen und nahmen sie mit aufs Land oder aber ließen sie über die Feiertage in der Wohnung. Rawlings war überzeugt, daß die zweite Annahme zutraf.
Er folgte dem Jaguar nach Hendon, beobachtete noch, wie der Wagen die letzte Meile bis zur Autobahn M1 flitzte, wendete dann und fuhr zurück in die Stadt. Ganz wie er gehofft hatte, war das Ehepaar eindeutig zum Bruder der Frau, dem Duke of Sheffield, unterwegs, der in Nord Yorkshire, volle sechs Autostunden von der Hauptstadt entfernt, ein Landgut besaß. Das würde Rawlings mindestens vierundzwanzig Stunden Zeit geben, mehr als er brauchte. Er bezweifelte nicht im geringsten, daß er die Wohnung in Fontenoy House würde knacken können; schließlich war er einer der besten Schränker Londons.
Um die Mitte des Vormittags hatte er den Volvo zum Autoverleih, die Livree zum Kostümverleih und die leeren Koffer in den Schrank zurückgebracht. Er war wieder in seiner komfortablen und teuer möblierten Wohnung im obersten Stock eines umgebauten Teelagerhauses in Wandsworth. In dieser Gegend war er aufgewachsen. Wie gut auch immer seine Geschäfte gingen, er war und blieb ein Südlondoner, und wenn Wandsworth auch nicht so schick sein mochte wie Belgravia oder Mayfair, es war sein Revier. Und wie alle seinesgleichen verließ er nur widerwillig die Geborgenheit des eigenen Reviers. Dort fühlte er sich einigermaßen sicher, obgleich er der örtlichen Unterwelt und der Polizei als »Face« bekannt war, das heißt als Verbrecher oder Gauner.
Auch verhielt er sich wie alle erfolgreichen Ganoven in seinem Revier unauffällig. Er fuhr einen bescheidenen Wagen, und die einzige Schwäche, die er sich gestattete, war die elegante Wohnung. Die niederen Chargen der Unterwelt hielt er absichtlich über sein Tun im unklaren, und obgleich die Polizei mit ziemlicher Sicherheit seine Spezialität kannte, war sein Strafregister, abgesehen von einer kurzen Wasser-und-Brot-Strecke in seiner Jugend, ein unbeschriebenes Blatt. Sein offensichtlicher Erfolg und die Unklarheit darüber, wie er ihn erreichte, machten ihn zu einer Kultfigur beim einschlägigen Nachwuchs, der nur zu gern kleine Gänge für ihn erledigte. Sogar die schweren Kaliber, die am hellen Tag, mit Schrotflinten und Schaufelstielen bewaffnet, Lohnbüros ausnahmen, hielten sich respektvoll von ihm fern.
Natürlich brauchte er ein Aushängeschild zur Rechtfertigung seiner Geldmittel. Alle erfolgreichen »Faces« übten irgendeine reguläre Tätigkeit aus. Die beliebtesten Tarngewerbe waren Taxiunternehmen, Obst und Gemüse en gros und Schrotthandel. Alle diese Aushängeschilder bescheren eine Menge nicht nachprüfbarer Gewinne, Bargeschäfte, Freizeit und Verstecke, und man kann ein paar »Schwere« oder Schläger anheuern, harte Burschen mit wenig Verstand und viel Muskelkraft, die zur Tarnung ihres eigentlichen Metiers als Gorillas ebenfalls einer regulären Arbeit nachgehen müssen.
Rawlings betrieb offiziell eine Altmetallhandlung und Autoverschrottung. Damit verfügte er über eine gut ausgerüstete Werkstatt, über Metalle aller Art, elektrische Kabel, Leitungen und Batteriesäure, und die beiden Schlägertypen, die in seinem Hinterhof Altwagen ausschlachteten, leisteten Schützenhilfe und konnten ihm als Leibgarde dienen, falls ihm irgendwelche »Kollegen« Scherereien machen wollten.
Frisch geduscht und frisch rasiert saß Rawlings am Frühstückstisch und verrührte die Zuckerwürfel in seinem zweiten Morgenespresso. Er studierte die Planskizzen, die Billy Rice ihm gebracht hatte.
Billy Rice war sein Eleve, ein smarter Dreiundzwanzigjähriger, der eines Tages Klasse, sogar große Klasse sein würde. Er bewegte sich vorläufig noch an der Randzone der Unterwelt und war erpicht darauf, einer Berühmtheit mit Gefälligkeiten an die Hand zu gehen, ganz abgesehen von der unschätzbaren Erfahrung, die er dabei erwerben konnte. Vor vierundzwanzig Stunden hatte Billy an der Tür der Wohnung im achten Stock von Fontenoy House geklingelt, einen riesigen Blumenstrauß in der Hand und angetan mit der Livree eines teuren Blumengeschäfts. Diese beiden »Requisiten« hatten ihn mühelos am Portier vorbei in die Vorhalle gebracht, wo er sich die genaue Lage der Portiersloge und des Wegs zum Treppenaufgang einprägt hatte.
Die Dame des Hauses öffnete ihm höchstpersönlich die Tür, und beim Anblick der Blumen leuchtete ihr Gesicht vor Überraschung und Freude auf. Der Strauß kam angeblich vom Hilfswerk für in Not geratene ehemalige Kriegsteilnehmer, dessen Galaball Lady Fiona in ihrer Eigenschaft als Schirmherrin am Abend dieses Tages, des 30.Dezember 1986, besuchen wollte. Selbst wenn sie auf dem Ball im Gespräch mit einem Vorstandsmitglied die Blumen erwähnen sollte, so würde der- oder diejenige, dachte Rawlings, ganz einfach annehmen, das Bukett sei von einem anderen Mitglied im Namen aller übersandt worden.
An der Tür hatte Lady Fiona einen Blick auf die angeheftete Karte geworfen, in dem kristallklaren Ton ihrer Klasse: »Wie wunder-wunderschön!« gerufen und den Strauß entgegengenommen. Billy hatte ihr sodann seinen Quittungsblock und einen Kugelschreiber gereicht. Da sie die drei Dinge nicht zugleich halten konnte, war sie in den Salon geflattert, um die Blumen irgendwo hinzulegen. Ein paar Sekunden lang stand Billy allein in der kleinen Diele.
Mit seinem knabenhaften Aussehen, dem flaumigen Goldhaar, den blauen Augen und dem schüchternen Lächeln war Billy ein Geschenk des Himmels. Er konnte sicher sein, daß ihm keine Hausfrau mittleren Alters den Weg in ihre Wohnung verwehren würde. Doch seinen Babyaugen entging kaum etwas.
Noch bevor er klingelte, prüfte er eine volle Minute lang die Außenseite des Eingangs, den Rahmen und die Mauer um die Türöffnung. Er hielt Ausschau nach einem kleinen walnußgroßen Summer oder einem schwarzen Knopf oder Schalter zum Abdrehen des Summers. Erst nachdem er sich überzeugt hatte, daß nichts dergleichen vorhanden war, klingelte er.
Als er allein in der Diele stand, wiederholte er das Ganze an der Innenseite und suchte den Türrahmen und die Wände nach einem Summer oder Schalter ab. Auch hier war nichts. Bis die Dame des Hauses wieder erschien, um die Quittung zu unterschreiben, hatte Billy festgestellt, daß die Tür durch ein Chubb-Schloß gesichert war und nicht, wie er befürchtet hatte, durch ein Bramah-Schloß, das als unknackbar gilt.
Lady Fiona nahm Block und Kugelschreiber und versuchte zu quittieren. Ohne Erfolg. Die Mine war aus dem Stift herausgenommen worden, und was eventuell an Schreibflüssigkeit noch an der Spitze verblieben war, hatte Billy sorgfältig auf ein Blatt Papier verschrieben. Er entschuldigte sich ausschweifend. Mit strahlendem Lächeln sagte Lady Fiona, das sei gar nicht schlimm, sie habe einen Füller in ihrer Handtasche, und wieder verschwand sie hinter der Salontür. Billy hatte bereits gefunden, was er suchte. Die Wohnungstür war in der Tat an ein Alarmsystem angeschlossen.
Aus der Kante der geöffneten Tür ragte hoch oben an der Scharnierseite ein winziger Federstift. Gegenüber war in den Türpfosten eine ebenso winzige Steckdose eingelassen. Darin befand sich, wie Billy wußte, ein Pye-Mikroschalter. Wenn die Tür geschlossen wurde, drang der Stift in die Dose ein, und der Kontakt war hergestellt.
Bei scharf geschalteter Einbruchssicherung würde der Mikroschalter den Alarm auslösen, sobald der Kontakt unterbrochen, das heißt die Tür geöffnet wurde. In weniger als drei Sekunden hatte Billy seine Tube Superklebstoff aus der Tasche gezogen, einen deftigen Schuß in die Öffnung mit dem Mikroschalter gespritzt und das Ganze mit einer kleinen Kugel aus Plastilin und Klebstoffgemisch zugestopft. Nach weiteren vier Sekunden war die Masse steinhart und der Mikroschalter vom Federstift isoliert.
Als Lady Fiona mit der unterschriebenen Quittung zurückkam, fand sie den netten jungen Mann mit einer Hand an den Türpfosten gelehnt vor. Er stieß sich mit einem entschuldigenden Lächeln sofort ab, wobei er die Klebstoffreste vom Daumen wischte. Später hatte Billy dann Rawlings eine vollständige Beschreibung der Eingangshalle, der Portiersloge, der Lage der Treppen und Aufzüge geliefert, vom Zugang zur Wohnungstür, der kleinen Diele dahinter und von den Teilen des Salons, die ihm zu Gesicht gekommen waren.
Rawlings war überzeugt, daß der Wohnungsinhaber vor vier Stunden seine Koffer in das Treppenhaus getragen hatte und dann in die Diele zurückgegangen war, um die Alarmanlage einzuschalten. Wie üblich hatte sie keinen Ton von sich gegeben. Er hatte die Tür hinter sich zugemacht, den Schlüssel im Steck-schloß ganz umgedreht und befriedigt gedacht, daß nun das Sicherheitssystem scharf geschaltet sei. Normalerweise wäre der Federstift mit dem Pye-Mikroschalter in Kontakt gewesen. Das Umdrehen des Schlüssels würde den Stromkreis geschlossen haben. Da aber der Stift vom Mikroschalter isoliert war, würde zumindest das Türsystem nicht funktionieren. Rawlings war sicher, daß sich das Türschloß in dreißig Minuten schaffen ließe. In der Wohnung selbst würden noch weitere Fallen sein. Mit denen wollte er zu gegebener Zeit fertig werden.
Er trank seinen Kaffee aus und nahm sich eine Mappe mit Zeitungsausschnitten vor. Wie alle Juwelendiebe war Rawlings ein aufmerksamer Leser der Klatschspalten. Die Ausschnitte dieser Mappe befaßten sich ausschließlich mit den gesellschaftlichen Auftritten Lady Fionas und mit dem einzigartigen Diamantschmuck, den sie auch gestern abend auf dem Galaball wieder getragen hatte – zum letzten Mal, wenn es nach Rawlings ging.
Tausend Meilen weiter östlich stand der alte Mann am Fenster seines Wohnzimmers im Block 111 am Mira-Prospekt und dachte ebenfalls an Mitternacht. Sie würde den 1.Januar 1987, seinen 75. Geburtstag, einläuten.
Obwohl es bereits in den Nachmittag ging, war der Mann immer noch im Morgenrock. Es gab, wie die Dinge lagen, keinen Anlaß, früh aufzustehen oder sich in Schale zu werfen, um ins Büro zu gehen. Es gab kein Büro mehr, in das er hätte gehen können. Seine um dreißig Jahre jüngere Frau Erita hatte ihre beiden Jungen in den Gorki Park geführt, wo die Kinder auf den in Eisbahnen verwandelten Wegen Schlittschuh laufen konnten. Der Mann war also allein.
Er warf einen flüchtigen Blick in einen Wandspiegel, und was er darin sah, stimmte ihn nicht fröhlicher als der Gedanke an sein Leben oder an das, was davon noch übrig war. Das seit jeher faltige Gesicht war jetzt tief gefurcht. Das einst dichte schwarze Haar war schlohweiß geworden, schütter und leblos. Unmäßiger Alkohol- und Nikotinkonsum hatten seine Haut gefleckt und gesprenkelt. Die Augen erwiderten elend seinen Blick. Der Mann ging wieder ans Fenster und sah auf die schneeverwehte Straße hinunter. Ein paar bis zur Nasenspitze eingemummte Babuschkas räumten den Schnee weg, bevor über Nacht neuer fiel.
Es war schon so lange her, vierundzwanzig Jahre fast auf den Tag genau, sinnierte der Mann, seit er seinen Un-Job und sein witzloses Exil in Beirut aufgegeben hatte, um hierherzukommen. Es wäre zwecklos gewesen, zu bleiben. Nick Elliot und der Rest der »Firma« hatten damals die ganze Sache spitzgekriegt, er hatte es schließlich ihnen selbst eingestanden. Also war er abgereist, ohne Frau und Kinder, die, wenn sie wollten, später nachkommen konnten.
Zuerst war es ihm erschienen, als sei er zurückgekehrt in seine eigentliche geistige und moralische Heimat. Er hatte sich begeistert in sein neues Leben geworfen und voller Überzeugung an die kommunistische Philosophie und ihren Sieg geglaubt. Warum auch nicht? Er hatte schließlich siebenundzwanzig Jahre damit verbracht, ihr zu dienen. In jenen ersten, frühen Jahren Mitte der Sechziger war er glücklich und in Einklang mit sich selbst gewesen. Natürlich war er intensiv ausgequetscht worden, doch in der KGB-Zentrale verehrte man ihn geradezu. Schließlich war er einer, wenn nicht der größte der fünf Stars, zusammen mit Burgess, Maclean, Blunt und Blake, die sich wie Maulwürfe bis ins innerste Mark des britischen Establishments gewühlt und es in Bausch und Bogen verraten hatten.
Burgess, dem Sex und Suff ein frühes Grab bereiten sollten, war schon dabei gewesen, bevor er, Philby, dazugestoßen war. Als erster hatte Maclean seine Illusionen verloren, aber der war ja schließlich schon seit 1951 in Moskau. Seine wachsende Verbitterung und Wut ließ er an Melinda aus, die ihn 1963 verließ und hierher, in diese Wohnung, kam. Maclean hatte voller Groll und total demoralisiert weitergemacht, bis der Krebs ihn erwischte, und als es soweit war, haßte er seine Gastgeber, und seine Gastgeber haßten ihn. Blunt war drüben in England »hochgenommen« und fallengelassen worden. Es blieben also nur noch er und Blake, dachte der alte Mann. In gewisser Weise beneidete er den völlig assimilierten, hochzufriedenen Blake, der ihn und Erita zur Silvesterfeier zu sich eingeladen hatte. Natürlich verfügte Blake über den für eine Integration nötigen kosmopolitischen Background, Vater Jude, Mutter Holländerin.
Für ihn persönlich konnte es keine Assimilation geben; das war ihm nach den ersten fünf Jahren klar geworden. Er schrieb damals schon perfekt Russisch und sprach es auch fließend, wenn auch mit einem ausgeprägten englischen Akzent. Davon abgesehen, haßte er die Gesellschaft. Es war eine vollständig, unwiderruflich und unabänderlich fremde Gesellschaft.
Das war jedoch nicht das Schlimmste; innerhalb von sieben Jahren nach seiner Ankunft hatte er seine letzten politischen Illusionen verloren. Alles war Lüge, und er war klug genug gewesen, dahinterzukommen. Er hatte seine Jugend und sein Mannesalter damit verbracht, einer Lüge zu dienen, für eine Lüge zu lügen, für eine Lüge zu verraten, er hatte dieses »grüne und angenehme Land« verlassen, alles für eine Lüge.
In all den Jahren, in denen er von Amts wegen alle britischen Magazine und Zeitungen analysierte, hatte er die Kricketresultate verfolgt, während er Ratschläge für die Anzettelung von Streiks gab, in den Zeitschriften nach den altvertrauten Stätten Ausschau gehalten, während er die Desinformation vorbereitete, die dies alles zu Fall bringen sollte, hatte im National unauffällig auf einem Barhocker gekauert, um die Briten lachen und in seiner Sprache Witze reißen zu hören, während er den führenden Leuten des KGB, einschließlich des Leiters selbst, Pläne unterbreitete, wie man diese kleine Insel am besten zerrütten könne. Und die ganze Zeit über hatte er während dieser letzten fünfzehn Jahre tief innen eine Leere der Verzweiflung empfunden, über die ihn nicht einmal der Alkohol und die vielen Frauen hinwegtäuschen konnten. Es war ohnehin zu spät; es führte kein Weg mehr zurück, sagte er sich. Und doch, und doch …
Die Türklingel ertönte. Philby war überrascht. Mira-Prospekt 111 war ein reiner KGB-Block, der in einer ruhigen Nebenstraße der Stadtmitte lag und in dem vornehmlich höhere KGB-Mitglieder und ein paar Leute vom Außenministerium wohnten. Jeder Besucher mußte sich über den Pförtner anmelden. Erita konnte es nicht sein. Sie hatte ihren eigenen Schlüssel.
Philby öffnete und sah einen jungen, athletisch gebauten Mann vor sich, der einen gut geschnittenen Mantel und eine warme Pelz-Tschapka ohne Abzeichen trug. Sein Gesicht war kalt und starr, woran jedoch nicht der frostige Wind schuld war, der draußen wehte, denn seine Schuhe bezeugten, daß er aus einem warmen Wagen direkt in den warmen Wohnblock gekommen und nicht durch eisigen Schnee gestapft war. Ausdruckslose Augen starrten den alten Mann an, weder freundlich noch feindselig.
»Genosse Oberst Philby?« fragte der Fremde.
Philby war überrascht. Enge persönliche Freunde, die Blakes und ein halbes Dutzend andere, nannten ihn Kim. Für den Rest lebte er seit vielen, vielen Jahren unter einem Pseudonym. Nur für ganz wenige an der Staatsspitze war er Philby, Oberst a.D. des KGB.
»Ich bin Major Pawlow, vom Neunten Direktorat, abgestellt zum persönlichen Stab des Generalsekretärs der KPdSU.«
Philby kannte das Neunte Direktorat des KGB. Es stellte die Leibwächter für alle Spitzenfunktionäre der Partei und besorgte den Schutz der Gebäude, in denen diese Funktionäre arbeiteten und wohnten. Innerhalb der Parteigebäude und bei offiziellen Anlässen trugen die Männer ihre Uniformen mit den typischen elektrischblauen Mützenbändern, Schulterklappen und Kragenspiegeln; in dieser Aufmachung waren sie auch als Kremlgarde bekannt. Als Leibwächter trugen sie elegante Zivilkleidung; sie waren topfit, durchtrainiert, eisig-loyal und bewaffnet.
»Verstehe«, sagte Philby.
»Das ist für Sie, Genosse Oberst.«
Der Major hielt ihm einen länglichen Umschlag aus Büttenpapier hin. Philby nahm ihn.
»Das auch«, fügte der Major hinzu und reichte ihm einen kleinen Zettel mit einer Telefonnummer darauf.
»Danke«, sagte Philby. Ohne ein weiteres Wort neigte der Major kurz den Kopf, machte auf dem Absatz kehrt und ging den Korridor hinunter. Einige Sekunden später beobachtete Philby von seinem Fenster aus, wie die schlanke schwarze Tschaika-Limousine mit dem Kennzeichen des Zentralkomitees, das mit den Buchstaben MOC beginnt, vom Hauseingang wegglitt.
Jim Rawlings blickte durch eine Lupe auf das Bild in dem Gesellschaftsmagazin. Das vor einem Jahr aufgenommene Foto zeigte die Frau, die er heute früh an der Seite ihres Mannes in nördlicher Richtung aus London hatte fahren sehen. Sie stand in einer Reihe von Leuten und wartete darauf, Prinzessin Alexandra vorgestellt zu werden. Und sie trug die Steine. Rawlings, der in monatelanger Arbeit seine Coups vorbereitete, kannte die Herkunft des Schmuckes besser als sein eigenes Geburtsdatum.
Im Jahre 1905 war der junge Earl of Margate aus Südafrika zurückgekommen und hatte vier herrliche Rohdiamanten mitgebracht. Vor seiner Hochzeit, 1912, übergab er sie Cartier in London zum Schleifen und Fassen als Geschenk für seine junge Frau. Cartier schickte die Steine nach Amsterdam zu Aascher, der aufgrund seiner meisterlichen Bearbeitung des riesigen Cullinan-Steins immer noch als der beste Diamantschleifer der Welt galt. Die vier Diamanten wurden zu zwei zusammenpassenden Paaren von birnenförmigen, achtundfünfzigfacettigen Steinen verarbeitet, wobei das eine Paar zehn Karat pro Stein wog und das andere zwanzig.
In London faßte Cartier diese Steine in Weißgold, umgab sie mit insgesamt vierzig sehr viel kleineren Diamanten und schuf ein Ensemble, bestehend aus einem Diadem mit einem der größeren birnenförmigen Steine als Mittelstück, einem Anhänger mit dem anderen größeren Diamanten als Mittelstück und zwei dazupassenden Ohrgehängen mit den beiden kleineren Steinen. Bevor der Schmuck fertig war, starb der Vater des Earl, der siebente Duke of Sheffield, und der Titel ging auf den Sohn über. Die Steine wurden als die Glen-Diamanten bekannt, nach dem Familiennamen des Hauses Sheffield.
Der achte Duke vererbte sie bei seinem Tod 1936 an seinen Sohn, der seinerseits zwei Kinder hatte, eine Tochter, geboren 1944, und einen Sohn, geboren 1949. Das Bild dieser Tochter, die nun zweiundvierzig Jahre alt war, befand sich jetzt unter Jim Rawlings’ Lupe.
»Die hast du zum letzten Mal getragen, Schätzchen«, sagte Rawlings vor sich hin. Dann überprüfte er nochmals seine Ausrüstung für den Abend.
Harold Philby schlitzte den Umschlag mit einem Küchenmesser auf, zog den Brief heraus und legte ihn auf den Tisch im Wohnzimmer. Er war beeindruckt; es war ein persönliches Handschreiben des Generalsekretärs der KPdSU; Philby erkannte die gestochene Schönschrift des Sowjetführers.
Der Briefbogen war wie der Umschlag Luxusqualität und trug keinen Briefkopf. Der Generalsekretär hatte den Brief sicher in seiner Privatwohnung im Kutuzowskij-Prospekt Nummer 26 geschrieben, dem riesigen Block, der seit Stalins Zeiten den Spitzen der Parteihierarchie in Moskau üppige Absteigequartiere bot. In der rechten oberen Ecke des Blattes stand »Mittwoch, den 31.Dezember 1986«. Darunter der Text. Er lautete:
»Lieber Philby,
ich wurde auf eine Bemerkung aufmerksam gemacht, die Sie kürzlich bei einem Abendessen in Moskau getan haben. Nämlich: Die politische Stabilität Großbritanniens werde hier in Moskau dauernd überschätzt, und heute mehr denn je.
Würden Sie mir bitte diese Bemerkung näher und ausführlicher erläutern. Machen Sie einen schriftlichen Bericht, in einem einzigen Exemplar, ohne Durchschlag für Sie und ohne die Hilfe einer Schreibkraft.
Wenn er fertig ist, rufen Sie die Nummer an, die Major Pawlow Ihnen gegeben hat, und verlangen Sie ihn persönlich. Er wird dann den Bericht bei Ihnen abholen.
Meine Glückwünsche zu Ihrem morgigen Geburtstag.
Ihr …«
Der Brief endete mit der Unterschrift.
Philby atmete tief durch. Das Abendessen, das Kryutschow am 26. für höhere KGB-Offiziere gegeben hatte, war also abgehört worden. Er hatte es halbwegs vermutet. Wladimir Alexandrowitsch Kryutschow, erster stellvertretender Leiter des KGB und Chef seines Ersten Hauptdirektorats, war ein ergebener Gefolgsmann des Generalsekretärs. Obwohl er den Titel eines Generaloberst trug, war Kryutschow kein Militär, ja nicht einmal ein berufsmäßiger Nachrichtendienstler; er war ein Parteiapparatschik reinsten Wassers, einer von denen, die der jetzige Sowjetführer hereingebracht hatte, als er den KGB leitete.
Philby las den Brief noch einmal und schob ihn dann weg. Der Stil des alten Herrn war immer noch der gleiche, dachte er. Kurz, sachlich, klar und präzise, ohne Höflichkeitsfloskeln, von einer Bestimmtheit, die jeden Widerspruch ausschloß. Selbst die Anspielung auf Philbys Geburtstag war kurz und sollte nur zeigen, daß der Generalsekretär sich die Personalakte und einiges mehr hatte kommen lassen.
Und doch war Philby beeindruckt. Ein persönliches Handschreiben vom eisigsten und distanziertesten aller Menschen war eine ungewöhnliche Ehre, die eine Menge Leute außer Fassung gebracht hätte. Vor Jahren war das noch ganz anders gewesen. Als der gegenwärtige Sowjetführer die Leitung des KGB übernahm, war Philby bereits Jahre in Moskau und galt als eine Art Star. Er hielt Vorträge über westliche Nachrichtendienste im allgemeinen und über den britischen Secret Intelligence Service im besonderen.
Wie alle Parteimenschen, die Fachleute einer anderen Disziplin zu befehligen haben, berief der neue Leiter seine getreuen Vasallen auf Schlüsselposten. Wenn er auch als einer der fünf Stars respektiert und bewundert wurde, so begriff Philby doch, daß in dieser konspiratorischsten aller Gesellschaften ein hochgestellter Gönner von Nutzen sein konnte. Der KGB-Chef, der ungleich intelligenter und gebildeter war als sein Vorgänger Semitschastnij, hatte für alles, was England betraf, eine Neugierde gezeigt, die über bloßes Interesse hinaus fast bis zur Faszination ging.
Er hatte damals Philby oft um eine Deutung oder Analyse von Ereignissen in England gebeten, von wahrscheinlichen Reaktionen seiner führenden Politiker, und Philby war glücklich gewesen, ihm einen Gefallen tun zu können. Es war, als wolle der KGB-Chef die Berichte, die von seinen hauseigenen England-Experten oder von seiner alten Dienststelle, der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees unter Boris Ponomarew, kamen, anhand eines Gegengutachtens überprüfen. Manchmal hatte er sich dann Philbys Ansichten zu eigen gemacht.
Es war schon fünf Jahre her, daß Philby den Zaren aller Reussen von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte. Das war im Mai 1982 gewesen bei einem Empfang anläßlich der Rückkehr des KGB-Chefs zum Zentralkomitee, angeblich als Sekretär, in Wahrheit aber zur Sicherung seines eigenen Aufstiegs nach Breschnews bevorstehendem Tod. Und jetzt suchte er wieder Philbys Rat.
Die Rückkehr Eritas und der Jungen, die erhitzt waren vom Schlittschuhlaufen und lärmten wie immer, riß Philby aus seinen Gedanken. 1975, lange nach Melinda Macleans Weggang, als die Oberen beim KGB befanden, daß seine ewige Sauferei und Hemmhurerei ihren Reiz verloren habe (zumindest für den Apparat), war Erita beordert worden, zu ihm zu ziehen. Sie war damals ein KGB-Mädchen, Jüdin gegen alle Regel, vierunddreißig Jahre alt, dunkelhaarig und ausgeglichen. Sie heirateten noch im selben Jahr.
Nach der Hochzeit hatte sein beträchtlicher persönlicher Charme alles überspielt. Sie hatte sich wirklich in ihn verliebt und sich geweigert, dem KGB noch irgendwelche Berichte über ihren Mann zu liefern. Ihr Führungsoffizier hatte die Achseln gezuckt, höheren Orts Meldung erstattet und war beschieden worden, die Sache fallen zu lassen. Die Jungen waren zwei und drei Jahre später gekommen.
»Was Wichtiges, Kim?« fragte Erita, als er aufstand und den Brief in die Tasche steckte. Er schüttelte den Kopf. Sie zog den Jungen die dicken, gesteppten Jacken aus.
»Nichts, Liebes«, sagte er. Doch sie sah ihm an, daß ihn etwas beschäftigte. Wohlweislich drang sie nicht weiter in ihn, sondern ging zu ihm und küßte ihn auf die Wange.
»Bitte, trink nicht zu viel heute abend bei den Blakes.«
»Ich werd’s versuchen«, sagte er lächelnd.
Er war jedoch fest entschlossen, sich eine letzte Besäufnis zu leisten. Als lebenslanger Alkoholiker, der, wenn er auf einer Party einmal zu trinken anfing, bis zur Bewußtlosigkeit weitermachte, hatte er die Warnungen von gut hundert Ärzten in den Windgeschlagen. Sie hatten ihn gezwungen, das Zigarettenrauchen aufzugeben, und das war schlimm genug gewesen. Aber nicht den Alkohol; er konnte damit aufhören, wenn er ernsthaft wollte, und er wußte, daß er nach dieser Silvesterparty für eine Weile damit Schluß machen mußte.
Er rief sich die Bemerkung, die er bei Kryutschow gemacht hatte, und die Überlegungen, die sie ausgelöst hatten, ins Gedächtnis zurück. Er wußte, was im Innersten der Labour Party vor sich ging und was damit bezweckt wurde. Auch andere hatten die Masse des nachrichtendienstlichen Rohmaterials bekommen, das er so viele Jahre hindurch geprüft hatte und das man ihm immer noch als eine Art Gunstbeweis zuleitete. Doch nur er allein war in der Lage, die einzelnen Teile zusammenzusetzen, sie in Bezug zu der britischen Massenpsychologie zu bringen und daraus ein zutreffendes Bild zu formen. Wenn er der Idee, die er im Kopfe hatte, Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte, dann mußte er dieses Bild in die entsprechenden Worte umsetzen; für den Sowjetführer einen der besten Berichte ausarbeiten, die er je niedergeschrieben hatte. Er würde Erita und die Jungen über das Wochenende auf die Datscha schicken. Dann würde er allein in der Wohnung sein und mit der Arbeit anfangen. Doch zuvor noch eine letzte Besäufnis.
Jim Rawlings verbrachte die Stunde zwischen neun und zehn Uhr an diesem Abend in einem anderen, kleineren Mietwagen vor dem Fontenoy House. Er betrachtete prüfend das Lichtmuster hoch oben im Gebäude. Die Wohnung, auf die er es abgesehen hatte, war natürlich stockdunkel, doch er stellte mit Genugtuung fest, daß die Apartments darüber und darunter hell erleuchtet waren. Nach den vielen Leuten zu urteilen, die an den Fenstern auftauchten, war in jedem von ihnen eine Party im Gange.
Nachdem er den Wagen diskret in einer Seitenstraße zwei Blocks weiter geparkt hatte, schlenderte er um zehn Uhr zum Portal von Fontenoy House. Es waren an diesem Abend so viele Leute aus- und eingegangen, daß die Türflügel zwar geschlossen, aber nicht verschlossen waren. In der Eingangshalle war linkerhand die Portiersloge, genau wie Billy Rice gesagt hatte. Darin saß der Nachtportier vor seinem japanischen Fernsehgerät. Er stand auf und kam an die Türöffnung, als wolle er etwas fragen.
Rawlings, der einen Smoking angelegt hatte, trug eine Champagnerflasche mit einer roten Schleife unterm Arm. Er hob die freie Hand zu einem beschwipsten Gruß.
»Abend«, rief er und fügte hinzu, »oh, und ein gutes neues.«
Sollte der alte Portier die Absicht gehabt haben, sich nach dem Wieso und Wohin zu erkundigen, so besann er sich jetzt eines Besseren. Im Block waren mindestens sechs Partys im Gang. Die Hälfte davon schien das Haus der offenen Tür zu praktizieren. Wie sollte er da die Gästeliste überprüfen?
»Oh, äh, danke, Sir. Ein glückliches neues Jahr, Sir«, rief er, aber der smokingbekleidete Rücken war bereits den Korridor hinunter verschwunden. Der Portier ging wieder zu seinem Film zurück.
Rawlings benützte die Treppe bis zum ersten Stock, dann den Lift bis zum achten. Um fünf nach zehn stand er vor der Tür der Wohnung, die er suchte. Wie Billy berichtet hatte, gab es keinen Summer, und das Schloß war ein Chubb-Steckschloß. Darunter befand sich ein Yale-Schloß für den täglichen Gebrauch.
Das Chubb-Steckschloß verfügt über insgesamt 17000 Kombinationen und Permutationen. Es ist ein Schloß mit fünf Zuhaltungen, für einen guten »Schlüssel-Mann« kein unüberwindliches Problem, da nur die ersten zweieinhalb Zuhaltungen ermittelt werden müssen; die anderen zweieinhalb sind die gleichen, nur in umgekehrter Anordnung, so daß der Schlüssel genauso gut funktioniert, wenn er von der anderen Seite der Tür eingeführt wird.
Nach seinem Schulabgang im Alter von sechzehn hatte Rawlings zehn Jahre in der Eisenwarenhandlung seines Onkels Albert gearbeitet. Das Geschäft war ein gutes Aushängeschild für den alten Knaben, der zu seiner Zeit ein bemerkenswerter Schränker gewesen war. Der eifrige junge Rawlings lernte jedes Schloß kennen, das auf dem Markt war, und die meisten kleineren Geldschränke. Nach diesem gründlichen »Praktikum« unter Onkel Alberts fachmännischer Anleitung konnte Rawlings jedes beliebige Schloß knacken, ganz gleich um welches Fabrikat es sich handelte.
Er zog einen Ring mit zwölf Dietrichen aus der Tasche, die er alle in seiner eigenen Werkstatt hergestellt hatte. Er wählte drei aus, probierte sie nacheinander und entschied sich schließlich für den sechsten am Ring. Er führte ihn in das Chubb-Schloß ein und tastete damit nach den Druckpunkten. Dann holte er einen Satz dünner Stahlfeilen aus der Brusttasche und bearbeitete damit den Weichmetallteil des Dietrichs. Innerhalb von zehn Minuten hatte er das passende Profil für die ersten zweieinhalb Zuhaltungen zurechtgefeilt. Nach weiteren fünfzehn Minuten war das Muster für die zweieinhalb anderen Zuhaltungen fertig. Er steckte den Dietrich ins Schloß und drehte ihn langsam und sorgfältig um.
Der Dietrich griff voll. Rawlings wartete sechzig Sekunden, für den Fall, daß Billys Mischung aus Plastilin und Superklebstoff im Türpfosten nicht gehalten hatte. Keine Alarmklingel. Er atmete auf und wandte sich nun mit einer dünnen Stahlnadel dem Yale-Schloß zu. Nach sechzig Sekunden ging die Tür geräuschlos auf. Es war dunkel in der Wohnung, aber das licht vom Korridor ließ die Umrisse der leeren Diele erkennen. Sie war ungefähr acht mal acht Fuß groß und mit einem Teppich belegt.
Rawlings vermutete, daß unter diesem Teppich irgendwo ein Druckfühler war, nicht zu nahe an der Tür, damit der Wohnungsinhaber nicht selbst den Alarm auslöste. Er trat in die Diele, wobei er sich dicht an der Wand hielt, schloß die Tür hinter sich und schaltete das licht ein. links war eine halboffene Tür, durch die er ein Waschbecken sehen konnte. Rechts eine weitere Tür, wahrscheinlich ein eingebauter Kleiderschrank, in dem sich das Alarmsteuersystem befand, das er in Ruhe lassen würde. Er zog eine Flachzange aus der Brusttasche, bückte sich und hob den Teppich an den Fransen in die Höhe. Er entdeckte den Druckfühler im toten Punkt der Diele. Nur einen. Er ließ den Teppich wieder sacht zurückgleiten, ging um ihn herum und öffnete die größere Tür. Wie Billy gesagt hatte, war das die Tür zum Salon.
Er blieb einige Minuten auf der Schwelle stehen, bevor er den Schalter fand und das licht anmachte. Es war riskant, aber er befand sich acht Stockwerke über der Straße, die Bewohner waren in Yorkshire, und er hatte nicht die Zeit, um in einem Raum voller Fallen beim licht einer Miniaturtaschenlampe zu arbeiten.
Das Zimmer war länglich, ungefähr fünfundzwanzig zu achtzehn Fuß, mit einem Teppich ausgelegt und reich möbliert. Die doppelscheibigen Panoramafenster gingen nach Süden zur Straße hinaus. An der Wand zu seiner Rechten sah Rawlings einen Gaskamin mit Marmorverkleidung und imitierten Scheiten sowie eine Tür, die vermutlich zu den Schlafzimmern führte. In der Wand zur Linken waren zwei Türen, die eine auf einen Flur geöffnet, an dem die Gästezimmer lagen, die andere geschlossen, vielleicht der Zugang zu Eßzimmer und Küche.
Rawlings verharrte weitere zehn Minuten regungslos und suchte die Wände und die Decke ab. Aus einem ganz einfachen Grund: Es konnte ein »Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder« vorhanden sein, den Billy Rice nicht gesehen hatte und der auf jegliche durch Bewegung im Raum ausgelöste Änderung der statischen Temperaturverhältnisse reagierte. Sollte der Alarm losgehen, konnte Rawlings in drei Sekunden draußen sein. Nichts geschah; das Sicherungssystem bestand aus Erschütterungskontakten an den Türen – und vielleicht auch an den Fenstern, die er ohnehin nicht berühren wollte – sowie aus mehreren Druckfühlern.
Der Safe war mit größter Sicherheit hier im Salon oder im Schlafzimmer der Wohnungsinhaber in einer Außenmauer, da die Innenwände nicht dick genug waren. Rawlings fand ihn kurz vor elf Uhr. Direkt vor ihm, an der Wand zwischen den zwei Panoramafenstern, war ein goldgerahmter Spiegel, der nicht wie die Bilder leicht schräg von der Wand hing und einen schmalen Schatten an den Kanten warf, sondern flach auflag, als sei er an einem Scharnier befestigt.
Rawlings arbeitete sich an den Wänden entlang vorwärts, wobei er mit seiner Zange die Teppichkante hochhob und die fadendünnen Drähte bloßlegte, die von den Fußleisten zu den Druckfühlern irgendwo in der Zimmermitte führten.
Als er den Spiegel erreichte, bemerkte er, daß ein Druckfühler direkt darunter lag. Er wollte ihn zuerst beseitigen, nahm aber dann einen breiten niedrigen Couchtisch und stellte ihn darüber, wobei er darauf achtete, daß die Tischbeine in gebührender Entfernung von den Fühlerrändern blieben. Er wußte jetzt, daß er in Sicherheit war, solange er sich eng an die Wände hielt oder auf einem Möbelstück stand (Möbel können nicht auf Druckfühlern stehen).
Der Spiegel wurde von einem verdrahteten Magnetverschluß eng an der Wand gehalten. Das war kein Problem. Rawlings schob ein dünnes magnetisiertes Stahlblatt zwischen die beiden Magneten des Verschlusses, von denen der eine im Spiegelrahmen, der andere in der Wand befestigt war. Er drückte das Stahlblatt fest auf den Wandmagneten und schlug den Spiegel zurück. Der Wandmagnet protestierte nicht; er war immer noch in Kontakt mit einem anderen Magneten und meldete daher keinerlei Kontaktunterbrechung.
Rawlings lächelte. Der Wandsafe war ein netter kleiner Hamber, Modell D. Er wußte, daß die Tür aus halbzölligem, zugfestem, gehärtetem Stahl bestand; die Angel war eine senkrechte Stange aus gehärtetem Stahl, die oben und unten von der Tür direkt in den Rahmen überging. Der Sicherheitsmechanismus bestand aus drei gehärteten Stahlbolzen, die aus der Tür ragten und eineinhalb Zoll tief in den Rahmen eindrangen. Innen an der Stahltür war ein zwei Zoll tiefes Weißblechgehäuse mit den drei Verschlußbolzen, dem senkrechten Bolzen zur Steuerung der drei Verschlußbewegungen und das dreischeibige Kombinationsschloß, dessen Vorderseite ihn nun anstarrte.
Es war nicht Rawlings’ Absicht, sich mit all diesen Verschlußraffinessen einzulassen. Es gab einen einfacheren Weg: die Tür von oben bis unten auf der Scharnierseite aufzuschlitzen. Das würde sechzig Prozent der Tür intakt lassen, und zwar den Teil, der das Kombinationsschloß enthielt, sowie die drei Verschluß-bolzen, die im Rahmen steckten. Die anderen vierzig Prozent würden so weit aufgehen, daß er die Hand hinein- und den Inhalt herausbrächte.
Er arbeitete sich in die Diele zurück, wo er seine Champagnerflasche gelassen hatte, und ging mit ihr wieder zum Safe. Auf dem Couchtisch kauernd, schraubte er den Boden der falschen Flasche ab und nahm sein Material heraus. Außer einem elektrischen Sprengzünder, der in einer kleinen Schachtel in Watte gebettet lag, einer Sammlung kleiner Magneten und einer gewöhnlichen Fünf-Ampere-Verbindungsschnur kam eine Länge CLC zum Vorschein.
Rawlings wußte, daß man eine halbzöllige Stahlplatte am besten nach der Monroe-Theorie aufschlitzt, so benannt nach dem Erfinder des Prinzips der »geformten Ladung«. Was er in der Hand hielt, hieß im einschlägigen Handel »Charge-Linear-Cutting« oder kurz CLC; ein V-förmiges Metallstück, steif, aber gerade noch biegbar, eingebettet in Plastiksprengstoff. In England stellen drei Firmen CLC her, eine staatliche und zwei private. Man erhält es nur mit behördlicher Genehmigung, aber als Berufsschränker hatte Rawlings einen Kontakt in der Person eines bestechlichen Angestellten bei einer der Privatfirmen.
Schnell und sachkundig fertigte Rawlings die Länge, die er brauchte, und befestigte sie von oben bis unten an der Safetür. In eines der CLC-Enden steckte er den Sprengzünder, aus dem zwei miteinander verflochtene Kupferdrähte ragten. Er entflocht die beiden Leiter und spreizte sie weit auseinander, um später einen Kurzschluß zu vermeiden. An jedem Draht befestigte er eine Litze seiner Verbindungsschnur, die ihrerseits in einem dreipoligen Stecker endete.
Er spulte die Schnur sorgfältig ab, als er an der Wand entlang in den Korridor ging, der zu den Gästezimmern führte. Der Verbindungsgang würde ihm Schutz gegen die Explosion bieten. In der Küche zog Rawlings einen großen Polyäthylenbeutel aus der Tasche und füllte ihn mit Wasser. Diesen Beutel befestigte er mit Reißnägeln an der Wand über der Sprengladung vor der Safetür. Federkissen, hatte Onkel Albert gesagt, sind für die Katz oder fürs Fernsehen. Es gibt keinen besseren Stoßdämpfer als Wasser.
Es war zwanzig Minuten vor Mitternacht. Die Party über ihm wurde immer lauter. Selbst in diesem Luxushaus, wo vornehme Ruhe oberstes Gesetz war, konnte er deutlich hören, daß alles tanzte und durcheinanderschrie. Bevor er sich in den Korridor zurückzog, drehte er den Fernseher an. Im Korridor suchte er nach einer Steckdose, versicherte sich, daß der Schalter an seiner Schnur auf »Aus« war und führte den Stecker ein. Dann wartete er.
Ungefähr eine Minute vor Mitternacht war der Krach über ihm ohrenbetäubend. Plötzlich verstummte er, als jemand »Ruhe« brüllte. Rawlings konnte jetzt den Fernseher hören, den er im Salon eingeschaltet hatte. Das traditionelle schottische Programm mit seinen Balladen und Highland-Tänzen wich einem Bild von Big Ben auf dem Turm des Londoner Parlaments. Hinter der Uhrenfassade war die riesige Glocke Great Tom, die fälschlicherweise oft Big Ben genannt wird. Der Fernsehsprecher plauderte über die Sekunden bis Mitternacht hinweg, während alle Welt im Königreich die Gläser füllte. Dann erklangen die vier Viertelstundenschläge.
Danach kam eine Pause. Dann BONG, das donnernde Dröhnen des ersten Mitternachtsschlags. Es hallte wider in zwanzig Millionen Heimen im ganzen Land; es schmetterte durch die Wohnung im neunten Stock von Fontenoy House und wurde dann vom Glückwunschgebrüll übertönt. Rawlings stellte den Schalter auf »Ein«.
Niemand außer Rawlings selbst hörte den dumpfen Knall. Er wartete sechzig Sekunden, dann zog er seine Schnur aus der Dose und arbeitete sich wieder bis zum Safe vor, wobei er unterwegs sein Werkzeug aufsammelte. Die Rauchschwaden verzogen sich. Von dem Plastikbeutel und der Gallone Wasser waren nur ein paar feuchte Flecken übriggeblieben. Die Safetür sah aus, als hätte sie ein Riese mit einer stumpfen Axt von oben bis unten gespalten. Rawlings blies einige noch verbliebene Rauchfahnen weg und schlug den kleineren Teil der Tür an den Scharnieren zurück. Das Weißblechgehäuse war durch die Explosion weggeblasen worden, doch alle Bolzen in dem anderen Teil der Tür steckten in ihren Löchern. Die Öffnung war so groß, daß er hineinspähen konnte. Eine Geldkassette und ein Samtbeutel; er zog den Beutel heraus, löste die Verschnürung und leerte den Inhalt auf den Couchtisch.
Sie glitzerten und blitzten im Licht, als enthielten sie ihr eigenes Feuer. Die Glen-Diamanten. Rawlings packte den Rest der Ausrüstung – die Schnur, die leere Zünderschachtel und das übriggebliebene CLC – wieder in die falsche Champagnerflasche, als er sich einem unerwarteten Problem gegenübersah. Den Anhänger und die Ohrringe würde er in den Hosentaschen unterbringen, aber das Diadem war breiter und höher, als er gedacht hatte. Er sah sich nach einem unauffälligen Behälter um. Er lag in einigen Schritten Entfernung auf dem Schreibtisch.
Rawlings leerte den Inhalt des Diplomatenkoffers in die Schale eines Sessels, eine Ansammlung von Brieftaschen, Kreditkarten, Füllern, Adreßbüchern und ein paar Aktenordner.
Der Koffer war genau richtig. Er faßte den ganzen Glen-Schmuck und die Champagnerflasche, die ja seltsam angemutet hätte, wenn man Rawlings damit hätte weggehen sehen. Nach einem letzten Rundblick schaltete Rawlings das Licht im Salon aus, trat auf die Diele und schloß die Tür. Als er im Treppenhaus stand, sperrte er den Wohnungseingang mit dem Chubb-Schloß wieder zu, und sechzig Sekunden später schlenderte er an der Portiersloge vorbei in die Nacht hinaus. Der alte Mann sah nicht einmal auf.
Es war fast Mitternacht an jenem ersten Januartag, als Philby sich in Moskau an seinen Wohnzimmertisch setzte. Er war am vergangenen Abend bei den Blakes zu seiner Besäufnis gekommen, hatte sie aber nicht einmal genossen. Seine Gedanken waren zu sehr mit dem Bericht für den Generalsekretär beschäftigt. Am Vormittag hatte er sich von seinem unvermeidlichen Katzenjammer erholt, und jetzt, nachdem Erita und die Jungen schliefen, konnte er sich in Muße überlegen, was er schreiben würde.
Plötzlich ertönte ein Gurren; Philby stand auf, ging zu dem großen Käfig in der Ecke und blickte durch die Stäbe auf eine Taube, die ein geschientes Bein hatte. Er war immer ein Tiernarr gewesen. In Beirut hatte er eine Füchsin gehabt, und hier in dieser Wohnung hielt er sich eine ganze Reihe von Kanarienvögeln und Papageien. Die fußkranke Taube watschelte über den Boden ihres Käfigs.
»Schon gut«, sagte Philby, »bald bist du sie los, und dann kannst du wieder herumfliegen.«
Er kehrte an seinen Tisch zurück. Der Bericht mußte gut sein, sagte er sich zum hundertsten Mal. Der Generalsekretär konnte sehr unangenehm werden, wenn man ihn täuschte oder enttäuschte. Einige der höheren Luftwaffenleute, die 1983 bei der Verfolgung und dem Abschuß des koreanischen Passagierflugzeugs solchen Pfusch gemacht hatten, waren auf seine persönliche Empfehlung hin in kalten Gräbern unter dem ewigen Frost der Kamtschatka gelandet. Wenn ihm auch seine Gesundheit zu schaffen machte und er einen Teil seiner Zeit im Rollstuhl verbrachte, so arbeitete sein Gehirn doch noch mit der Präzision eines Computers, und seinen blassen Augen entging nichts. Philby nahm Papier und Bleistift und machte sich an die Ausarbeitung seiner Antwort.
Vier Stunden später – in London war immer noch der 1.Januar kehrte der Inhaber der Wohnung in Fontenoy House kurz vor Mitternacht allein in die Hauptstadt zurück. Der große grauhaarige, distinguiert aussehende Mann fuhr direkt in die Tiefgarage, deren Tor er mit seiner Plastikkarte öffnete, nahm seinen Koffer aus dem Wagen und trug ihn zum Aufzug. Er war miserabel gelaunt.
Nach einem heftigen Streit mit seiner Frau hatte er den hochherrschaftlichen Besitz seines Schwagers drei Tage früher als vorgesehen verlassen. Sein knochiges und pferdegesichtiges Ehegespons liebte das Landleben ebenso innig, wie er es haßte. Mit Wonne strich sie durch die bleichen winterlichen Yorkshiremoore und lieferte ihn schmählich der Gesellschaft ihres Bruders, des zehnten Herzogs, aus. Das war schlimm, denn der Wohnungsinhaber, dem Männlichkeit über alles ging, hatte den Verdacht, daß der elende Tropf schwul war.
Das Silvesteressen war für ihn eine Qual gewesen. Die Tischgespräche, die von den Busenfreundinnen seiner Frau bestritten wurden, gingen ausschließlich ums Jagen, Schießen und Fischen, und das Ganze wurde untermalt vom hohen, zwitschernden Lachen des Herzogs und seiner etwas zu hübschen Freunde. Am Morgen hatte er seiner Frau gegenüber eine Bemerkung gemacht. Lady Fiona war hochgegangen. Worauf beschlossen wurde, daß er nach dem Tee allein zurückfahren und sie so lange bleiben würde, wie sie Lust hatte, vielleicht den ganzen Januar.
Er betrat die Diele seiner Wohnung und stutzte; das Intrusionsschutzsystem hätte, bevor der Hauptalarm ausgelöst wurde, dreißig Sekunden lang ein kräftiges »Piep, Piep« aussenden müssen. Das war Zeit genug, um die Anlage durch Betätigung des Steuerschalters unscharf zu machen. Verdammtes Ding, dachte er, wahrscheinlich gestört. Er ging zum Kleiderschrank und schaltete das System mit seinem persönlichen Schlüssel ab. Dann betrat er den Salon und knipste das Licht an.
Er stand da und starrte mit vor Schreck offenem Mund auf das Bild, das sich ihm bot. Sein Blick fiel geradewegs auf die versengte Wand und die gespaltene Safetür. Mit ein paar Sprüngen stand er vor dem Geldschrank und lugte hinein. Kein Zweifel, die Diamanten waren weg. Er schaute um sich, sah, daß seine Siebensachen im Sessel am Kamin lagen und der Teppich an den Wänden entlang zurückgeschlagen war. Er sank kreidebleich in den anderen Kaminsessel.
»Oh, mein Gott«, stöhnte er. Er schien fassungslos über das Ausmaß der Katastrophe. Zehn Minuten lang blieb er schwer atmend sitzen und starrte auf das Durcheinander.
Schließlich raffte er sich auf und ging zum Telefon. Mit zitterndem Zeigefinger wählte er eine Nummer. Am anderen Ende läutete und läutete es, doch niemand hob ab.
Am nächsten Morgen ging John Preston kurz vor elf die Curzon Street hinunter zum Sitz der Abteilung, für die er arbeitete. Sie befand sich ganz in der Nähe des Restaurants Mirabelle, in dem nur wenige Leute aus seiner Dienststelle sich ein Essen leisten konnten.
Die meisten Angestellten des öffentlichen Dienstes machten, da der Neujahrstag auf einen Donnerstag gefallen war, ein verlängertes Wochenende und arbeiteten an diesem Freitag nicht. Aber Brian Harcourt-Smith hatte ihn eigens gebeten zu kommen, also kam er. Er glaubte zu wissen, worüber der stellvertretende Generaldirektor von MI5 mit ihm sprechen wollte.
Seit drei Jahren, also über die Hälfte der Zeit seit seinem Eintritt 1981 als Späteinsteiger, arbeitete John Preston im Referat F, das sich mit der Überwachung von rechts- und linksradikalen politischen Organisationen befaßte, mit der Ausspähung dieser Gruppen und der Führung der in sie infiltrierten Agenten. Zwei der drei Jahre war er bei F.1 gewesen als Leiter der Sektion D, die auf die Unterwanderung der Labour Party durch Elemente des äußersten linken Flügels spezialisiert war. Das Ergebnis seiner Nachforschungen während dieser Zeit hatte er vor zwei Wochen, knapp vor Weihnachten, vorgelegt. Preston war überrascht, daß man den Bericht so schnell gelesen und verarbeitet hatte.
Er meldete sich am Empfangspult, zeigte seine Karte, wurde überprüft und erhielt nach einer telefonischen Rückfrage im Büro des stellvertretenden Generaldirektors die Erlaubnis, nach oben in die Führungsetage zu fahren.
Zu seinem Bedauern konnte Preston nicht den Generaldirektor selbst sehen. Er mochte Sir Bernard Hemmings, aber es war in »Fünf« ein offenes Geheimnis, daß der alte Mann krank war und immer weniger Zeit im Büro verbrachte. Während seiner Abwesenheit wurden die laufenden Geschäfte in zunehmendem Maße von seinem ehrgeizigen Stellvertreter wahrgenommen, zum Mißvergnügen einiger Veteranen der Dienststelle.
Sir Bernard hatte sich in »Fünf« hochgedient und früher selbst Außendienst gemacht. Er konnte sich in die Leute einfühlen, die Verdächtige beschatteten, feindlichen Kurieren auf den Fersen waren und subversive Organisationen infiltrierten. Harcourt-Smith war direkt von der Universität gekommen, mit einem erstklassigen akademischen Grad, war immer in der Zentrale gewesen und auf seinem Marsch durch die Abteilungen stetig die Beförderungsleiter hinaufgeklettert.
Er war wie immer tadellos gekleidet und bereitete Preston einen warmen Empfang. Preston mißtraute der Wärme. Andere, so hieß es, waren ebenso warm empfangen worden und eine Woche später aus der Dienststelle verschwunden. Harcourt-Smith bat Preston, vor dem Schreibtisch Platz zu nehmen, und setzte sich selbst dahinter. Auf der Schreibunterlage lag Prestons Bericht.
»Nun, John, zu Ihrem Bericht. Sie werden natürlich verstehen, daß ich ihn wie alles, was von Ihnen kommt, äußerst ernst nehme.«
»Danke«, sagte Preston.
»So sehr, daß ich einen guten Teil der Feiertage hier im Büro verbracht habe, um ihn wieder und wieder zu lesen und um darüber nachzudenken.«
Preston hielt es für besser, nichts zu sagen.
»Er ist – wie soll ich sagen – ganz schön radikal. Geht in die vollen, wie? Die Frage ist nur, und diese Frage muß ich mir selbst stellen, bevor unsere Abteilung irgendeine Strategie aufgrund Ihres Berichts vorschlägt: Ist das alles absolut wahr? Nachprüfbar? Denn genau das wird man mich fragen.«
»Hören Sie, Brian, ich habe zwei Jahre auf diese Nachforschungen verwendet. Meine Leute haben tief, sehr tief geschürft. Die Tatsachen sind, wo ich sie als solche ausgewiesen habe, absolut wahr.«
»Mein lieber John, ich würde nie irgendwelche Tatsachen in Frage stellen, die Sie eruiert haben. Aber die Folgerungen, die Sie daraus ziehen –«
»Beruhen auf Logik, denke ich«, sagte Preston.
»Eine großartige Disziplin, war einmal mein Studienfach«, spann Harcourt-Smith den Faden weiter. »Aber nicht immer durch harte Beweise untermauert, meinen Sie nicht auch? Zum Beispiel diese Sache da …« Er fand die Stelle im Bericht, und sein Finger fuhr die Zeile entlang. »Das Manifest der britischen Revolution. Ganz schön extrem, das müssen Sie doch zugeben.«
»Stimmt, Brian, es ist extrem. Diese Leute sind wirklich ganz schön extrem.«
»Das steht außer Zweifel. Aber wäre es nicht hilfreich gewesen, wenn Sie Ihrem Bericht ein Exemplar des Manifestes beigelegt hätten?«
»Soweit ich feststellen konnte, gibt es nichts Schriftliches. Es handelt sich um eine Reihe von Absichten, wenn auch sehr konkreten Absichten, in den Köpfen gewisser Leute.«
Harcourt-Smith saugte bedauernd an einem Zahn.
»Absichten«, sagte er, als mache ihm das Wort zu schaffen, »ja natürlich, Absichten. Aber sehen Sie, John, eine Menge Absichten spuken in den Köpfen einer Menge Leute herum, nicht immer sehr freundliche Absichten diesem Land gegenüber. Aber wir können keine Politik, keine Maßnahmen und Gegenmaßnahmen aufgrund dieser Absichten vorschlagen …«
Preston setzte zum Sprechen an, doch Harcourt-Smith stand auf, zum Zeichen dafür, daß die Audienz zu Ende war.
»Hören Sie, John, ich behalte Ihr Papier noch ein Weilchen. Muß es nochmals überdenken und vielleicht ein paar Sondierungen vornehmen, um rauszukriegen, wohin ich es am besten weiterleiten kann. Übrigens, wie gefällt es Ihnen bei F.1. (D)?«
»Großartig«, sagte Preston und stand ebenfalls auf.
»Ich könnte was für Sie haben, wo es Ihnen vielleicht noch besser gefällt«, sagte Harcourt-Smith.
Als Preston gegangen war, starrte Harcourt-Smith minutenlang auf die Tür, durch die sein Mitarbeiter verschwunden war. Er schien gedankenverloren.
Die Akte war lästig und konnte sogar eines Tages gefährlich werden. Die beste Lösung wäre der Reißwolf. Aber das war unmöglich. Sie war in aller Form von einem Sektionschef vorgelegt worden. Sie hatte eine Aktennummer. Er dachte lange und angestrengt nach. Dann nahm er seinen roten Filzstift und beschrieb sorgfältig den Umschlag des Preston-Reports. Er klingelte nach seiner Sekretärin.
»Mabel«, sagte er, als sie hereinkam, »tragen Sie das persönlich in die Registratur hinunter. Sofort, bitte.«
Das Mädchen warf einen Blick auf den Aktendeckel. Er trug über die ganze Breite die Buchstaben KWV und Brian Harcourt-Smiths Initialen. KWV bedeutet in der Dienststelle »Keine weitere Veranlassung«. Der Bericht sollte begraben werden.
2. Kapitel
Erst am Sonntag darauf, dem 4.Januar, erreichte der Inhaber der Wohnung in Fontenoy House die Nummer, die er drei Tage lang stündlich angerufen hatte. Es war nur ein kurzes Gespräch, aber es hatte zur Folge, daß er sich kurz vor der Mittagsstunde mit einem anderen Mann traf, und zwar in einer verschwiegenen Nische der Gasträume eines stillen Hotels im West End.
Der Gesprächspartner war um die Sechzig, hatte eisengraues Haar und wirkte in seinem korrekten Anzug wie ein Staatsbeamter, was er in gewissem Sinn auch war. Er traf als zweiter ein, und während er Platz nahm, entschuldigte er sich.
»Tut mir schrecklich leid, daß ich die letzten drei Tage nicht zu erreichen war«, sagte er. »Ich bin Junggeselle und war über Neujahr bei Freunden auf dem Land eingeladen. Also, wo brennt’s?«
Der Wohnungsinhaber berichtete in kurzen, klaren Sätzen. Er hatte Zeit gehabt, sich genau zu überlegen, wie er die Ungeheuerlichkeit des Geschehenen darstellen würde, und tat es in wohlgesetzten Worten. Der andere folgte dem Bericht mit wachsendem Ernst.
»Gewiß, Sie haben völlig recht«, sagte er schließlich. »Es könnte sehr gravierend sein. Haben Sie die Polizei benachrichtigt, als Sie Donnerstag nacht nach Hause kamen? Oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt?«
»Nein, ich wollte zuerst mit Ihnen sprechen.«
»Wäre aber vielleicht besser gewesen. Nun, jetzt ist es ohnehin zu spät. Die Experten würden feststellen, daß der Tresor schon vor drei oder vier Tagen aufgesprengt wurde. Schwierig zu erklären. Es sei denn …«
»Ja?« fragte der Wohnungsinhaber hoffnungsvoll.
»Es sei denn, Sie könnten glaubhaft machen, der Spiegel sei an seinem alten Platz gewesen und alles so tipptopp in Ordnung, daß Sie drei Tage lang überhaupt nichts von dem Einbruch gemerkt haben.«
»Kaum«, sagte der Wohnungsinhaber. »Der Teppich war an allen vier Kanten umgeschlagen. Der Kerl muß an den Wänden entlanggegangen sein, um nicht auf die Druckfühler zu treten.«
»Ja«, überlegte der andere. »Die Polizei würde kaum schlucken, daß ein Einbrecher aus lauter Ordnungsliebe den Teppich geglättet und den Spiegel wieder aufgehängt hätte. So geht es demnach nicht. Und vermutlich wird man auch nicht vorgeben können, Sie hätten die letzten drei Tage anderswo verbracht.«
»Wo zum Beispiel? Jemand hätte mich sehen müssen. Aber es hat mich niemand gesehen. Im Club? Im Hotel? Ich hätte mich anmelden müssen.«
»Genau«, sagte sein Gegenüber. »Nein, so geht’s auch nicht. Wie auch immer, die Würfel sind gefallen. Jetzt ist es zu spät, um die Polizei einzuschalten.«
»Aber was zum Teufel tu’ ich dann?« fragte der Wohnungsinhaber. »Der Schmuck muß ganz einfach wiedergefunden werden.«
»Wie lange wird Ihre Frau noch wegbleiben?« fragte der andere.
»Schwer zu sagen. Es gefällt ihr in Yorkshire. Ein paar Wochen, hoffe ich.«
»Dann müssen wir dafür sorgen, daß der beschädigte Safe durch einen neuen, völlig gleichen ersetzt wird. Und wir brauchen eine Kopie der Glen-Diamanten. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen.«
»Aber was ist mit dem, was gestohlen wurde?« fragte der Wohnungsinhaber verzweifelt. »Die Dinger dürfen nicht einfach irgendwo herumschwirren. Ich muß sie zurückhaben.«
»Stimmt«, nickte der andere. »Nun, wie Sie sich denken können, haben meine Leute ihre Verbindungen zur Diamantenbranche. Ich werde Nachforschungen veranlassen. Die Schmuckstücke werden fast mit Sicherheit an einen der Schwerpunkte der Edelsteinschleiferei zur Umarbeitung geschickt. In ihrer jetzigen Form wären sie nicht abzusetzen. Zu leicht zu identifizieren. Ich will sehen, ob wir den Einbrecher fassen und die Dinger wiederbeschaffen können.«
Der Mann stand auf und schickte sich zum Gehen an. Der Wohnungsinhaber blieb sitzen, offensichtlich zutiefst besorgt. Der korrekt gekleidete Mann war nicht weniger erschüttert, ließ es sich jedoch nicht so anmerken.
»Sprechen Sie nicht darüber, und handeln Sie nicht auf eigene Faust«, riet er. »Sehen Sie zu, daß Ihre Frau so lange wie möglich auf dem Land bleibt. Benehmen Sie sich völlig normal. Seien Sie ganz ruhig, Sie werden von mir hören.«
Am Morgen darauf schloß sich John Preston dem gewaltigen Menschenstrom an, der sich nach den fünf arbeitsfreien Tagen der Neujahrswoche wieder in die Londoner City ergoß. Da Preston in South Kensington wohnte, fuhr er am liebsten mit der U-Bahn zur Arbeit. An der Goodge Street stieg er aus und ging die letzten vierhundert Meter zu Fuß, ein unauffälliger sechsundvierzigjähriger Mann mittlerer Größe und Figur im grauen Regenmantel und trotz der Kälte ohne Hut.
Fast am Ende der Gordon Street bog er in den Zugang zu einem ebenso unauffälligen Gebäude ein, das ein Bürohaus unter vielen anderen hätte sein können, solide, aber nicht modern, und mit dem Firmenschild einer Versicherungsgesellschaft versehen. Erst in der Eingangshalle zeigten sich gewisse Unterschiede zu den benachbarten Verwaltungsgebäuden.
Erstens waren drei Männer in der Halle, einer an der Tür, einer hinter dem Empfangspult und einer neben den Lifttüren; alle drei nach Maß und Gewicht höchst untypisch für Policenaquisiteure. Falls ein argloser Bürger sich hierher verirrte, um ausgerechnet bei dieser und keiner anderen Gesellschaft einen Abschluß zu tätigen, so würde er barsch dahingehend beschieden werden, daß nur Leute mit einem Spezialausweis, der vor dem Auge des kleinen Computers unter der Empfangstheke Gnade fand, weiter kamen als bis in die Halle.
Der britische Sicherheitsdienst, besser bekannt als MI5, haust nicht nur in einem einzigen Gebäude. Er verteilt sich vielmehr, was ebenso umsichtig wie unpraktisch ist, auf vier Bürohäuser. Das Hauptquartier ist an der Charles Street, nicht mehr im alten Leconfield House, wie die Zeitungen gewöhnlich schreiben.
Die zweitgrößte Abteilung hat ihren Sitz in der Gordon Street und wird schlicht »Gordon« genannt, so wie das Hauptquartier kurz und bündig unter der Bezeichnung »Charles« läuft. Die beiden weiteren Gebäude liegen an der Cork Street (und werden als »Cork« bezeichnet), und eine bescheidene Nebenstelle an der Marlborough Street ist gleichfalls nur unter dem Namen der Straße bekannt.
Die Dienststelle ist in sechs Referate unterteilt, die über sämtliche Gebäude verstreut sind. Und einige Referate haben wiederum Unterabteilungen in den verschiedenen Häusern. Um unnötigen Verschleiß von Schuhwerk zu vermeiden, sind sämtliche Abteilungen durch ein hochgesichertes Telefonnetz miteinander verbunden und verfügen jeweils über ein unfehlbares Kontrollsystem, das jedem Unbefugten den Zutritt verwehrt.
Referat A besteht aus den Unterabteilungen Politik, Logistik, Standortverwaltung, Registratur/Datenverarbeitung, dem Büro des Justitiars und dem Observierungsdienst. Dort nistet jene ganz besondere straßenkundige und gerissene Spezies von Männern (und einigen Frauen) aller Altersstufen und Typen, aus der die besten Überwachungsteams der Welt gebildet werden können. Sogar die »Konkurrenz« gibt zu, daß die »Beschatter« von MI5 auf eigenem Platz schlechthin unschlagbar sind.
Während der für Auslandsaufklärung zuständige Geheime Nachrichtendienst MI6 eine Anzahl von Amerikanismen in seinen Hausjargon aufgenommen hat, bedient sich der mit Schutzfunktion im Inland befaßte Sicherheitsdienst MI5 noch immer weitgehend des guten alten Polizeijargons. Er vermeidet Ausdrücke wie »surveillance operative« und nennt seine Observantenteams immer noch schlicht und einfach »Beschatter«.
Referat B befaßt sich mit Anwerbung, Personal, Sicherheitsüberprüfung, Beförderungen, Pensionen und Finanzen (will heißen Gehälter und Auslagen im Geschäftsinteresse).
Referat C ist verantwortlich für die Sicherheit in Behörden (Personal und Baulichkeiten), in Unternehmen mit Staatsaufträgen (hauptsächlich Privatfirmen, die auf dem Rüstungs- und Kommunikationssektor tätig sind), für die militärische Sicherheit (in enger Zusammenarbeit mit dem Abschirmdienst der Army) und für Sabotageabwehr (Vorsorge und Aufdeckung).
Es gab früher auch ein Referat D, das jedoch, dank der nur den Geheimdienstinsidern zugänglichen Logik, schon vor langer Zeit die Bezeichnung »Referat K« erhalten hat. Es ist eines der größten Referate, und seine größte Abteilung heißt nur »Sowjet«. Sie ist unterteilt in Operative Funktionen, Außendienst und Einsatztaktik. Ferner gehört zu »K« »Sowjetische Satelliten«, gleichfalls in die drei genannten Untergruppen aufgeteilt, dann »Forschung« und schließlich »Agenten«.
Selbstverständlich widmet »K« seine nicht unbeträchtlichen Aktivitäten der Überwachung des Heeres von Agenten der UdSSR und ihrer Satellitenstaaten. Dieses Heer operiert von den verschiedenen Botschaften, Konsulaten, Gesandtschaften, Handelsmissionen, Banken, Nachrichtenagenturen und Firmen aus, denen eine allzu nachsichtige britische Regierung die Niederlassung an allen Ecken und Enden der Hauptstadt und (im Fall der Konsulate) der Provinzen gestattet.
Referat K birgt auch ein bescheidenes Büro, dessen Insasse die Verbindung zwischen MI5 und der Schwesterorganisation MI6 aufrechterhält. Dieser Beamte ist ein Mann aus Gruppe Sechs, der in die Charles Street abkommandiert ist. Die Sektion trägt die Bezeichnung K.7.
Referat E (hier wird die alphabetische Reihenfolge wieder aufgenommen) befaßt sich mit dem internationalen Kommunismus und dessen Anhängern, die nach Großbritannien einreisen wollen, um dem Land Schaden zuzufügen, sowie mit der einheimischen Spielart, die zum gleichen Zweck ins Ausland reisen möchte. Die zu »E« gehörige Gruppe »Fernost« hat Verbindungsstellen in Hongkong, Neu Delhi, Canberra und Wellington, während »Übrige Gebiete« die ihren in Washington, Ottawa, in Westindien und anderen Freundstaaten unterhält.
Und schließlich Referat F, zu dem John Preston – jedenfalls bis zu diesem Vormittag – gehörte und das für politische Parteien (extreme Linke), politische Parteien (extreme Rechte), Forschung und Agenten zuständig ist.
Referat F haust an der Gordon Street in der vierten Etage, und dorthin, zu seinem Büro, begab Preston sich an jenem Januarmorgen. Er wiegte sich zwar nicht in der Annahme, sein vor drei Wochen eingereichter Bericht werde ihn zu Brian Harcourt-Smiths »Herzblatt des Monats« befördern, aber er glaubte noch immer, daß der Bericht den Weg zum Schreibtisch des Generaldirektors finden würde, zu Sir Bernard Hemmings.
Hemmings, davon war Preston überzeugt, würde die darin enthaltene Information und die zugegebenermaßen zum Teil auf Vermutungen gründenden Resultate an den Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses weiterleiten oder an den Unterstaatssekretär im Innenministerium, dem MI5 unterstellt ist. Ein guter Unterstaatssekretär würde vermutlich der Ansicht sein, daß sein Minister einen Blick in den Bericht werfen sollte, und der Innenminister könnte die Premierministerin darauf aufmerksam machen.
Die Notiz, die Preston bei seiner Ankunft auf dem Schreibtisch fand, belehrte ihn eines anderen. Nachdem er sie gelesen hatte, lehnte er sich zurück und überlegte. Wäre der Bericht an höhere Stellen weitergeleitet worden, so hätte es eine Menge Fragen gegeben, darauf war er vorbereitet gewesen. Er hätte die Antworten gewußt und gegeben, denn er war überzeugt, daß er recht hatte. Das heißt, als Leiter von F.1. (D) hätte er sie geben können, aber nicht, nachdem er in eine andere Abteilung versetzt worden war.
Nach einer Umbesetzung würde der neue Leiter von F.1. (D) den Preston-Report aufs Tapet bringen müssen. Preston wußte nur zu gut, daß zu seinem Nachfolger fast mit Sicherheit einer von Harcourt-Smiths getreuesten Schützlingen ausersehen war, der nichts dergleichen tun würde.
Er rief in der Registratur an. Ja, der Bericht war abgelegt worden. Er ließ sich das Aktenzeichen geben, nur für den Fall künftiger Wiedervorlage.
»Was sagen Sie? KWV?« fragte er ungläubig. »Schon gut, tut mir leid, ja, ich weiß, Sie können nichts dafür, Charlie. War nur eine Frage; kommt ein bißchen überraschend, weiter nichts.«