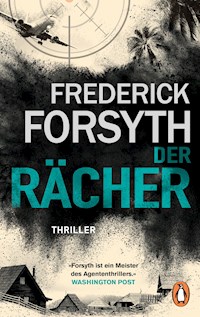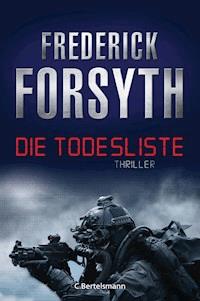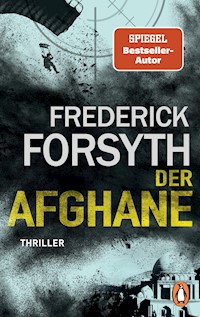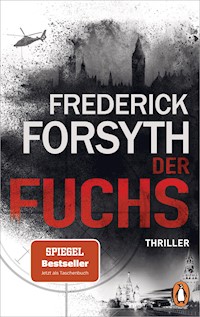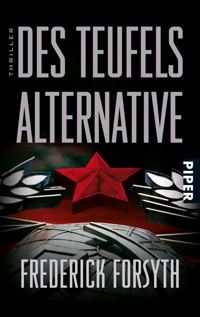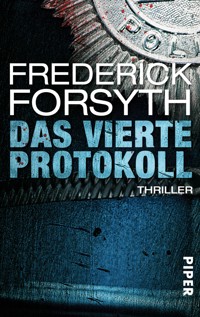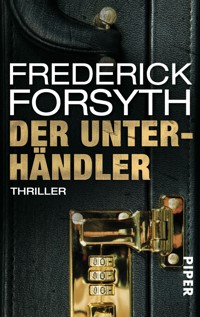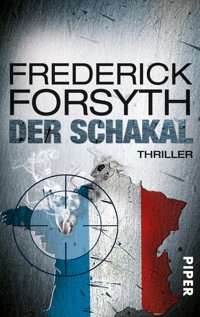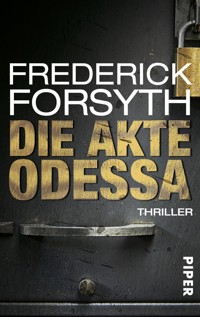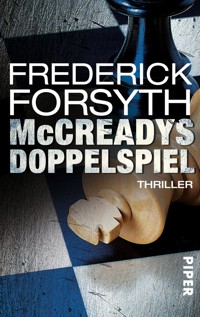Buch
Cal Dexter ist ein einsamer Mann. Im Vietnamkrieg war er als »Maulwurf« in den Tunneln der Vietcong unmenschlichen Erfahrungen ausgesetzt. Nach dem Krieg musste er erleben, wie seine Tochter brutal ermordet wurde. Die Justiz hatte keinen Zugriff auf die Mörder, weshalb Dexter in blinder Verzweiflung die Schuldigen selbst zur Strecke brachte. Doch sein Zorn verlor seitdem nicht an Kraft, denn Dexter lebt von nun an zwei Leben: das des engagierten Anwalts und das des mächtigen, einsamen Jägers, der im Geflecht von Politik, Terror und Menschenverachtung für Gerechtigkeit kämpft.
Nun jagt er den serbischen Verbrecher Zoran Zilic, der im Balkankrieg einen jungen Amerikaner sinnlos hingerichtet hat. Der »Maulwurf« spürt den gefährlichen Serben in einer Festung in Südamerika auf – und ein gnadenloser Kampf beginnt …
Autor
Frederick Forsyth, geboren 1938 in Ashford/Kent, war mit neunzehn Jahren jüngster Pilot der Royal Air Force. Später berichtete er als Journalist aus den Hauptstädten Europas, bevor er mit Büchern wie »Der Schakal« oder »Die Akte Odessa« zum internationalen Bestsellerautor avancierte. Weltweit sind bis heute mehr als 35 Millionen seiner Bücher verkauft. »Der Rächer« zeigt Forsyth auf der Höhe seines Könnens.
Frederick Forsyth
Der Rächer
Roman
Aus dem Englischenvon Reiner Pfleiderer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Avenger« bei Bantam Press, London
Copyright © der Originalausgabe 2003 by Frederick Forsyth
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2003
by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Covergestaltung und Covermotiv: www.buerosued.de
An · Herstellung: Str.
ISBN 978-3-641-02834-3
V006
www.goldmann-verlag.de
Den Tunnelratten. Jungs, ihr habt etwas getan, wozu ich mich niemals überwinden könnte.
Prolog
Der Mord
Siebenmal hatten sie den jungen Amerikaner in die flüssigen Exkremente der Jauchegrube gedrückt, dann erlahmte seine Gegenwehr, und er starb da unten, jede Körperöffnung mit unsäglichem Schmutz gefüllt.
Als sie fertig waren, legten die Männer die Stangen beiseite, setzten sich ins Gras, lachten und rauchten. Dann brachten sie den anderen Flüchtlingshelfer und die noch übrigen fünf Waisenkinder um, nahmen den Geländewagen der Hilfsorganisation und fuhren zurück über die Berge.
Man schrieb den 15. Mai 1995.
Erster Teil
1
Der Bauarbeiter
Der einsame Läufer nahm die Steigung in Angriff und kämpfte einmal mehr gegen seinen Feind, den Schmerz. Es war zugleich Tortur und Therapie. Deswegen lief er.
Nach Meinung derer, die es wissen müssen, ist keine sportliche Disziplin so brutal und gnadenlos wie das Triathlon. Der Zehnkämpfer muss mehr Techniken beherrschen und braucht etwa beim Kugelstoßen mehr reine Körperkraft, aber was die schiere Ausdauer und die Fähigkeit angeht, Schmerzen auszuhalten und zu besiegen, gibt es nur wenige Wettbewerbe wie das Triathlon.
Der Mann, der bei Sonnenaufgang durch New Jersey lief, war wie an jedem Trainingstag lange vor dem Morgengrauen aufgestanden. Er fuhr mit seinem Pick-up zu dem entlegenen See, lud unterwegs sein Rennrad ab und kettete es sicherheitshalber an einen Baum. Zwei Minuten nach fünf stellte er die Stoppuhr an seinem Handgelenk, stülpte den Ärmel seines Neopren-Schwimmanzugs darüber und watete ins eisige Wasser.
Er trainierte das olympische Triathlon. Fünfzehnhundert Meter Schwimmen, dann raus aus dem Wasser, rasch ausziehen bis auf Radlerhose und Trikot und rauf auf das Rennrad. Danach vierzig Kilometer geduckt über dem Lenker, die gesamte Distanz im Sprinttempo. Vor langer Zeit schon hatte er die fünfzehnhundert Meter von einem Ende des Sees zum anderen abgemessen und sich genau die Stelle am anderen Ufer eingeprägt, wo sein Rad stand. Er hatte auf den um diese Zeit immer leeren Landstraßen seine Vierzig-Kilometer-Strecke abgesteckt und wusste, an welchem Baum er vom Rad steigen und mit dem Laufen beginnen musste. Die Strecke war zehn Kilometer lang, und das Gatter einer Farm kennzeichnete den Beginn der letzten beiden Kilometer. An diesem Morgen hatte er das Tor gerade passiert. Diese beiden Kilometer führten bergauf, der letzte Härtetest, der sich gnadenlos in die Länge zog.
Es tut deshalb so weh, weil ganz unterschiedliche Muskeln beansprucht werden. Normalerweise braucht ein Radfahrer oder Marathonläufer nicht die kräftige Brust, die muskulösen Schultern und Arme eines Schwimmers. Sie sind bloß zusätzlicher Ballast, den er mitschleppen muss.
Beim Radfahrer kommt die Kraft aus den Beinen und Hüften, dem Läufer helfen die Sehnen, seinen Rhythmus zu halten. Jede Disziplin hat ihren eigenen, gleich bleibenden Rhythmus. Der Triathlet muss alle drei beherrschen, dann kann er versuchen, an die Leistungen der Spezialisten heranzukommen.
Für einen Zweiundfünfzigjährigen ist dies mörderisch. Einundfünfzigjährige sollten durch die Genfer Konvention davor geschützt werden. Der Läufer war im Januar einundfünfzig geworden. Er riskierte einen Blick auf die Uhr. Seine Miene verfinsterte sich. Nicht gut. Mehrere Minuten über seiner Bestzeit. Er kämpfte noch verbissener gegen den Feind.
Olympiateilnehmer peilen zwei Stunden und zwanzig Minuten an, der Läufer in New Jersey hatte die Zweieinhalbstundenmarke bereits einmal unterboten. Beinahe ebenso lange war er nun schon unterwegs, und er hatte noch zwei Kilometer zu laufen.
Hinter einer Kurve des Highway 30 kamen die ersten Häuser seines Wohnorts in Sicht. Die Straße führt mitten durch die alte, aus vorrevolutionärer Zeit stammende Ortschaft Pennington, unweit der Interstate-Autobahn 959, die, von New York kommend, den Bundesstaat durchquert und weiter nach Delaware, Pennsylvania und Washington führt. Innerhalb der Ortschaft heißt der Highway Main Street.
Pennington ist eine ganz gewöhnliche Kleinstadt, so sauber und ordentlich, hübsch und freundlich wie die vielen tausend anderen, die das verkannte und unterschätzte Herz der USA ausmachen. Nur eine größere Kreuzung im Zentrum, wo sich die West Delaware Avenue und die Main Street schneiden, mehrere gut besuchte Kirchen der drei Glaubensgemeinschaften, eine Filiale der First National Bank, eine Hand voll Geschäfte und, abseits des Verkehrs, verstreute Häuser in Seitenalleen.
Der Läufer steuerte auf die Kreuzung zu, noch ein halber Kilometer. Es war noch zu früh für eine Tasse Kaffee im Café Cup of Joe oder ein Frühstück in Vito’s Pizza, doch selbst wenn sie geöffnet gewesen wären, hätte er nicht Halt gemacht.
Südlich der Kreuzung kam er an dem aus der Bürgerkriegszeit stammenden Schindelhaus vorbei, neben dessen Tür das Firmenschild Calvin Dexter, Rechtsanwalt, hing. Es war sein Büro, sein Firmenschild und seine Kanzlei, in der er arbeitete, wenn er sich nicht gerade wieder freinahm und wegfuhr, um seiner zweiten Beschäftigung nachzugehen. Klienten und Nachbarn akzeptierten, dass er hin und wieder zum Angeln fuhr, nicht ahnend, dass er in New York City unter einem anderen Namen eine kleine Wohnung gemietet hatte.
Mit schmerzenden Beinen quälte er sich über die letzten fünfhundert Meter bis zur Abzweigung in den Chesapeake Drive am Südende der Stadt. Dort wohnte er, und an der Ecke endete sein sich selbst auferlegtes Martyrium. Er verlangsamte seine Schritte, blieb stehen, ließ den Kopf hängen und sog, an einen Baum gelehnt, Sauerstoff in seine Lungen. Zwei Stunden und sechsunddreißig Minuten. Weit von seiner Bestzeit entfernt. Wahrscheinlich gab es im Umkreis von hundert Meilen niemanden, der mit einundfünfzig noch an diese Zeit herankam, aber das bedeutete ihm nichts. Auch wenn er es den Nachbarn, die ihn anfeuerten und belächelten, niemals würde erklären können: Ihm kam es nur darauf an, mit dem einen Schmerz den anderen zu bekämpfen, den immer währenden Schmerz, den, der niemals verging, den Schmerz über den Verlust eines Kindes, den Verlust einer Liebe, den Verlust von allem.
Der Läufer bog in seine Straße ein und legte die letzten zweihundert Meter im Schritttempo zurück. Vor sich sah er den Zeitungsjungen einen dicken Packen auf seine Veranda werfen. Der Junge winkte im Vorbeiradeln, und Cal Dexter winkte zurück.
Später würde er sich auf seinen Motorroller schwingen und seinen Pick-up holen, mit dem Roller hinten auf der Ladefläche wieder nach Hause fahren und unterwegs das Rennrad auflesen. Vorher brauchte er eine Dusche, ein paar Energieriegel und frisch gepressten Orangensaft.
Auf der Veranda angekommen, hob er den Packen Zeitungen auf, öffnete ihn und sah ihn durch. Wie erwartet, enthielt er das Lokalblatt, eine Zeitung aus Washington, die Sonntagsausgabe der New York Times sowie eine Zeitschrift.
Calvin Dexter, der drahtige, rotblonde, freundlich lächelnde Anwalt aus Pennington, New Jersey, war nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden.
Er wurde in einem kakerlaken- und rattenverseuchten Slum in Newark gezeugt und kam im Januar 1950 als Sohn eines Bauarbeiters und einer Kellnerin vom örtlichen Diner zur Welt. Die Moral der Zeit zwang seine Eltern zu heiraten, als ein Stelldichein in einem Tanzlokal und ein paar Gläser zu viel dazu führten, dass seine Mutter mit ihm schwanger wurde. Am Anfang wusste er nichts davon, denn Kinder wissen nie, wie und durch wen sie hierher gekommen sind. Sie müssen es herausfinden, und das kann sehr schmerzlich sein.
Sein Vater war für seine Verhältnisse kein schlechter Mensch. Nach Pearl Harbor hatte er sich freiwillig zum Militär gemeldet, war aber als qualifizierter Bauarbeiter an der Heimatfront im Raum New Jersey dringender gebraucht worden, wo im Zuge der Kriegsanstrengungen Tausende von neuen Fabriken, Werften und Verwaltungsgebäuden entstanden.
Er war ein harter Bursche und flink mit den Fäusten, in vielen Arbeiterjobs die einzige Chance, sich Recht zu verschaffen. Dennoch versuchte er, auf dem Pfad der Tugend zu bleiben, lieferte die Lohntüte ungeöffnet zu Hause ab und hielt seinen Sohn dazu an, das Sternenbanner, die Verfassung und Joe di Maggio zu lieben.
Doch nach dem Ende des Koreakriegs schwanden die Jobs. Nur die Industriekrise blieb, und die Gewerkschaften waren fest in Mafiahand.
Calvin war fünf, als seine Mutter die Familie verließ. Er war zu jung, um die Gründe dafür zu verstehen. Er wusste nicht, dass seine Eltern eine lieblose Ehe geführt hatten, und ertrug ihr Streiten mit dem stoischen Gleichmut von Kindern, die nichts anderes kannten. Er wusste nichts von dem Handelsvertreter, der ihr das Blaue vom Himmel und schönere Kleider versprochen hatte. Ihm wurde nur gesagt, dass sie »fortgegangen« sei.
Er nahm es einfach hin, dass sein Vater nun jeden Abend zu Hause saß, statt nach der Arbeit ein paar Bierchen zu trinken, ihn versorgte und deprimiert in den Fernseher stierte. Erst im Teenageralter sollte er erfahren, dass seine Mutter zurückkommen wollte, weil der Vertreter sie sitzen gelassen hatte, von seinem verbitterten Vater aber eine schroffe Abfuhr bekam.
Er war sieben, als sein Vater in der näheren Umgebung keine Jobs mehr fand und auf die Idee kam, ihre schäbige Wohnung in Newark aufzugeben und sich einen gebrauchten Wohnwagen zuzulegen. Darin verbrachte er zehn Jahre seiner Jugend.
Vater und Sohn zogen von Baustelle zu Baustelle, und der verwahrloste Junge besuchte die Schulen am Ort, die bereit waren, ihn aufzunehmen. Es war die Zeit Elvis Presleys, Del Shannons, Roy Orbisons und der Beatles, die aus einem Land kamen, von dem Cal noch nie gehört hatte. Es war die Zeit Kennedys, des Kalten Kriegs und Vietnams.
Jobs ergaben sich und wurden erledigt. Sie zogen durch die Städte East Orange, Union und Elizabeth im Norden, dann weiter zu Baustellen bei New Brunswick und Trenton. Eine Zeit lang, als Dexter senior Vorarbeiter bei einem kleinen Bauprojekt war, lebten sie in den Pine Barrens. Danach ging es in den Süden nach Atlantic City. Zwischen seinem achten und sechzehnten Lebensjahr besuchte Cal neun Schulen. Was er dort lernte, passte auf eine Briefmarke.
Dafür sammelte er anderweitig Erfahrungen und lernte, sich auf der Straße durchzuboxen. Wie seine mittlerweile verstorbene Mutter wurde er nicht größer als einen Meter zweiundsiebzig, doch in seinem schmächtigen Körper steckte eine unglaubliche Kraft und in seinen Fäusten ein mörderischer Punch. Einmal trat er in einer Schaubude gegen einen Kirmesboxer an, schlug ihn k.o. und kassierte zwanzig Dollar Preisgeld.
Ein nach billiger Pomade riechender Mann sprach seinen Vater an und schlug vor, der Junge solle in seine Sporthalle kommen und Boxer werden. Doch sie zogen weiter in eine neue Stadt, zu einem neuen Job.
Für einen Urlaub fehlte das Geld, und so begleitete der Junge den Vater in den Ferien einfach auf die Baustelle. Er kochte Kaffee, erledigte Botengänge und übernahm Gelegenheitsarbeiten. Bei einem dieser Botengänge geriet er an einen Mann mit grüner Schirmmütze, der ihm einen Ferienjob anbot. Er sollte bei verschiedenen Adressen in Atlantic City Umschläge abliefern und mit keinem Menschen darüber reden. So kam es, dass er in den Sommerferien 1965 für einen Buchmacher den Laufburschen spielte.
Cal Dexter mochte auf der untersten Stufe der sozialen Leiter stehen, aber er war ein aufgeweckter Junge und hatte Augen im Kopf. Ohne Eintrittskarte schlich er sich ins Kino am Ort und bestaunte die Glitzerwelt Hollywoods, die weiten Hügellandschaften des Wilden Westens, den Glamour und Pomp der Leinwandmusicals und die schrägen Gags in den Komödien mit Dean Martin und Jerry Lewis.
Er sah in den Fernsehspots schicke Wohnungen mit Edelstahlküchen, lächelnde Familien und Eltern, die sich zu lieben schienen. Er sah die glänzenden Luxuslimousinen und Sportwagen auf den Plakatwänden über dem Highway.
Er hatte nichts gegen die Arbeiter auf dem Bau. Sie waren harte, ruppige Burschen, behandelten ihn jedoch freundlich, jedenfalls die meisten. Auf der Baustelle trug er einen Helm, und alle gingen davon aus, dass er nach der Schulzeit in die Fußstapfen seines Vaters treten und Bauarbeiter werden würde. Doch ihm schwebte etwas anderes vor. Ganz gleich, so schwor er sich, was für ein Leben er führen würde, Hauptsache weit weg vom Krach eines Presslufthammers und dem beißenden Staub einer Betonmischmaschine.
Dann begriff er, dass er für dieses bessere Leben mit einem komfortablen Einkommen nichts vorweisen konnte. Er spielte mit dem Gedanken, zum Film zu gehen, glaubte jedoch, dass alle Kinostars groß gewachsene Männer seien, nicht ahnend, dass die meisten eher kleiner als er waren. Das dämmerte ihm erst, als eine Bardame zu ihm sagte, er habe Ähnlichkeit mit James Dean. Doch die Bauarbeiter brüllten vor Lachen, und so schlug er sich die Idee aus dem Kopf.
Der Sport konnte einen Jungen von der Straße holen und zu Ruhm und Reichtum führen, aber bei seinen kurzen schulischen Gastspielen bekam er nie die Gelegenheit, sich einen Platz in einer Schulmannschaft zu erobern.
Alles, wofür man eine ordentliche Schulbildung oder gar Zeugnisse brauchte, konnte er vergessen. Somit blieben nur andere unqualifizierte Jobs wie Kellner, Hotelpage, Tankwart oder Lieferwagenfahrer. Die Liste war endlos, aber die meisten boten so wenig Aussichten, dass er gleich auf dem Bau bleiben konnte. Die Arbeit dort war zwar hart und gefährlich, wurde deshalb aber besser bezahlt als die meisten anderen.
Blieb noch die kriminelle Laufbahn. Wer in den Hafenvierteln oder Bauarbeitercamps von New Jersey aufwuchs, dem konnte nicht verborgen bleiben, dass man ein Luxusleben mit schönen Wohnungen, schnellen Autos und leichten Mädchen führen konnte, wenn man sich mit dem organisierten Verbrechen einließ und mit den Gangs die Straßen unsicher machte. Angeblich landete nur selten einer im Gefängnis. Er war kein Italoamerikaner, deshalb blieb ihm der Weg in die Mafiaelite verbaut. Aber es gab auch Weiße von angelsächsisch-protestantischer Herkunft, die durchaus etwas erreicht hatten.
Mit siebzehn verließ er die Schule und fing am nächsten Tag auf der Baustelle seines Vaters an, einem staatlichen Wohnungsbauprojekt bei Princeton. Einen Monat später erkrankte der Raupenführer, einen Ersatzmann gab es nicht. Es war ein Facharbeiterjob. Cal sah sich das Führerhaus von innen an. Kein Problem.
»Das könnte ich hinkriegen«, sagte er. Der Vorarbeiter hatte Bedenken. So etwas war streng verboten. Wenn jemand von der Bauaufsicht aufkreuzte, war er seinen Job los. Andrerseits konnte der Bautrupp erst wieder arbeiten, wenn jemand die Erdberge bewegte.
»Da drin sind wahnsinnig viele Hebel.«
»Vertrauen Sie mir«, sagte der Junge.
Sie brauchten zwanzig Minuten, um herauszufinden, wofür welcher Hebel war. Er begann, Dreck zu bewegen. Dafür gab es eine Zulage, aber es war noch immer kein Beruf.
Im Januar 1968 wurde er achtzehn, und der Vietcong startete die Tet-Offensive. Er saß in einer Bar in Princeton vor dem Fernseher. Auf die Nachrichten folgten Reklamespots und dann ein Werbefilm der Army. Wer sich gut machte, so die Botschaft, bekam eine Ausbildung. Am nächsten Tag ging er ins Büro der US-Army in Princeton und verkündete: »Ich möchte Soldat werden.«
Zur damaligen Zeit wurde jeder Amerikaner, sofern er nicht außergewöhnliche Umstände geltend machen konnte oder das Land verließ, nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs zum Wehrdienst eingezogen. Dem zu entgehen war der Wunsch der meisten Teenager und vieler Eltern. Der Stabsfeldwebel hinter dem Schreibtisch streckte die Hand aus, um seinen Einberufungsbefehl entgegenzunehmen.
»Ich habe keinen«, sagte Cal Dexter. »Ich möchte mich freiwillig melden.« Das ließ aufhorchen.
Der Feldwebel schob ihm ein Formular hin.
»Na wunderbar, mein Junge. Eine weise Entscheidung. Darf ich Ihnen als alter Haudegen einen Rat geben?«
»Klar.«
»Verpflichten Sie sich für drei Jahre und nicht nur für zwei. Das verspricht bessere Standorte, bessere Berufschancen.« Er beugte sich vor wie einer, der ein Staatsgeheimnis ausplaudert. »Bei drei Jahren kommen Sie eventuell sogar um Vietnam herum.«
»Aber ich möchte nach Vietnam«, erwiderte der Junge in der speckigen Jeans.
Das gab dem Sergeant zu denken. »Aha«, sagte er gedehnt und hätte hinzufügen können: Die Geschmäcker sind verschieden. Doch er sagte nur: »Heben Sie die rechte Hand...«
Dreiunddreißig Jahre später drückte der ehemalige Bauarbeiter vier Orangen in der Saftpresse aus, rubbelte sich mit dem Handtuch das nasse Haar trocken und ging mit dem Saft und den Zeitungen ins Wohnzimmer.
Als erstes nahm er sich die Zeitschrift vor. Vintage Airplane hat keine große Auflage und war in Pennington nur über Postversand zu beziehen. Das Magazin wendet sich an Liebhaber alter Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg und anderer Epochen. Dexter blätterte bis zum Kleinanzeigenteil und studierte die Kaufgesuche. Er hielt inne, stellte das Glas ab und las die Annonce noch einmal. Sie lautete:
»AVENGER gesucht. Seriöses Angebot. Keine Preisgrenze. Bitte um Anruf.«
Da draußen gab es keine Torpedobomber vom Typ Grumman Avenger, auch »Rächer« genannt, aus dem Pazifikkrieg zu kaufen. Die standen in Museen.
Jemand hatte den Kontaktcode benutzt. Eine Telefonnummer stand dabei. Mit Sicherheit eine Handynummer.
Man schrieb den 13. Mai 2001.
2
Das Opfer
Ricky Colenso hatte es nicht verdient, mit zwanzig Jahren in einer Jauchegrube in Bosnien zu sterben. Er hätte nicht so enden müssen. Er war dazu ausersehen, einen College-Abschluss zu machen und sein Leben in den Staaten zu verbringen, ein Leben in Freiheit mit Frau und Kindern, einer passablen Zukunftsperspektive und dem Streben nach Glück. Doch daraus wurde nichts, weil er zu gutmütig war.
Im Jahr 1970 erhielt der junge und brillante Mathematiker Adrian Colenso eine Berufung an die Georgetown University vor den Toren Washingtons. Mit seinen fünfundzwanzig Jahren war er bemerkenswert jung für eine Professur in Mathematik.
Drei Jahre später hielt er im kanadischen Toronto ein Sommerseminar. Zu den Teilnehmern gehörte eine junge Frau namens Annie Edmond, die von seinen Ausführungen zwar nur wenig verstand, aber fantastisch aussah. Sie verliebte sich in ihn und arrangierte über Freunde ein blind date.
Adrian Colenso hatte nie von ihrem Vater gehört, was sie gleichermaßen verwunderte wie erfreute. Sie war bereits von einem halben Dutzend Mitgiftjägern bedrängt worden. Auf der Fahrt zurück ins Hotel stellte sie fest, dass er nicht nur brillant im Quantenrechnen war, sondern auch ziemlich gut küssen konnte.
Eine Woche später flog er nach Washington zurück. Miss Edmond war eine junge Lady, der niemand widerstehen konnte. Sie kündigte ihren Job, besorgte sich einen angenehmen Posten beim kanadischen Konsulat, mietete ein Apartment gleich neben der Wisconsin Avenue und reiste mit zehn Koffern an. Zwei Monate später heirateten sie. Die fürstliche Hochzeit wurde in Windsor, Ontario, gefeiert, die Flitterwochen verbrachte das Paar in Caneel Bay auf den US-amerikanischen Jungferninseln.
Als Hochzeitsgeschenk kaufte der Brautvater dem Paar ein großes Landhaus an der Foxhall Road neben der Nebraska Avenue in einer der ländlichsten und mithin gefragtesten Gegenden von Georgetown. Zu dem Anwesen gehörte ein großes bewaldetes Grundstück mit Swimmingpool und Tennisplatz. Das Taschengeld der Braut deckte die Instandhaltungskosten, das Gehalt des Bräutigams reichte gerade für den Rest. Die Frischvermählten gründeten eine Familie.
Ihr Sohn Richard Eric Steven wurde im April 1975 geboren und bekam bald den Spitznamen Ricky.
Wie Millionen andere junge Amerikaner wuchs er in einem behüteten und liebevollen Elternhaus auf, tat die Dinge, die alle Jungs tun, verbrachte die Ferien in Sommerlagern, entdeckte und erforschte die aufregende Welt der Mädchen und Sportwagen, sorgte sich um Noten und anstehende Prüfungen.
Er war nicht so begabt wie sein Vater, aber auch nicht dumm. Vom Vater hatte er das verschmitzte Lächeln, von der Mutter das gute Aussehen. Er war allseits beliebt. Wenn ihn jemand um Hilfe bat, tat er stets, was er konnte. Nur hätte er niemals nach Bosnien gehen dürfen.
1994 schloss er die High School ab und wurde für den Herbst in Harvard angenommen. Im Winter zuvor hatte er im Fernsehen Berichte über die brutalen ethnischen Säuberungen, das daraus resultierende Flüchtlingselend und die Hilfsprogramme in einem fernen Land namens Bosnien gesehen und den Entschluss gefasst, sich irgendwie nützlich zu machen.
Seine Mutter flehte ihn an, in den Staaten zu bleiben. Es gebe doch auch karitative Einrichtungen im Land, wenn er unbedingt sein soziales Gewissen beruhigen und Menschen helfen wolle. Doch die Fernsehbilder von niedergebrannten Dörfern, weinenden Waisenkindern und die Verzweiflung der Vertriebenen hatten ihn tief erschüttert. Es musste unbedingt Bosnien sein.
Sein Vater fand durch ein paar Telefonate heraus, dass das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen als führende Organisation in New York ein Büro unterhielt. Ricky bettelte um die Erlaubnis, wenigstens im Sommer mitzuhelfen, und fuhr nach New York, um sich nach den Aufnahmebedingungen zu erkundigen.
Nach dem Zerfall Jugoslawiens und drei Jahren Bürgerkrieg war die Republik Bosnien-Herzegowina im Frühjahr 1995 verwüstet. Das UNHCR tat mit vierhundert »Internationalen« und mehreren tausend im Land angeworbenen Mitarbeitern alles, was in seiner Macht stand. Der Koordinator vor Ort war ein ehemaliger britischer Soldat, der vollbärtige und energische Larry Hollingworth. Ricky kannte ihn aus dem Fernsehen.
Im New Yorker Büro war man freundlich, aber nicht besonders begeistert. Es trafen säckeweise Bewerbungen von Hilfswilligen ein, und täglich sprachen Dutzende persönlich vor. Ricky war bei den Vereinten Nationen gelandet. Alles ging seinen bürokratischen Gang. Sechs Monate Bearbeitungszeit und unzählige Formulare. Da er im Herbst in Harvard antreten musste, war eine Ablehnung wahrscheinlich.
Zu Beginn der Mittagspause fuhr der junge Mann ernüchtert mit dem Fahrstuhl wieder nach unten, als ihn ein Beamter mittleren Alters freundlich anlächelte.
»Wenn Sie wirklich helfen wollen«, sagte er, »müssen Sie ins Außenbüro Zagreb gehen. Dort werden die Leute direkt eingestellt. An Ort und Stelle sieht man alles nicht so eng.«
Auch Kroatien hatte einst zu Jugoslawien gehört, aber seine Abspaltung erzwungen und war jetzt ein unabhängiger Staat, in dessen sicherer Hauptstadt Zagreb viele Organisationen ihre Zentrale eingerichtet hatten. Eine davon war das UNHCR.
Ricky telefonierte mit seinen Eltern und flog, nachdem sie widerstrebend eingewilligt hatten, von New York über Wien nach Zagreb. Doch die Reaktion war die gleiche. Wieder musste er Formulare ausfüllen, und wirklich gefragt waren nur langfristige Engagements. Ferienhelfer bürdeten der Organisation eine große Verantwortung auf und leisteten herzlich wenig.
»Vielleicht sollten Sie es bei einer der NGOs versuchen«, schlug der Regionalleiter vor. »Die sitzen in dem Café gleich um die Ecke.«
Das UNHCR mochte die wichtigste Organisation sein, aber sie war bei weitem nicht die einzige. Katastrophenhilfe ist ein regelrechter Wirtschaftszweig und für viele ein Beruf. Neben den Vereinten Nationen und einzelstaatlichen Einrichtungen gibt es außerdem die Nichtregierungsorganisationen. In Bosnien waren über dreihundert von ihnen vertreten.
Kaum ein Dutzend sind der Öffentlichkeit ein Begriff: Save the Children (Großbritannien), Feed the Children (USA), Age Concern, War on Want, Ärzte ohne Grenzen – sie alle waren da. Einige waren religiös, andere weltlich ausgerichtet, und viele von den kleineren hatte man erst unter dem Eindruck der Fernsehbilder vom Bosnienkrieg, die im Westen ausgestrahlt wurden, gegründet. Die unterste Ebene bildeten einzelne Lastwagen, mit denen zwei kräftige junge Männer, die in ihrer Stammkneipe spontan Geld gesammelt hatten, Hilfsgüter quer durch Europa transportierten. Das letzte Etappenziel auf dem Weg nach Bosnien war entweder Zagreb oder die Adriastadt Split.
Ricky fand das Lokal, bestellte einen Kaffee und einen Sliwowitz gegen den kalten Märzwind draußen und sah sich nach jemandem um, den er ansprechen konnte. Zwei Stunden später trat ein bärtiger Mann mit der kräftigen Statur eines Fernfahrers ein. Er trug einen kurzen karierten Mantel und bestellte in einem Akzent, den Ricky in North oder South Carolina ansiedelte, Kaffee und Cognac. Er ging zu ihm, stellte sich vor und landete prompt einen Glückstreffer.
John Slack beförderte und verteilte Hilfsgüter im Auftrag einer kleinen amerikanischen Einrichtung namens Loaves’n’ Fishes, einer unlängst gegründeten Tochter der gemeinnützigen Organisation Salvation Road, die ein gewisser Reverend Billy Jones in diese sündhafte Welt gesetzt hatte, seines Zeichens Fernsehprediger und Seelenretter (bei angemessener Spende) aus dem schönen Charleston in South Carolina. Slack lauschte Ricky wie jemand, der das alles schon einmal gehört hatte.
»Kannst du einen Lkw fahren, Junge?«
»Ja.« Das entsprach zwar nicht ganz der Wahrheit, aber in seinen Augen waren ein großer Offroader und ein Kleinlaster so ziemlich das Gleiche.
»Kannst du eine Karte lesen?«
»Klar.«
»Und du willst ein dickes Gehalt?«
»Nein. Ich bekomme Taschengeld von meinem Großvater.«
John Slack zwinkerte.
»Du willst also nichts? Nur helfen?«
»Ja.«
»Okay, du bist dabei. Unser Laden ist klein. Ich geh los und kaufe Lebensmittel, Kleider, Decken und so, hauptsächlich in Österreich. Ich bringe alles mit dem Lastwagen nach Zagreb, mach den Tank voll, und dann geht es weiter nach Bosnien. Wir sitzen in Travnik. Dort gibt es Tausende von Flüchtlingen.«
»Toll«, sagte Ricky. »Ich komme auch selbst für meinen Unterhalt auf.«
Slack kippte den Rest seines doppelten Cognacs hinunter.
»Dann mal los, Junge«, sagte er.
Der Laster war ein Zehntonner-Hanomag, und noch vor der Grenze hatte Ricky den Dreh raus. Sie wechselten sich am Steuer ab und brauchten zehn Stunden bis Travnik. Es war Mitternacht, als sie auf das Gelände von Loaves’n’ Fishes am Rand der Stadt rollten. Slack warf ihm ein paar Decken zu.
»Schlaf im Führerhaus«, sagte er. »Morgen Früh suchen wir dir eine Bleibe.«
Das Hilfsaufgebot von Loaves’n’ Fishes war in der Tat bescheiden. Es bestand aus einem zweiten Lastwagen, mit dem ein wortkarger Schwede gerade gen Norden aufbrach, um weitere Hilfsgüter zu holen, einem kleinen, gemeinsam mit anderen genutzten Gelände, das ein Maschendrahtzaun vor Dieben schützte, einem winzigen Büro in einem Bauwagen, einem als Lagerhaus bezeichneten Schuppen für Nahrungsmittel, die bereits abgeladen, aber noch nicht verteilt waren, und drei bosnischen Helfern aus dem Ort. Dazu kamen zwei nagelneue schwarze Toyota-Landcruiser für die Verteilung kleiner Posten von Hilfsgütern. Slack zeigte ihm das Gelände, und am Nachmittag fand Ricky in der Stadt bei einer bosnischen Witwe ein Zimmer. Für die Fahrt zur Arbeit kaufte er sich von seinem Geld, das er in einer Gürteltasche aufbewahrte, ein klappriges Fahrrad. John Slack bemerkte den Gürtel.
»Macht es dir was aus, mir zu sagen, wie viel du da drin hast?«
»Tausend Dollar«, antwortete Ricky. »Nur für Notfälle.«
»Scheiße. Wedel bloß nicht damit herum, sonst gibt’s Ärger. Damit kann man sich hier zur Ruhe setzen.«
Ricky versprach, vorsichtig zu sein. Ein Postamt, so stellte er bald fest, gab es nicht, da es ja keinen bosnischen Staat und somit auch keine bosnische Post gab und die des alten Jugoslawien zusammengebrochen war. Von John Slack erfuhr er, dass jeder Mitarbeiter, der nach Kroatien oder Österreich fuhr, für die anderen Briefe und Postkarten beförderte. Ricky beschrieb rasch eine Karte aus dem Stapel, den er am Wiener Flughafen gekauft und in seinen Rucksack gesteckt hatte. Der Schwede nahm sie mit nach Norden, und Mrs. Colenso erhielt sie eine Woche später.
Travnik war einst eine blühende, von Serben, Kroaten und bosnischen Muslimen bewohnte Marktstadt gewesen, wie noch an den Gotteshäusern zu erkennen war. Es gab eine katholische Kirche für die mittlerweile geflüchteten Kroaten, eine orthodoxe für die gleichfalls geflüchteten Serben und ein Dutzend Moscheen für die muslimische Mehrheit, die so genannten Bosniaken.
Mit Beginn des Bürgerkriegs brach die Gemeinschaft der drei ethnischen Gruppen, die lange friedlich zusammengelebt hatten, auseinander. Die Berichte über die Pogrome im ganzen Land zerstörten das gegenseitige Vertrauen.
Die Serben flohen nach Norden über den Berg Vlasić, der Travnik überragt, und zogen sich nach Banja Luka jenseits des Lasvatals zurück.
Von den ebenfalls vertriebenen Kroaten suchten die meisten im fünfzehn Kilometer entfernten Vitez Zuflucht. So entstanden drei ethnische Hochburgen, und in jede strömten Flüchtlinge der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.
Die internationalen Medien lasteten alle Pogrome den Serben an, obwohl durchaus auch Serben abgeschlachtet wurden, wenn sie isoliert und in der Minderheit waren. Der Grund dafür war, dass die Serben in der Armee des alten Jugoslawien die beherrschende Rolle gespielt hatten. Als der Staat auseinander brach, sicherten sie sich neunzig Prozent der schweren Waffen, was ihnen eine erdrückende Überlegenheit verlieh.
Die Kroaten, die auch nicht zimperlich waren, wenn es galt, in ihrer Mitte lebende nichtkroatische Minderheiten zu massakrieren, hatten durch den deutschen Bundeskanzler Kohl zu einem unverantwortlich frühen Zeitpunkt ihre staatliche Anerkennung erhalten und konnten sich danach auf dem Weltmarkt Waffen besorgen.
Die Bosniaken hingegen waren weitgehend unbewaffnet und blieben es auf Anraten der europäischen Politiker auch. Demzufolge hatten sie am meisten unter den brutalen Übergriffen zu leiden. Im späten Frühjahr 1995 sollten es die Amerikaner sein, die das untätige Zusehen satt hatten und ihre militärische Stärke dazu nutzten, den Serben eine blutige Nase zu schlagen und alle Konfliktparteien in Dayton, Ohio, an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das Abkommen von Dayton sollte im folgenden November in die Tat umgesetzt werden. Doch das hatte Ricky Colenso nicht mehr erlebt.
Zu der Zeit, als Ricky nach Travnik kam, konnte man noch überall die Einschläge der vielen Granaten sehen, die von serbischen Stellungen in den Bergen auf den Ort abgefeuert worden waren. Die meisten Häuser schützten ihre Bewohner durch an die Außenwände gelehnte Bretter. Ein Treffer verwandelte sie in Kleinholz, aber das Haus selbst blieb unversehrt. Fensterscheiben fehlten meist und waren durch Plastikplanen ersetzt worden. Die bunt bemalte Hauptmoschee war wie durch ein Wunder verschont geblieben. In den beiden größten Gebäuden der Stadt, dem Gymnasium und der einstmals berühmten Musikschule, drängten sich die Flüchtlinge.
Jene, deren Zahl die ursprüngliche Einwohnerschaft um ein Dreifaches überstieg, waren von den Feldern und Äckern des Umlandes praktisch abgeschnitten und daher auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Deswegen war es so wichtig, dass Loaves’n’ Fishes und ein Dutzend anderer kleinerer NGOs sich der Stadt annahmen.
Die beiden Landcruiser konnten bis zu fünf Zentner Hilfsgüter laden und in abgelegene Dörfer und Weiler karren, in denen die Not noch größer war als in Travnik selbst. Mit Freuden erklärte sich Ricky bereit, Säcke mit Lebensmitteln zu schleppen und mit dem Geländewagen in die Berge im Süden zu fahren.
Vier Monate nachdem er in Georgetown vor dem Fernseher gesessen und die Bilder menschlichen Elends gesehen hatte, war er glücklich, das zu tun, was er tun wollte. Er war gerührt über die Dankbarkeit der knorrigen Bauern und ihrer Kinder, die große Augen machten, wenn er Säcke mit Weizen, Mais, Milchpulver und Suppenkonzentrat in ein von der Außenwelt abgeschnittenes Dorf brachte, in dem es seit einer Woche nichts Essbares mehr gegeben hatte.
Irgendwie hatte er das Gefühl, sich auf diese Weise für all die Wohltaten erkenntlich zu zeigen, die ihm ein gütiger Gott dadurch erwiesen hatte, dass er ihn als Amerikaner hatte auf die Welt kommen lassen.
Er konnte weder ein Wort Serbokroatisch, noch verstand er den bosnischen Dialekt. Er hatte keine Ahnung, wie die Gegend geografisch beschaffen war, wohin die Bergstraßen führten, wo es sicher war und wo es gefährlich werden konnte.
John Slack stellte ihm einen der bosnischen Helfer zur Seite, einen jungen Mann namens Fadil Sulejman, der passables Schulenglisch sprach und sich als Führer, Dolmetscher und Beifahrer nützlich machte.
Den ganzen April hindurch und in der ersten Maihälfte schickte er seinen Eltern jede Woche einen Brief oder eine Postkarte, und je nachdem, wer gerade in den Norden fuhr, um Nachschub zu holen, trafen sie mit mehr oder weniger großer Verspätung und mit einem kroatischen oder österreichischen Stempel versehen in Georgetown ein.
In der zweiten Maiwoche war Ricky plötzlich allein und für das gesamte Lager verantwortlich. Lars, der Schwede, war auf der Fahrt nach Zagreb kurz hinter der kroatischen Grenze auf einer einsamen Bergstraße mit schwerem Motorschaden liegen geblieben, und John Slack hatte sich sofort mit einem Landcruiser auf den Weg gemacht, um den Laster wieder flottzubekommen.
Fadil Sulejman bat Ricky um einen Gefallen.
Wie Tausende in Travnik hatte Fadil auf der Flucht vor dem Krieg sein Zuhause verlassen müssen. Seine Familie, so erzählte er, habe auf einem Bauernhof in einem Hochtal an den Hängen der Vlasić-Bergkette gelebt. Er müsse unbedingt wissen, ob von dem Hof etwas übrig sei. War er niedergebrannt worden oder verschont geblieben? Stand er noch? Bei Kriegsausbruch habe sein Vater den Familienschmuck und andere Wertgegenstände in einer Scheune vergraben. Befanden sie sich noch da? Kurzum, er wollte zum ersten Mal seit drei Jahren sein Elternhaus aufsuchen.
Ricky gab ihm bereitwillig frei, aber das war nicht der springende Punkt. Da der Frühjahrsregen die unbefestigten Bergstraßen aufgeweicht hatte, war die Fahrt nur mit einem Geländewagen zu schaffen. Deshalb wollte sich Fadil den Landcruiser ausleihen.
Ricky war hin und her gerissen. Er wollte helfen und war auch bereit, das Benzin zu bezahlen. Aber war es in den Bergen sicher? Vor nicht allzu langer Zeit hatten dort oben noch Serben patrouilliert und mit ihrer Artillerie das im Tal liegende Travnik beschossen.
Das sei ein Jahr her, entgegnete Fadil und ließ nicht locker. Die Südhänge, wo sein Elternhaus stehe, seien inzwischen ziemlich sicher. Ricky zögerte und fragte sich, wie es wohl war, wenn man sein Zuhause verlor. Schließlich ließ er sich durch Fadils inständige Bitten erweichen und willigte ein. Unter einer Bedingung: Er wolle mitfahren.
Die Frühlingssonne schien, und die Fahrt verlief ohne Probleme. Sie fuhren aus der Stadt hinaus und auf der Hauptstraße fünfzehn Kilometer in Richtung Donji Vakuf, dann bogen sie rechts ab.
Die Straße kroch den Berg hinauf, verengte sich zu einem Waldweg und führte weiter bergan, gesäumt von Buchen, Eschen und Eichen in ihrem neuen Frühlingskleid. Ricky fühlte sich an den Shenandoah erinnert, an dem er einmal mit einer Schülergruppe gezeltet hatte. In den Kurven gerieten sie ins Schleudern, und er musste zugeben, dass sie es ohne Allradantrieb nicht geschafft hätten.
Die Eichen wichen Nadelbäumen, und in fünfzehnhundert Metern Höhe gelangten sie in das Hochtal, das von der Straße weit unten nicht zu sehen war. Mitten im Tal stand das Bauernhaus. Das heißt, nur den Schornstein gab es noch, der Rest war niedergebrannt und dem Erdboden gleichgemacht worden. Dahinter ragten alte Viehkoppeln und mehrere windschiefe Scheunen empor, die das Feuer verschont hatte. Ricky blickte Fadil an und sagte:
»Das tut mir sehr Leid.«
Sie stiegen neben dem verkohlten Haufen aus. Ricky wartete, während Fadil durch die feuchte Asche stapfte und hier und dort gegen einen Gegenstand trat, der von dem Haus, in dem er seine Kindheit verbracht hatte, noch übrig geblieben war. Ricky folgte ihm, als er an den Koppeln und der bis zum Rand mit einer widerlichen Brühe und Regenwasser gefüllten Jauchegrube vorbei zu den Scheunen ging, in denen sein Vater den Familienschatz vergraben hatte, um ihn vor Plünderern zu schützen. In diesem Augenblick hörten sie ein Rascheln und Wimmern.
Die beiden Männer entdeckten sie unter einer nassen und stinkenden Abdeckplane. Es waren sechs, dicht aneinander gekauert, verängstigt, zwischen vier und zehn Jahre alt. Vier kleine Jungen und zwei Mädchen, von denen die Ältere offenbar die Mutter ersetzte und die Gruppe führte. Beim Anblick der beiden Männer, die sie entgeistert ansahen, erstarrten sie vor Schreck. Fadil redete sanft auf sie ein. Nach einer Weile antwortete das Mädchen.
»Sie kommen aus Gorcia, einem kleinen Weiler, ungefähr sechs Kilometer von hier am Berg entlang. Das bedeutet ›kleiner Hügel‹. Ich kenne ihn von früher.«
»Was ist passiert?«
Fadil sprach weiter in der lokalen Mundart. Das Mädchen antwortete, dann brach es in Tränen aus.
»Männer kamen, Serben, Milizionäre.«
»Wann?«
»Letzte Nacht.«
»Was ist passiert?«
Fadil seufzte.
»Es war ein sehr kleiner Weiler. Vier Familien, zwanzig Erwachsene, etwa zwölf Kinder. Alle tot, alle ermordet. Ihre Eltern schrien, sie sollten weglaufen, als die ersten Schüsse fielen. Sie entkamen in der Dunkelheit.«
»Waisen? Alle?«
»Alle.«
»Großer Gott, was für ein Land«, sagte der Amerikaner. »Wir müssen sie zum Wagen bringen, runter ins Tal.«
Sie führten die Kinder, von denen jedes das nächstältere an der Hand hielt, sodass sie eine Kette bildeten, aus der Scheune in die strahlende Frühlingssonne. Vögel zwitscherten. Es war ein schönes Tal.
Am Waldrand erblickten sie die Männer – zehn, und dazu zwei russische GAZ-Jeeps mit militärischem Tarnanstrich. Die Männer trugen Tarnanzüge und waren schwer bewaffnet.
Drei Wochen später, als Annie Colenso in den Briefkasten schaute und wieder keine Karte darin fand, wählte sie eine Nummer in Windsor, Ontario. Beim zweiten Klingeln wurde abgehoben. Sie erkannte die Stimme der Privatsekretärin ihres Vaters.
»Hi, Jean. Hier spricht Annie. Ist mein Vater da?«
»Gewiss, Mrs. Colenso. Ich verbinde Sie sofort.«
3
Der Magnat
Die Baracke der Flight-Crew A war mit zehn jungen Piloten belegt, die der B-Crew nebenan mit weiteren acht. Draußen im hellgrünen Gras des Flugfelds kauerten zwei oder drei Hurricanes, leicht zu erkennen an der buckelartigen Ausbuchtung hinter der Pilotenkanzel. Sie waren nicht neu, und Stoffflicken verrieten, dass sie in den zurückliegenden vierzehn Tagen bei den Gefechten über Frankreich Schrammen davongetragen hatten.
Die Stimmung in den Baracken hätte in keinem schärferen Kontrast zu dem strahlenden Sommerwetter an diesem 25. Juni 1940 auf dem Flugplatz Coltishall im englischen Norfolk stehen können. Die Moral der Männer von Squadron 242 der Royal Air Force, auch unter dem Namen »Kanadische Jagdstaffel« bekannt, war auf dem Tiefpunkt angelangt – und das mit gutem Grund.
Die 242 war beinahe von Anfang an, seit an der Westfront der erste Schuss gefallen war, im Einsatz. Sie hatte in der verlorenen Schlacht um Frankreich gekämpft und den Rückzug von der Ostgrenze des Landes bis zur Kanalküste mitgemacht. Während Hitlers vorrückende Blitzkriegsmaschine die französische Armee mühelos beiseite fegte, mussten die Piloten, die sie aufzuhalten versuchten, ein ums andere Mal feststellen, dass man ihre Stützpunkte evakuiert und weiter nach hinten verlegt hatte, während sie in der Luft waren, und dann selbst zusehen, wo sie Verpflegung, Quartiere, Ersatzteile und Sprit auftrieben. Wer jemals einer sich zurückziehenden Armee angehört hat, weiß, dass »chaotisch« das alles beherrschende Adjektiv ist.
Wieder in England, hatten sie von der anderen Kanalseite aus die zweite Schlacht geschlagen, diesmal über den Stränden von Dünkirchen, während unter ihnen die britische Armee zu retten versuchte, was noch zu retten war, und in wilder Flucht mit allem, was schwamm, zurück nach England paddelte, dessen verlockende weiße Klippen jenseits der ruhigen See zu sehen waren.
Zu dem Zeitpunkt, als der letzte Tommy von diesen unsäglichen Stränden evakuiert war und die letzten Verteidiger für fünf Jahre in deutsche Gefangenschaft wanderten, waren die Kanadier erschöpft. Sie hatten tüchtig Prügel bezogen: neun Gefallene, drei Verwundete und drei nach ihrem Abschuss in Gefangenschaft geratene Männer.
Drei Wochen später saßen sie in Coltishall noch immer am Boden fest, ohne Ersatzteile und Werkzeug, denn alles war in Frankreich zurückgelassen worden. Ihr Staffelführer, Commander »Papa« Gobiel, war schon seit Wochen krank und sollte nicht wieder auf seinen Posten zurückkehren. Doch die Briten hatten ihnen einen neuen Commander versprochen. Er wurde jeden Augenblick erwartet.
Ein kleiner Sportwagen mit offenem Verdeck war zwischen den Hangars aufgetaucht und parkte neben den beiden Holzbaracken. Ein Mann kletterte mit sichtlicher Mühe heraus. Niemand trat ins Freie, um ihn zu begrüßen, und er stapfte linkisch in die Baracke A. Nach ein paar Minuten kam er wieder heraus und steuerte auf die Baracke B zu. Die kanadischen Piloten beobachteten ihn durchs Fenster, wunderten sich über seinen breitbeinigen Seemannsgang.
Die Tür schwang auf, und er erschien in der Öffnung. Seine Schulterklappen wiesen ihn als Staffelführer aus. Niemand stand auf.
»Wer hat hier das Kommando?«, fragte er ärgerlich.
Ein bulliger Kanadier stemmte sich in die Höhe, ein paar Schritte neben ihm rekelte sich Steve Edmond auf seinem Stuhl und musterte den Neuankömmling durch blauen Dunst.
»Ich vermutlich«, antwortete Stan Turner. Obwohl der Krieg noch jung war, hatte er bereits zwei bestätigte Abschüsse auf seinem Konto. Er sollte es auf insgesamt vierzehn und zu einer ganzen Reihe Orden bringen.
Der britische Offizier mit den zornigen blauen Augen machte auf den Hacken kehrt und stakste zu einer der geparkten Hurricanes. Die Kanadier traten neugierig aus den Baracken.
»Ich glaub’s nicht«, raunte Johnny Latta Steve Edmond zu. »Scheiße, die Arschlöcher haben uns einen Commander geschickt, der keine Beine mehr hat.«
Er hatte Recht. Der Neue stelzte auf zwei Prothesen durch die Gegend. Er hievte sich in die Pilotenkanzel der Hurricane, warf den Merlin-Motor von Rolls-Royce an, drehte in den Wind und hob ab. Eine halbe Stunde lang vollführte er mit dem Jagdflugzeug jedes bekannte akrobatische Manöver und noch ein paar unbekannte dazu.
Er war deshalb so gut, weil er schon vor dem Krieg, und lange bevor er durch einen Unfall beide Beine verloren hatte, ein Fliegerass gewesen war, auch und gerade weil er keine Beine mehr hatte. Wenn ein Jagdflieger eine enge Kurve fliegt oder die Maschine nach einem Sturzflug wieder hochzieht – und beide Manöver sind im Luftkampf lebenswichtig -, ist sein Körper enormen Fliehkräften ausgesetzt. Das Blut schießt vom Oberkörper nach unten, was eine Ohnmacht zur Folge haben kann. Da dieser Pilot keine Beine hatte, blieb das Blut notgedrungen im Oberkörper und somit näher am Gehirn. Seine Leute sollten erfahren, dass er engere Kurven fliegen konnte als jeder andere. Schließlich landete er die Hurricane, kletterte heraus und ging auf die sprachlosen Kanadier zu.
»Mein Name ist Douglas Bader«, sagte er, »und wir werden verflucht noch mal das beste Geschwader der gesamten Air Force.«
Er hielt Wort. Auch wenn der Kampf um Frankreich verloren und es bei Dünkirchen verdammt eng geworden war, stand die Entscheidungsschlacht erst noch bevor. Göring, der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe, hatte Hitler die Luftherrschaft versprochen, die Voraussetzung war für eine erfolgreiche Invasion in England. Um diese Lufthoheit ging es beim Kampf um England. Als sie endete, konnten die Kanadier von der Squadron 242, die stets von ihrem beinamputierten Commander in den Kampf geführt worden war, das beste Abschuss-Verlust-Verhältnis vorweisen.
Im Spätherbst hatte die deutsche Luftwaffe genug und zog sich nach Frankreich zurück. Hitler ließ seine Wut an Göring aus und richtete sein Augenmerk auf den Osten, auf Russland.
In den drei Schlachten um Frankreich, Dünkirchen und England, die sich nur über sechs Monate des Jahres 1940 erstreckten, hatte das kanadische Geschwader achtundachtzig bestätigte Abschüsse erzielt, davon allein siebenundsechzig im Kampf um England. Doch sie hatten dabei siebzehn Piloten verloren, und alle bis auf drei waren Kanadier gewesen.
Fünfundfünfzig Jahre später stand Steve Edmond von seinem Schreibtisch auf und trat, wie schon so oft in den Jahren zuvor, zu dem Foto an der Wand. Nicht alle seiner Fliegerkameraden waren darauf zu sehen. Einige waren bereits gefallen, andere erst später dazugekommen. Aber es zeigte die siebzehn Kanadier in Duxford an einem heißen und wolkenlosen Tag im späten August, als die Schlacht ihren Höhepunkt erreicht hatte.
Fast alle waren inzwischen tot, die meisten im Krieg gefallen. Übermütig, fröhlich und optimistisch blickten ihm die Gesichter der neunzehn- bis zweiundzwanzigjährigen Männer entgegen, die an der Schwelle zu einem Leben standen, das die meisten nie kennen lernen sollten.
Er sah genauer hin. Benzie, der direkt neben ihm geflogen war, abgeschossen und gefallen über der Themsemündung am 7. September, zwei Wochen nachdem das Foto aufgenommen worden war. Solanders, der Junge aus Neufundland, einen Tag später.
Johnny Latta und Willie McKnight, die nebeneinander standen, starben im Januar 1941 bei einem gemeinsamen Einsatz irgendwo über der Biskaya.
»Du warst von uns allen der Beste, Willie«, murmelte der alte Mann. McKnight war ein Ass und der unbestrittene Star, ein »Naturtalent«. Neun bestätigte Abschüsse in den ersten siebzehn Tagen, einundzwanzig Siege im Luftkampf, als er zehn Monate nach seinem ersten Einsatz einundzwanzig Jahre jung starb.
Steve Edmond hatte überlebt, war ziemlich alt und steinreich geworden und mit Sicherheit der größte Bergbaumagnat in Ontario. Doch in all den Jahren hatte das Foto ihn stets begleitet: als er allein mit einer Keilhaue in einer Hütte hauste, seine erste Dollarmillion machte und ihn das Magazin Forbes zum Milliardär kürte.
Er hatte es aufgehängt, um sich an die schreckliche Fragilität dessen zu erinnern, was wir »Leben« nennen. Rückblickend fragte er sich oft, wie er überlebt hatte. Er lag nach seinem ersten Abschuss noch im Lazarett, als die Squadron 242 im Dezember 1941 in den Fernen Osten verlegt wurde. Nach seiner Genesung wurde er in eine Ausbildungseinheit versetzt.
Doch er wollte wieder Kampfeinsätze fliegen, und verärgert bombardierte er seine Vorgesetzten so lange mit Gesuchen, bis sie seinem Wunsch entsprachen – gerade noch rechtzeitig vor der Landung in der Normandie, bei der er das neue Kampfflugzeug Typhoon flog, einen gefürchteten, ebenso schnellen wie kampfstarken Panzerknacker.
Das zweite Mal wurde er bei Remagen abgeschossen, als die Amerikaner über den Rhein setzten. Seine Maschine gehörte zu einem Dutzend britischer Typhoons, die den Vormarsch deckten. Nach einem Volltreffer in den Motor blieben ihm nur wenige Sekunden, um Höhe zu gewinnen, die Kanzelhaube zu öffnen und aus der Maschine zu springen, ehe sie explodierte.
Die Absprunghöhe war gering, die Landung hart. Er brach sich beide Beine. Benommen vor Schmerzen, lag er im Schnee und nahm nur undeutlich die Stahlhelme wahr, die sich rasch auf ihn zubewegten. Wesentlich deutlicher jedoch wurde ihm bewusst, dass die Deutschen gegen die Typhoons eine besondere Abneigung hegten und die Leute, die er weggepustet hatte, einer Panzerdivision der SS angehörten, die für ihre Toleranz nicht gerade bekannt war.
Eine vermummte Gestalt blieb vor ihm stehen, blickte auf ihn herab und sagte: »Wen haben wir denn da?« Ein Seufzer der Erleichterung entfuhr ihm. Wenige von Adolfs Besten sprachen Englisch mit einem breiten Mississippi-Akzent.
Die Amerikaner brachten ihn, benommen von Morphium, zurück über den Rhein und ließen ihn nach England ausfliegen. Als seine Beine wieder leidlich in Ordnung waren, wurde sein Bett dringender für Neuzugänge von der Front gebraucht. Und so schickte man ihn zur Erholung an die Südküste, wo er bis zu seiner Rückkehr nach Kanada erste Gehversuche unternahm.
Er genoss die Zeit in Dilbury Manor, einem verschachtelten, geschichtsträchtigen Gemäuer aus der Tudorzeit mit Rasenflächen, so grün wie ein Billardtischbezug, und einigen hübschen Krankenschwestern. In jenem Frühjahr wurde er fünfundzwanzig und bekleidete den Rang eines Geschwaderkommandeurs.
Jeweils zwei Offiziere teilten sich einen Raum, doch sein Zimmergenosse traf erst eine Woche später ein. Er war etwa im gleichen Alter, Amerikaner ohne Uniform, und gleichen bei einem Feuergefecht in Norditalien am linken Arm und an der linken Schulter verwundet worden. Das bedeutete eine verdeckte Operation hinter den feindlichen Linien. Spezialeinheit.
»Hi«, grüßte der Neuankömmling, »Peter Lucas. Spielen Sie Schach?«
Steve Edmond stammte aus den Bergarbeitercamps in Ontario und hatte sich, um der Arbeitslosigkeit im Bergbau zu entgehen, 1938 zur Royal Canadian Air Force gemeldet. Die Welt hatte damals keine Verwendung für kanadisches Nickel. Später sollte dieses Metall Bestandteil jedes Flugzeugmotors werden, der ihn und seine Maschinen in der Luft hielt. Lucas stammte aus der Oberschicht Neuenglands, der Wohlstand war ihm in die Wiege gelegt worden.
Die beiden jungen Männer saßen, den Schachtisch zwischen sich, auf dem Rasen, als eine Radiostimme aus dem Fenster des Speisesaals drang und im blasierten Akzent der BBC-Nachrichtensprecher jener Tage die Meldung verlas, dass Generaloberst Jodl in Reims die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet habe. Man schrieb den 7. Mai 1945.
Der Krieg in Europa war vorbei. Der Amerikaner und der Kanadier gedachten all der Freunde, die nicht heimkehren würden, und jeder sollte sich später daran erinnern, dass er an diesem Tag das letzte Mal in der Öffentlichkeit geweint hatte.
Eine Woche später schieden sie voneinander und kehrten in ihr jeweiliges Land zurück. Doch in dem Genesungsheim an der englischen Küste hatten sie eine Freundschaft fürs Leben geschlossen.
Es war ein anderes Kanada, in das Steve Edmond heimkehrte, und er ein anderer Mann, ein hoch dekorierter Kriegsheld, der eine boomende Wirtschaft vorfand. Er stammte aus dem Sudbury-Becken, und dorthin kehrte er auch zurück. Sein Vater war Bergarbeiter gewesen wie davor schon sein Großvater. Seit 1885 bauten die Kanadier um Sudbury Kupfer und Nickel ab, und die Edmonds waren fast immer dabei gewesen.
Steve Edmond bekam von der Air Force eine hübsche Stange Geld und verwendete sie dazu, als Erster seiner Familie aufs College zu gehen. Er schrieb sich, keineswegs überraschend, für das Fach Bergbautechnik ein und belegte zusätzlich Hüttenkunde. 1948 schloss er in beiden Fächern als einer der Besten seines Jahrgangs ab und wurde von der INCO, der International Nickel Company und wichtigsten Arbeitgeberin im Becken, mit Handkuss genommen.
Die 1902 gegründete INCO hatte maßgeblich dazu beigetragen, aus Kanada den größten Nickelproduzenten der Welt zu machen. Und das Herz des Unternehmens lag in der riesigen Lagerstätte bei Sudbury in Ontario. Steve Edmond begann als Managementtrainee.
Er wäre wohl Minenmanager geblieben und hätte weiter in einem komfortablen, aber firmeneigenen Holzhaus in einem Vorort von Sudbury gelebt, hätte ihm sein rastloser Geist nicht unentwegt eingeflüstert, dass es noch einen »besseren Weg« geben müsse.
Auf dem College hatte er gelernt, dass das wichtige Nickelerz Pentlandit nicht nur Nickel, sondern auch andere Elemente enthielt wie Platin, Palladium, Iridium, Ruthenium, Rhodium, Tellur, Selen, Kobalt, Silber und Gold. Er begann, sich mit den Seltenerdmetallen, ihrer Anwendung und möglichen Vermarktung zu beschäftigen. Kein anderer machte sich diese Mühe, denn ihre Gewinnung war wegen ihrer geringen Konzentration zu unrentabel, sodass sie auf den Abraumhalden landeten. Nur sehr wenige wussten, was Seltenerdmetalle waren.
Fast alle großen Vermögen sind einer bahnbrechenden Idee und dem Mut zu verdanken, sie in die Tat umzusetzen. Auch harte Arbeit und Glück sind nicht von Nachteil. Steve Edmonds bahnbrechende Idee bestand darin, ins Labor zurückzukehren, während die anderen jungen Bergbaumanager den spärlichen Ertrag ihrer Arbeit einfach vertranken. Die Lösung, die er präsentierte, war ein Verfahren namens »saure Drucklaugung«.
Im Wesentlichen ging es darum, die sehr geringen Bestandteile an seltenen Metallen aus der Schlacke herauszulösen und aufzubereiten.
Wäre er damit zur INCO gegangen, hätte man ihm auf die Schulter geklopft und allenfalls noch ein opulentes Abendessen spendiert. Stattdessen kündigte er, löste eine Eisenbahnkarte dritter Klasse nach Toronto und suchte dort das Patentamt auf. Er war dreißig und auf dem Weg nach oben.
Natürlich musste er einen Kredit aufnehmen, wenn auch keinen sehr großen, denn das, was er im Sinn hatte, kostete nicht viel. Wenn das Nickelerz Pentlandit völlig oder zumindest so weit abgebaut war, dass eine weitere Förderung unwirtschaftlich erschien, hinterließen die Bergbaugesellschaften riesige Abraumhalden. Diese Erzabfälle bestanden aus Schutt, den keiner wollte – keiner außer Steve Edmond. Er kaufte ihn für ein Butterbrot, gründete die Edmond Metals, kurz »Ems« genannt und an der Torontoer Börse schlicht als »Emmys« bekannt, und der Kurs schoss nach oben. Er verkaufte nie, widerstand allen Überredungsversuchen und ließ sich auf keines der riskanten Geschäfte ein, die ihm Banken und Finanzberater vorschlugen. Auf diese Weise vermied er jeden Medienrummel, blieb von platzenden Spekulationsblasen und Börsenkrächen verschont. Mit vierzig war er Multimillionär, und 1985, mit fünfundsechzig, umgab ihn die Aura des Milliardärs.
Er prahlte nie damit, vergaß nie seine Wurzeln, spendete viel für wohltätige Zwecke, mied die Politik, blieb leutselig und galt als guter Familienvater.
Im Lauf der Jahre gab es tatsächlich ein paar Narren, die von seinem freundlichen Auftreten auf den ganzen Mann schlossen und versuchten, ihn zu betrügen, zu belügen oder zu bestehlen. Sie mussten, häufig zu spät aus ihrer Sicht, erkennen, dass Steve Edmond so hart war wie der Stahl in jedem Flugzeugmotor, hinter dem er gesessen hatte.
Er heiratete nur einmal, und zwar 1949, kurz vor seiner großen Entdeckung. Er und Fay waren ein Liebespaar, und sie blieben es, bis sie 1994 an amyotrophischer Lateralsklerose starb. Sie hatten ein Kind, die 1950 geborene Tochter Annie.
Steve Edmond vergötterte sie auch im Alter noch, hielt große Stücke auf Professor Adrian Colenso, den Mathematiker der Georgetown University, den sie mit zweiundzwanzig geheiratet hatte, und liebte seinen einzigen Enkel Ricky über alles, der sich, damals zwanzig Jahre alt, irgendwo in Europa herumtrieb, ehe er das Studium aufnehmen wollte.
Die meiste Zeit war Steve Edmond ein zufriedener Mann, und er hatte allen Grund dazu. Doch es gab auch Tage, an denen er unruhig und reizbar war. Dann durchschritt er sein Penthousebüro hoch über der Stadt Windsor in Ontario und blickte wieder in die jungen Gesichter auf dem Foto. Gesichter aus einer anderen Welt, einer anderen Zeit.
Das Telefon klingelte. Er kehrte zum Schreibtisch zurück.
»Ja, Jean?«
»Mrs. Colenso ruft aus Virginia an.«
»Schön. Stellen Sie durch.« Er lehnte sich in seinem gepolsterten Drehstuhl zurück, während er verbunden wurde. »Hi, mein Schatz. Wie geht es dir?«
Sein Lächeln erstarb, während er zuhörte. Er lehnte sich vor und stützte sich auf den Tisch.
»Was meinst du mit ›vermisst‹? … Hast du versucht, ihn anzurufen? … Bosnien? Keine Verbindung … Annie, du weißt doch, dass die jungen Leute heutzutage nicht schreiben … Vielleicht hat die Post da drüben geschlampt … Ja. Ich weiß, er hat es hoch und heilig versprochen … In Ordnung, überlass die Sache mir. Für wen arbeitet er?«
Er nahm einen Kugelschreiber und schrieb auf, was sie diktierte.
»Loaves’n’ Fishes. Ist das der Name? Ist das eine Hilfsorganisation? Nahrungshilfe für Flüchtlinge. Schön, dann wird sie registriert sein. Sie muss registriert sein. Überlass alles mir, Liebes. Ja, sowie ich etwas in Erfahrung gebracht habe.«
Er legte den Hörer auf, überlegte einen Augenblick und rief seinen Generaldirektor an.
»Haben Sie unter Ihren Jungs einen, der im Internet recherchieren kann?«, fragte er.
Der Direktor war verdutzt. »Selbstverständlich. Dutzende.«
»Ich brauche den Namen und die Privatnummer des Leiters einer Hilfsorganisation namens Loaves’n’ Fishes. Nein, mehr nicht. Und bitte beeilen Sie sich.«
Er hatte beides nach zehn Minuten. Eine Stunde später beendete er ein langes Telefonat mit einem von diesen Fernsehpredigern, der in einem Glitzerbau in Charleston, South Carolina, seine Bürozentrale hatte, einem von der Sorte, die er verachtete, weil sie Leichtgläubigen riesige Spenden abschwatzten und ihnen dafür das Seelenheil versprachen.
Loaves’n’ Fishes war der karitative Arm des Erlösers mit Schmalztolle und sammelte Spenden für die bedauernswerten Flüchtlinge in Bosnien, die zu der Zeit unter einem grausamen Bürgerkrieg litten. Wie viel von den Spendendollars an die armen Teufel floss und wie viel in den Wagenpark des Reverends, das konnte man nur vermuten. Doch wenn Ricky Colenso als Freiwilliger für Loaves’n’ Fishes in Bosnien gearbeitet habe, so erfuhr er von der Stimme aus Charleston, dann in ihrem Verteilungszentrum in einer Stadt namens Travnik.
»Jean, erinnern Sie sich an den Mann in Toronto, dem vor ein paar Jahren bei einem Einbruch in sein Landhaus ein paar wertvolle alte Gemälde gestohlen wurden? Es stand in der Zeitung. Später tauchten sie wieder auf. Jemand im Klub sagte, er habe eine diskrete Agentur damit beauftragt, sie aufzuspüren und zurückzubringen. Ich brauche seinen Namen. Rufen Sie mich zurück.«
Der gesuchte Name war mit Sicherheit nicht im Internet zu finden, doch es gab andere Netze. Jean Searle, seit vielen Jahren seine Privatsekretärin, nutzte das Sekretärinnennetz, und eine ihrer Freundinnen saß im Vorzimmer des Polizeichefs.
»Rubinstein? Schön. Finden Sie Mr. Rubinstein, in Toronto oder sonst wo.«
Das dauerte eine halbe Stunde. Der Kunstsammler weilte gerade in Amsterdam, um sich zum wiederholten Mal im Rijksmuseum Rembrandts »Nachtwache« anzusehen. Wegen der sechs Stunden Zeitunterschied wurde er beim Abendessen gestört. Er war dennoch hilfsbereit.
»Jean«, sagte Steve Edmond nach dem Telefonat, »rufen Sie den Flughafen an. Sie sollen die Grumman startklar machen. Sofort. Ich möchte nach London fliegen. Nein, das in England. Sowie es hell wird.«
Man schrieb den 10. Juni 1995.
4
Der Soldat
Kaum hatte Cal Dexter seinen Fahneneid geleistet, war er auch schon auf dem Weg ins Grundausbildungslager. Er brauchte nicht weit zu fahren, Fort Dix liegt in New Jersey.
Im Frühjahr 1968 rückten Zehntausende junger Amerikaner ein, fünfundneunzig Prozent davon widerwillig als Wehrpflichtige. Den Ausbildern war das völlig schnuppe. Ihre Aufgabe bestand darin, aus dieser Masse von kahl geschorenen jungen Männern so etwas wie Soldaten zu machen, ehe sie, nur drei Monate später, an einen anderen Standort versetzt wurden.
Woher sie kamen, wer ihre Väter waren und welche Ausbildung sie genossen hatten, interessierte sie herzlich wenig. Das Ausbildungslager war der größte Gleichmacher nach dem Tod. Der würde später kommen. Jedenfalls für einige.
Dexter war von Natur rebellisch, aber auch cleverer als die meisten. Das Essen war bescheiden, aber immer noch besser als das, das er auf vielen Baustellen bekommen hatte, und so aß er mit Appetit.
Im Gegensatz zu den Jungs aus begütertem Haus hatte er keine Probleme mit dem Schlafsaal, den offenen Toiletten oder dem Befehl, seine Montur und den kleinen Spint pieksauber zu halten. Am meisten kam ihm jetzt zugute, dass ihm nie jemand hinterhergeräumt hatte, und so erwartete er auch nichts dergleichen im Lager. Andere, die es gewohnt waren, bedient zu werden, brachten viele Stunden damit zu, unter den Blicken eines missgestimmten Unteroffiziers um den Exerzierplatz zu joggen oder Liegestütze zu machen.
Gleichwohl sah Dexter in den meisten Vorschriften und Ritualen keinen Sinn, doch er war klug genug, seine Meinung für sich zu behalten. Ebenso wenig konnte er verstehen, wieso Unteroffiziere immer Recht hatten und er immer Unrecht.
Es zahlte sich sehr schnell aus, dass er sich auf drei Jahre verpflichtet hatte. Die Corporals und Sergeants, die in einem Grundausbildungslager gleich nach dem lieben Gott kamen, kannten seinen Status und drückten bei ihm ein Auge zu. Reiche Muttersöhnchen hatten es am schwersten.
Nach zwei Wochen musste er zu seinem ersten Beurteilungsgespräch vor einem dieser nahezu unsichtbaren Wesen erscheinen – einem Offizier, genauer gesagt einem Major. »Irgendwelche besonderen Qualifikationen?«, fragte der Major wohl zum tausendsten Mal.
»Ich bin Bulldozer gefahren, Sir«, antwortete Dexter.
Der Major studierte seine Akte und sah auf. »Wann war das?«
»Letztes Jahr, Sir. Nach der Schule und vor meiner Verpflichtung.«