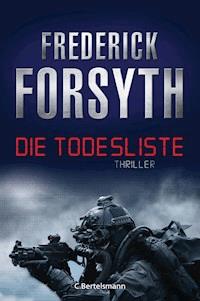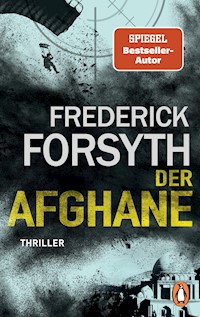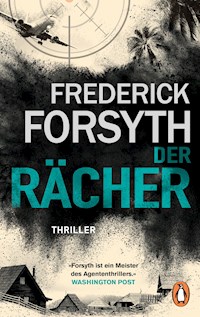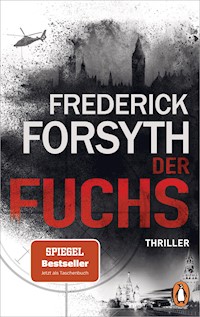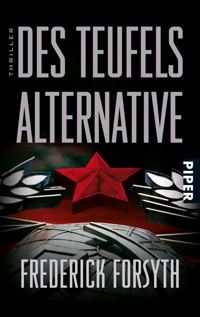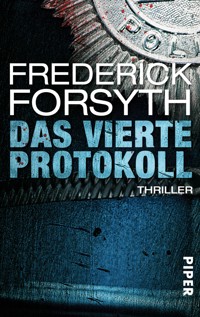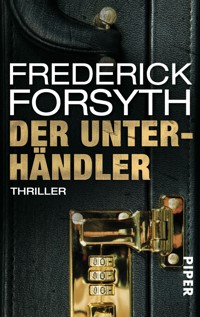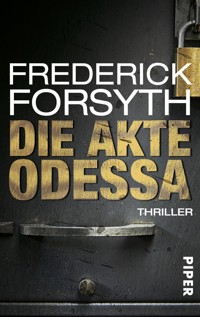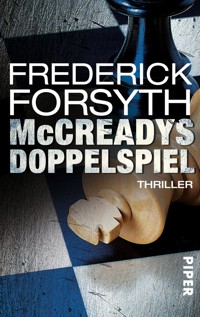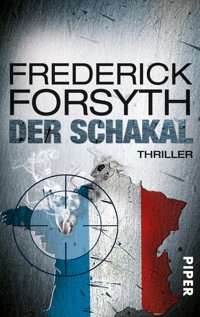
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle soll vor einem eiskalten Attentäter geschützt werden. Doch der Plan des Superkillers aus London, genannt der »Schakal« und angeheuert von der französischen Untergrundorganisation OAS, scheint perfekt zu sein. Die Jagd, die quer durch Europa führt, steigert sich zum atemberaubenden Duell zwischen dem französischen Polizeiapparat und dem eiskalten Profimörder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine Mutter
und meinen Vater
Übersetzung aus dem Englischen von Tom Knoth
ISBN 978-3-492-96048-9 © 1971 Frederick Forsyth Titel der englischen Originalausgabe: »The Day of the Jackal«, Hutchinson & Co. Ltd., London © der deutschsprachigen Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 1972 Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur Umschlagabbildung: Olga Nikonova / Shutterstock Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Erster Teil: Der Plan
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zweiter Teil: Die Jagd
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Dritter Teil: Das Ende
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Guide
Erster Teil
Der Plan
Erstes Kapitel
Es ist kalt um 6 Uhr 40 in der Frühe eines Pariser Märztages, und es scheint noch kälter zu sein, wenn zu dieser Zeit ein Mann von einem Exekutionskommando füsiliert werden soll.
Am 11. März 1963 stand zu jener Stunde ein Oberstleutnant der französischen Luftwaffe im Gefängnishof des Fort d’Ivry an einem in den Kies getriebenen Pfahl, hinter welchem man ihm die Hände zusammenband, und starrte mit langsam schwindendem Zweifel auf den Zug Infanteristen, der ihm gegenüber in zwanzig Meter Entfernung Aufstellung genommen hatte.
Schritte, unter denen der Kiesboden knirschte, brachten ein kaum merkliches Nachlassen der Spannung, als Oberstleutnant Jean-Marie Bastien-Thiry die Binde auf die Augen gelegt und ihnen das Licht für immer genommen wurde. Das Gemurmel des Priesters bildete den monotonen Kontrapunkt zum Klicken der zwanzig Gewehrschlösser, als die Soldaten ihre Karabiner durchluden und spannten.
Jenseits der Mauern sicherte sich ein stadteinwärts fahrender Berliet-Laster mit schmetterndem Hupsignal das Vorfahrtsrecht, als ein kleineres Fahrzeug seinen Weg kreuzen wollte. Die Hupe, die das vom Führer des Infanteriezugs gegebene »Legt an!«-Kommando übertönt hatte, verhallte in der Ferne. Als dann die Gewehrsalve krachte, löste Sie mit dem sekundenlangen Aufflattern eines himmelwärts gescheuchten Taubenschwarms im Weichbild der erwachenden Stadt kaum mehr als einen flüchtigen örtlichen Reflex aus. Und der Knall des Sekunden später abgegebenen Gnadenschusses wurde vom anschwellenden Lärm des Verkehrs, der von außerhalb der Mauern herüberdrang, vollends verschluckt.
Mit der Hinrichtung des Offiziers als des Chefs eines organisierten Geheimbundes ehemaliger Armeeangehöriger, die dem Präsidenten der Republik Frankreich nach dem Leben trachteten, sollte weiteren Anschlägen auf den Präsidenten ein Ende gemacht werden. Die Ironie des Schicksals wollte es jedoch, daß sie einen neuen Anfang setzte. Um aber davon zu berichten, muß zuvor erklärt werden, wie es dazu kam, daß an jenem frühen Märzmorgen im Hof des südöstlich von Paris gelegenen Militärgefängnisses ein von Schüssen durchsiebter Leichnam in den Fesseln, die ihn an den Pfahl banden, zusammensank …
Die Sonne war endlich hinter die Mauern des Palastes gesunken, und die länger werdenden Schatten, die jetzt über den Innenhof krochen, brachten eine willkommene Linderung. Am heißesten Tag des Jahres betrug die Temperatur in Paris um 19 Uhr noch dreiundzwanzig Grad Celsius. Überall in der vor Hitze verschmachtenden Stadt verstauten Familienväter ihre nörgelnden Ehefrauen und greinenden Kinder in Automobile und Zugabteile, um mit ihnen das Wochenende auf dem Land zu verbringen. Es war der 22. August 1962, der Tag, an dem der Präsident der Republik, Charles de Gaulle, auf Beschluß einer Handvoll Männer, die sich außerhalb der Stadtgrenzen bereithielten, sterben sollte.
Während die Bevölkerung der Métropole sich zur Flucht vor der Hitze in die an Flüssen und Stränden herrschende relative Kühle rüstete, wurde hinter der prächtigen Fassade des Elysée-Palastes die Kabinettsitzung fortgesetzt. Stoßstange an Stoßstange waren auf dem braunen Kies des jetzt in wohltuendem Schatten abkühlenden Hofes sechzehn Citroën-DS-Limousinen im Halbkreis aufgefahren.
Die Fahrer, die nahe der Innenhoffassade des Westflügels, dort, wohin der Schatten zuerst gefallen und wo es jetzt am kühlsten war, herumstanden, ergingen sich – nach der Art von Leuten, die ihre Arbeitstage größtenteils damit verbringen, auf einen Wink ihrer Herrschaft zu warten – in müßigen gegenseitigen Frotzeleien.
Das vage Murren über die ungewöhnlich lange Dauer der Kabinettsitzung hörte erst auf, als gegen 19 Uhr 30 auf der obersten der sechs zu den Spiegelglastüren führenden Treppenstufen ein mit Ketten und Medaillen behängter Diener erschien und dem Wachtposten ein Zeichen gab. Halbgerauchte Gauloises wurden von den Fahrern fallen gelassen und im Kies ausgetreten. Die Sicherungsbeamten und Wachtposten in ihren Schilderhäusern beiderseits der Einfahrt zum Hof erstarrten in militärischer Haltung, und das massive Eisengitter schwang auf.
Die Fahrer saßen schon am Steuer ihrer Limousinen, als die erste Gruppe von Ministern hinter den Spiegelglasscheiben erschien. Der Diener öffnete die Türen, die Mitglieder des Kabinetts wünschten einander ein angenehmes Wochenende und stiegen die Stufen hinab. Die Limousinen hielten nacheinander am Fuß der Treppe, der Diener öffnete den Schlag zum Fond und verbeugte sich, dann bestiegen die Minister ihre Wagen und fuhren an den salutierenden Posten der Garde Republicaine vorbei auf die rue Faubourg St-Honoré hinaus und davon.
Innerhalb von zehn Minuten waren alle fort, bis auf zwei langgestreckte Citroën DS 19. Beide fuhren jetzt langsam am Fuß der Treppe vor. Der erste, der den Stander des Präsidenten der Französischen Republik führte, wurde von François Marroux gesteuert, einem vom Trainings- und Ausbildungszentrum der Gendarmerie Nationale in Satory abkommandierten Polizeifahrer. Schweigsam wie immer, hatte er sich an den Scherzen der Ministerfahrer im Hof nicht beteiligt. Daß er de Gaulles ständiger Chauffeur geworden war, verdankte er seinen eiskalten Nerven und der Fähigkeit, sehr sicher und sehr schnell zu fahren. Außer Marroux saß niemand im Wagen. Den zweiten DS 19 fuhr ebenfalls ein Gendarm aus Satory.
Um 19 Uhr 45 tauchte eine weitere Gruppe hinter den Glastüren auf, und wiederum erstarrten die Männer auf dem Kiesboden in »Habt acht!«-Stellung. Wie üblich in dunkelgrauem doppelreihigem Anzug und dunkler Krawatte, erschien de Gaulle hinter den Spiegelglasscheiben. Mit altmodischer Höflichkeit geleitete er Mme. Yvonne de Gaulle zunächst durch die Türen und nahm dann ihren Arm, um sie die Stufen hinab zum wartenden Citroën zu führen. Am Wagen trennten sie sich, und die Gattin des Präsidenten bestieg den Fond des ersten Wagens durch dessen linke hintere Tür. Der General stieg von rechts dazu und setzte sich neben Mme. de Gaulle.
Ihr Schwiegersohn, Oberst Alain de Boissieu, zu der Zeit Stabschef der Panzer- und Kavallerieeinheiten der französischen Armee, überzeugte sich, daß beide Türen festgeschlossen waren, und nahm dann neben Marroux auf dem Beifahrersitz Platz.
In den zweiten Wagen stiegen zwei Männer aus der Gruppe von Beamten, die das Präsidentenehepaar die Treppe hinab begleitet hatte. Henri d’Jouder, der ungeschlachte Leibwächter vom Dienst, ein Kabyle aus Algerien, lockerte den Halfter des schweren Revolvers unter seiner linken Achselhöhle und lehnte sich in das Polster zurück. Von diesem Moment ab würde er seine Blicke unaufhörlich wandern lassen, weniger zu dem vorausfahrenden Wagen als vielmehr über das Pflaster und die Straßenecken, die sie passierten. Nach einer letzten Anweisung an einen der zurückbleibenden diensttuenden Sicherungsbeamten setzte sich der zweite Mann allein in den Fond. Es war Kommissar Jean Ducret, Chef der persönlichen Sicherungsgruppe des Präsidenten.
Zwei weißbehelmte Polizisten warfen ihre Motorräder an und fuhren, von der Innenhoffront des Westflügels herkommend, langsam aus dem Schatten heraus und auf das Portal zu. Drei Meter Abstand voneinander haltend, stoppten sie vor der Einfahrt und blickten zurück.
Marroux steuerte den ersten Citroën von der Treppe fort, bog in Richtung auf das Tor ein und hielt hinter den motorisierten Vorreitern. Der zweite Wagen folgte. Es war 19 Uhr 50. Wieder schwang das eiserne Gitter auf, und der kleine Konvoi brauste an den zu Ladestöcken erstarrenden Wachtposten vorüber in die rue Faubourg St-Honoré. Am Ende des Westflügels angelangt, bog er nach links in die Avenue Marigny ein.
Unter den Kastanienbäumen am Straßenrand saß ein junger Mann in weißem Sturzhelm auf einem Motorroller und wartete, bis der Konvoi vorbeigefahren war. Dann stieß er sich vom Bordstein ab und folgte ihm.
Für ein Wochenende im August war der Verkehr normal. Man hatte keine die Abfahrt des Präsidenten betreffende Vorwarnung gegeben. Lediglich das Heulen der Motorradsirenen machte die diensttuenden Verkehrspolizisten auf den herannahenden Konvoi aufmerksam, und nur unter beträchtlichem Aufwand an hektisch winkenden Gesten und schrillen Pfiffen auf ihren Trillerpfeifen gelang es ihnen, den Verkehr zu stoppen.
Auf der baumbeschatteten Avenue beschleunigte der Konvoi seine Geschwindigkeit und schoß auf die sonnenbeschienene Place Clemenceau hinaus, die er schnurstracks in Richtung auf den Pont Alexandre III überquerte. Im Windschatten der Regierungswagen fahrend, war es für den jungen Mann auf dem Motorroller nicht allzu schwer, sich an den Konvoi anzuhängen.
Hinter der Brücke folgte Marroux den motorisierten Polizisten in die Avenue du Maréchal Gallieni und von dort in den breiten Boulevard des Invalides. Der Fahrer des Motorrollers wußte nun, was er hatte wissen wollen: die Route, auf welcher der General Paris verlassen würde. An der Ecke der rue de Varenne nahm er das Gas weg und steuerte auf ein Café zu. Mit langen Schritten durchquerte er den Raum, in dessen hinterem Teil sich das Telephon befand, holte eine metallene Marke aus der Tasche, steckte sie in den Schlitz des Apparats und wählte eine Ortsnummer.
Im Pariser Vorort Meudon hatte Oberstleutnant Jean-Marie Bastien-Thiry auf den Anruf gewartet. Er war fünfunddreißig Jahre alt, im Luftfahrtministerium tätig, verheiratet und Vater dreier Kinder. Hinter der konventionellen Fassade seines Berufs- und Familienlebens nährte er eine tiefe Bitterkeit gegen Charles de Gaulle, der seiner Überzeugung nach Frankreich und die Männer, die ihm 1958 die Rückkehr an die Macht ermöglichten, durch die Preisgabe Algeriens an die algerischen Nationalisten schmählich verraten hatte.
Er persönlich hatte durch die Aufgabe Algeriens nichts verloren, und es waren keine persönlichen Beweggründe, von denen er sich leiten ließ. Er fühlte sich als Patriot und war überzeugt, seinem Land einen Dienst zu erweisen, indem er den Mann tötete, der es, wie er meinte, verraten hatte. Es gab Tausende und aber Tausende, die dachten wie er, aber nur wenige von ihnen zählten zu den Mitgliedern der geheimen Armeeorganisation, die sich verschworen hatten, de Gaulle zu beseitigen und seine Regierung zu stürzen. Bastien-Thiry war einer dieser Männer.
Er nippte an einem Glas Bier, als der Anruf kam. Der Kellner reichte ihm das Telephon herüber und ging dann zum anderen Ende der Theke, um den Fernseher leiser zu stellen. Bastien-Thiry lauschte ein paar Sekunden, flüsterte: »Sehr gut, danke«, in die Muschel und legte den Hörer auf.
Sein Bier hatte er schon bezahlt. Er verließ die Bar, schlenderte auf die Straße hinaus, schlug die zusammengefaltete Zeitung, die er bis dahin unter dem Arm getragen hatte, auf und blätterte demonstrativ zweimal um.
Auf der anderen Seite der Straße trat eine junge Frau hinter der zugezogenen Spitzengardine vom Fenster ihrer im ersten Stock gelegenen Wohnung zurück und sagte, indem sie sich den zwölf Männern zuwandte, die in dem Zimmer herumsaßen: »Er nimmt Route Nummer zwei.«
Fünf von den zwölf Männern waren noch ganz junge Burschen, Amateure im Handwerk des Tötens; sie hörten auf, ihre Finger zu kneten, und fuhren hoch. Die sieben anderen waren älter und weniger nervös. Der Ranghöchste unter ihnen, Alain Bougrenet de la Tocnaye, fünfunddreißig, verheiratet und Vater von zwei Kindern, ein aus einer Familie adliger Großgrundbesitzer stammender Mann der extremen Rechten, fungierte bei dem von Bastien-Thiry geleiteten Anschlag als verantwortlicher Unterführer.
Der gefährlichste war der neununddreißigjährige Georges Watin, ein breitschultriger OAS-Fanatiker mit eckiger Kinnlade. Ehedem landwirtschaftlicher Berater in Algerien, war er nach zwei Jahren als einer der schießwütigsten Killer der OAS wieder aufgetaucht. Einer alten Verwundung wegen wurde er »Das Hinkebein« genannt.
Als die junge Frau die Nachricht bekanntgab, stürmten die zwölf Männer über die Hintertreppe und den Hof in eine Seitenstraße, auf der sechs teils gestohlene, teils gemietete Wagen geparkt waren. Es war 19 Uhr 55.
Bastien-Thiry hatte Tage gebraucht, um den geeigneten Tatort für den Mordanschlag zu bestimmen, Geschwindigkeit, Entfernung und Abstand der heranbrausenden Wagen sowie die Feuerkraft zu errechnen, die erforderlich war, um sie zu stoppen. Schließlich hatte er sich für die Avenue de la Liberation entschieden, eine schnurgerade, lange Ausfallstraße, die zur großen Kreuzung von Petit-Clamart führt.
Der Plan sah vor, daß die mit Karabinern ausgerüsteten Scharfschützen der ersten Gruppe etwa zweihundert Meter vor der Kreuzung das Feuer auf den Wagen des Präsidenten eröffnen sollten. Sie würden hinter einem am Straßenrand geparkten Lieferwagen in Deckung liegen und schon aus einem extrem flachen Schußwinkel heraus auf die herannahenden Fahrzeuge zu feuern beginnen, um ein Maximum an Treffern zu gewährleisten. Nach Bastien-Thirys Berechnung mußte der erste Citroën zu dem Zeitpunkt, da er mit dem geparkten Lieferwagen auf gleicher Höhe war, bereits von hundertfünfzig Geschossen durchlöchert sein. Sobald das Automobil des Präsidenten gestoppt war, würde der zweite OAS-Wagen, aus einer Seitenstraße kommend, heranpreschen und den Begleitwagen der Polizei aus kürzester Distanz zusammenschießen. Beide Gruppen würden nur wenige Sekunden benötigen, um den Insassen des Präsidentenwagens den Rest zu geben, und dann zu den drei in einer anderen Seitenstraße zur Flucht bereitgestellten Automobilen rennen. Bastien-Thiry, der dreizehnte Mann der Gruppe, würde seinerseits auf Vorposten als Späher fungieren.
Um 20 Uhr 05 hatten die Trupps Stellung bezogen. Die zusammengefaltete Zeitung unter dem Arm, stand Bastien-Thiry an einer vom Hinterhalt etwa hundert Meter in Richtung Paris entfernten Bushaltestelle. Durch Winken mit der Zeitung würde er Serge Bernier, der als Führer des ersten Kommandos hinter dem geparkten Lieferwagen stand, das Zeichen geben, das dann von diesem an die ihm zu Füßen im Gras liegenden Scharfschützen weitergegeben wurde.
Bougrenet de la Tocnaye würde, das »Hinkebein« Watin mit der Maschinenpistole im Anschlag neben sich, am Steuer des Wagens sitzen, der die Sicherheitspolizei auszuschalten hatte.
Als am Straßenrand in Petit-Clamart die Schußwaffen entsichert wurden, hatte General de Gaulles Konvoi den dichteren Straßenverkehr von Paris hinter sich gelassen und die weniger befahrenen Avenuen der Vorstädte erreicht. Hier beschleunigte er seine Geschwindigkeit auf hundert Stundenkilometer. François Marroux, der die gereizte Unruhe des hinter ihm sitzenden Generals spürte, warf einen Blick auf seine Armbanduhr und erhöhte, sobald sich der Straßenverkehr weiter gelichtet hatte, das Tempo abermals. Die beiden motorisierten Vorreiter fielen zurück, um sich an den Schluß des Konvois zu setzen. De Gaulle schätzte derart ostentative Ankündigungen ohnehin nicht und verzichtete auf sie, wann immer er konnte. In dieser Formation erreichte der Konvoi die Avenue de la Division Leclerc m Petit-Clamart. Es war 20 Uhr 17.
Anderthalb Kilometer voraus sollte Bastien-Thiry die Folgen seines Irrtums, der ihm übrigens, bis ihn die Polizei Monate später in der Todeszelle darüber aufklärte, verborgen blieb, in wenigen Minuten zu spüren bekommen. Beim Aufstellen des Zeitplans für den Anschlag hatte er anhand eines Kalenders ermittelt, daß am 22. August die Dämmerung um 20 Uhr 35 hereinbrechen würde – immer noch spät genug selbst dann, wenn de Gaulle sich seinerseits verspäten sollte, was in der Tat der Fall war. Aber der Kalender, den der Luftwaffen-Oberstleutnant zu Rate gezogen hatte, bezog sich auf das Jahr 1961. Am 22. August 1962 brach die Dämmerung um 20 Uhr 10 ein. Dieser Unterschied von fünfundzwanzig Minuten sollte für die Geschichte Frankreichs entscheidend sein.
Um 20 Uhr 18 machte Bastien-Thiry den mit einer Geschwindigkeit von über hundert Stundenkilometer auf der Avenue de la Liberation heranbrausenden Konvoi aus. Aufgeregt winkte er mit seiner Zeitung.
Hundert Meter weiter spähte Bernier von der anderen Straßenseite aus wütend zu der in der sinkenden Dämmerung nur undeutlich erkennbaren Gestalt an der Bushaltestelle hinüber. »Hat der Oberstleutnant schon mit der Zeitung gewinkt?« fragte er, ohne von irgendeinem seiner Männer eine Antwort zu erwarten. Er hatte die Frage kaum ausgesprochen, als er in Höhe der Bushaltestelle das Haifischmaul des Präsidentenwagens in Sicht kommen sah.
»Feuern!« schrie er den mit angeschlagenen Karabinern rechts und links vor ihm im Gras liegenden Schützen zu. Sie eröffneten das Feuer, als der Konvoi praktisch schon auf gleicher Höhe mit ihnen war, und mußten mit einem Vorhalt von neunzig Grad auf ein bewegtes Ziel schießen, das sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als hundert Kilometer pro Stunde passierte.
Daß der Wagen dennoch von zwölf Geschossen durchlöchert wurde, zeugte von der eminenten Treffsicherheit der Scharfschützen. Die meisten Kugeln durchschlugen die Rückfront des Citroën. Zwei Reifen wurden durch Feuereinwirkung zerfetzt, und obgleich sie mit Schläuchen gefüllt waren, die sich selbsttätig abdichteten, bewirkte der plötzliche Druckabfall, daß der Fahrer über den ins Schleudern geratenen Wagen vorübergehend die Kontrolle verlor. Das war der Augenblick, in dem Marroux’ Fahrkunst de Gaulle das Leben rettete.
Während der beste Scharfschütze, Ex-Legionär Varga, die Reifen durchsiebte, leerten die anderen, auf das sich rasch entfernende Rückfenster des Wagens haltend, ihre Magazine. Mehrere Geschosse durchschlugen die Karosserie, und eines zerschmetterte das Rückfenster, wobei es die Nase des Präsidenten nur um wenige Zentimeter verfehlte.
Der neben dem Fahrer sitzende Oberst de Boissieu drehte sich zu seinen Schwiegereltern um und schrie: »Deckung!«
Mme. de Gaulle barg den Kopf im Schoß ihres Gatten. Der General machte seinem Unmut über den Zwischenfall mit einem ungehaltenen »Was, schon wieder?« Luft und wandte sich zum Rückfenster, um hinauszublicken.
Marroux umklammerte das bebende Lenkrad und drehte es, wobei er langsam den Gashebel durchtrat, sacht in die Richtung der Schleuderbewegung. Nach einem vorübergehenden Geschwindigkeitsabfall zog der Citroën rasch an und schoß wieder vorwärts, auf die Kreuzung mit der Avenue du Bois zu, der Nebenstraße, auf der das zweite Kommando der OAS-Männer lauerte. Unmittelbar hinter dem Citroën folgte der von keinem einzigen Schuß getroffene Sicherungswagen.
Die hohe Geschwindigkeit der beiden heranpreschenden Automobile stellte den mit laufendem Motor in der Avenue du Bois wartenden Bougrenet de la Tocnaye vor die Wahl, sie entweder abzufangen und dabei, indem er sich von den aufeinanderprallenden Metallteilen in Stücke reißen ließ, Selbstmord zu begehen, oder den Gang um Bruchteile von Sekunden zu spät einzulegen. Er entschied sich für letzteres. Und so war es, als er aus der Seitenstraße hinausschoß und in die Fahrtrichtung des Konvois einschwenkte, nicht de Gaulles Wagen, mit dem er in gleicher Höhe fuhr, sondern der mit dem Scharfschützen d’Jouder und Kommissar Ducret besetzte Sicherungswagen.
Den Oberkörper bis zur Hüfte aus dem rechten Seitenfenster gelehnt, richtete Watin seine Maschinenpistole auf das Rückfenster des ihm unmittelbar vorausfahrenden DS 19 und schoß das Magazin leer. Hinter der zersplitterten Glasscheibe war das hochmütige Profil des Generals deutlich erkennbar.
»Warum schießen diese Idioten nicht zurück?« fragte de Gaulle vorwurfsvoll.
Aus dem zwischen seinem und dem Wagen der OAS-Killer bestehenden Abstand von drei Metern versuchte d’Jouder zum Schuß zu kommen, aber der Polizist auf dem Motorrad nahm ihm die Sicht. Ducret befahl dem Fahrer, sich an den Wagen des Präsidenten zu hängen, und in der nächsten Sekunde hatten sie die OAS hinter sich gelassen. Die beiden motorisierten Vorreiter, von denen der eine fast aus dem Sattel gehoben worden wäre, als de la Tocnayes Wagen plötzlich aus der Seitenstraße herausgeschossen kam, schlossen jetzt rasch auf und nahmen wieder ihre vormalige Position ein. In dieser Formation durchraste der Konvoi den Kreisverkehr der Kreuzung von Petit-Clamart und setzte seinen Weg in Richtung Villacoublay fort.
Zu gegenseitigen Beschuldigungen hatten die am Tatort verbliebenen Männer der OAS keine Zeit. Das mußte auf später verschoben werden. Sie ließen die drei beim Überfall benutzten Fahrzeuge zurück, sprangen in ihre bereitgestellten Fluchtwagen und verschwanden in der hereinbrechenden Dämmerung. Über sein im Citroën eingebautes’ Sprechfunkgerät rief Ducret Villacoublay und berichtete kurz, was geschehen war. Als der Konvoi zehn Minuten später die Ortschaft erreicht hatte, bestand de Gaulle darauf, sogleich zum Flugplatz, wo der Hubschrauber wartete, weitergefahren zu werden.
Dort eingetroffen, wurde der Wagen von Offizieren und Honoratioren umringt, welche die Türen aufrissen, um der sichtlich mitgenommenen Mme. de Gaulle beim Aussteigen behilflich zu sein. Die Glassplitter von den Aufschlägen seines Jacketts abschüttelnd, entstieg der General dem zerschossenen Fahrzeug auf der anderen Seite. Er überhörte die angstvollen Beschwörungen der ihn umdrängenden Offiziere geflissentlich, umschritt den Wagen und bot seiner Frau den Arm.
»Kommen Sie, meine Liebe«, sagte er, »wir fliegen heim.«
Abschließend gab er den Mitgliedern des Luftwaffenstabs seine Meinung über die OAS kund: »Nicht einmal richtig schießen können sie.« Damit wandte er sich um, half seiner Frau beim Besteigen des Hubschraubers und nahm neben ihr Platz.
D’Jouder stieg hinzu, und der Hubschrauber, mit dem der General und seine Gattin für ein Wochenende aufs Land flogen, hob ab. Auf der Landebahn war François Marroux mit aschfahlem Gesicht am Steuer des Citroën sitzen geblieben. Aus dem Reifen sowohl des rechten Vorder- als auch des rechten Hinterrads war die restliche Luft entwichen, und der DS fuhr auf Felgen. Ducret beglückwünschte Maroux mit ein paar gemurmelten Worten und machte sich daran, Ordnung zu schaffen.
Während die Journalisten in aller Welt Spekulationen über den Mordanschlag anstellten und ihre Kolumnen mangels Fakten mit unverbindlichen Vermutungen und persönlichen Betrachtungen füllten, startete die Surete Nationale, unterstützt sowohl vom Geheimdienst als auch von der Gendarmerie, die umfassendste Polizeiaktion der französischen Geschichte. Sie sollte sich schon bald zur größten Menschenjagd entwickeln, die das Land je erlebt hatte, und nur noch von der Großfahndung nach einem anderen Attentäter übertroffen werden, der in den Polizeiakten noch heute unter seinem Decknamen »Der Schakal« geführt wird, weil sein bürgerlicher Name unbekannt geblieben und seine Lebensgeschichte nie veröffentlicht worden ist.
Ein erster Erfolg konnte am 3. September verzeichnet werden. Wie so oft war es eine routinemäßig vorgenommene Ausweiskontrolle, die auf eine wichtige Spur führte. Eine Polizeistreife hielt außerhalb der südlich von Lyon gelegenen Stadt Valence auf der von Paris nach Marseille führenden Nationalstraße einen Privatwagen mit vier Insassen an. Sie hatte an diesem Tag bereits Hunderte gestoppt, um Ausweise zu kontrollieren. Einer der vier Männer hatte keine Papiere bei sich. Er behauptete, sie verloren zu haben. Daraufhin wurde er mitsamt den drei anderen zu einem Routineverhör nach Valence gebracht.
Dort stellte sich rasch heraus, daß die übrigen drei Insassen, abgesehen davon, daß sie ihn ein Stück mitgenommen hatten, mit dem vierten nichts zu tun hatten. Man ließ sie frei. Von dem vierten Mann wurden lediglich Fingerabdrücke angefertigt und nach Paris geschickt, weil man seine Identität überprüfen wollte. Zwölf Stunden später traf die Auskunft ein: Die Fingerabdrücke waren die eines 22jährigen fahnenflüchtigen Fremdenlegionärs, aber der Name, den er angegeben hatte – Pierre-Denis Magade –, stimmte.
Magade wurde nach Lyon in die Zentrale des Service Regional der Police Judiciaire gebracht. Während er in einem Vorzimmer auf seine Vernehmung wartete, fragte ihn einer seiner Bewacher scherzhaft: »Na, und in Petit-Clamart – wie hat sich das abgespielt?«
Magade zuckte hilflos mit den Achseln. »Also gut«, sagte er, »was wollen Sie wissen?«
Acht Stunden lang lauschten Polizeibeamte gebannt und kratzten emsige Stenographenfedern über Stöße von Papier, während Magade »sang«. Als er endete, hatte er die Namen jedes einzelnen der am Attentat von Petit-Clamart Beteiligten sowie die neun weiteren Mitwisser genannt, die in der Planungsphase der Verschwörung und bei der Beschaffung von Waffen, Gerät und Fahrzeugen kleinere Rollen gespielt hatten – zweiundzwanzig Namen insgesamt. Die Jagd begann, und diesmal wußte die Polizei, wen sie suchte.
Nur ein einziger Mittäter entkam ihr und wurde bis zum heutigen Tag nicht gefaßt: Georges Watin. Dem Vernehmen nach soll er, wie die meisten Ex-Bosse der OAS, unter ehemals franko-algerischen Siedlern in Spanien leben.
Im Dezember waren Ermittlung und Anklagevorbereitung gegen Bastien-Thiry, Bougrenet de la Tocnaye und die anderen Verschwörer abgeschlossen, und im Januar 1963 wurde die Gruppe vor Gericht gestellt.
Während man den beiden Hauptangeklagten und ihren Mittätern den Prozeß machte, sammelte die OAS alle ihr verfügbaren Kräfte zu einer neuerlichen Großoffensive gegen das gaullistische Regime, das diese von seinen Geheimdiensten mit unbarmherzigen Gegenangriffen beantworten ließ. Hinter den gefälligen äußeren Formen des pariserischen Lebensstils wurde unter dem Firnis von Kultur und Zivilisation im Untergrund ein grausamer und erbitterter Krieg geführt.
Die offizielle Bezeichnung für die Abteilung V besteht aus einem einzigen Wort, das ihre Tätigkeit gleichwohl treffend wiedergibt, und lautet: Aktion. Die Abteilung ist nahe der Porte des Lilas in einem unauffälligen, gleich hinter dem Boulevard Mortier im Pariser Nordosten gelegenen Gebäudekomplex untergebracht, von dem aus die hundert eisenharten Burschen des Aktionsdienstes in den Kampf geschickt werden. Diese Männer, die in ihrer Mehrzahl korsischer Herkunft sind, verkörpern einen Typus, der James Bond ähnlicher ist als alles, was die Wirklichkeit bislang in Fleisch und Blut hervorgebracht hat. Sie waren zunächst durch spezielle Trainingsmethoden in Spitzenkondition gebracht und dann zur Polizeischule nach Satory versetzt worden, wo man sie in einem vom regulären Schulungsbetrieb hermetisch abgeschlossenen Sonderlehrgang mit allen bis dato bekannten Formen der Zerstörung und Vernichtung vertraut machte. Sie wurden Experten im Kampf mit leichten Waffen, im waffenlosen Zweikampf, in Judo und Karate. Sie absolvierten Spezialkurse in funktechnischer Kommunikation, in Demolierung und Sabotage, Menschenraub, Brandstiftung und Mord sowie Verhörtechniken mit und ohne Anwendung von Foltermethoden.
Einige von ihnen sprachen nur Französisch, andere beherrschten mehrere Fremdsprachen und kannten sich in allen Hauptstädten der Welt aus, als seien sie dort zu Hause. Sie waren berechtigt, in Ausübung ihres Dienstes zu töten, und machten nicht selten von diesem Recht Gebrauch.
Als die Aktionen der OAS zusehends bedenkenloser und brutaler wurden, entschloß sich General Guibaud, der Leiter des SDECE, seine Männer loszuketten und auf die OAS zu hetzen. Einige von ihnen traten der Geheimorganisation bei und gelangten bis in deren höchste Gremien. Dort beschränkte sich ihre Tätigkeit auf die Übermittlung von Informationen, auf denen dann die gezielten Aktionen ihrer außerhalb der OAS verbliebenen Kollegen basierten. So wurden viele OAS-Kuriere, die in geheimer Mission nach Frankreich oder in Länder entsandt worden waren, die mit Frankreich Auslieferungsabkommen geschlossen hatten, aufgrund von Informationen verhaftet, welche die in die OAS eingeschleusten Männer des Aktionsdienstes geliefert hatten. In anderen Fällen wurden steckbrieflich gesuchte Männer, die sich nicht nach Frankreich locken ließen, außerhalb des Landes brutal ermordet. Viele Angehörige verschwundener OAS-Mitglieder sind nach wie vor überzeugt, daß der Aktionsdienst diese Männer liquidiert hat.
Nicht daß die OAS ihrerseits Lektionen in Gewalttätigkeit nötig gehabt hätte. Ihre Mitglieder haßten die ihrer Untergrundtätigkeit wegen »les barbouzes« – die »Bärtigen« – genannten Männer des Aktionsdienstes mehr als jeden Polizeibeamten. In den letzten Tagen des zwischen OAS und gaullistischen Behörden ausgetragenen Kampfes um die Macht in Algerien gerieten sieben barbouzes lebend in die Hände der Geheimorganisation. Ihre Leichen wurden später, von Balkonen und Laternenpfählen baumelnd, ohne Ohren und Nasen aufgefunden. In dieser Weise ging der Untergrundkrieg weiter, und die ganze Wahrheit darüber, wer von wem in wessen Keller zu Tode gefoltert wurde, wird nie ans Licht kommen.
Die außerhalb der OAS verbliebenen barbouzes hielten sich dem SDECE ständig zur Verfügung. Einige von ihnen, die vor ihrer Anwerbung schwere Jungens gewesen waren, hatten ihre alten Kontakte zur Unterwelt niemals abreißen lassen und konnten auf diese Weise so manches Mal, wenn es im Auftrag der Regierung eine besonders schmutzige Arbeit zu verrichten galt, die Hilfe ihrer alten Freunde in der Unterwelt in Anspruch nehmen. Diese Praktiken waren es vor allem, die den in Frankreich kursierenden Gerüchten von einer Jacques Foucard, Präsident de Gaulles rechter Hand, unterstehenden »Parallel«-Polizei Nahrung gaben. In Wirklichkeit existierte eine solche »Parallel«-Polizei nicht; die ihr zugeschriebene Tätigkeit blieb den Gorillas des Aktionsdienstes und den zeitweilig angeheuerten Gangsterbossen aus dem milieu vorbehalten.
Auf Vendetten haben sich die Korsen, die sowohl die Pariser als auch die Marseiller Unterwelt kontrollierten, von jeher verstanden, und nach der Ermordung der sieben barbouzes in Algerien begannen sie eine Vendetta gegen die OAS. In gleicher Weise, wie die korsische Unterwelt 1944 den Alliierten bei ihrer Landung in Frankreich Hilfsdienste leistete (wahrlich nicht zu ihrem Schaden übrigens – bald darauf nahm sie das organisierte Laster an der Côte d’Azur weitgehend in eigene Regie), kämpften die Korsen in den frühen sechziger Jahren in ihrer Vendetta gegen die OAS wiederum für Frankreich. Viele OAS-Männer waren pieds noirs – in Algerien geborene französische Siedler – und den Korsen vom Typ her sehr ähnlich, und zeitweilig steigerte sich der Krieg zum Brudermord.
Während die Verhandlung gegen Bastien-Thiry und seine Kameraden ihren Fortgang nahm, eskalierte auch die Kampagne der OAS. Ihr Führer war Oberst Antoine Argoud, der hinter den Kulissen schon als eigentlicher Anstifter der Verschwörung von Petit-Clarnart gewirkt hatte. Argoud verfügte über einen geschulten Intellekt und dynamische Energie; er war Absolvent der zu den besten Hochschulen Frankreichs zählenden Ecole Polytechnique und hatte unter de Gaulle als Leutnant für die Befreiung Frankreichs von den Nazis gekämpft. Später befehligte er ein Kavallerieregiment in Algerien. Als hervorragender, wenngleich unbarmherziger Soldat war der kleine, drahtige Mann bereits 1962 zum Operationschef der exilierten OAS avanciert.
Erfahren in der Technik psychologischer Kriegführung, hatte er sogleich erkannt, daß der Kampf gegen das gaullistische Frankreich auf allen Ebenen, mit Terror, Diplomatie und unter Anwendung wirksamer Public-Relations-Methoden, aufgenommen werden mußte. Es entsprach diesem Konzept, daß er eine Serie von Interviews plante, die der ehemalige französische Außenminister Georges Bidault als Vorsitzender des den politischen Flügel der OAS repräsentierenden Nationalen Widerstandsrates westeuropäischen Zeitungen und Fernsehstationen gewähren sollte, um der Weltöffentlichkeit die Gründe für die unversöhnliche Gegnerschaft der OAS zum gaullistischen Regime in »würdiger« Form darzulegen.
Auch hierbei kam Aigoud die ungewöhnliche Intelligenz zugute, die ihn einst zum jüngsten Obersten der französischen Armee werden und jetzt als den gefährlichsten Mann der OAS gelten ließ. Er organisierte für Bidault eine Reihe von Interviews mit Zeitungs-, Rundfunk- und Fernsehjournalisten, bei denen der alte Politiker die weniger ruhmreichen Aktionen der OAS zu bemänteln oder herunterzuspielen verstand. Der offenkundige Erfolg der von Argoud initiierten Propagandaaktion Bidaults beunruhigte die französische Regierung nicht weniger als die terroristische Taktik und die Welle der in Paris und überall in Frankreich in Kinos und Cafés explodierenden Plastikbomben.
Am 14. Februar wurde dann ein weiteres Komplott zur Ermordung General de Gaulles aufgedeckt. Für den darauffolgenden Tag war ein Vortrag des Präsidenten in der Ecole Militaire auf den Champs de Mars angesetzt gewesen. Der Plan sah vor, daß de Gaulle beim Betreten des Saales vom Dach des angrenzenden Gebäudes aus hinterrücks niedergeschossen werden sollte.
Jean Bichon, einem Hauptmann der Artillerie namens Robert Poinard und Mme. Paule Rousselet de Liffiac, einer Englischlehrerin an der Militärakademie, wurde später wegen des geplanten Attentats der Prozeß gemacht. Der Mordschütze hätte Georges Watin sein sollen, aber das »Hinkebein« entkam wiederum. In Poinards Wohnung fand man einen Karabiner mit Zielfernrohr, und die drei Verschwörer wurden verhaftet. In der Verhandlung wurde erklärt, daß Feldwebelleutnant Marius Tho, mit dem sie darüber beratschlagt hatten, wie Watin mit seinem Gewehr unbemerkt in die Akademie geschmuggelt werden könne, schnurstracks zur Polizei gegangen war General de Gaulle nahm wie vorgesehen an der militärischen Veranstaltung teil, machte aber – wenngleich nur ungern – die Konzession, in einem gepanzerten Wagen vorzufahren.
Als Anschlag war das Ganze unglaublich dilettantisch geplant gewesen; aber es hatte de Gaulle doch außerordentlich verstimmt. Am Tag darauf bestellte er Innenminister Rogen Frey zu sich, schlug mit der Faust auf den Tisch und machte Frey als dem für die nationale Sicherheit verantwortlichen Minister unmißverständlich klar, daß er die fortgesetzten Anschläge nunmehr satt habe.
Man beschloß, an einigen der OAS-Verschwörer zur Abschreckung der anderen ein Beispiel zu statuieren. Über den Ausgang des Verfahrens gegen Bastien-Thiry, das vor dem Obersten Militärgerichtshof verhandelt wurde, hatte Frey keinerlei Zweifel, denn der Angeklagte war seinerseits bemüht, eingehend darzulegen, aus welchen Gründen er Charles de Gaulles Beseitigung als unerläßlich erachtete. Was dennoch not tat, war eine Maßnahme, deren abschreckende Wirkung stärker und unmittelbarer beeindruckte als Gerichtsurteile.
Am 22. Februar landete die Kopie eines Memorandums, das der Direktor der Abteilung II des SDECE (Spionageabwehr/Innere Sicherheit) dem Innenminister zugeleitet hatte, auf dem Schreibtisch des Aktionsdienstchefs. Der Inhalt sei hier auszugsweise wiedergegeben:
»Es ist uns gelungen, den Aufenthaltsort des ehemaligen Obersten der französischen Armee, Antoine Argoud, eines der Haupträdelsführer der subversiven Bewegung, ausfindig zu machen. Er ist nach Westdeutschland entflohen, wo er, den Informationen unseres dortigen Abwehrdienstes zufolge, einige Tage zu verbleiben beabsichtigt …
In Anbetracht dieses Umstandes sollte es möglich sein, Argoud zu stellen und gegebenenfalls zu ergreifen. Da der an die zuständigen westdeutschen Sicherheitsbehörden gestellte Antrag unseres Spionageabwehrdienstes abgelehnt worden ist und die genannten Behörden jetzt annehmen, daß unsere Agenten Argoud und anderen OAS-Verschwörern auf der Spur sind, müßte das Unternehmen, soweit es die Person Argouds betrifft, mit blitzartiger Schnelligkeit und unter äußerster Geheimhaltung ausgeführt werden.«
Die Aufgabe wurde dem Aktionsdienst übertragen.
Am 25. Februar nachmittags traf Argoud, von Rom kommend, wo er mit anderen OAS-Führern zu einer Besprechung zusammengetroffen war, wieder in München ein. Anstatt sich sogleich in die von ihm in der Unertlstraße gemietete Wohnung zu begeben, fuhr er im Taxi zum Hotel Eden-Wolff, wo er offenbar für eine geplante Konferenz ein Zimmer reserviert hatte.
Zu der Konferenz ist er nie erschienen. In der Hotelhalle traten zwei Männer auf ihn zu, die ihn in akzentfreiem Deutsch ansprachen. Argoud, der die beiden offenbar für deutsche Kriminalbeamte hielt, griff in seine Brusttasche, um seinen Paß hervorzuziehen.
Er fühlte, wie seine Arme mit schraubstockartigem Griff gepackt wurden, während seine Füße sich vom Boden hoben. Man schleifte ihn zu einem wartenden Wäschereiauto hinaus. Er versuchte zum Schlag auszuholen und wurde von einem Sturzbach französischer Flüche überschüttet. Eine harte Faust traf seine Nase, eine andere schlug ihm in die Magengrube, ein Finger tastete nach dem neuralgischen Punkt unter seinem Ohr, und sein Bewußtsein erlosch wie ein Licht.
Vierundzwanzig Stunden später klingelte in der Brigade Criminelle der Police judiciaire am Quai des Orfevres Nr. 36 in Paris das Telephon. Eine heisere Stimme, die behauptete, im Auftrag der OAS zu sprechen, erklärte dem Sergeanten, der den Anruf entgegennahm, Antoine Argoud befände sich, »säuberlich verschnürt«, in einem hinter dem PJ-Gebäude geparkten Lieferwagen. Wenige Minuten später wurde die Tür des Lieferwagens aufgerissen, und vor den Augen der staunend im Halbkreis versammelten Polizeibeamten taumelte Argoud heraus.
Seine Augen, die vierundzwanzig Stunden lang verbunden gewesen waren, vermochten nichts zu erkennen. Argoud mußte gestützt werden, um nicht zusammenzusinken. Sein Gesicht war mit getrocknetem Blut bedeckt, das von dem Faustschlag auf die Nase herrührte; und seine Mundhöhle schmerzte von dem Knebel, den die Polizeibeamten daraus entfernten. Befragt, ob er Oberst Antoine Argoud sei, flüsterte er tonlos: »Ja.« Auf bis heute nichtgeklärte Weise hatte ihn der Aktionsdienst in der vorhergegangenen Nacht über die Grenze geschafft, und der anonyme Anruf bei der Polizei wegen des auf ihrem eigenen Parkplatz für sie hinterlegten »Pakets« war nur ein für die vom Aktionsdienst bevorzugte Art von Humor kennzeichnender Scherz gewesen.
Eines aber hatte der Aktionsdienst nicht bedacht: die Ausschaltung Argouds wirkte sich auf die OAS zwar ungemein demoralisierend aus, zugleich aber hatte sie zur Folge, daß nun Argouds schattenhafter Stellvertreter, der wenig bekannte, aber nicht minder intelligente Oberstleutnant Marc Rodin, die Leitung der auf die Beseitigung de Gaulles abzielenden Operationen übernahm. Und das sollte sich für die Regierung als ein schlechter Tausch erweisen.
Am 4. März verkündete der Oberste Militärgerichtshof sein Urteil über Jean-Marie Bastien-Thiry. Er und zwei andere Angeklagte wurden zum Tode verurteilt, desgleichen drei weitere Mittäter – unter ihnen das »Hinkebein« Watin –, die flüchtig waren.
Am 8. März lauschte General de Gaulle drei Stunden lang schweigend den von den Anwälten der Verurteilten vorgebrachten Gnadengesuchen. Zwei der Todesurteile verwandelte er in lebenslängliches Zuchthaus, aber im Falle Bastien-Thirys blieb es bei der erkannten Strafe.
Noch in der Nacht wurde der Oberstleutnant der Luftwaffe von seinem Anwalt über die Entscheidung des Präsidenten unterrichtet. »Das Datum ist auf den 11. März festgesetzt«, sagte der Anwalt seinem Klienten, und als dieser weiterhin ungläubig lächelte, platzte es aus ihm heraus: »Man wird Sie erschießen!«
Bastien-Thiry schüttelte lächelnd den Kopf.
»Sie verstehen das nicht«, sagte er dem Anwalt: »Kein französisches Erschießungskommando wird seine Karabiner auf mich in Anschlag bringen.«
Er täuschte sich. Die Hinrichtung wurde in den 8-Uhr-Nachrichten über Radio Europa Eins in französischer Sprache bekanntgegeben. In den meisten europäischen Ländern konnte die Meldung gehört werden. In einem kleinen Hotelzimmer in Österreich setzte sie eine Kette von Überlegungen und Aktionen in Gang, die General de Gaulle in größere Lebensgefahr bringen sollte als je zuvor in seiner gesamten militärischen und politischen Laufbahn.
Zweites Kapitel
Marc Rodin knipste sein Transistorradio aus und erhob sich vom Tisch, auf dem das Frühstück fast unberührt geblieben war. Er ging zum Fenster hinüber, zündete sich eine weitere Zigarette an und starrte auf die Landschaft hinaus. Der spät einsetzende Frühling hatte die Schneedecke noch nicht aufzutauen vermocht.
»Hunde.« Er stieß das Wort leise und voller Haß aus. Rodin war in jeder Weise das völlige Gegenteil seines Vorgängers. Hochgewachsen und mager, mit einem vom Haß ausgezehrten, totenähnlichen Gesicht, pflegte er seine Gefühlsregungen für gewöhnlich hinter der Maske einer ganz ungallischen Kälte zu verbergen. Ihm hatten die Tore der Ecole Polytechnique, deren Absolvierung seiner Beförderung dienlich gewesen wäre, nicht offengestanden. Der Sohn eines Schusters war noch keine Zwanzig gewesen, als er in den Tagen, da die Deutschen Frankreich überrannten, in einem Fischerboot nach England entkam, um sich dort als einfacher Soldat freiwillig zum Dienst unter dem Zeichen des Lothringer Kreuzes zu melden.
Die Beförderung zum Sergeanten und später zum Feldwebelleutnant hatte er sich in den blutigen Schlachten von Nordafrika unter Koenig und in der Normandie unter Leclerc verdient. Die Offizierslitzen, die er nach Herkunft und Erziehung nie erhalten hätte, verdankte er seiner im Kampf um Paris bewiesenen Tapferkeit vor dem Feind, und nach dem Krieg hatte er vor der Wahl gestanden, in das Zivilleben zurückzukehren oder in der Armee zu verbleiben.
Aber auf welchen Beruf hätte er zurückgreifen sollen? Er verstand sich auf nichts anderes als das Schusterhandwerk, das er von seinem Vater erlernt hatte; zudem erkannte er, daß die werktätige Klasse seines Landes von den Kommunisten, die bereits die Résistance und die innerfranzösische Bewegung des Freien Frankreich kontrollierten, weitgehend beherrscht wurde. Er blieb daher in der Armee, um in den folgenden Jahren als aus dem Mannschaftsstand hervorgegangener Offizier eine neue Generation gebildeter Jungen die Kriegsschulen absolvieren und sich die gleichen Offizierstressen beim theoretischen Unterricht im Klassenzimmer verdienen zu sehen, für die er hatte Blut und Wasser schwitzen müssen. Daß sie rascher als er befördert und ihm auch sonst vorgezogen wurden, verbitterte ihn.
Ihm blieb nur übrig, sich in ein Kolonialregiment versetzen zu lassen, zu den Haudegen und Rabauken, die das Kriegführen besorgten, während die aus Wehrpflichtigen rekrutierten Einheiten auf den Exerzierplätzen paradierten.
Innerhalb eines Jahres nach seiner Abkommandierung zur kolonialen Fallschirmtruppe in Indochina war er Kompanieführer geworden; er lebte unter Männern, die so dachten und sprachen wie er. Auch dem Sohn eines Schusters konnten Beförderungen winken nach Fronteinsatz und abermaligem Fronteinsatz. Als der Krieg in Indochina zu Ende ging, war er Major, und nach einem unglücklichen und enttäuschenden Jahr in Frankreich wurde er nach Algerien geschickt.
Der französische Rückzug aus Indochina und das in Frankreich verbrachte Jahr hatten seine latente Bitterkeit in einen verzehrenden Haß auf alle Politiker und Kommunisten – was für ihn ein und dasselbe war – verwandelt. Nur ein Frankreich, das von Soldaten geführt wurde, konnte für immer aus dem Würgegriff der Verräter und Speichellecker, die das öffentliche Leben beherrschten, befreit werden. Und nur in der Armee hatte diese Brut nichts zu melden.
Wie die meisten Frontoffiziere, die ihre Männer hatten sterben sehen und gelegentlich auch die schaurig zugerichteten Leichen derjenigen hatten begraben müssen, die lebend in die Hand des Feindes geraten waren, sah er im Typus des Soldaten das wahre Salz der Erde, den Mann, der sein Blut opferte, damit die Bourgeoisie daheim ein behagliches Leben führen konnte. Nach acht im indochinesischen Dschungel verbrachten Jahren des Kämpfens erkennen zu müssen, daß den meisten Zivilisten im Mutterland das Soldatentum und seine Tugenden vollkommen gleichgültig waren, die von Linksintellektuellen verfaßten Schmähungen des Militärs zu lesen, die auf Lappalien wie dem Erhalt lebenswichtiger Informationen dienenden Folterungen von Kriegsgefangenen basierten – dies alles hatte Marc Rodin zu einem blinden Eiferer gemacht.
Er war nach wie vor überzeugt, daß die Armee, sofern sie nur von seiten der Kolonialverwaltung, der Regierung in Paris und der Bevölkerung des Mutterlandes genügend unterstützt worden wäre, den Viet Minh geschlagen hätte. Die Preisgabe Indochinas war ein ungeheuerlicher Verrat an den Tausenden jungen Männern gewesen, die dort hatten fallen müssen – umsonst, wie sich jetzt erwies.
Einen Treubruch wie diesen, das schwor sich Rodin, konnte und durfte es nie wieder geben. Algerien würde das beweisen.
Als er sich im Frühjahr 1956 in Marseille nach Algerien einschiffte, war er nahezu ein glücklicher Mann, glücklicher jedenfalls, als er es je zuvor gewesen war und je wieder sein sollte.
In den darauffolgenden zwei Jahren zäher, erbitterter Kämpfe geschah nur wenig, was ihn an seiner Überzeugung hätte irre werden lassen können. Zugegeben, mit den Rebellen fertig zu werden, war nicht so leicht, wie er anfangs geglaubt hatte. Wie viele Fellachen er und seine Männer auch immer erschossen, wie viele Dörfer auch immer sie dem Erdboden gleichmachten, wie viele FLN-Terroristen auch immer sie zu Tode folterten – der Aufstand breitete sich aus, bis er das ganze Land erfaßt hatte und auch auf die Städte übergriff.
Was not tat, war mehr und wirksamere Unterstützung aus Paris. Schließlich handelte es sich hier ja nicht um einen Krieg in irgendwelchen entlegenen Gegenden des Kolonialreiches. Algerien, das war Frankreich – ein von drei Millionen Franzosen bevölkerter Landesteil, um den man kämpfte, wie man um die Normandie, die Bretagne oder die Seealpen kämpfen würde.
Als Rodin zum Oberstleutnant befördert wurde, verlagerte sich sein militärischer Aufgabenbereich von den Stützpunkten draußen auf dem Lande in die Städte, zunächst nach Bône, dann nach Constantine. Von den Stützpunkten aus hatte er die ALN bekämpft – eine irreguläre Truppe zwar, aber doch eine Kampftruppe. Sein Haß auf sie verblaßte gegen die kalte Mordlust, die ihn der gemeine, hinterhältige Krieg in den Städten lehrte, ein Krieg, der mit Plastikbomben geführt wurde, die das Reinigungspersonal und andere algerische Bedienstete in von Franzosen bevorzugten Cafés, Supermarkets und Parks legten. Die Maßnahmen, die Rodin ergriff, um Constantine von dem aufständischen Gesindel zu säubern, das sich nicht scheute, diese Bomben mitten unter französische Zivilpersonen zu werfen, brachten ihm in der Kasbah den ehrenvollen Beinamen »Der Schlächter« ein.
Um die FLN und ihre Armee, die ALN, endgültig zu vernichten, fehlte es einzig und allein an wirksamerer Hilfe aus Paris. Wie die meisten Fanatiker machte der verbohrte Glaube auch Rodin blind gegen offenkundige Tatsachen. Die steigenden Kosten der Kriegführung, die kritische Lage der von der Bürde eines zusehends aussichtsloser werdenden Krieges schwer belasteten französischen Wirtschaft, die Demoralisation der Wehrpflichtigen – in Rodins Augen waren das lediglich Bagatellen.
Im Juni 1958 kehrte General de Gaulle als Ministerpräsident an die Macht zurück. Souverän liquidierte er die korrupte und zerrüttete Vierte Republik und gründete die Fünfte. Als er dann seinerseits jenes von den Generälen im Munde geführte Wort vom »französischen Algerien« aufnahm, das ihn ins Matignon zurück und im Januar 1959 in den Elysée-Palast bringen sollte, ging Rodin auf sein Zimmer und weinte. Und als de Gaulle Algerien besuchte, war es Rodin, als habe sich Zeus persönlich aus dem Olymp herabbemüht. Die neue Politik, dessen war er gewiß, würde nicht lange auf sich warten lassen. Die Kommunisten würden aus ihren Ämtern entfernt, Jean-Paul Sartre und seine Gesinnungsfreunde ohne Zweifel wegen Verrats erschossen, die Gewerkschaften zur Räson gebracht. Das Mutterland würde endlich zum Schutz seiner Bürger in Algerien wie auch zur Unterstützung seiner die Grenzen der französischen Zivilisation sichernden Armee wirksame Maßnahmen beschließen.
Rodin war dessen so sicher wie der Tatsache, daß die Sonne allmorgendlich im Osten aufgeht. Als de Gaulle indes die ersten Schritte einleitete, um Frankreich seinen eigenen Vorstellungen gemäß zu reformieren, führte er dies zunächst auf gewisse, anfänglich nicht zu vermeidende Fehler zurück. Man mußte dem großen alten Mann schon ein wenig Zeit lassen. Den ersten Gerüchten über vorbereitende Gespräche mit Ben Bella und der FLI vermochte er keinen Glauben zu schenken. Obschon er mit dem vom großen Jo Ortiz angeführten Siedleraufstand von 1960 sympathisierte, war er noch immer der Meinung, daß die mangelnden Fortschritte, die bei der endgültigen Vernichtung der Fellachen zu verzeichnen waren, nichts anderes als ein taktisches Manöver de Gaulles darstellten. Le Vieux würde, da gab es gar keinen Zweifel, schon wissen, was er tat. Hatte er sie nicht ausgesprochen, die goldenen Worte vom »französischen Algerien«? Als dann schließlich der unwiderlegbare Beweis erbracht war, daß Charles de Gaulles Konzept von einem erneuerten Frankreich ein französisches Algerien nicht vorsah, zersprang Rodins Weltbild wie eine zu Boden geschmetterte Vase. Rodin führte sein Bataillon – von ein paar Duckmäusern abgesehen, die hinter den Ohren noch nicht trocken waren – geschlossen in den Putsch von 1961.
Der Putsch mißlang. Mit einem einzigen, beängstigend schlauen Trick wurde er, noch ehe er an Boden gewonnen hatte, von de Gaulle vereitelt. Als in den Wochen, die den angekündigten Gesprächen mit der FLN vorausgingen, Tausende von simplen Transistorradios an die Truppe ausgegeben wurden, hatte dem keiner der Offiziere sonderliche Bedeutung beigemessen. Die Radioapparate wurden als harmlose Zerstreuung für die Soldaten angesehen, und viele der Offiziere billigten die Idee sogar ausdrücklich. Die von Hitze, Flöhen und Langeweile geplagten Jungen empfanden die über Ätherwellen aus Frankreich kommende Rock'n'Roll- und Schlagermusik als willkommene Ablenkung.
Die Wirkung der Stimme de Gaulles war weniger harmlos. Als dann die Loyalität der Armee auf die entscheidende Probe gestellt wurde, schalteten in den Kasernen ganz Algeriens Zehntausende zwangsrekrutierter junger Soldaten ihre Radios ein, um die Nachrichten zu hören. Anschließend vernahmen sie dieselbe Stimme, der Rodin im Juni 1940 gelauscht hatte. Auch die Botschaft war nahezu gleichlautend: »Ihr steht vor einer Gewissensentscheidung. Frankreich, das bin ich, das Werkzeug seines Schicksals. Hört auf mich. Gehorcht mir.«
Manche Bataillonskommandeure fanden anderntags nur noch eine Handvoll Offiziere und die meisten ihrer Sergeanten vor. Die Meuterei war niedergeworfen – per Rundfunk.
Rodin hatte mehr Glück als manche seiner Kameraden. Hundertzwanzig seiner Offiziere hielten zu ihm. Das war darauf zurückzuführen, daß die von ihm befehligte Einheit einen höheren Prozentsatz in Indochina und Algerien bewährter altgedienter Soldaten aufwies als die Mehrzahl sonstiger Formationen. Gemeinsam mit den anderen Putschisten gründeten sie die geheime Armeeorganisation, die sich verschworen hatte, den Judas im Elysée-Palast zu beseitigen.
Auf verlorenem Posten zwischen der triumphierenden FLN einerseits und der loyalen französischen Armee andererseits, versäumte die OAS keine Gelegenheit, wahre Orgien der Zerstörung zu veranstalten. Während der letzten sieben Wochen, in denen die französischen Siedler ihren in lebenslanger Arbeit erworbenen Besitz für ein Ei und ein Butterbrot verkauften und die vom Krieg heimgesuchte Küste flohen, ließ sich die geheime Armeeorganisation an dem, was sie nicht hatten mitnehmen können, in einem letzten, absurden Racheakt ihre Zerstörungswut aus. Als auch das vorüber war, blieb den OAS-Führern, deren Namen der Regierung bekannt waren, nur die Flucht ins Exil übrig.
Im Winter 1961 wurde Rodin zum Stellvertreter Antoine Argouds, des Stabschefs der exilierten OAS, ernannt. Das Flair, die strategische Begabung und der Einfallsreichtum, von denen die nunmehr in die Städte des Mutterlandes getragenen OAS-Aktionen zeugten, gingen auf das Konto Argouds, die glänzende Organisation, die taktische Geschicklichkeit und die listenreiche Schläue auf das Rodins.
Wäre er nichts weiter als ein hartgesottener Fanatiker gewesen, hätte man Rodin einen zwar gefährlichen, aber doch berechenbaren Mann nennen können. Es gab eine Menge anderer Männer dieses Kalibers, die in den frühen sechziger Jahren bereit gewesen waren, sich für die OAS zu schlagen. Aber Rodin war mehr als das. Der alte Schuhmacher hatte einen Sohn großgezogen, der präzise denken konnte, wenngleich diese Fähigkeit weder durch eine entsprechende Schulbildung noch durch den Dienst in der Armee jemals gefördert worden war. Rodin hatte sich selbst fortgebildet, und das auf seine eigene Weise.
Solange es um Frankreich und die Ehre der Armee ging, zeigte er sich als ebenso blinder Eiferer wie jeder andere OAS-Führer. Wenn er sich jedoch einem rein taktischen Problem gegenübersah, konnte er dem mit konzentriertem logisch-pragmatischen Denken zu Leibe rücken, das wirksamer war als alle fanatische Begeisterung und sinnlose Gewalttätigkeit.
Eben diese Fähigkeit war es, die er auf das Problem, mit dem er sich am Vormittag jenes 11.März befaßte, methodisch ansetzte: das Problem, wie man Charles de Gaulle umbringen konnte. Er war nicht so töricht zu meinen, daß es leicht zu lösen sei. Im Gegenteil, das Debakel von Petit-Clamart und der mißlungene Anschlag in der Ecole Militaire hatten das Problem ungemein erschwert. Einen Killer anzuwerben, war jederzeit möglich. Die Schwierigkeit lag darin, einen Mann oder einen Plan zu haben, welcher einen einzigen durchschlagenden Faktor aufwies, der so wenig vorherzusehen war, daß er alle den Präsidenten seit den jüngsten Vorkommnissen konzentrisch umgebenden Sicherheitsmechanismen ausschalten konnte.
Seit Petit-Clamart hatte sich die Lage grundlegend geändert. Die Unterwanderung der höheren Chargen und Kader der OAS durch Agenten des Aktionsdienstes hatte alarmierende Ausmaße erreicht. Die kürzlich erfolgte Entführung von Rodins eigenem Vorgesetzten Argoud machte deutlich, zu welchen Anstrengungen der Aktionsdienst entschlossen war, um die Führer der OAS in Gewahrsam zu nehmen und zu verhören. Dafür war man sogar bereit, scharfe Demarchen der deutschen Regierung in Kauf zu nehmen.
Zwei Wochen nachdem der seither endlosen Verhören unterzogene Oberst Argoud dingfest gemacht worden war, wurde es auch für die letzten OAS-Führer Zeit, sich abzusetzen oder unterzutauchen. Bidault fand an Publicity und öffentlicher Selbstdarstellung auf einmal keinen Geschmack mehr. Andere Mitglieder des Nationalen Widerstandsrates (CNR) flohen, von Panik ergriffen, nach Spanien, Amerika und Belgien. Urplötzlich setzte eine rasch steigende Nachfrage nach falschen Papieren und Flugtickets zu entlegenen Orten ein.
Das alles hatte sich auf die Moral des Fußvolks der OAS verheerend ausgewirkt. In Frankreich legten jetzt Männer, die bisher bereit gewesen waren zu helfen, steckbrieflich gesuchte Kameraden zu beherbergen, Waffenkisten zu schleppen, Meldungen weiterzugeben und Informationen zu übermitteln, mit einer gemurmelten Ausrede den Telephonhörer auf. Nach dem Fehlschlag von Petit Clamart und den Verhören der Festgenommenen mußten drei ganze réseaux schleunigst stillgelegt werden. Mit genauen Informationen versorgt, durchsuchte die französische Polizei ein Haus nach dem anderen, hob ein Waffenlager nach dem anderen aus und deckte zwei weitere auf die Beseitigung Charles de Gaulles abzielende Konspirationen auf: als die Verschwörer zu ihrer zweiten Besprechung zusammentraten, wurden sie von einem Riesenaufgebot an Polizei gestellt.
Knapp bei Kasse, im Begriff, sowohl die nationale und internationale Unterstützung als auch ihre Mitglieder – und damit ihre Glaubwürdigkeit – zu verlieren, drohte die OAS von den massierten Aktionen des französischen Geheimdienstes und der Polizei zermalmt zu werden.
Die Exekution Bastien-Thirys konnte die Moral nur noch weiter untergraben. Es würde schwer sein, Männer zu finden, die in dieser Phase des Kampfes bereit waren, sich für die Sache einzusetzen. Und die Gesichter derjenigen, welche auch jetzt noch weitermachen wollten, hatten sich jedem französischen Polizisten ins Gedächtnis gegraben – und einigen Millionen Staatsbürgern ebenfalls. Jeder neue Plan würde, weil er zu diesem Zeitpunkt eine Vielzahl von Vorbereitungen wie auch die Koordination verschiedener Gruppen erforderte, »auffliegen«, noch bevor der Attentäter auch nur näher als hundert Kilometer an de Gaulle herangekommen wäre.
Am Ende seines stummen Zwiegesprächs mit sich selbst murmelte Rodin: »Ein Mann, den keiner kennt …« Er überflog die Liste derjenigen, von denen er wußte, daß sie nicht davor zurückschrecken würden, einen Präsidenten zu ermorden. über jeden einzelnen von ihnen existierte im französischen Polizeiministerium eine Akte, die so dick war wie die Bibel. Weshalb würde er, Marc Rodin, sich sonst in einem obskuren österreichischen Gebirgsdorf versteckt halten?
Gegen Mittag hatte er dann plötzlich die Lösung gefunden. Er verwarf sie zunächst, kam aber doch immer wieder auf sie zurück. Wenn sich ein solcher Mann finden ließe – sofern es ihn überhaupt gab … Mit verbissener Geduld begann er, einen neuen, auf diesen Mann zugeschnittenen Plan auszuarbeiten, den er dann einer scharfen, alle nur denkbaren Hindernisse und Einwände berücksichtigenden Prüfung unterzog. Der Plan bestand sie und erwies sich, selbst was das Problem der Sicherheit betraf, als hieb- und stichfest.
Kurz bevor die Mittagsstunde schlug, zog sich Rodin den Wintermantel über und ging hinunter. Vor der Haustür traf ihn der Wind, der die Straße entlangfegte, mit voller Wucht. Er ließ Rodin zusammenfahren, befreite ihn jedoch augenblicklich von den dumpfen Kopfschmerzen, die ihm die zahllosen in dem überhitzten Zimmer gerauchten Zigaretten verursacht hatten. Er wandte sich nach links und stapfte durch den knirschenden Schnee zum Postamt in der Adlerstraße. Dort gab er eine Reihe kurzgefaßter Telegramme auf, in denen er seine sich unter Decknamen in Süddeutschland, Österreich, Italien und Spanien verbergenden Gesinnungsfreunde davon unterrichtete, daß er sich in den folgenden Wochen auf eine geheime Mission begeben und daher für sie vorübergehend nicht erreichbar sein würde.
Auf dem beschwerlichen Rückweg zu seiner bescheidenen Unterkunft wurde ihm klar, daß manche seiner Kameraden jetzt glauben mochten, auch er wolle sich nur verdrücken und vor der drohenden Entführung oder Ermordung durch den Aktionsdienst in Sicherheit bringen. Er zuckte mit den Achseln. Sollten sie doch denken, was sie wollten. Zu langatmigen Erklärungen war jetzt keine Zeit mehr.
Obschon die im indochinesischen Dschungel und in der algerischen Wildnis verbrachten Jahre seinen Geschmack nicht gerade kultiviert hatten, fiel es ihm schwer, das Tagesgericht der Pension – Eisbein mit Nudeln – hinunterzubringen. Am frühen Nachmittag hatte er Koffer und Aktentasche gepackt, die Rechnung bezahlt und das Haus verlassen. Er war bereit, sich in einsamer Mission auf die Suche nach einem bestimmten Mann – genauer: dem ganz bestimmten Typ eines Mannes – zu begeben, von dem er nicht einmal wußte, ob es ihn überhaupt gab.
Als Rodin den Zug bestieg, schwebte eine Comet 4 B in die auf Landebahn Null-vier des Londoner Airport zuführende Flugschneise ein. Die Maschine kam aus Beirut. Unter den Passagieren befand sich ein hochgewachsener, blonder Engländer. Sein Gesicht wies eine von der Sonne des Nahen Ostens herrührende Bräune auf. Nach den zwei Wochen, in denen er die unbestreitbaren Freuden des Libanon genossen und das für ihn sogar noch erfreulichere Vergnügen gehabt hatte, die Transferierung eines ansehnlichen Geldbetrags von einer Bank in Beirut auf eine andere in der Schweiz bestätigt zu erhalten, fühlte er sich ungemein fit und entspannt.
Weit, weit hinter ihm im sandigen Boden Ägyptens und lange schon begraben von der ebenso empörten wie ratlosen ägyptischen Polizei, lagen die Leichen zweier deutscher Raketeningenieure, beide mit einem sauberen Einschußloch im Genick. Ihr Hinscheiden hatte die Entwicklung der Al-Zafira-Rakete Nassers um einige Jahre zurückgeworfen und einem zionistischen Millionär in New York zu der angenehmen Gewißheit verholfen, sein Geld nicht umsonst ausgegeben zu haben.
Nachdem der Engländer die Zollkontrolle rasch passiert hatte, nahm er sich ein Taxi und fuhr nach Mayfair in seine Wohnung.
Rodins Suche endete erst nach neunzig Tagen, und alles, was er vorzuweisen hatte, waren drei schmale Dossiers, jedes in einem der Schnellhefter steckend, die er ständig in der Aktentasche mit sich führte.
Es war Mitte Juni, als er nach Österreich zurückkehrte und sich in Wien in der Pension Kleist, Brucknerallee, ein Zimmer mietete.
Auf der Wiener Hauptpost hatte er zwei kurze Telegramme aufgegeben, eines nach Bozen, das andere nach Rom, um seine beiden engsten Mitarbeiter zu einer dringenden Besprechung zu zitieren. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden waren die beiden Männer in Wien: René Montclair war mit einem gemieteten Wagen aus Bozen gekommen, André Casson per Flugzeug aus Rom. Beide reisten unter falschem Namen und mit gefälschten Papieren, denn sowohl in Italien als auch in Österreich führten die dort residenten Agenten des SDECE Montclair und Casson als dringend gesuchte OAS-Anhänger in ihren Akten und gaben eine Menge Geld aus, um an Grenzübergängen und auf Flughäfen Agenten und Informanten anzuwerben.
André Casson traf als erster in der Pension Kleist ein, sieben Minuten vor Beginn der auf elf Uhr angesetzten Besprechung. Er ließ das Taxi an der Ecke Brucknerallee halten und verwandte ein paar Minuten darauf, sich vor dem Schaufenster eines Blumenladens die Krawatte zu richten, bevor er sich mit raschen Schritten in die Pension begab.
Rodin hatte sich wie immer unter einem von zwanzig nur seinen engsten Mitarbeitern bekannten falschen Namen eingeschrieben. Jeder der beiden Herbeigerufenen hatte am Tag zuvor ein mit »Schulze« unterzeichnetes Telegramm erhalten. Rodins Codenamen wechselten vereinbarungsgemäß in zwanzigtägigem Rhythmus.
Casson blickte den jungen Mann hinter dem Empfangstisch fragend an. »Herr Schulze, bitte?«
»Zimmer vierundsechzig. Werden Sie erwartet, mein Herr?«
»Allerdings, ja«, entgegnete Casson und stieg rasch die Treppe hinauf. Im ersten Stock ging er den Korridor entlang bis zum Zimmer Nummer vierundsechzig. Als er die Hand hob, um an die Tür zu klopfen, wurde sie von hinten beim Gelenk gepackt. Er wandte sich um und starrte in ein blauwangiges Gesicht über ihm. Unter den zu einem Gestrüpp schwarzer Haare zusammengewachsenen Brauen blickten Augen auf ihn herab, die keinerlei Gefühlsregung, geschweige denn Neugier verrieten.
Der Mann war ihm gefolgt, als er an einem vier Meter entfernten Alkoven vorüberkam, und obwohl der Veloursteppich abgetreten war, hatte Casson keinen Laut gehört.
»Vous désirez?« sagte der Riese in einem Tonfall, als könne ihm nichts gleichgültiger sein als die Beantwortung seiner Frage. Aber der Griff, mit dem er Cassons Handgelenk gepackt hielt, lockerte sich nicht.
Einen Augenblick lang drehte sich Casson der Magen um, weil er an Argouds Verschleppung aus dem Eden-Wolff-Hotel in München denken mußte. Aber dann erkannte er in dem Hünen einen polnischen Fremdenlegionär aus Rodins Kompanie in Indochina und Algerien. Er erinnerte sich, daß Rodin Viktor Kowalsky gelegentlich zu Spezialaufgaben heranzog.
»Ich habe eine Verabredung mit Oberst Rodin, Viktor«, entgegnete er leise.
Die Nennung seines eigenen wie auch des Namens seines Herrn bewirkte, daß Kowalskys Brauen sich zu einem noch dichteren Dickicht runzelten.
»Ich bin André Casson«, fügte er hinzu.
Kowalsky schien nicht beeindruckt zu sein. Er langte mit der Linken um Casson herum und pochte an die Tür von Zimmer vierundsechzig.
Drinnen antwortete eine Stimme: »Oui?«
Kowalsky trat nahe an die hölzerne Türfüllung heran. »Ich habe da einen Besucher«, knurrte er, und die Tür öffnete sich einen Spaltbreit. Rodin blinzelte hindurch und machte sie dann ganz auf. »Mein lieber André! Tut mir leid, das.« Er nickte Kowalsky zu. »Schon gut, Corporal. Ich habe diesen Mann erwartet.« Casson rieb sich das rechte Handgelenk, das der Pole endlich losgelassen hatte, und trat in das Zimmer. Rodin wechselte auf der Schwelle noch ein paar Worte mit Kowalsky und schloß dann die Türe wieder. Der Pole ging zum Alkoven zurück, wo er erneut Posten bezog.
Rodin schüttelte Casson die Hand und führte ihn zu den beiden Sesseln, die vor der Gasheizung standen. Obschon es Mitte Juni war, herrschte regnerisches, kühles Wetter, und beide Männer waren an das heiße Klima Nordafrikas gewöhnt. Rodin hatte die Gasheizung voll aufgedreht. Casson zog seinen Mantel aus und setzte sich.
»Solche Vorsichtsmaßnahmen haben Sie doch sonst nie getroffen, Marc«, bemerkte er.
»Es ist nicht meinetwegen«, entgegnete Rodin. »Wenn irgend etwas passieren sollte, werde ich schon allein klarkommen. Aber ich muß ein bißchen Zeit gewinnen, um diese Papiere da loszuwerden.« Er deutete auf den Schreibtisch am Fenster, auf dessen Platte ein dicker Heftordner neben seiner Aktentasche lag. »Deswegen habe ich Viktor mitgebracht. Was auch immer los sein mag, er wird mir die sechzig Sekunden verschaffen, die ich brauche, um die Papiere zu vernichten.«
»Sie müssen ziemlich wichtig sein.«
»Schon möglich.« Rodins Tonfall war dennoch eine gewisse Befriedigung anzumerken. »Aber warten Sie ab, bis René da ist. Ich habe ihn wissen lassen, daß er um elf Uhr 15 kommen soll, damit Sie beide nicht zugleich eintreffen und mir Viktor aus der Ruhe bringen. Er wird nervös, wenn er zu viele Gesichter um sich hat, die er nicht kennt.«
Bei dem Gedanken an das, was zu erwarten stand, wenn Viktor mit dem schweren Colt unter der linken Achselhöhle nervös werden würde, gestattete sich Rodin – was nur selten geschah – ein schmales Lächeln.
Es klopfte. Rodin durchquerte das Zimmer und brachte seinen Mund nahe an die Türfüllung: »Oui?«
Diesmal war es René Montclairs Stimme. Sie klang nervös und gepreßt:
»Marc, um Himmels willen …«
Rodin riß die Tür auf. Zwergenhaft im Vergleich zu dem polnischen Hünen hinter ihm, die Arme in dessen eisernem Griff, stand Montclair da.
Ȃa va, Viktor