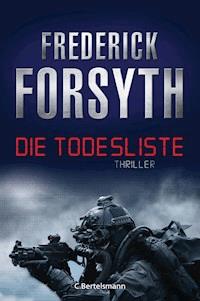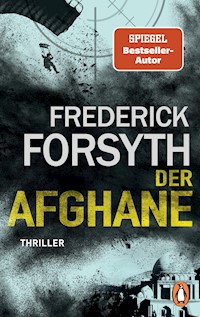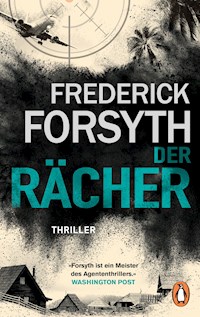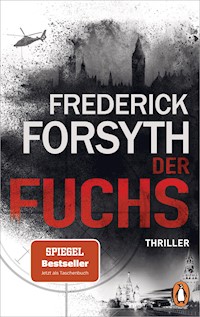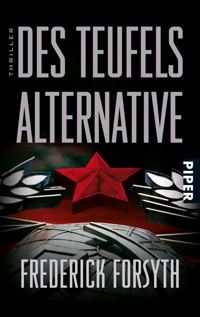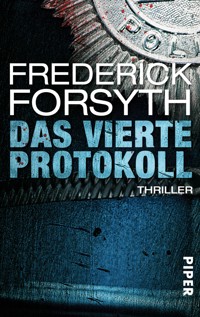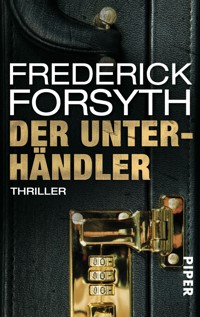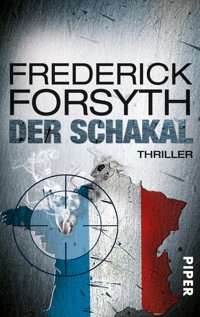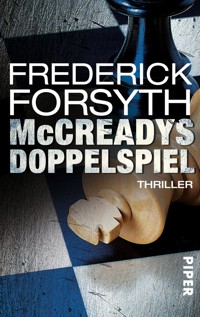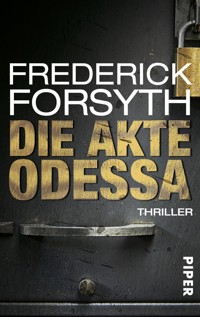
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Selbstmord des alten Juden Salomon Taubers wäre fast unbemerkt geblieben, hätte nicht der Zufall dem jungen Hamburger Illustrierten-Reporter Peter Miller ein vergilbtes Tagebuch in die Hände gespielt: Die minutiösen Aufzeichnungen lassen in ihm den fürchterlichen Verdacht aufkommen, dass der einstige Lagerkommandant Eduard Roschmann noch lebt. Die Jagd auf Roschmann wird ein Abenteuer auf Leben und Tod. Miller gerät in das Räderwerk der mächtigen Geheimorganisation ODESSA, einer Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. In ihrem Auftrag und Schutz entwickelt Roschmann ein Fernsteuersystem für Raketen, die eines Tages Israel endgültig vernichten sollen. Aber wer verbirgt sich hinter den Decknamen Vulkan und Werwolf? Wie wird ODESSA finanziert? Was enthält die ominöse schwarze Akte? Ein spannender Wettlauf beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für alle Reporter
Übersetzung aus dem Englischen von Tom Knoth
ISBN 978-3-492-96049-6 August 2017
© 1972 Danesbrook Produktion Ltd. Titel der englischen Originalausgabe: »The ODESSA File«, Hutchinson & Co. Ltd., London der deutschsprachigen Ausgabe: © 1973 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur Umschlagabbildung: Getty Images / Jetta Productions Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhaltsverzeichnis
Cover & Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Danksagung
Guide
Kapitel 1
Fast jeder weiß noch, was er gerade in dem Augenblick tat, als ihn die Nachricht von Präsident Kennedys Ermordung erreichte. Das tödliche Geschoß hatte den Präsidenten um 12 Uhr 22 (Dallas Ortszeit) getroffen. Die Meldung von seinem Tode wurde um 13 Uhr 30 veröffentlicht. Das war 14 Uhr 30 in New York, 19 Uhr 30 in London und 20 Uhr 30 in Hamburg. Peter Miller hatte seine Mutter in Osdorf, einem Vorort von Hamburg besucht, und fuhr durch den von Böen gepeitschten Regen in die Stadt zurück. Er besuchte sie immer Freitag abends, um sich zu vergewissern, ob sie auch mit allem versorgt war, was sie über das Wochenende brauchte, und weil er sich ohnehin verpflichtet fühlte, sie einmal die Woche zu sehen. Er hätte sie lieber angerufen, aber sie hatte kein Telefon; also mußte er zu ihr hinausfahren. Und genau das war natürlich der Grund, weswegen seine Mutter kein Telefon haben wollte.
Wie üblich hatte Miller das Radio eingeschaltet und hörte Musik vom NDR. Um 20 Uhr 30 befand er sich in Osdorf, zehn Minuten von der Wohnung seiner Mutter entfernt, als die Musik mitten im Takt abbrach und die Stimme des Ansagers sich meldete:
»Achtung, Achtung! Soeben erreicht uns eine Meldung. Präsident Kennedy ist tot. Ich wiederhole: Präsident Kennedy ist tot.«
Miller nahm den Blick von der Straße und sah auf die schwacherleuchtete Skala des Autoradios, als könnten seine Augen widerlegen, was seine Ohren gehört hatten, einen Sender, der Unsinn verbreitete.
»Mein Gott«, murmelte er, bremste und steuerte an den Straßenrand. Er blickte die breite, gerade Schnellstraße entlang, die durch Altona zur Hamburger Innenstadt führte. Andere Fahrer hatten dieselbe Meldung gehört und hielten ebenfalls am Straßenrand, als seien Autofahren und Radiohören auf einmal Dinge, die einander ausschlossen. Und genauso war es.
Vor sich sah er die Bremslichter der stadteinwärts fahrenden Wagen aufleuchten. Die Fahrer fuhren an die Bordsteinkante, um weitere Nachrichten nicht zu versäumen. Auf der Gegenfahrbahn strichen die Scheinwerfer stadtauswärts fahrender Wagen unruhig über den Asphalt, auch dort steuerten die Fahrer an den Straßenrand. Zwei Wagen überholten Miller, der Fahrer des ersten hupte wütend und tippte sich demonstrativ mit dem Zeigefinger an die Stirn.
Er wird es schon noch früh genug erfahren, dachte Miller.
Die Unterhaltungsmusik hatte aufgehört. Aus dem Radio kam der erstbeste Trauermarsch, den man zur Hand hatte. In gewissen Abständen verlas der Sprecher Bruchstücke weiterer Informationen, die ihm aus dem Nachrichtenraum überbracht wurden, so wie sie aus dem Fernschreiber kamen. Aus den Einzelheiten wurde langsam ein Bild: die Fahrt im offenen Wagen durch die Straßen von Dallas, der Scharfschütze im Fenster des Schulbuchlagers. Von der Festnahme verdächtiger Personen war vorerst noch nicht die Rede.
Vor Miller hatte ein anderes Auto gehalten. Der Fahrer stieg aus und ging auf Millers Wagen zu. Er trat an das linke Wagenfenster, stellte fest, daß sich der Fahrersitz auf der rechten Seite befand, und ging um den Wagen herum. Er trug eine Joppe mit einem Kragen aus Nylonpelz. Miller drehte das Wagenfenster hinunter.
»Haben Sie das gehört?« fragte der Mann und beugte sich zum Fenster herab.
»Ja«, sagte Miller.
»Entsetzlich«, sagte der Mann. Überall in Hamburg, in Europa, in der ganzen Welt sprechen fremde Menschen einander an, um über das Ereignis zu reden.
»Glauben Sie, daß es die Kommunisten waren?« fragte der Mann.
»Weiß ich nicht.«
»Wenn sie es waren, kann das Krieg bedeuten«, sagte der Mann.
»Schon möglich«, sagte Miller. Als Reporter konnte er sich unschwer das Chaos vorstellen, das jetzt überall in den Leitungsredaktionen der Bundesrepublik ausbrach. Alle verfügbaren Leute würde man zusammentrommeln, um den Lesern die auf den allerletzten Stand gebrachte Morgenausgabe rechtzeitig zum Frühstück zu liefern. Man mußte Nachrufe verfassen, aus den laufend eingehenden Informationen zusammenhängende Berichte schreiben und in die Setzmaschine geben. Schreiende, schwitzende Männer würden auf der Jagd nach immer mehr Einzelheiten sämtliche Telefonleitungen blockieren, weil in einer Stadt in Texas ein Mann mit durchschossener Kehle auf einer Bahre lag.
In mancher Hinsicht wünschte sich Miller wieder in die Redaktion einer Tageszeitung zurück, aber in den drei Jahren, in denen er inzwischen als freier Journalist sein Geld verdiente, hatte er sich auf Inlandsberichte über die Unterwelt in der Bundesrepublik und die Arbeit der Polizei spezialisiert. Seiner Mutter gefiel das ganz und gar nicht, und sie warf ihm seinen »Umgang mit schlechten Menschen« vor. Sein Einwand, daß er bald einer der gefragtesten Reporter Westdeutschlands sein werde, vermochte sie nicht von der Meinung abzubringen, die Tätigkeit eines Sensationsreporters sei ihres einzigen Sohnes unwürdig.
Der Rundfunk brachte weitere Meldungen. Peter Miller überlegte fieberhaft, ob sich aus dem sensationellen Ereignis für ihn die Möglichkeit zu einer speziell innerdeutschen Story ergab. Die Berichterstattung über die Redaktion der Bundesregierung war Sache der Bonner Korrespondenten, und die obligaten Rückblicke auf Kennedys Besuch in West-Berlin würden die dortigen Journalisten liefern. Eine brauchbare Bildreportage aber für eine der zahlreichen westdeutschen Illustrierten, die zu den besten Kunden seiner Schreibe gehörten, schien auch nicht drin zu sein.
Der Mann am Wagenfenster merkte, daß Miller mit den Gedanken woanders war. Er setzte ebenfalls eine nachdenkliche Miene auf.
»Ja, ja«, murmelte er wie jemand, der das alles hatte kommen sehen, »gewalttätige Menschen sind das, diese Amis. Denken Sie an meine Worte – gewalttätige Menschen. Die haben alle eine gewalttätige Ader, und das wird unsereinem hier immer unbegreiflich bleiben.«
»Sicher«, sagte Miller abwesend.
Der Mann begriff endlich.
»Tja, dann werde ich mich mal wieder auf die Socken machen«, sagte er.
»Ich muß nach Hause. Guten Abend!« Und er ging zu seinem Wagen zurück.
»Guten Abend«, rief Miller ihm aus dem geöffneten Wagenfenster nach und kurbelte die Scheibe rasch wieder hoch, denn der Wind peitschte vom Fluß her Schneeregen landeinwärts. Immer noch kamen die getragenen Klänge des »marche funebre« aus dem Radio. Der Ansager erklärte, das für diesen Abend ursprünglich vorgesehene Unterhaltungsprogramm sei abgesetzt worden; es werde ausschließlich Musik gesendet, die dem Ernst des Ereignisses angemessen sei, nur unterbrochen von den neuesten Meldungen aus Dallas.
Miller lehnte sich in die bequemen Ledersessel seines Jaguars zurück und steckte sich eine filterlose Roth-Händle an. Seine Vorliebe für diese Zigarette gehörte ebenfalls zu den Dingen, die seine Mutter an ihrem einzigen Sohn auszusetzen fand.
Nur allzu gerne versuchte man sich auszumalen, was geschehen wäre, wenn … Gewöhnlich sind solche Denkspiele müßig, denn was hätte sein können, wird man nie wissen. Dennoch: Peter Miller hätte seinen Wagen mit Sicherheit nicht an den Straßenrand gesteuert und dort eine halbe Stunde lang geparkt, wenn an jenem Abend sein Radio nicht eingeschaltet gewesen wäre. Weder hätte er den Unfallwagen gesehen noch jemals von Salomon Tauber und Eduard Roschmann etwas gehört, und aller Wahrscheinlichkeit nach hätte der Staat Israel vierzig Monate später nicht mehr existiert.
Miller rauchte seine Zigarette zu Ende, drehte das Wagenfenster wieder hinunter und warf den Stummel fort. Ein leichter Druck auf den Gashebel ließ den 3,8-l-Motor unter der langgestreckten, flach gewölbten Kühlerhaube des Jaguar XK 150 S einmal aufheulen, dann fiel die Maschine in ihr gewohntes Brummen. Es klang wie das Knurren eines gefesselten Raubtieres. Miller schaltete die beiden Scheinwerfer an, blickte zurück und reihte sich in den dichter werdenden Verkehr auf dem Osdorfer Weg ein.
Die Ampel an der Ecke Stresemann-Daimlerstraße zeigte Rot, als er hinter sich das Signal des Unfallwagens hörte. Mit an- und abschwellendem Sirenengeheul raste der Wagen links an ihm vorbei, bremste leicht ab, bevor er bei Rot auf die. Kreuzung fuhr, und bog unmittelbar vor Miller nach rechts in die Daimlerstraße ein. Miller reagierte reflexhaft. Er legte den Gang ein, der Jaguar schoß mit einem Satz nach vorn, bog kreischend um die Ecke und folgte dem Unfallwagen im Abstand von zwanzig Metern.
Schon im nächsten Augenblick wünschte sich Miller, er wäre geradeaus, auf dem direkten Weg, heimgefahren. Vermutlich kam bei der Verfolgung des Unfallwagens nichts heraus, aber man konnte nie wissen. Wo ein Unfallwagen hinfuhr, da waren immer Menschen in Not, und wo Menschen in Not waren, da gab’s vielleicht Stoff für eine Reportage, besonders, wenn man als erster an Ort und Stelle war und die von den Redaktionen geschickten Kollegen erst eintrafen, wenn schon alles gelaufen war. Es konnte sich um einen schweren Verkehrsunfall, ein Großfeuer in einem Hafensilo oder ein brennendes Mietshaus handeln, in dem Kinder von den Flammen eingeschlossen waren. Es konnte sich um alles mögliche handeln. Miller hatte stets eine kleine Yashica mit Blitzlicht im Handschuhfach seines Wagens, weil man nie wußte, was sich im nächsten Augenblick vor der eigenen Nase abspielen mochte. Er kannte einen Mann, einen Engländer, der am 6. Februar 1958 durch München ging, als nur wenige hundert Meter vor ihm das Flugzeug mit der Mannschaft von Manchester United abstürzte. Sofort hatte der Mann, der beileibe kein Berufsphotograph war, die Kamera, die er immer auf seine Reise mitnahm, vors Auge gerissen und die ersten Bilder der brennenden Maschine geschossen. Einer Illustrierten hatte er sie dann exklusiv für 50 000 DM verkauft.
Der Unfallwagen ließ den Altonaer Hauptbahnhof links liegen und raste durch das Gewirr der engen und düsteren Straßen, das sich bis zur Elbe erstreckte. Der Mann am Steuer des Ambulanz-Mercedes mußte sich in dem Viertel gut auskennen und verstand etwas vom Fahren. Miller spürte, wie die hartgefederten Hinterräder des Jaguars über das regennasse Kopfsteinpflaster rutschten, wenn er in den Kurven beschleunigte.
Miller hetzte an Mencks Auto-Ersatzteillager vorüber. Zwei Straßenecken weiter wurde seine Neugier gestillt. Der Unfallwagen bog in eine schlecht beleuchtete, von abbruchreifen Mietskasernen und schäbigen Stundenhotels gesäumte Straße ein, die in dem vom Wind gepeitschten, mit Schnee vermischten Regen um diese Zeit noch trostloser wirkte als bei Tageslicht. Der Unfallwagen hielt vor einem Haus, vor dem bereits ein Polizeiwagen stand, dessen kreisendes Blaulicht geisterhaft über die Gesichter der Zuschauer am Hauseingang strich.
Ein stämmiger Polizeimeister in einem Regenumhang befahl der Menge in barschem Ton, zur Seite zu treten und dem Unfallwagen Platz zu machen. Der Fahrer und ein Sanitäter stiegen aus, liefen zur hinteren Tür des Wagens und zogen eine Bahre heraus. Sie wechselten ein paar Worte mit dem Polizeibeamten und eilten in das Mietshaus.
Miller parkte den Jaguar zwanzig Meter weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite und hob die Brauen. Kein Zusammenstoß, kein Feuer, kein von Flammen eingeschlossenes Kind. Vermutlich nur ein Herzanfall. Er stieg aus und schlenderte zu den Leuten, die auf Weisung des Polizisten zurückgewichen waren. Sie standen da in einem Halbkreis, der einen Durchgang von der Haustür zum Unfallwagen freiließ.
»Haben Sie was dagegen, wenn ich hinaufgehe?« fragte Miller.
»Allerdings. Sie haben da nichts zu suchen.«
»Ich bin von der Presse«, sagte Miller und zog seinen Presseausweis hervor.
»Und ich bin von der Polizei«, entgegnete der Beamte. »Hier kommt niemand durch. Die Treppen sind viel zu schmal und außerdem baufällig. Die Krankenträger werden sowieso gleich wieder hier sein.«
Er war ein Hüne von einem Mann, wie sich das für einen Polizeimeister gehörte, der in einem der verkommensten Viertel Hamburg-Altonas Dienst tat. Annähernd zwei Meter groß, wirkte er mit seinen ausgestreckten Armen, mit denen er die Menge zurückhielt, und in seinem weiten Regenumhang unbeweglich wie ein verriegeltes Scheunentor.
»Was ist denn überhaupt los?« fragte Miller.
»Ich darf keine Erklärungen abgeben. Am besten erkundigen Sie sich auf dem Revier.«
Ein Mann in Zivil kam die Treppe hinunter und trat auf die Straße. Das rotierende Blaulicht auf dem Dach des VW-Streifenwagens huschte über sein Gesicht, und Miller erkannte ihn. Sie hatten zusammen die Oberschule in Altona besucht. Der Mann war kürzlich zum Kriminalinspektor bei der Hamburger Polizei befördert und der Altonaer Hauptwache zugeteilt worden.
»Guten Abend, Karl.«
Der junge Inspektor drehte sich um und blickte suchend in die Menge hinter dem Polizisten. Im aufblitzenden Blaulicht erkannte er Miller, der die rechte Hand erhoben hatte. Sein Gesicht verzog sich zu einem Grinsen, das zugleich freudiges Wiedererkennen und schicksalsergebene Resignation verriet. Er nickte dem Polizeimeister zu.
»In Ordnung, Wachtmeister. Er ist mehr oder weniger harmlos.«
Der Beamte senkte den Arm, und Miller drängte sich an ihm vorbei.
Sie gaben sich die Hand.
»Was tust du hier?« fragte Brandt.
»Bin dem Unfallwagen nachgefahren.«
»Alter Geier … Gibt’s was Neues bei dir?«
»Immer noch das gleiche. Wurstele mich nach wie vor als freier Journalist durch.«
»Scheinst aber ganz gut zurechtzukommen dabei. Ich sehe deinen Namen alle naselang in den illustrierten.«
»Na ja, der Schornstein muß schließlich rauchen. Hast du schon gehört – das mit Kennedy?«
»Ja. Scheußliche Sache. Die werden ganz Dallas durchkämmen müssen. Bin bloß froh, daß es nicht bei uns passiert ist.«
Miller deutete mit einem Kopfnicken auf den trüb beleuchteten Treppenflur des Mietshauses. Eine schwache nackte Glühbirne warf einen gelblichen Schein auf den bröckelnden Wandverputz.
»Selbstmord«, sagte der Inspektor. »Gas. Die Nachbarn haben den Geruch bemerkt, als es durch die Türritze drang, und die Polizei verständigt. Nur gut, daß niemand ein Streichholz angezündet hat, das ganze Haus stank nach Gas.«
»Nicht zufällig ein Filmstar oder sonstwas Berühmtes?«
»Na, hör mal, wenn die so etwas machen, suchen sie sich eine andere Adresse aus. Nein, es war ein alter Mann. Sah ohnehin aus, als sei er schon seit Jahren tot. Passiert jeden Tag, daß jemand Schluß macht.«
»Na, wo immer der sich jetzt auch wiederfindet, schlimmer als hier kann’s kaum sein.«
Der Inspektor lächelte flüchtig und drehte sich um, als die Krankenträger mit ihrer Last die letzten Stufen der knarrenden engen Treppen zum Hausflur hinabkamen. Brandt wandte sich dem Polizeibeamten zu.
»Lassen Sie mal ein bißchen Platz machen, damit die Männer da durchkönnen.«
Der Polizeimeister drängte die Menge noch weiter zurück. Die beiden Krankenträger traten auf den Gehsteig hinaus und gingen um den Unfallwagen herum zu der offenen Hintertür. Brandt folgte ihnen mit Miller, der sich ihm an die Fersen geheftet hatte. Nicht, daß Miller unbedingt den Toten sehen wollte; er ging nur ganz einfach dorthin mit, wohin Brandt ging. Der eine der beiden Krankenträger setzte das Kopfende der Trage auf die Gleitschiene im Wagen. Der zweite wollte die Bahre gerade hineinschieben, als Brandt sagte: »Augenblick mal.« Er schlug einen Zipfel der Decke zurück, die über den Toten gebreitet war. Über die Schulter bemerkte er zu Miller: »Nur eine Formsache. Ich muß in meinem Bericht erwähnen, daß der Tote unter meiner Aufsicht zum Abtransport in die Leichenhalle in den Wagen geschafft wurde.«
Die Innenbeleuchtung des Unfallwagens war sehr hell. Für zwei Sekunden konnte Miller das Gesicht des Selbstmörders sehen. Sein erster und einziger Eindruck war, noch nie einen so alten und so häßlichen Menschen gesehen zu haben. Selbst wenn man von den Auswirkungen der Gasvergiftung – der fleckigen Verfärbung der Haut und der bläulichen Tönung der Lippen – absah, konnte der Mann zu Lebzeiten wahrlich keine Schönheit gewesen sein. Ein paar schüttere Haarsträhnen klebten quer über dem ansonsten kahlen Schädel. Die Augen waren geschlossen. Das Gesicht war erschreckend ausgezehrt, und da dem Toten das falsche Gebiß fehlte, waren die Wangen so tief eingefallen, daß sie sich innen fast berühren mußten, was ihm das Aussehen eines Ghuls aus einem Horrorfilm verlieh. Lippen waren kaum zu erkennen, und die Partie über und unter dem Mund war von vertikalen Falten durchzogen. Miller dachte an die zusammengenähten Lippen eines Schrumpfkopfes, den er einmal bei Eingeborenen im Amazonasbecken gesehen hatte. Die beiden gezackten blassen Narben, die von den Schläfen bis zu den Mundwinkeln liefen, verstärkten diesen Eindruck noch.
Nachdem er einen raschen Blick auf das Gesicht des Toten geworfen hatte, legte Brandt die Decke wieder zurück und nickte dem Krankenträger hinter ihm zu. Der Mann trat zurück, als sein Kollege die Bahre in den Wagen schob, verschloß die Tür, ging um den Wagen herum und setzte sich auf den Beifahrersitz. Der Unfallwagen schoß davon, und die Menge zerstreute sich.
Miller sah Brandt an und hob die Brauen.
»Trostlos.«
»Ja. Armes Luder, der Alte. Wohl nichts drin für dich, oder?«
Miller sah gequält drein.
»Nichts zu machen. Wie du sagst, es passiert jeden Tag, daß einer Schluß macht. Überall in der ganzen Welt begehen in diesem Augenblick Menschen Selbstmord, und niemand nimmt auch nur die geringste Notiz davon. Schon gar nicht jetzt, wo sie gerade Kennedy umgebracht haben.«
Inspektor Brandt lachte bitter.
»Ihr verdammten Journalisten.«
»Seien wir doch ehrlich. Was die Leute lesen wollen, das sind Berichte über Kennedys Ermordung. Und auf die Leute kommt es schließlich an, denn sie kaufen die Zeitungen.«
»Damit wirst du wohl recht haben. Tja, ich muß wieder zur Wache. Bis bald, Peter.«
Sie trennten sich, und Miller fuhr zum Altonaer Hauptbahnhof zurück. Er bog in die zur Stadtmitte führende Hauptstraße ein und stellte seinen Jaguar zwanzig Minuten später in der großen unterirdischen Garage beim Hansaplatz ab. Von hier aus waren es keine zweihundert Meter bis zu dem Haus, in dem er ein Dachgartenapartment bewohnte.
Den Wagen während der Wintermonate in der Kellergarage unterzubringen, war kostspielig und gehörte zu den wenigen Extravaganzen, die Miller sich leistete. Seine ziemlich teure Wohnung gefiel ihm, weil sie so hochgelegen war. Er konnte auf den geschäftigen Steindamm und über einen weiten Teil der Stadt blicken. Für Kleidung und Essen gab er nicht viel aus. Mit seinen neunundzwanzig Jahren, seiner Länge von fast zwei Metern, seinem unbändigen braunen Haar und seinen braunen Augen, die den Frauen so gut gefielen, hatte er es nicht nötig, sich teure Anzüge zu kaufen. Ein Freund hatte ihm einmal, nicht ohne Neid, gesagt: »Dir würden die Mädchen noch in eine Mönchszelle nachlaufen.« Miller hatte nur gelacht, sich aber doch geschmeichelt gefühlt, weil er wußte, daß es die Wahrheit war.
Seine wirkliche Leidenschaft waren Sportwagen, sein Beruf und Sigrid, obschon er sich gelegentlich eingestand, daß Sigi, wenn er jemals zwischen ihr und dem Jaguar zu wählen hätte, sich anderweitig würde trösten müssen.
Er blieb noch eine Weile vor dem Jaguar stehen, nachdem er ihn auf seinem Garagenplatz abgestellt hatte, ganz in den Anblick des Wagens versunken. Er konnte sich nicht daran satt sehen. Wenn er ihn in irgendeiner Straße geparkt hatte und zurückkam, verharrte er oft einen Augenblick lang in andächtiger Bewunderung, bevor er einstieg. Häufig blieben Passanten stehen und bemerkten, ohne zu wissen, daß der Wagen ihm gehörte, anerkennend: »Toller Schlitten!«
Normalerweise fährt kein freier Reporter seines Alters einen Jaguar XK 150 S. Ersatzteile waren in Hamburg schon deswegen nur unter allergrößten Schwierigkeiten zu bekommen, weil die XK-Serie, deren letztes Modell der Typ s gewesen war, seit 1960 nicht mehr produziert wurde. Miller hielt den Wagen selbst in Schuß, verbrachte jeden Sonntag viele Stunden im Overall unter dem Chassis oder der Motorhaube. Das Benzin, das der Wagen mit seinen drei Vergasern schluckte, ging ganz schön ins Geld, aber das nahm Miller gern in Kauf. Das berserkerhafte Röhren zu hören, wenn er auf der Autobahn das Gaspedal durchtrat, oder den Druck zu spüren, der ihn gegen die Polsterung preßte, wenn der Wagen auf einer Bergstraße aus der Kurve in die Gerade schoß – das ließ er sich gerne etwas kosten. Er hatte die Federung der beiden Vorderräder noch härter machen lassen, und da die Hinterräder mit Einzelradaufhängung versehen waren, blieb der Jaguar auch in Kurven, in denen andere Wagen, die sich nicht überholen lassen wollten, unweigerlich ins Schleudern gerieten, eisern in der Spur. Miller hatte ihn schwarz spritzen und an den Seiten der Länge nach mit einem wespengelben Streifen versehen lassen. Da der Wagen nicht für den Export, sondern für den innerenglischen Verkehr hergestellt war, befand sich das Lenkrad auf der rechten Seite; das erwies sich wegen der Sicht beim Überholen zuweilen als hinderlich, andererseits konnte er jedoch so mit der linken Hand schalten und mit der rechten steuern, was er als sehr vorteilhaft empfand. Immer noch vermochte er, wenn er daran dachte, wie er an den Jaguar gekommen war, sein Glück kaum zu fassen. Irgendwann im Frühsommer hatte er beim Friseur ein Schlagermagazin aufgeschlagen und müßig durchgeblättert. Normalerweise interessierte er sich nicht für die Klatschgeschichten von Schlagersängern, aber es gab nichts anderes zu lesen. Ein langer Artikel berichtete von dem kometenhaften Aufstieg, mit dem vier pilzköpfige junge Engländer internationalen Ruhm errungen hatten. Das Gesicht ganz rechts außen auf dem doppelseitigen Photo – das mit der großen Nase – sagte Miller nichts, aber die anderen drei Gesichter kamen ihm bekannt vor.
Die Titel der beiden Schallplatten, mit denen das Quartett den entscheidenden Erfolg erzielt hatten – »Please, Please Me« und »Love Me Do« –, sagten ihm ebenfalls nichts, aber über die drei Gesichter zerbrach er sich zwei Tage lang den Kopf. Dann fiel ihm ein, daß die drei vor zwei Jahren in irgendeinem Beatschuppen an der Reeperbahn gespielt hatten. Es dauerte einen weiteren Tag, bis er sich an den Namen des Lokals erinnerte. Er war nur einmal auf einen Drink dort gewesen, um einen Gewährsmann aus der Unterwelt zu treffen, von dem er Informationen über die St.-Pauli-Bände zu erhalten hoffte. Der Schuppen hieß »Star-Club«. Er fuhr hin, ließ sich die Programme aus dem Jahr 1961 zeigen und fand die Gruppe, die er suchte. Damals waren es fünf Musiker gewesen, die drei, die er kannte, und noch zwei andere, Pete Best und Stuart Sutcliffe.
Von dort fuhr er zu der Photographin, die im Auftrag des Impresarios Bert Kämpferts die Werbephotos gemacht hatte. Von ihr erwarb er die Exklusivrechte an sämtlichen Bildern, die sie noch besaß. Seine Reportage »Wie Hamburg die Beatles entdeckte« erschien in fast allen westdeutschen Schlagermagazinen und Illustrierten und in vielen ausländischen Blättern. Mit dem Honorar kaufte er den Jaguar, den er bei einem Gebrauchtwagenhändler gesehen hatte. Der hatte ihn von einem britischen Armeeoffizier übernommen, dessen hochschwangere Ehefrau nicht mehr in den Wagen paßte. Miller hatte aus Dankbarkeit sogar ein paar Beatles-Platten gekauft, aber der einzige Mensch, der sie manchmal spielte, war Sigi.
Er riß sich vom Anblick des Wagens los, schlenderte über die Rampe zur Straße und fuhr in seine Wohnung hinauf. Es war fast Mitternacht, und obwohl ihm seine Mutter um sieben Uhr, wie immer am Freitag, ein reichhaltiges Abendessen vorgesetzt hatte, spürte er schon wieder Hunger. Er machte sich ein paar Rühreier und hörte die Spätnachrichten. Sie bezogen sich nahezu ausschließlich auf Kennedy, und da aus Dallas selbst nur sehr spärliche Meldungen kamen, war hauptsächlich von der offiziellen Reaktion in der Bundesrepublik die Rede. Die Polizei suchte noch immer nach dem Täter. Kommentatoren und Nachrichtensprecher verbreiteten sich wortreich über Kennedys Liebe zu Deutschland, seinen Besuch in der ehemaligen Reichshauptstadt im Sommer zuvor, als er auf deutsch gesagt hatte: »Ich bin ein Berliner!«
Es folgte ein auf Band gesprochener Nachruf des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Willy Brandt, dessen Stimme die innere Bewegung anzumerken war. Weitere Würdigungen schlossen sich an, so von Bundeskanzler Erhard und Altkanzler Konrad Adenauer, der am 15. Oktober zurückgetreten war.
Peter Miller stellte das Radio ab und ging zu Bett. Er wünschte, Sigi wäre zu Hause, weil er immer, wenn er deprimiert war und nicht einschlafen konnte, das Bedürfnis hatte, sich wie ein Kind ganz eng an sie zu kuscheln – worauf er sie jedesmal heftig begehrte. Sie liebten sich dann, und er konnte endlich einschlafen – sehr zu Sigis Enttäuschung, denn hinterher wollte sie immer vom Heiraten und Kinderkriegen reden. Der Nachtklub, in dem sie tanzte, machte erst um vier Uhr morgens zu, und samstags und sonntags häufig sogar noch später, weil die Reeperbahn an Wochenenden von Provinzlern und Touristen wimmelte, die bereit waren, einem Mädchen mit großem Busen und hübschem Hintern Champagner zu bestellen, der das Zehnfache des Ladenpreises kostete. Und Sigi hatte den größten Busen und hübschesten Hintern von allen.
Miller rauchte also noch eine weitere Zigarette, schlief um Viertel nach eins ein und träumte von dem grauenhaften Gesicht des alten Mannes, der sich in den Elendsvierteln von Altona das Leben genommen hatte.
Während sich Peter Miller um Mitternacht in Hamburg Rühreier bereitete, saßen in dem komfortablen Rauchsalon eines Hauses bei Kairo fünf Männer beim Drink zusammen. Das Haus gehörte zum Wohnkomplex einer Reitschule in der Nähe der Pyramiden. Die Männer hatten ausgezeichnet zu Abend gespeist und waren in bester Stimmung, seit sie vier Stunden zuvor – in Kairo war es jetzt ein Uhr morgens – die Nachricht aus Dallas gehört hatten.
Drei Männer waren Deutsche, die anderen beiden Ägypter. Die Frau des Gastgebers war zu Bett gegangen und hatte ihren Mann seinem bis in die frühen Morgenstunden währenden Gespräch mit den vier Besuchern überlassen. Er war der Inhaber der Reitschule, die ein beliebter Treffpunkt der Kairoer Gesellschaft und der deutschen Kolonie war.
In dem bequemen Ledersessel beim Fenster, dessen Jalousien geschlossen waren, saß Peter Bodden – El Gumrah. Er war unmittelbar nach dem Krieg nach Ägypten übergesiedelt, hatte den ägyptischen Namen El Gumrah angenommen und war jetzt im Kairoer Informationsministerium als Sachverständiger für außenpolitische Fragen tätig. Er hielt ein Glas Whisky in der Hand, während sein Nachbar zur Linken, Georg Reiche, ein Nahost-Experte der ehemaligen deutschen Reichsregierung und heute ebenfalls im ägyptischen Informationsministerium tätig, nur Orangensaft trank. Reiche war inzwischen zum moslemischen Glauben übergetreten, hatte eine Pilgerreise nach Mekka gemacht und nannte sich seither El Hadj. Seinem neuen Glauben getreu, verschmähte er jeglichen Alkohol. Beide Männer waren fanatische Nationalsozialisten.
Der eine der beiden Ägypter war Oberst Chams Edine Badrane, der persönliche Adjutant Marschall Abdel Hakim Amers, der zum ägyptischen Verteidigungsminister avancierte, bevor er nach dem Sechstagekrieg von 1967 wegen Landesverrats zum Tode verurteilt wurde. Oberst Badrane sollte gleich seinem Herrn und Meister ebenfalls in Ungnade fallen. Der andere Ägypter war Oberst Ali Samir, der Chef des Mukhabarat, des ägyptischen Geheimdienstes.
An dem Essen hatte noch ein weiterer Mann teilgenommen, der Ehrengast, der um 21 Uhr 30, als die Nachricht von Präsident Kennedys Tod gemeldet wurde, nach Kairo zurückgeeilt war: Anwar Sadat, der Vorsitzende der ägyptischen Nationalversammlung, ein enger Mitarbeiter Präsident Nassers, der später sein Nachfolger wurde.
Peter Bodden hob sein Glas.
»Die Politik der Vereinigten Staaten wird sich ändern müssen. Meine Herren, trinken wir auf die gemeinsame Sache.«
»Aber unsere Gläser sind leer«, bemerkte Oberst Samir.
Der Gastgeber beeilte sich, diesem Übelstand abzuhelfen, und schenkte Scotch nach.
Die Anspielung auf die Politik der Vereinigten Staaten hatte keinen der vier Männer überrascht oder gar befremdet. Am 14. März 1960, als Eisenhower noch Präsident der Vereinigten Staaten war, hatten sich der israelische Premierminister David Ben-Gurion und Bundeskanzler Konrad Adenauer im New Yorker Hotel Waldorf-Astoria zu einer Geheimbesprechung unter vier Augen getroffen, die zehn Jahre zuvor noch für undenkbar gehalten worden wäre. Was bei jener Zusammenkunft vereinbart worden war, galt auch noch 1960 als undenkbar, und das war auch der Grund, warum es Jahre dauern sollte, bis Einzelheiten davon an die Öffentlichkeit drangen, und warum Präsident Nasser sich weigerte, die Informationen ernst zu nehmen, die ihm die ODESSA, die Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, und Oberst Samirs Mukhabarat auf den Tisch legten.
Die beiden Staatsmänner hatten ein Abkommen getroffen, demzufolge Westdeutschland dem Staat Israel einen jährlichen Kredit in Höhe von 50 Millionen Dollar gewährte, ohne irgendwelche Bedingungen daran zu knüpfen. Ben-Gurion stellte jedoch sehr bald fest, daß es zwar gut und schön war, Geld zu haben, aber wenig half, wenn es einem an sicheren und verläßlichen Waffenlieferanten mangelte.
Ein halbes Jahr darauf wurde das Waldorf-Astoria-Abkommen durch eine weitere Vereinbarung ergänzt, die von Franz Josef Strauß und Shimon Peres unterzeichnet war, den Verteidigungsministern der Bundesrepublik Deutschland und des Staates Israel. Israel konnte jetzt den deutschen Kredit zum Ankaufen von Waffen in der Bundesrepublik verwenden.
Adenauer, der sich der weitaus heikleren Natur dieses zweiten Abkommens durchaus bewußt war, zögerte die Ratifizierung monatelang hinaus, bis er im November 1961 in New York mit dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, John Fitzgerald Kennedy, zusammentraf. Kennedy setzte ihn unter Druck. Er wünschte zwar nicht, daß Waffen aus den USA direkt an Israel geliefert wurden, war aber doch sehr stark daran interessiert, daß Israel auf anderen Wegen mit amerikanischen Waffen versorgt wurde. Israel benötigte Jagdflugzeuge, Transportflugzeuge, 10,5-cm-Geschütze, gepanzerte Mannschaftstransportwagen und vor allem Kampf- und Schützenpanzerwagen. Die Bundesrepublik verfügte über alle diese Waffen, vornehmlich amerikanische Fabrikate, die sie entweder zum Ausgleich für die Stationierungskosten der US-Truppen den Amerikanern abkaufte oder aber in Lizenz selbst herstellte. Unter dem Druck Kennedys trat das Strauß-Peres-Abkommen in Kraft. Die ersten deutschen Panzer trafen Ende Juni 1963 in Haifa ein. Es erwies sich allerdings als schwierig, das Übereinkommen auf die Dauer geheimzuhalten; allzu viele Menschen waren daran beteiligt. Die ODESSA erfuhr bereits gegen Ende des Jahres 1962 davon und informierte umgehend die Ägypter, mit denen ihre Agenten in Kairo aufs engste zusammenarbeiteten.
Im Herbst 1963 änderte sich die Situation. Konrad Adenauer trat am 15. Oktober zurück und ging in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde Ludwig Erhard, als »Vater des Wirtschaftswunders« eine erstklassige Wahllokomotive, in Fragen der Außenpolitik jedoch schwach und wankelmütig. Selbst zu Adenauers Zeiten hatte es eine lautstarke Gruppe innerhalb des Kabinetts gegeben, die für einen Aufschub des Waffenabkommens mit Israel war und es lieber gesehen hätte, wenn die Lieferungen gestoppt worden wären, noch bevor sie begonnen hatten. Der alte Kanzler hatte sie mit ein paar scharfen Sätzen zum Schweigen gebracht, und seine Macht erwies sich als so groß, daß sie stumm blieben.
Nach Erhards Amtsübernahme gewannen die Gegner des Waffenabkommens, die vor allem von dem an guten Beziehungen zur arabischen Welt interessierten Auswärtigen Amt unterstützt wurden, neuerlich an Einfluß. Erhard, der sich bereits den Spitznamen »Gummilöwe« zugezogen hatte, zögerte. Aber der amerikanische Präsident war nach wie vor entschlossen, Israel über Westdeutschland Waffen zukommen zu lassen.
Und dann wurde Kennedy ermordet. In den Morgenstunden des 23. November lautete die große Frage für die Gegner des Waffenabkommens daher ganz einfach: Würde auch Kennedys Amtsnachfolger den amerikanischen Druck auf Bonn weiterhin ausüben, oder würde er dem zaudernden Kanzler Erhard gestatten, von dem Abkommen zurückzutreten? Wie sich zeigen sollte, wich Präsident Lyndon Johnson in dieser Hinsicht um keinen Deut von der Politik seines Vorgängers ab; aber zu jenem Zeitpunkt setzte man in Kairo noch große Hoffnungen darauf, daß er es tat.
Der Gastgeber jener geselligen Zusammenkunft im Rauchsalon der Villa vor den Toren Kairos goß sich einen weiteren Whisky ein, nachdem er die Gläser seiner Gäste nachgefüllt hatte. Er hieß Wolfgang Lutz, war 1921 in Mannheim geboren, hatte in der deutschen Wehrmacht zuletzt den Rang eines Majors bekleidet und war 1961 nach Kairo emigriert, wo er eine Reitschule eröffnete. Blond, blauäugig, mit kühner Adlernase, war er fanatischer Judenhasser und wurde von den politisch einflußreichen Gesellschaftskreisen Kairos und der vielfach aus Nazis bestehenden deutschen Kolonie hofiert.
Er stellte die Whiskyflasche wieder zu den anderen Flaschen auf dem Getränketisch und wandte sich mit einem breiten Lächeln seinen Gästen zu. Der Gedanke, daß dieses Lächeln falsch sein könnte, wäre seinen Gästen absurd erschienen. Und doch war es ein falsches Lächeln.
Lutz war zwar in Mannheim geboren, jedoch 1933 im Alter von zwölf Jahren mit seinen Eltern nach Israel emigriert. Er hieß Ze’ev, war Rav-Seren (Major) der israelischen Armee und zu jenem Zeitpunkt der führende Agent des israelischen Geheimdienstes in Ägypten. Am 28. Januar 1965 wurde er verhaftet. Bei einer Hausdurchsuchung hatte man im Badezimmer einen versteckten Geheimsender gefunden. Am 26. Juni des gleichen Jahres wurde er zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt. Nach Beendigung des Sechstagekrieges von 1967 ließ man ihn im Rahmen eines Austauschverfahrens, bei dem Tausende von ägyptischen Kriegsgefangenen repatriiert wurden, frei. Am 4. Februar 1968 betrat er dann gemeinsam mit seiner Frau auf dem israelischen Flugplatz Lod erstmals wieder heimatlichen Boden.
Aber alles das – die Verhaftung, die Folterungen, die wiederholten Vergewaltigungen seiner Frau – lag in der Nacht nach Kennedys Tod noch in ferner Zukunft. Lutz hob sein Glas und prostete den vier lächelnden Gesichtern vor ihm zu. Er konnte es kaum erwarten, daß seine Gäste sich endlich verabschiedeten, denn eine Bemerkung, die einer von ihnen während des Essens gemacht hatte, war von allergrößter Bedeutung für sein Land, und er wünschte verzweifelt, allein zu sein, ins Badezimmer hinaufzugehen, den Geheimsender aus einem Versteck zu holen und eine Meldung nach Tel Aviv zu übermitteln. Aber er zwang sich zu einem Lächeln.
»Tod allen Judenfreunden«, sagte er und leerte sein Glas.
Peter Miller wachte kurz vor 9 Uhr auf und räkelte sich genießerisch unter der gewaltigen Daunendecke, die über das Doppelbett gebreitet war. Sigi schlief. Er spürte die Wärme ihres Körpers und drängte sich eng an sie. Der feste Druck ihres Gesäßes gegen seinen Bauch erregte ihn.
Sigi, die erst gegen 5 Uhr morgens heimgekommen war, maunzte schlaftrunken und rückte unwillig von ihm ab.
»Lag mich in Ruhe«, murmelte sie, ohne aufzuwachen.
Miller seufzte, drehte sich auf den Rücken, hob den Arm vor die Augen und schaute im Zwielicht auf das Zifferblatt seiner Armbanduhr. Dann schwang er sich aus dem Bett, warf sich den Bademantel über, ging barfuß ins Wohnzimmer und zog die Vorhänge auf. Kaltes, graues Novemberlicht fiel in den Raum, und Miller kniff die Augen zusammen. Schläfrig blickte er auf den Steindamm hinunter. Es war Sonntagvormittag und der Verkehr auf dem regennassen Asphalt nur schwach. Miller gähnte und ging in die Küche, um sich die erste Tasse Kaffee zu machen, der im Lauf des Tages noch viele andere folgen würden. Seine Mutter und Sigi hielten ihm vor, ausschließlich von Kaffee und Zigaretten zu leben.
Während er in der Küche seinen Kaffee trank und die erste Zigarette rauchte, überlegte er, ob an diesem Tag irgendwelche unaufschiebbaren Dinge zu erledigen waren. Es fiel ihm nichts Wichtiges ein. Die Zeitungen und Illustrierten würden auf Tage oder gar Wochen nur an Kennedy-Berichten und Kennedy-Reportagen interessiert sein, und eine irgendwie interessante Story, hinter der er hätte herjagen müssen, gab es auch nicht. Im übrigen waren am Wochenende kaum Leute in den Redaktionen anzutreffen, und zu Hause ließen sie sich nur ungern stören. Er hatte kürzlich eine Serie über die Unterwanderung des Vergnügungsgewerbes auf St. Pauli durch französische, österreichische und italienische Gangster und Zuhälter abgeschlossen, die gut angekommen, aber noch nicht bezahlt worden war. Einen Augenblick lang erwog er, ob er sich das Honorar abholen sollte, überlegte es sich dann jedoch anders. Sie würden schon rechtzeitig zahlen, und einstweilen hatte er noch genügend Geld. Der letzte Kontoauszug, der ihm vor drei Tagen zugeschickt worden war, besagte, daß er noch 5000 DM auf der Bank hatte. Damit konnte er eine Weile auskommen.
»Das Schlimme mit dir, Freundchen«, sagte er zu seinem Spiegelbild, das ihm aus der von Sigi blitzblank geputzten Bratpfanne entgegensah, »ist nur, daß du faul bist.« Er ging zum Spülbecken und wusch seine Kaffeetasse mit dem Zeigefinger aus.
Als er vor zehn Jahren die Schule mit dem Abitur verließ, hatte ihn ein Lehrer nach seinen Plänen gefragt.
»Ich will ein reicher Nichtstuer werden«, hatte er geantwortet, und mit neunundzwanzig Jahren hielt er dieses Ziel, obschon er es nicht erreicht hatte und vermutlich auch niemals erreichen würde, noch immer für erstrebenswert.
Er trug das Transistorradio ins Badezimmer, schloß die Tür, damit Sigi nicht aufwachte, und hörte die Nachrichten, während er duschte und sich rasierte. Die wichtigste Meldung besagte, daß man in Dallas inzwischen einen Verdächtigen festgenommen hatte. Die Nachrichten handelten fast nur von dem Attentat.
Miller trocknete sich ab, ging in die Küche zurück und machte weiteren Kaffee, diesmal zwei Tassen. Er trug sie ins Schlafzimmer, stellte sie auf das Tischchen neben dem Bett, warf den Bademantel ab und schlüpfte nochmals unter die Decke, unter der nur Sigis Haarschopf hervorschaute.
Sigi war als Schülerin eine glänzende Leichtathletin gewesen; sie hätte, so erzählte sie, alle Chancen gehabt, in die Olympiamannschaft zu kommen, wenn ihr Busen sich nicht in einer Weise entwickelt hätte, die sich beim Training als hinderlich erwies und eine gesicherte Unterbringung in einem Sportdreß nicht mehr gewährleistete. Sie machte Abitur, studierte und war dann zunächst Sportlehrerin an einer Hamburger Mädchenschule. Der Berufswechsel ein Jahr später hatte ebenso simple wie einleuchtende wirtschaftliche Gründe: Als Striptease-Tänzerin verdiente sie das Fünffache ihres Lehrerinnengehalts.
Es machte ihr nichts aus, sich in Nachtklubs splitternackt auszuziehen, aber lüsterne Bemerkungen über ihren Körper waren ihr außerordentlich unangenehm, wenn sie von einem Gast gemacht wurden, den sie dabei sehen konnte.
»Die Sache ist die«, hatte sie dem amüsierten Miller zu Beginn ihrer Bekanntschaft mit größter Ernsthaftigkeit klarzumachen versucht, »daß ich die Zuschauer nicht erkennen kann, wenn ich auf der Bühne im Scheinwerferlicht stehe, und deswegen macht es mir nichts aus. Ich glaube, ich würde sofort von der Bühne rennen, wenn ich sie sehen könnte.«
Das hielt sie jedoch nicht davon ab, sich an einen der Tische im Zuschauerraum zu setzen, sobald sie wieder angezogen war, um sich von einem Gast zum Champagner einladen zu lassen. Ein anderes Getränk gab es nicht, und der Champagner wurde in halben oder ganzen Flaschen (meist in ganzen) serviert. Sigi war an dem Erlös jeder Flasche, zu deren Konsum sie die Gäste animierte, mit 15 Prozent beteiligt. Zwar versprachen sich die Gäste in der Regel mehr davon als bloß eine Stunde lang in andächtiger Bewunderung in das tiefe Tal zwischen ihren Brüsten starren zu dürfen. Aber alle Hoffnungen erwiesen sich als trügerisch. Sigi war ein freundliches und verständnisvolles Mädchen und reagierte auf die plumpen Aufmerksamkeiten der Gäste mit nachsichtigem Bedauern.
»Arme Kerle sind das«, bemerkte sie einmal zu Miller, »was denen fehlt, ist eine nette Frau, die zu Hause auf sie wartet.«
»Was soll denn das heißen – arme Kerle?« protestierte Miller. »Das sind geile Böcke, die die Taschen voller Geld haben, mit dem sie um sich werfen können.«
»Aber das brauchten sie bestimmt nicht, wenn sie jemanden hätten, der sich um sie kümmert«, entgegnete Sigi, und was das betraf, war ihre weibliche Logik unwiderlegbar.
Miller hatte sie ganz zufällig entdeckt, als er Madame Koketts Bar neben dem Café Keese an der Reeperbahn aufsuchte, um mit dem Eigentümer, einem seiner alten Bekannten und bewährten Kontaktleute auf St. Pauli, ein paar Gläschen zu kippen und ein wenig zu schwätzen. Sie war ein großes Mädchen, annähernd einsachtzig, und hatte eine Figur, die für eine kleinere Person allzu kurvenreich gewesen wäre. Sie strippte mit den üblichen Gesten, die sinnlich wirken sollten, und zog dabei den obligaten Schmollmund und machte Schlafzimmeraugen. Miller kannte alles das zur Genüge und schlürfte ungerührt seinen Drink. Als aber dann der Büstenhalter fiel, vergaß er, das schon halb erhobene Glas zum Mund zu führen, und konnte nur noch starren und staunen. Sein Gastgeber blickte ihn lächelnd an.
»Die ist vielleicht gebaut, was?« meinte er.
Die doppelseitigen, ausklappbaren Damen im Playboy waren dagegen Fälle besorgniserregender Unterentwicklung. Wo andere einen Büstenhalter brauchten, hatte dieses Mädchen da seine Muskeln, die alles hübsch hoch und straff hielten.
Als der Auftritt beendet war und der Applaus einsetzte, gab das Mädchen die unpersönliche Pose der professionellen Tänzerin auf und machte eine scheue, verschämte Verbeugung vor dem Publikum. Im nächsten Augenblick verzog sich ihr Mund zu einem entwaffnenden breiten Grinsen, das an den Gesichtsausdruck eines noch nicht gänzlich abgerichteten jungen Jagdhundes denken ließ, der entgegen allen Wetten einen soeben geschossenen Fasan apportiert hat. Es war dieses Grinsen, das es Miller angetan hatte, und nicht ihr Strip oder ihre Figur. Er fragte den Besitzer, ob er sie wohl zu einem Drink einladen könne, und der ließ sie rufen.
Da Miller in Gesellschaft des Chefs war, bestellte sie nicht Champagner, sondern bat um einen Gin-Fizz. Miller ertappte sich bei der Vorstellung, wie angenehm es sein müßte, sie ständig um sich zu haben, und fragte sie, ob er sie später heimfahren dürfe. Sichtlich zögernd stimmte sie zu. Miller ging sehr überlegt vor und machte an jenem Abend sonst keinerlei Annäherungsversuche. Es war Frühlingsanfang, und als die Bar schloß, erschien das Mädchen in einem alles andere als modischen Dufflecoat, was er für eine vorsätzliche Demonstration hielt.
Sie tranken einen Kaffee miteinander und unterhielten sich über alles mögliche, wobei sie zusehends gelöster wurde und munter drauflos plauderte. Er erfuhr, daß sie Schlagermusik und Kunst liebte, gern an der Alster spazierenging und viel für Hausarbeit und Kinder übrig hatte. Von da an gingen sie regelmäßig an ihrem einzigen freien Abend in der Woche zusammen aus, aßen miteinander zu Abend oder gingen ins Kino.
Nach drei Monaten ging Miller mit ihr ins Bett, und bald darauf schlug er ihr vor, zu ihm zu ziehen, wenn sie Lust dazu habe. Mit der Zielstrebigkeit, die sie den wenigen Dingen gegenüber an den Tag legte, auf die es im Leben ankam, war sie sich bereits darüber klargeworden, daß sie Peter heiraten wollte. Das Problem war lediglich, ob sie am sichersten zum Ziel kam, wenn sie nicht mit ihm schlief, oder gerade dadurch, daß sie es tat. Da ihr jedoch nicht entging, daß er sich um eine ausreichende Belegung der zweiten Hälfte seiner Matratze nicht zu sorgen brauchte, wenn er nur wollte, zog sie zu ihm. Wenn sie ihm das Leben so angenehm wie möglich machte, würde er schon bald von selbst darauf kommen, sie zu heiraten. Ende November waren es sechs Monate, daß sie miteinander lebten.
Miller hatte zwar keinen sonderlichen Sinn für Heim und Herd, aber ihm entging nicht, daß sie ihm auf sehr angenehme Weise den Haushalt führte, und im Bett war sie mit Vergnügen bei der Sache. Sie sprach nie direkt vom Heiraten, versuchte aber, ihm ihren Herzenswunsch auf andere Weise zu signalisieren. Wenn sie an sonnigen Tagen durch die Grünanlagen an der Alster schlenderten, schloß sie, unter wohlwollenden elterlichen Blicken, zuweilen auch einmal Freundschaft mit einem der dort spielenden kleinen Jungen.
»O Peter, ist der nicht süß?«
Miller murmelte dann: »Ja, ja, wirklich, das ist er.«
Danach redete sie zur Strafe etwa eine Stunde lang nicht mit ihm, weil er den Wink nicht zur Kenntnis genommen hatte. Aber sie waren sehr glücklich miteinander, besonders Peter Miller, dem das Arrangement ausnehmend gut gefiel. Es bot ihm die Vorzüge der Ehe und insbesondere die Freuden regelmäßiger Liebe ohne die lästigen Bindungen der Ehe.
Er trank seine Tasse Kaffee halb aus und kroch ganz unter die Decke. Sigi schlief immer noch. Der Rücken war ihm zugekehrt.
Er legte die Arme um sie und liebkoste sanft ihre Scham. Davon würde sie langsam aufwachen. Nach einer Weile begann sie leise vor Behagen zu stöhnen und drehte sich auf den Rücken. Er beugte sich über sie und küßte ihre Brüste. Sie seufzte, noch immer schlaftrunken. Langsam tasteten ihre Hände über seinen Rücken, und zehn Minuten später liebten sie sich, stöhnend vor Lust und erschauernd.
»Das ist ja eine niederträchtige Art, mich aufzuwecken«, beschwerte sich Sigi hinterher.
»Es gibt schlimmere Arten«, meinte Miller.
»Wie spät ist es?«
»Fast zwölf«, log Miller, der wußte, daß sie den nächstbesten Gegenstand nach ihm werfen würde, wenn sie erfuhr, daß es erst halb elf war und er sie nur fünf Stunden hatte schlafen lassen. »Schlaf ruhig weiter, wenn du willst.«
»Mmmm. Danke, Lieber. Du bist so gut zu mir«, murmelte Sigi und war im nächsten Augenblick schon wieder eingeschlafen.
Miller hatte den restlichen Kaffee ausgetrunken und wollte gerade ins Badezimmer gehen, als das Telefon klingelte. Er eilte ins Wohnzimmer und nahm den Hörer ab.
»Miller.«
»Peter?«
»Ja, wer ist da?«
»Karl.«
Er war noch ein wenig benommen und erkannte die Stimme nicht gleich.
»Karl?«
»Karl Brandt«, wiederholte die Stimme. »Was ist los mit dir, schläfst du etwa noch?«
Miller riß sich zusammen.
»Ah ja. Entschuldige, Karl, aber ich bin eben erst aufgestanden. Was gibt’s?«
»Hör mal, es ist wegen des toten Juden. Ich muß mit dir sprechen.«
Miller war perplex.
»Welcher tote Jude?«
»Der in Altona, der sich gestern abend mit Gas vergiftet hat. Kannst du dich noch so weit zurückerinnern?«
»Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an gestern abend«, sagte Miller. »Ich wußte nur nicht, daß es ein Jude war. Hast du irgend etwas über ihn herausgekriegt?«
»Ich muß mit dir sprechen«, sagte der Kriminalinspektor. »Aber nicht am Telefon. Können wir uns irgendwo treffen?«
Millers Reportergehirn schaltete jetzt blitzschnell. Wer etwas mitzuteilen hat, dies aber nicht am Telefon tun will, hält seine Information meist für sehr wichtig. Und wenn schon ein Kriminalinspektor sich so übervorsichtig verhielt, konnte es sich kaum um eine Bagatelle handeln.
»Selbstverständlich«, erklärte Miller. »Bist du über Mittag frei?«
»Das ließe sich einrichten«, sagte Brandt.
»Gut«, sagte Miller. »Ich gebe auch einen aus, wenn du meinst, daß da was Lohnendes drin ist für mich.« Er nannte ein kleines Restaurant am Gänsemarkt, und sie verabredeten sich für ein Uhr. Miller konnte sich nicht vorstellen, daß der Selbstmord eines alten Mannes in einer schäbigen Mietswohnung in Altona – ob es nun ein Jude war oder nicht – eine brauchbare Story abgeben sollte.
Während des Mittagessens schien der junge Kriminalinspektor nicht davon sprechen zu wollen, erst beim Kaffee sagte er unvermittelt: »Der Mann gestern abend.«
»Ja«, sagte Miller. »Was ist mit ihm?«
»Du weißt, was die Nazis während des Krieges und auch schon vor dem Krieg mit den Juden gemacht haben.
»Allerdings«, sagte Miller. »Das haben sie uns auf der Schule ja ausführlich erzählt.«
Er war verwirrt und peinlich berührt. Wie die meisten jungen Deutschen seiner Generation hatte er mit vierzehn oder fünfzehn Jahren in der Schule gelernt, daß er zusammen mit allen seinen Landsleuten auf ewig von den entsetzlichen Kriegsverbrechen gebrandmarkt sei, die Deutsche begangen hatten. Damals hatte er das akzeptiert, ohne überhaupt zu begreifen, wovon die Rede war.
Lange Zeit war er nicht dahintergekommen, was die Lehrer in der ersten Zeit nach dem Krieg damit eigentlich gemeint hatten. Natürlich konnte man Lehrer und Eltern danach fragen, aber die schienen nie eine Antwort zu wissen. Erst Jahre später, als er zum jungen Mann heranwuchs, hatte er das eine oder andere darüber gelesen, und obschon er das, was er dabei erfuhr, abscheulich fand, vermochte er sich nicht persönlich betroffen zu fühlen. Das alles war in einer ganz anderen Zeit und in einer ganz anderen Welt geschehen und lag lange, sehr lange zurück.
Er war nicht dabeigewesen, als es geschah, sein Vater war nicht dabeigewesen und auch seine Mutter nicht. Irgendeine innere Stimme hatte ihm gesagt, daß Peter Miller mit alldem nichts zu schaffen habe, und so waren die Namen, die Daten und alle Einzelheiten für ihn immer abstrakt geblieben. Er wußte nicht, warum Karl Brandt das Thema zur Sprache brachte.
Brandt rührte in seinem Kaffee. Offenkundig war er ebenfalls um Worte verlegen und schien nicht zu wissen, wie er beginnen sollte.
»Der alte Mann gestern abend«, sagte er schließlich, »das war ein deutscher Jude. Er hat viele Jahre im Konzentrationslager verbracht.«
Miller rief sich die Züge des Toten auf der Bahre von gestern abend ins Gedächtnis zurück. Hatten sie alle so ausgesehen, als sie starben? Aber das war absurd. Der Mann mußte vor nunmehr achtzehn Jahren von den Alliierten befreit worden sein; er hatte überlebt und ein ansehnliches Alter erreicht. Aber die Erinnerung an das Gesicht ließ sich nicht einfach fortwischen, und plötzlich wußte Miller, daß es ihn gestern nacht im Traum verfolgt hatte. Er war, zumindest bewußt, nie jemandem begegnet, der im Konzentrationslager gesessen hatte. Und selbstverständlich war er auch niemals einem dieser SS-Massenmörder begegnet, das stand fest. Das hätte er gespürt. Einen solchen Mann würde man schließlich noch von seinen Mitmenschen unterscheiden können.
Er dachte an den Eichmann-Prozeß in Jerusalem, der soviel Aufsehen erregt hatte. Wochenlang waren die Zeitungen voll davon. Ihm fiel das Gesicht hinter der schußsicheren Glasscheibe ein, und er erinnerte sich, daß es die Alltäglichkeit, die deprimierende Alltäglichkeit dieses Gesichts gewesen war, was ihn damals am meisten beschäftigt hatte. Erst die Prozeßberichte hatten ihm eine vage Vorstellung davon vermittelt, wie die SS vorgegangen war und wie es überhaupt zu all dem hatte kommen können. Aber es war ausschließlich um Dinge gegangen, die sich in Polen, in Rußland, Ungarn und der Tschechoslowakei abgespielt hatten und weit zurücklagen. Er selbst hatte nichts damit zu tun.
Das Gespräch war ihm unbehaglich.
»Na, und?« fragte er.
Statt zu antworten, holte Brandt aus seinem Attachékoffer ein in braunes Packpapier eingewickeltes Päckchen hervor und schob es Miller über den Tisch zu.
»Der alte Mann hat ein Tagebuch hinterlassen. So alt war er übrigens gar nicht. Sechsundfünfzig. Offenbar hat er die Aufzeichnungen, die er im KZ machte, in seinen Fußlappen versteckt. Nach dem Krieg hat er sie dann alle übertragen. Sie bilden den Kern des Tagebuchs.«
Miller betrachtete das Paket mit mäßigem Interesse.
»Wo hast du es gefunden?«
»Es lag neben seiner Leiche. Ich habe es an mich genommen und gestern nacht durchgelesen.«
»Schlimm?«
»Grauenhaft. Ich habe nicht geahnt, daß es so entsetzlich war. Was die mit denen gemacht haben, meine ich.«
»Und was soll ich damit anfangen?«
Brandt zuckte mit den Achseln.
»Ich dachte, du könntest vielleicht irgendwas draus machen«, sagte er. »Etwas für die Zeitung oder so.«
»Wem gehört das Tagebuch?«
»Streng genommen Taubers Erben. Aber die sind wohl kaum ausfindig zu machen. Also bleibt es bei der Polizei und kommt zu den Akten. Du kannst es haben, wenn du willst. Sag nur keinem, daß du es von mir hast. Ich will keinen Ärger haben.«
Miller zahlte, und sie traten auf die Straße hinaus.
»Also gut, ich werde es lesen. Aber ich kann dir nicht versprechen, daß da eine große Sache draus wird. Vielleicht reicht es für einen Illustriertenartikel.
»Du bist doch ein zynischer Hund«, sagte Brandt mit einem schwachen Lächeln.
»Nein«, sagte Miller. »Aber ich interessiere mich wie die Mehrzahl meiner Zeitgenossen nun einmal hauptsächlich für das, was hier und heute passiert. Was ist los mit dir? Ich hätte eigentlich angenommen, daß zehn Jahre bei der Kripo ausreichen müßten, um einen sturen, abgebrühten Bullen aus dir zu machen. Diese Geschichte hat dir wohl echt zugesetzt, was?«
Brandt lächelte nicht mehr. Er blickte auf das Päckchen unter Millers Arm und nickte zögernd.
»Ja. Ja, das hat sie. Daß es so war, wie Tauber schreibt, habe ich nie wahrhaben wollen. Außerdem ist es eben nicht so, daß das alles längst der Geschichte angehört und damit vorbei und erledigt ist. Diese Story da endete gestern abend hier in Hamburg. Wiedersehen, Peter.«
Er nickte Miller zu, wandte sich um und ging rasch fort. Wie sehr er sich, was das Ende der Geschichte betraf, getäuscht hatte, konnte er nicht ahnen.
Kapitel 2
Kurz nach 15Uhr war Peter Miller wieder in seiner Wohnung. Er warf das in braunes Packpapier eingeschlagene Manuskript auf den Wohnzimmertisch und ging in die Küche, um sich eine große Kanne Kaffee zu machen, bevor er mit der Lektüre des Tagebuchs begann.
Dann machte er es sich in seinem Lieblingssessel bequem, stellte sich eine Tasse Kaffee in Reichweite, zündete eine Zigarette an und öffnete das Päckchen. Das Tagebuch steckte in einem Lose-Blatt-Hefter, dessen Pappumschlag mit einem mattschwarzen Kunststoff überzogen war. Die ringförmigen Klammern im Heftrücken konnte man öffnen und schließen und so die Blätter des Tagebuchs herausnehmen oder auch, falls erforderlich, weitere einfügen. Der Hefter enthielt einhundertfünfzig engbeschriebene Blätter. Die Schreibmaschine mußte recht altersschwach gewesen sein, denn einige Buchstaben tanzten teils ober-, teils unterhalb der Zeile aus der Reihe und andere waren beschädigt oder bis zur Unkenntlichkeit abgenutzt. Die Seiten mußten größtenteils schon vor Jahren geschrieben worden sein, denn sie waren zwar säuberlich und glatt, aber doch zu einem großen Teil sehr vergilbt. Die ersten und die letzten Seiten waren jedoch neu und offenbar erst vor wenigen Tagen beschrieben worden: es war das Vorwort und ein Epilog. Aus der Datierung ging hervor, daß beides am 21.November – also erst vor zwei Tagen – verfaßt worden war. Der Mann, nahm Miller an, hatte diese Seiten wohl geschrieben, als er bereits entschlossen war, sich das Leben zu nehmen.
Miller überflog ein paar Sätze auf der ersten Seite und stellte fest, daß sie in klarem, präzisem Deutsch geschrieben waren und den Stil eines gebildeten, kultivierten Mannes verrieten. Auf dem vorderen Buchdeckel war ein weißes viereckiges Stück Papier aufgeklebt und darüber, um es sauberzuhalten, ein ebenfalls viereckiges, aber etwas größeres Stück Zellophanpapier. Auf dem weißen Papier stand in großen, mit schwarzer Tinte geschriebenen Blockbuchstaben: »Tagebuch von Salomon Tauber«. Miller setzte sich in seinem Sessel zurecht, schlug die erste Seite auf und begann zu lesen.
TAGEBUCH VON SALOMON TAUBER
Vorwort
Mein Name ist Salomon Tauber, ich bin Jude und im Begriff zu sterben. Ich habe beschlossen, meinem Leben ein Ende zu setzen, weil es wertlos geworden ist und mir nichts mehr zu tun bleibt. Was ich aus meinem Leben zu machen versucht habe, ist mir nicht gelungen: Meine Anstrengungen sind vergebens geblieben. Denn das Böse, das ich gesehen habe, hat nicht nur überlebt, es blüht und gedeiht – einzig das Gute ist dahingesunken in Staub und Spott. Die Freunde, die ich gekannt habe, die Dulder und Opfer, sind tot, und ihre Peiniger leben überall um mich herum. Bei Tage sehe ich ihre Gesichter in den Straßen, und in der Nacht sehe ich das Gesicht meiner Frau Esther, die auch schon lange tot ist. Ich bin nur deswegen so lange am Leben geblieben, weil es etwas gab, was ich tun wollte, etwas, was ich noch sehen wollte, und jetzt weiß ich, daß mir das nie vergönnt sein wird.
Ich hege keinen Haß und keine Bitterkeit gegen das deutsche Volk, denn es ist ein gutes Volk. Völker sind nicht böse; nur einzelne Menschen sind es. Der englische Philosoph Burke hatte recht, als er schrieb: »Ich sehe keine Möglichkeit, einen Schuldspruch für eine ganze Nation zu fällen.« Es gibt keine Kollektivschuld. Schon die Bibel berichtet, daß der Herr Sodom und Gomorrha wegen der Lasterhaftigkeit der Männer, die darin lebten, zerstören und auch ihre Frauen und Kinder nicht verschonen wollte, daß aber ein gerechter Mann unter ihnen lebte, der wegen seiner Rechtschaffenheit vor dem Zorn des Herrn bewahrt blieb. Das beweist, daß Schuld ebenso wie Erlösung an den einzelnen gebunden ist.
Als ich die Konzentrationslager von Riga und Stutthof und den Todesmarsch nach Magdeburg überlebt hatte und die alliierten Truppen im April 1945 meinen Körper – einen lebenden Leichnam – befreiten und nur meine Seele in Ketten ließen, da gab es in mir nur Haß auf die Welt. Ich haßte die Menschen und die Bäume und die Steine, denn sie hatten sich gegen mich verschworen und mich leiden gemacht. Vor allem aber haßte ich die Deutschen. Ich fragte mich damals, wie ich mich schon in den vier Jahren zuvor immer wieder gefragt hatte, warum der Herr sie nicht strafte, sie nicht – bis zum letzten Mann, Weib und Kind – niedermachte und ihre Städte und Häuser für immer vom Angesicht der Erde tilgte. Und weil Er es nicht tat, haßte ich auch Ihn, haderte mit Ihm, weil Er mich und mein Volk, das Er zu dem Glauben verleitet hatte, auserwählt zu sein, verlassen hatte, ja, ich erklärte, es gibt Ihn nicht.
Aber in den Jahren, die seither vergangen sind, habe ich wieder gelernt zu lieben; die Steine und die Bäume zu lieben, den Himmel über ihnen und den Strom, an dem diese Stadt liegt; ich liebe die herrenlosen Hunde und Katzen, das Gras, das aus den Fugen des Kopfsteinpflasters sprießt, und die Kinder, die auf der Straße vor mir weglaufen, weil ich so häßlich bin. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Es gibt ein französisches Sprichwort: »Alles verstehen heißt alles vergeben.« Wenn man die Menschen versteht, ihre Leichtgläubigkeit und ihre Ängste, ihre Gelüste und ihre Gier nach Macht, ihre Unwissenheit und ihre Unterwürfigkeit gegenüber dem Mann, der am lautesten schreit, wenn man das alles begreift, kann man ihnen vergeben. Ja, man kann ihnen selbst das vergeben, was sie getan haben. Aber vergessen kann man es nicht.
Es gibt einige Männer, deren Schuld über jedes begreifliche Maß hinausgeht und daher auch nicht vergeben werden kann. Und hier ist unser Versagen zu suchen. Denn sie sind noch unter uns, sie leben in den Städten mit uns, sie arbeiten in den Büros mit uns, essen mit uns in den Kantinen, sie lächeln uns an und schütteln uns die Hand und reden anständige Männer mit »Kamerad« an. Daß sie – beileibe nicht als Ausgestoßene, sondern als geachtete Mitbürger – weiterleben und mit ihrer ungesühnten Schuld ein ganzes Volk weiterhin in Verruf bringen dürfen, das ist unsere wahre Niederlage. Und diese Niederlage haben wir selbst verschuldet, du und ich, weil wir versagt haben, jämmerlich versagt.
Im Lauf der Zeit fand ich zu meiner Liebe zum Herrn zurück, und ich bat ihn um Vergebung für die Sünden wider seine Gebote. Ich habe mich vieler Sünden schuldig gemacht.
Shema Israel, Adonai elohenu, Adonai ehod …
Die ersten zwanzig Seiten des Tagebuches schilderten Taubers Kindheit und seine frühe Jugend in Hamburg. Es berichtet von seinem Vater, der aus der Arbeiterklasse stammte und im Ersten Weltkrieg mit höchsten Auszeichnungen dekoriert wurde, sowie vom Tod seiner Eltern im Jahre 1933, kurz nach der Machtergreifung Hitlers. Ende der dreißiger Jahre hatte er ein Mädchen namens Esther geheiratet, arbeitete in einem Architekturbüro und blieb dank der Intervention seines Arbeitgebers bis 1941 von rassischer Verfolgung verschont. In Berlin, wohin er zu einer Besprechung mit einem Bauherrn gereist war, wurde er festgenommen. Nach einem Aufenthalt in einem Durchgangslager wurde er in einem verplombten Viehwagen mit anderen jüdischen Leidensgenossen in den Osten abtransportiert.
Ich erinnere mich nicht genau daran, nach wie vielen Tagen und Nächten der Zug schließlich am Ziel war. Vielleicht sechs Tage und sieben Nächte, seit wir in Berlin verladen worden waren und man die Waggons verriegelt hatte. Plötzlich stand der Zug. Das Licht, das durch die Ritzen drang, verriet mir, daß es draußen Tag sein mußte. Mir war übel vor Erschöpfung und dem Gestank im Waggon; in meinem Kopf drehte sich alles.
Von draußen hörte ich Rufe; die Riegel wurden zurückgelegt und die Türen aufgeschoben. Es war gut, daß ich, der einmal ein weißes Hemd und gebügelte Hosen getragen hatte, mich nicht selbst sehen konnte. (Krawatte und Jackett, die ich in dem stickigen Viehwagen ausgezogen hatte, waren mir längst abhanden gekommen.) Der Anblick, den meine Leidensgenossen boten, war schlimm genug.
Als das gleißend helle Tageslicht in den Waggon fiel, schlugen sie die Arme vor die Augen und schrien vor Schmerz. Beim Öffnen der Türen hatte ich sofort die Augen zugekniffen, um sie zu schützen. Bei dem Gedränge der Körper leerte sich der Waggon zur Hälfte wie von selbst; die Menschen stürzten in einer stinkenden, taumelnden Masse auf den Bahnsteig. Ich hatte neben den Türen im hinteren Teil des Waggons gestanden und trat, vorsichtig durch halbgeschlossene Lider in das blendende Tageslicht blinzelnd, aufrecht auf den Bahnsteig hinunter.