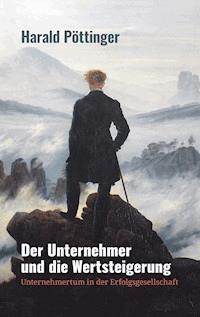
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Werte verändern sich, während Wert bleibt. Das Konzept des wertsteigernden Unternehmertums stellt den Unternehmer ins Zentrum. Als vitale und komplexe Persönlichkeit lässt er sich nicht auf eine emotionslose Gewinnmaximierungsmaschine reduzieren. Er wird mitsamt seiner Persönlichkeit, Präferenzstrukturen und Einbettung in ein gesellschaftliches Umfeld zum Unternehmen in Beziehung gesetzt. Wertsteigerndes Unternehmertum ist die Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel im 21. Jahrhundert und die damit verbundenen unternehmerischen Herausforderungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Harald Pöttinger ist Experte für Unternehmenswert-Steigerung, die Unternehmerpersönlichkeit hinter der Alpine Group of Companies und Autor. Er steigert den Wert von Unternehmen wie kein anderer. Denn: Werte verändern sich, während Wert bleibt. Harald Pöttinger steht für faires Verhalten gegenüber Geschäftspartnern, pragmatisches Agieren und den Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit zur Zielerreichung. Seit 30 Jahren richtet sich sein Angebot an Unternehmer, Manager und Investoren, die sich nicht mit dem Mittelmaß zufriedengeben, sondern in einer Zeit globaler Umwälzungen Chancen von nie dagewesener Größe nutzen wollen.
Die Unternehmen der Alpine Group of Companies wurden von Harald Pöttinger gegründet und beschäftigen sich mit Financal and Professional Services rund um die Themenfelder Beratung, Finanzierung und Investition.
Während Alpine Equity® sich dem Themenkomplex Venture Capital und Private Equity verschrieben hat, ist Alpine Value Management® eine Gesellschaft, die sich als Beratungsschwerpunkt der Steigerung des Unternehmenswerts ihrer Kunden widmet. Alpine Accounting & Advisory wiederum deckt die Bereiche Buchhaltung, Bilanzierung, Planung, Controlling und rechnungswesenbasierte Unternehmensberatung ab.
Vorwort, Dank und Widmung
Dieses Buch entstand im Wesentlichen 2016 aus einer Anregung meines Sohnes Ralph und aufgrund eines von mir wahrgenommenen Mangels an Büchern von Unternehmern für Unternehmer. 2017 wurde es darüber hinaus zum Rückgrat einer von uns beiden gemeinsam geleiteten Lehrveranstaltung an der Wirtschaftsuniversität Wien zum Thema „Corporate Finance für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)“.
Ich hoffe, dass es in dieser Doppelfunktion sowohl die unternehmerischen Persönlichkeiten der Gegenwart begeistern kann als auch jene ansprechen, die in Zukunft als proaktive Gestalter die Geschicke unserer Wirtschaft lenken wollen.
Mein Dank gebührt an dieser Stelle meinem Sohn Ralph ebenso wie etlichen weiteren Unterstützern auf meinem Weg zur Fertigstellung dieses Werks. Stellvertretend für alle seien hier genannt Alexander Weis, der mich bei Recherchen aller Art tatkräftig und gekonnt unterstützt hat, meine fantastische Assistentin Melanie Hubert, meine zuverlässige Lektorin Nikola Langreiter, sowie Irem Özcan und Hans-Georg Stadler, die beide für grafische Gestaltung, Design und Promotion dieses Buches verantwortlich gezeichnet haben. Nicht zuletzt danken möchte ich auch meiner lieben Frau Angela und unserem jüngeren Sohn Klaus, welche die Entbehrung meiner Aufmerksamkeit an so vielen Abenden ohne Beschwerde auf sich genommen und mir stets den Rücken freigehalten sowie mir Mut gemacht haben, sodass ich dieses Projekt trotz eines vollen Terminkalenders in unternehmertypischer Eile vorantreiben konnte.
Widmen will ich es den zahlreichen unternehmerischen Persönlichkeiten, die mich während mittlerweile dreier Jahrzehnte beruflicher Tätigkeit begleitet haben – als Freunde, Widersacher und Partner. Sie alle haben mich geprägt und so zum Entstehen dieses Werks beigetragen.
Harald Pöttinger
Bregenz, Österreich im Mai 2017
Inhalt
Was bedeutet „wertsteigerndes Unternehmertum“?
16 Thesen zum Unternehmertum in der Erfolgsgesellschaft
Unterlasser sein ist nicht schwer, Unternehmer dagegen sehr
Von der Leistungsgesellschaft zur Erfolgsgesellschaft
Sünden muss man büssen, Sünder bestrafen – Gedanken zu Geldpolitik, Überregulierung und Wutgesellschaft
Unternehmertum in der Erfolgsgesellschaft
Unternehmenswert-Steigerung als übergeordnete Zielsetzung der Unternehmenspolitik
Wege zur Unternehmenswert-Steigerung
Strategische Werttreiber
Finanzielle Werthebel
Strategische Positionierung und Geschäftskompetenzen
Geschäftsmodell und Equity Story
Warum Manager Value-based Management lieben sollten
Fallstudie einer Unternehmenswert-Steigerung
I.Was bedeutet „wertsteigerndes Unternehmertum“?
Das Konzept des wertsteigernden Unternehmertums stellt den Unternehmer ins Zentrum. Der Unternehmer wird mitsamt seiner Persönlichkeit, seinen Präferenzstrukturen und seiner Einbettung in ein gesellschaftliches Umfeld zum Unternehmen in Beziehung gesetzt. Zugleich wird ein praktikabler, konsistenter Handlungsrahmen – die Steigerung des „Unternehmenswertes“ – sowie ein dementsprechender Werkzeugkasten mit dem Unternehmertum verbunden. Wertsteigerndes Unternehmertum ist die Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel im 21. Jahrhundert und die damit verbundenen unternehmerischen Herausforderungen.
Äußere Rahmenbedingung dieses Unternehmertums, wie ich es verstehe, ist der bereits vollzogene Wandel der westlichen Gesellschaften von Leistungs- zu Erfolgsgesellschaften vor dem Hintergrund der Globalisierung. Diese Kontexte erfordern, wie im Folgenden noch näher ausgeführt wird, die fokussierte Ausrichtung der Unternehmenspolitik auf eine Grundfunktion privatwirtschaftlichen ökonomischen Handelns: die Wertsteigerung. Damit ist nicht eindimensional die Verabsolutierung von Eigennutz im Sinne des homo oeconomicus, eines rationalen Nutzenmaximierers, gemeint. Der Unternehmer als vitale und komplexe Persönlichkeit lässt sich nämlich nicht auf eine emotionslose Gewinnmaximierungsmaschine reduzieren.
Der Aufklärer Adam Smith gilt als Vater der Nationalökonomie, die er aus der Moralphilosophie heraus entwickelte. Er befasste sich in seinem 1759 erschienenen Werk „Theorie der ethischen Gefühle“ mit der Natur des Menschen und seinem Verhältnis zur Gesellschaft. Im Gegensatz dazu neigten die mathematisch dominierten Wirtschaftswissenschaften häufig dazu, den Menschen auf eine rationale Subsumptionsmaschine zu reduzieren, die gar nicht anders könne, als sich ausschließlich monetär orientiert und rational der persönlichen Nutzenmaximierung zu widmen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückte der Ökonom Joseph Alois Schumpeter den Unternehmer als Innovator in den Mittelpunkt. Nach Schumpeter ist der Unternehmer innovativ, um seine wirtschaftliche Position zu verbessern. Demnach bringt der Unternehmergeist Innovationen hervor und befördert damit Wirtschaftswachstum und sozialen Wandel. Dabei kommt es weniger auf die Ideen und Konzepte an, sondern auf deren Durchsetzung. Schumpeter unterscheidet dezidiert zwischen Unternehmern und Kapitalisten. Beim Kapitalisten steht die Verfügungsgewalt über materielle Ressourcen im Vordergrund, für deren Bereitstellen er Rendite erwartet. Das wesentliche Anliegen des Unternehmers ist hingegen, Erneuerungsprozesse zu gestalten.
Keine der großen Innovationen der Geschichte lässt sich durch die Gier nach Geld oder das emotionslose Optimieren von Bestehendem erklären. Stets motivierten andere Antriebe (wie Neugier oder Selbstverwirklichung) den Innovator, sein Projekt voranzutreiben. Dieser Unternehmer trifft nun in der westlichen Welt auf eine saturierte Gesellschaft, die im Schumpeter’schen Sinn kapitalistisch, also renditegetrieben ist. Dazu zählt auch ein hoheitlich agierender Staat, der zur Realisierung von Verteilungszielen, zwecks Ernährung seiner Bürokratie bzw. behufs Geltungskonsum wie ein Kapitalist Schumpeter’scher Prägung agiert und eine unternehmerische Entfaltung nur gegen Rendite in Form von Steuern, Gebühren und sonstigen Zwangsabgaben ermöglicht. Um diese Rendite schmälert er in stets steigendem Ausmaß die produktive Wertschöpfung. Zur Rechtfertigung dieser Vorgehensweise wird ein scheinbarer Interessengegensatz zwischen Unternehmern und anderen gesellschaftlichen Gruppen formuliert. Infolgedessen sehen sich Unternehmer gezwungen, sich ihrerseits zu legitimieren, denn – ganz im Sinne des historisch überlebten Klassenkampfes – werden sie, um mit Schumpeter zu sprechen, in erster Linie nicht als Innovatoren, sondern als Kapitalisten wahrgenommen.
Diese Sichtweise negiert andere Motive als rein ökonomische. Unternehmer werden einerseits als notwendiges Übel in Zusammenhang mit Produkten und Arbeitsplätzen wahrgenommen, andererseits unter scharfe Beobachtung gestellt. Scheitern gilt als unmoralisch oder gar kriminell. Für den Unternehmer bedeutet dies, dass er wachsam sein muss. Andrew Stephen Grove, der Mitbegründer und ehemalige Vorstandsvorsitzende von Intel, betitelte sein Buch über erfolgreiches Management des Wandels: „Nur die Paranoiden überleben“. 1Unternehmer sind Menschen aus Fleisch und Blut – zumeist ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten und außergewöhnlichem Antrieb. Heute können sie in Europa allerdings nur unter verschärften Bedingungen handeln. Diese Ausgangslage verlangt nach einem neuen Zugang zum Unternehmertum und einem stringenten Orientierungsrahmen.
Die Verhaltensökonomie ist ein junges Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften und setzt sich mit menschlichen Handlungsweisen in wirtschaftlichen Situationen auseinander. Im Zuge dessen werden auch Konstellationen untersucht, in denen Menschen im Widerspruch zum Modell des homo oeconomicus agieren. Pionier dieses Ansatzes ist der Psychologe Daniel Kahneman. 2002 erhielt er für die zusammen mit Amos Tversky entwickelte Prospect Theory den Wirtschaftsnobelpreis. Entscheidende und heute unumstrittene Beobachtungen der Verhaltensökonomie sind:
» Menschen treffen Entscheidungen häufig auf Grundlage einfacher, schneller und stabiler Faustregeln. Je komplexer Entscheidungssituationen sind, desto eher verdrängen derartige Heuristiken eine sorgfältige Analyse.
»Die Vorstellungen rund um ein Problem oder eine Entscheidungssituation beeinflussen die Handlung des Entscheiders. Man spricht im Fachjargon vom Framing.
»Märkte sind unvollkommen und weisen Anomalien auf, die vernünftigen Erwartungen von effizienten Märkten (Markteffizienzhypothese und wirtschaftswissenschaftliche Gleichgewichtstheorie) entgegenlaufen.
»Animal spirits (irrationale Elemente wie Instinkte und Emotionen) sowie Herdenverhalten entsprechen der sozialen Natur des Menschen und führen wiederkehrend zu kollektivem Versagen in Form von Konjunkturzyklen, Blasenbildung und Wirtschaftskrisen.
Unternehmer wie Manager unterliegen hinsichtlich ihres Entscheidungsverhaltens denselben Gesetzmäßigkeiten wie jeder Mensch. Diese Entscheidungsmechanismen sind evolutionsbiologisch angelegt und sollen rechtzeitiges, adäquates Handeln (beispielsweise Angriff oder Flucht bei Gefahr) ohne vorausgehende langwierige Analyse ermöglichen. Dieses schnelle Denken (instinktiv und emotional) ist aber nicht für komplexe soziale Kontexte geschaffen, wie sie moderne Wirtschaftsstrukturen darstellen. Hier ist langsames Denken (analytisch und logisch) oft der einzige Weg, um schwerwiegende Fehlschlüsse zu vermeiden. Bewusst sollte uns sein, dass Menschen beide Denkformen brauchen und nutzen.
Die nachfolgend dargestellte, starke Orientierung – basierend auf einem vernünftigen Fundament – erleichtert sachgerechtes Verhalten selbst im Fall von Bauchentscheidungen. Liegt der Unternehmenspolitik eine solche Grundhaltung und methodische Systematik zugrunde, fördert das sowohl bessere Bauchentscheidungen als auch analytisches Herangehen an Entscheidungssituationen. Für den Unternehmer ist eine Orientierung gefragt, die das Schaffen von materiellen Wertenins Zentrum der Unternehmensziele stellt. Das Generieren von Werten ist eine zentrale Triebfeder des Unternehmertums, wenngleich nicht die einzige. Die prinzipielle Zielsetzung muss breit genug angelegt, einfach kommunizierbar und dennoch abstrakt sein, um sich als oberstes Leitziel von Unternehmenspolitik zu eignen. Die laufende „Steigerung des Unternehmenswerts“ ist eine solche Zielsetzung, die als umfassende Orientierung taugt. Sie lässt offen, mit welchen Mitteln sie zu erreichen ist, kann Interessen sämtlicher Betroffener harmonisieren, ist auf Langfristigkeit ausgelegt und entspricht den Anforderungen einer Erfolgsgesellschaft. Eine solche Orientierung ist abstrakter als eine Vision oder ein Mission Statement und zugleich leichter zu operationalisieren.
Der betriebswirtschaftliche Rahmen für wertorientierte Unternehmensführung, wertorientierte Unternehmenssteuerung, wertorientiertes Management oder Value-based Management ist mehr oder weniger derselbe. Ausgehend vom durch Alfred Rappaport geprägten Shareholder-Value-Ansatz, haben sich verschiedene Methoden und Instrumente durchgesetzt, die systematisch auf die Steigerung des Unternehmenswerts abzielen. Häufig reduziert sich das Verständnis von Value-based Management jedoch im Kern auf finanzwirtschaftliche Instrumente. Indes ist klar, dass effektive Unternehmenswert-Steigerung finanzwirtschaftliche Instrumente zwar wirkungsvoll einsetzen kann, diese jedoch nur einen – und zudem nicht den wichtigsten – Teil des Toolsets ausmachen. Dieses Faktum wird in den nachfolgenden Kapiteln deutlich werden.
Zunächst formuliere ich jene Thesen, die ich als Ausgangspunkt für das Aufbereiten der Thematik betrachte. Auf diese Diagnose folgt eine Auseinandersetzung mit dem von mir entwickelten Konzept des wertsteigernden Unternehmertums. In den ersten Kapiteln steht der Unternehmer in seinen vielfältigen Rollen, Funktionen und Begrenzungen im Mittelpunkt. Um seine veränderte Stellung im Wandel hin zur Erfolgsgesellschaft zu beleuchten, skizziere ich den ideengeschichtlichen Hintergrund der Stellung von Unternehmertum in der Erfolgsgesellschaft. Die weiteren Kapitel sind der konkreten Ausgestaltung des Konzepts der Unternehmenswert-Steigerung in seinen unterschiedlichen Facetten und Handlungsfeldern gewidmet. Abschließend zeigt eine Fallstudie, wie Unternehmenswert-Steigerung praktisch umgesetzt werden kann. Als Manager und Partner jenes Private-Equity-Fonds, der als Lead Investor fungierte, begleitete ich aktiv das der Untersuchung zugrunde liegende Projekt. Die Fallstudie wurde so gewählt, dass bereits ihre zeitlichen Einordnung in die Jahre der Finanz- und Wirtschaftskrise verdeutlicht, dass die Unternehmenswert-Steigerung kein Schönwetterkonzept ist.
Zum einen basiert wertorientiertes Management freilich auf betriebswirtschaftlich-wissenschaftlichen Grundlagen. Zum anderen kann nicht oft genug betont werden, dass die praktische Umsetzung von Unternehmenswert-Steigerung der Persönlichkeit des Unternehmers, eines unternehmerischen Investors oder eines unternehmerisch orientierten Managements bedarf. Es wäre falsch anzunehmen, dass Manager aufgrund ihrer Rolle diesen Anforderungen nicht gerecht werden können. Zahlreiche managergeführte Publikumsgesellschaften beweisen das Gegenteil. Ich verweise in diesem Zusammenhang nur auf General Electric und Jack Welch – davon wird später noch die Rede sein. Ebensowenig halte ich es für sinnvoll, Investoren diese Fähigkeit abzusprechen. Das tun manche Managementdenker, aber wer wollte behaupten, dass Warren Buffett mit Berkshire Hathaway nicht in der Lage sei, wertorientiertes Management umzusetzen? Es sind immer Menschen, die sich unternehmerisch verhalten, nicht Institutionen oder abstrakte Rollenbilder.
Letztlich ist Unternehmenswert-Steigerung Handwerk und Kunst zugleich. Erfolg erfordert sowohl Willenskraft und Professionalität als auch Know-how und Kreativität. Ein Akteur allein wird selten sämtliche der nötigen – sich im Zeitablauf auch noch ändernden – Qualifikationen und Persönlichkeitsmerkmale mitbringen. Komplementäre Kompetenzen sind gefragt, die durch eine gemeinsame Zielsetzung gebündelt werden. Dies kann durch Partner, Manager, Berater, persönliche Freunde oder Mentoren geschehen. Weder Überheblichkeit noch überzogene Demut vor der Aufgabe sind hilfreich. Anpacken ist gefragt.
Vor allem aber ist wichtig, sich vor Augen zu halten: Unternehmenswert-Steigerung ist ein Konzept, das sich perfekt mit Unternehmertum verbinden lässt. Es ist ein umfassendes, logisch stringentes, gesellschaftlich und persönlich sinnvolles sowie für den langfristigen Unternehmenserhalt notwendiges Konzept. Unternehmenswert-Steigerung ist dabei nicht Selbstzweck im Leben eines Unternehmers, sondern die persönlichen Motive und Lebensziele des Unternehmers





























