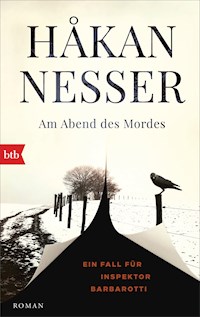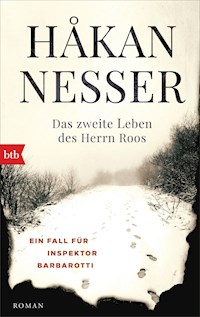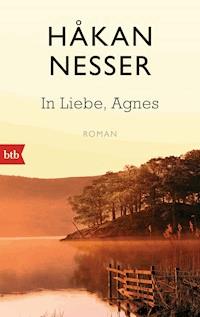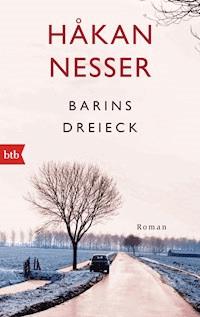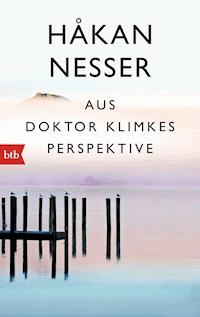9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kommissar Van Veeteren und Inspektor Barbarotti auf der Spur eines Mörders, der alle zum Narren hält.
Kommissar Van Veeteren - mittlerweile im Ruhestand, aber so legendär wie eh und je - bereitet sich innerlich darauf vor, seinen 75. Geburtstag zu feiern, als ein früherer Kollege auftaucht, um ihm von einem alten Fall zu berichten. Damals waren in einer Pension in Oosterby vier Menschen ums Leben gekommen, die nur eines gemeinsam hatten: die Mitgliedschaft in einem "Verein der Linkshänder". Da das fünfte am Treffen teilnehmende Mitglied verschwunden war, wurde der Mann schnell als Täter identifiziert, aber niemals gefunden. Nun ist überaschend nach Jahren seine Leiche aufgetaucht, offensichtlich wurde er zur selben Zeit ermordet wie die anderen. Mit anderen Worten: Van Veeteren und seine Kollegen haben damals versagt, der Mörder ist weiter auf freiem Fuß. Bald danach wird eine weitere Männerleiche gefunden - mit den Ermittlungen hier betraut: ein gewisser Inspektor Barbarotti...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Ex-Kommissar Van Veeteren bereitet sich innerlich darauf vor, seinen 75. Geburtstag zu feiern, als ein früherer Kollege auftaucht, um ihn von einem alten Fall zu berichten. Damals waren in einer Pension in Oosterby vier Menschen ums Leben gekommen, die nur eines gemeinsam hatten: die Mitgliedschaft in einem »Verein der Linkshänder«. Da das fünfte am Treffen teilnehmende Mitglied verschwunden war, wurde der Mann schnell als Täter identifiziert, aber niemals gefunden. Nun ist seine Leiche aufgetaucht, offensichtlich wurde er zur selben Zeit ermordet wie die anderen. Mit anderen Worten: Van Veeteren und seine Kollegen haben versagt, der Mörder ist weiter auf freiem Fuß. Bald danach wird eine weitere Männerleiche gefunden – mit den Ermittlungen hier betraut: ein gewisser Inspektor Barbarotti …
Zum Autor
HÅKAN NESSER, geboren 1950, ist einer der beliebtesten Schriftsteller Schwedens – und verfügt mittlerweile auch in Deutschland über eine riesige Fangemeinde. Für seine Kriminalromane um Kommissar Van Veeteren und Inspektor Barbarotti erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, sie sind in über zwanzig Sprachen übersetzt. Daneben schreibt er Psychothriller, die in ihrer Intensität und atmosphärischen Dichte an die besten Bücher von Georges Simenon und Patricia Highsmith erinnern. »Kim Novak badetet nie im See von Genezareth« oder »Und Piccadilly Circus liegt nicht in Kumla« gelten inzwischen als Klassiker in Schweden und werden als Schullektüre eingesetzt. Håkan Nesser lebt abwechselnd in Stockholm und auf Gotland.
HÅKAN NESSER
Der Verein der Linkshänder
Roman
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Die schwedische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »De vänsterhäntas förening« bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Håkan Nesser
Copyright © der deutschen Ausgabe 2019 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © plainpicture/Joseph S. Giacalone
Autorenfoto: © Caroline Andersson
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23762-2V004
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
»… what’s the point of waking up in the morning if you don’t try to match the enormousness of the known forces in the world with something powerful in your own life?«
Don DeLillo, Underworld
»The gods looked down from their mountain and shrugged.«
Paul Auster, 4 3 2 1
Einleitende Bemerkung
Manche Details im vorliegenden Buch – wie Adressen, Bankfilialen, Menschen, Ereignisse, Namen von Städten und Ländern – stimmen nicht mit der sogenannten Wirklichkeit überein. Andere Details stimmen dagegen umso besser mit ihr überein.
Erster Teil
1 1957–58. Oosterby und Umgebung
Marten Winckelstroop wuchs mit zwei Makeln auf. Er hatte keinen Vater, und er war Linkshänder.
Dass er vaterlos war, wurde ihm früh bewusst. Wahrscheinlich im Alter von etwa drei Jahren, denn zu dieser Zeit begann seine Mutter, Louise Henriette Winckelstroop, dem Schädel ihres eingeborenen Sohns die Grundvoraussetzungen des Lebens einzubläuen. Zum Beispiel, dass Gestalten, die gern in langer Hose und Hut oder Mütze herumstolzierten – und die sich zuweilen mit Bart und Schnäuzer schmückten, weil sie zu faul waren, sich zu rasieren –, bei Familie Winckelstroop nicht die geringste Chance hatten.
So viel dazu.
Dass dieser Mangel an Mannsbildern ein Makel sein könnte, kam allerdings keinem der beiden jemals in den Sinn. Nicht einmal ansatzweise. Männer, alte wie junge, waren – abgesehen natürlich vom kleinen Marten selbst – ein Elend und eine missratene Erfindung, so idiotisch war die Welt eingerichtet. Sie mochten eventuell für gewisse Arten schwerer körperlicher Arbeit und zur Säuberung verstopfter Abflüsse taugen – sowie für etwas anderes, aber um darauf einzugehen, war es noch zu früh. Aber das war auch schon alles, buchstäblich alles.
Dass die linke Hand des kleinen Marten sich so viel besser zu allen Arten des Herumfingerns eignete, angefangen beim Rotz und von dort in die Welt hinaus, wusste er auf eine halb unbewusste Weise bereits in sehr jungen Jahren, aber erst, als er sieben Jahre und ein paar Monate alt war, wurde er darauf aufmerksam gemacht, wie widernatürlich es war. An einem sonnigen Herbsttag im Jahre des Herrn 1957, der mit einer sanften Brise vom Meer einherging, wurde er nämlich zusammen mit den übrigen zitternden, aber sorgsam gekämmten Siebenjährigen der Obhut und Aufsicht von Lehrerin Bolster in der Volksschule Oosterby unterstellt. Womit die Kleine Schule gemeint war; es gab auch eine Große Schule, auf demselben großzügig bemessenen Grundstück zwischen Feuerwache und Kirche gelegen, allerdings hinter einer Hecke der Marke Liguster.
Es war aus Backsteinen, dieses kleine Schulgebäude, beherbergte vier Klassenzimmer und einen Werkraum sowie die Wohnungen von Lehrerin Bolster und Lehrer Klitschke unter dem Dach. Ein paar Jahre zuvor hatte die Kleine Schule den fünfundsiebzigsten Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Die Große Schule war zwei Jahre jünger, aber wie alt Frau Bolster war, wusste keiner so genau. Viele meinten, sie sei sicher von Anfang an dabei gewesen. Vielleicht war auch sie aus Backsteinen gefertigt worden, aus dem, was übrig geblieben war, nachdem die beiden Schulhäuser errichtet worden waren, der Gedanke erschien einem nicht abwegig.
Jedenfalls gehörte sie zu einem alten, gestählten Stamm, diese Margarete Bolster. Sie hatte nicht nur alle älteren Geschwister der zitternden Schar erzogen, sondern in den meisten Fällen auch deren Eltern. Wenn es in dieser veränderlichen Welt etwas gab, was man nicht in Frage stellte, dann war es Lehrerin Bolster.
Und man sollte kein Linkshänder sein. Auf gar keinen Fall.
Man sollte auch nicht vaterlos sein. Vermutlich hingen diese Dinge in irgendeiner unergründlichen Weise zusammen; das Familientechnische entzog sich Lehrerin Bolsters Einfluss, aber wenn es darum ging, zwischen welchen Fingern und in welcher Hand man einen Stift, ein Stück Kreide oder eine Nähnadel hielt, nun, was das anging, gab es pädagogische Richtlinien.
Und Methoden. Also wenn es galt, mit verkehrt gepolten Schulkindern zurechtzukommen. Zumindest eine Methode.
Und so durfte Marten Winckelstroop bereits an seinem zweiten Schultag, der übrigens ebenso sonnig war wie der erste und mit dem gleichen freiheitlichen Wind aus Nordwest einherging, die Bekanntschaft des sogenannten Korrekturhandschuhs machen. Er war aus Leder, roch nach einer Prise Mist, einer Prise Schaf und zwei Prisen altem Schweiß und wurde noch vor dem morgendlichen Kirchengesang fest um seine linke Hand geschnürt. Er durfte unter keinen Umständen vor dem Ende des Schultags abgenommen werden. Im Grunde war es eher eine Tüte als ein Handschuh, fest gefüttert mit Rosshaar und ohne Finger. Lehrerin Bolster hatte ihn in einer langen Reihe von Jahren benutzt und auf diese Art eine noch längere Reihe von mutmaßlichen Falschschreibern kuriert.
Es gab in der Volksschule Oosterby nicht nur einen solchen Handschuh, sondern mehrere, und Marten war kein Einzelfall. An seiner Seite, in der vordersten Pultreihe am Lehrerpult (so dass sie sich unter strenger Aufsicht befanden und bei Bedarf einen Schlag mit dem Lineal versetzt bekommen konnten), hatte er einen kleinen, dunkelhaarigen Knaben namens Rejmus Fiste, der, abgesehen davon, dass er Linkshänder war, weitere Unzulänglichkeiten aufwies. So stotterte er und war zudem wenig zuverlässig, wenn es darum ging, rechtzeitig zur Toilette zu kommen.
Er hatte jedoch einen Vater, der in der Stadt als Bäcker arbeitete und seinerzeit auch Linkshänder gewesen war. Genau genommen war er das immer noch, da er auswärts zur Schule gegangen war und man niemals Maßnahmen gegen sein Handicap ergriffen hatte. Rätselhafterweise backte er dennoch gutes Brot.
»Diese Bolster ist eine verfluchte Schabracke«, vertraute Marten seinem neugewonnen Leidesgenossen nach ungefähr einer Woche Schullaufbahn an. »Wir sollten sie umbringen.«
Sie standen unter dem großen Kastanienbaum neben der Turnhalle und warteten auf das Ende der Frühstückspause. Rejmus nickte emsig, brachte aber wie üblich kein vernünftiges Wort heraus. Sie spuckten ins Gras und tauschten stattdessen ein paar Boxschläge mit ihren Rosshaartüten aus, und dann läutete die Schulglocke. Es war, wie es war, gegen manche Dinge sollte man aber wirklich etwas unternehmen. Wenn nicht heute, so doch auf lange Sicht.
Die Zeit verging. Die Tage, die Wochen und nach und nach auch die Monate. Ende Dezember bekamen sie Ferien. Während des gesamten Winterhalbjahrs hatten Marten und Rejmus hartnäckig mit dem rechtshändigen Schreiben gekämpft, aber bisher konnte kein Mensch lesen, was sie schrieben. Nicht einmal sie selbst und erst recht nicht Lehrerin Bolster. Rejmus’ Stottern hätte auch ein dankbares Objekt für Reformbemühungen abgegeben, aber hier hieß es, eins nach dem anderen. Erst musste die rechte Hand des Jungen funktionieren, dann konnte man sich seinem Sprechen widmen.
Diese Rangfolge führte dazu, dass Rejmus in den Schulstunden keine Fragen gestellt wurden, weil er so unchristlich lange brauchte, um selbst die einfachsten kurzen Antworten herauszubringen. Seine Klassenkameraden sahen sich täglich und stündlich mit dem Einmaleins und Erdkunde sowie mit der Schlange im Paradies und Moses im Schilf konfrontiert. Rejmus dagegen nicht. Ihm wurde nie eine Frage gestellt. Er selbst war mit der Lage der Dinge recht zufrieden und vertraute Marten an, er habe es weiß Gott nicht eilig, die Tüte loszuwerden.
Diese roch immer noch ein bisschen nach Mist und ein bisschen nach Schaf, aber mit der Zeit gewöhnte man sich daran, hatte außerdem ein bisschen vom eigenen Duft in sie hineingeschmuggelt, und die beiden Freunde, denn das waren sie inzwischen, einigten sich insgeheim darauf, dass man den Handschuh sogar ganz nett finden konnte. So eignete er sich beispielsweise hervorragend zum Boxen und saß ja auch eindeutig an der besseren Hand.
Wie Rejmus eigentlich mit seinem Kameraden Marten kommunizierte, wusste keiner, und es machte sich auch keiner die Mühe, es herauszufinden. Sie waren ein Paar für sich, Sonderlinge, wie man so sagte, und vielleicht hatte Marten einfach die nötige Geduld, die Silben abzuwarten, die in einem abgehackten und alles andere als steten Strom aus dem Mund seines Schulkameraden plumpsten.
Oder sie verständigten sich in einer Art Zeichensprache, während der Schulzeit dann allerdings nur mit einer Hand. Obwohl Marten natürlich wie gewohnt reden konnte, denn ganz gleich, was alles auf der Liste über Rejmus Fistes Makel stand, taub war er zumindest nicht.
Dass die beiden nach dem ersten abgeschlossenen Schulhalbjahr der schlechteste beziehungsweise zweitschlechteste Schüler der Klasse waren, wurde auch kaum in Frage gestellt.
Im Januar 1958 wehte der beißendste Nordwind seit Menschengedenken. Tag für Tag, Woche für Woche. Die Kanäle bei Gruydern und Birkenberje froren zu, und wenn der Wind an manchen Sams- und Sonntagen von einer steifen zu einer mäßigen Brise abflaute, liefen manche auf Schlittschuhen bis nach Oostersee. Der Ort lag eigentlich nicht besonders weit weg, höchstens fünf oder sechs Kilometer, aber bei Gegenwind hatte man bisweilen das Gefühl, einen Berg hochzulaufen. Dafür kam man auf dem Heimweg natürlich umso leichter voran.
Die Erstklässler gingen allerdings niemals Schlittschuhlaufen. Sie wären fortgeweht worden.
Im Schulsaal heizte Lehrerin Bolster den Kamin, dass es krachte. Ein Schulinspektor aus Kaalbringen besuchte die Schule für einen halben Tag und stellte dabei fest, dass alles gut aussah, wenn man einmal davon absah, dass Rejmus Fiste in der ersten Reihe die Gelegenheit nutzte, um in die Hose zu machen. Als direkte Ursache dafür betrachtete man die Tatsache, dass er auf Grund seines Stotterns nicht oder nicht rechtzeitig um Erlaubnis zu bitten vermochte, die Toilette aufsuchen zu dürfen, und folglich ließ sich dies weder dem Unterricht als solchem noch etwas anderem zur Last legen. Zwei Ohrfeigen, eine auf jede Wange, und die Sache konnte zu den Akten gelegt werden.
Am selben Tag, allerdings am Abend, trafen sich Marten und Rejmus auf dem Dachboden im Haus des Erstgenannten in der Beerenstraat. Es war ein Ort, an dem sie sich gern aufhielten, auch wenn der enge Raum unter dem Dachfirst mit Eingang von der einen Giebelseite eher dem Hausbesitzer gehörte, Herrn Flindermann, als den Mietern in der oberen Etage, Fräulein Winckelstroop und ihrem eingeborenen Sohn. Aber Herr Flindermann war mit den Jahren zu schwer geworden, um die Wandleiter hinaufzusteigen, und solange die kleinen Racker nichts kaputtmachten oder herumkrakeelten, hatte er nichts einzuwenden. Sechzig und mehr Jahre zuvor hatte er selbst zahlreiche Stunden unter dem Dachfirst verbracht, um Ruhe vor seinem Vater zu haben, wenn dieser betrunken nach Hause kam und seine Kinder vermöbeln wollte. Das Haus befand sich seit drei Generationen im Familienbesitz, und Marten und sein Schulkamerad, wie auch immer er hieß, waren noch zu jung, um heimlich zu rauchen und Schnaps zu trinken.
»Ich habe mir überlegt«, sagte Marten, als sie sich mit dem Rücken an den Schornstein gelehnt da niederließen, wo es am wärmsten war, »dass es an der Zeit ist, dass wir einen Club gründen.«
»Einen C… C… C… C…?«, sagte Rejmus.
»Genau«, erwiderte Marten. »Oder vielleicht auch einen Verein.«
»Einen V… V… V… V…?«, sagte Rejmus.
»Es spielt eigentlich keine Rolle, ob wir es so oder so nennen«, fuhr Marten fort. »Aber wir brauchen eine Satzung und Versammlungen und, wie heißt das noch …?«
»Z… Z… Z…?«, sagte Rejmus.
»Was?«, fragte Marten.
»Zw… Zw… Zw…«, sagte Rejmus.
»Zwiebel?«, riet Marten.
»N… n… nein!«, sagte Rejmus.
Einige Minuten später war klar, dass das gesuchte Wort Zweck war. Marten wusste nicht recht, was damit gemeint war, aber Rejmus hatte wesentlich mehr Worte im Kopf, als aus seinem Mund herauskamen, so dass er sicher recht hatte.
»Okay«, erklärte Marten. »Wir brauchen einen Zweck.«
Rejmus nickte.
»Und Mitgliedsausweise«, ergänzte Marten. »Wir müssen Mitgliedsausweise haben. Nummerierte. Ich bin Nummer eins, und du bist Nummer zwei, darum musst du dich kümmern, du kannst besser zeichnen als ich. Aus Pappe und so klein, dass er ins Portemonnaie passt. Einverstanden?«
Rejmus hob den Daumen zum Zeichen seiner Zustimmung.
»Fürs Erste sollten du und ich als Mitglieder reichen. Wenn wir noch jemanden aufnehmen wollen, müssen wir uns eine Art Aufnahmeprüfung einfallen lassen.«
»P… P… Prüfung?«, schaffte es Rejmus herauszubringen.
»Ja. Aber nur für neue Mitglieder. Du und ich müssen keine Prüfung bestehen, weil wir den Club gegründet haben. Oder den Verein. Ich finde, Verein klingt besser, es ist irgendwie … länger. Was meinst du?«
Rejmus hob erneut den Daumen. Marten dachte eine Weile nach, während er Wundschorf von seinem Ellbogen abknibbelte.
»Diesen Zweck vergessen wir erst einmal«, sagte er, »aber wir brauchen einen Namen. Das ist verdammt wichtig. Er soll natürlich auf dem Mitgliedsausweis stehen und muss gut klingen.«
»D… D… D… D…«, setzte Rejmus an und strahlte vor lauter Eifer.
»Was?«, sagte Marten.
»D… D… D… D…«, wiederholte Rejmus und wedelte vor Martens Augen mit seiner linken Hand. »D… D… D… Ve…«
»Perfekt!«, rief Marten. »Du hast den Nagel auf das Ei getroffen oder wie immer es heißt. Der Verein der Linkshänder! So nennen wir uns.«
Es war der fünfundzwanzigste Januar 1958. Gegen sieben Uhr abends. Das Leben hatte soeben ein neues Kapitel aufgeschlagen.
2 Oktober 2012. Maardam
»Wahrheiten verändern sich mit der Zeit.«
»Wie bitte?«
»Doch, so verhält es sich wirklich«, sagte Mahler und betrachtete seine erloschene Zigarre. »Gewissen Mustern folgend. Man lernt, diese kleinen Verschiebungen zu erfassen, notabene, nicht, sie zu verstehen, aber sie wahrzunehmen. Vor allem im Nachhinein natürlich, ich weiß nicht, ob du darüber schon einmal nachgedacht hast?«
»Wahrnehmen?«, sagte Van Veeteren. »Im Nachhinein?«
Mahler antwortete nicht. Van Veeteren hatte gerade die Hand gehoben, um einen Zug zu machen, ließ sie nun jedoch wieder sinken und seufzte schwer.
»Du hinterhältiger Teufel«, sagte er. »Du sagst solche Dinge doch nur, damit ich die Konzentration verliere.«
Mahler ließ die Zigarre nicht aus den Augen und verzichtete weiterhin auf einen Kommentar.
»Das tust du jetzt seit dreißig Jahren, und ich habe es schon vor neunundzwanzig durchschaut. Ärgerlich daran ist nur, dass …«
»Was ist ärgerlich?«, fragte Mahler nach einer langen Pause.
»Ärgerlich ist, dass es funktioniert«, antwortete Van Veeteren.
»Was du nicht sagst?«, sagte Mahler.
»Du solltest disqualifiziert werden. Oder zumindest einen Bauern verlieren … und zwar jedes Mal.«
Mahler studierte einen Moment lang das Brett.
»So wie es im Moment aussieht, kann ich es mir durchaus leisten, einen Bauern zu verlieren.«
Er zog die Lippen zu etwas hoch, was möglicherweise ein Lächeln darstellen sollte. Oder es einst, im Anbeginn der Zeit, gewesen wäre.
»Sitzen wir hier wirklich schon dreißig Jahre?«
»In etwa«, antwortete Van Veeteren. »Unsere Namen sollten auf einer Plakette an der Wand stehen. Wenn ich es recht bedenke, würde ich fast meinen, dass es noch mehr sind … an die fünfunddreißig.«
»Sie warten bestimmt darauf, dass wir zuerst sterben«, sagte Mahler. Steckte sich die Zigarre zwischen die Lippen und studierte das Schachbrett mit einer Miene sanfter Resignation. »Und so furchtbar lange kann es bis dahin ja nicht mehr dauern.«
Van Veeteren lehnte sich zurück, ohne seinen Zug gemacht zu haben. Er ließ seinen Blick durch den Raum schweifen und dachte, dass es ohnehin nur um einen Bruchteil von Jahren ging. Die Räumlichkeiten des Café Gilde hatten mehr als vierhundert davon auf dem Buckel; sie waren nach einem Feuer Ende des neunzehnten Jahrhunderts renoviert worden, ihre eigene Zeit, seine und Mahlers, ließ sich historisch gesehen vor diesem Hintergrund vernachlässigen. Weniger als ein Zehntel. Das war kein erfreulicher Gedanke, und es kam erschwerend hinzu, dass sich seine Rückenschmerzen wieder meldeten. Die Lendenwirbel, linksseitig. Selten auch mal rechtsseitig, im Verhältnis eins zu fünf, nicht mehr.
»Wir sind nicht jünger geworden«, bemerkte er. »Was war das eben mit sich verschiebenden Wahrheiten?«
»Nichts Besonderes«, sagte Mahler.
»Nichts Besonderes?«, wiederholte Van Veeteren.
»Ja, nur eine Beobachtung. Sie passt wahrscheinlich besser zur Dichtung als zur Wissenschaft. Obwohl sie mir in den Sinn gekommen sein dürfte, weil ich glaube, dass wir mit genau dieser Stellung hier schon einmal gesessen haben.«
»Was?«, sagte Van Veeteren. »Tja, so etwas sagt sich leicht …«
»Skandinavische Eröffnung«, präzisierte Mahler. »Ich behaupte nicht, dass jeder Zug identisch gewesen ist, nur die jetzt entstandene Stellung. Du verlierst Tempo nach deiner Rochade, und im Moment denkst du über das Gleiche nach wie damals. Ob du den Springer auf e3 oder d6 ziehen sollst. Herbst achtundachtzig, glaube ich, vielleicht auch neunundachtzig. Also genau die gleichen Gedanken … was das allerdings mit der Wahrheit zu tun hat, weiß der Teufel. Wenn ich es recht bedenke.«
Van Veeteren öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Mahler zündet seine Zigarre an. Van Veeteren musterte ihn.
»Wie alt bist du noch einmal? Bist du letztes oder vorletztes Jahr achtzig geworden?«
»Warum fragst du?«
»Man wird ja wohl noch fragen dürfen«, entgegnete Van Veeteren.
»Vorletztes«, sagte Mahler. »Glaube ich zumindest. Aber du bist ja immer noch ein junger Mann. Fünfundsiebzig in ein paar Wochen … tja, wahrscheinlich hast du noch nicht die nötige Reife, um das mit den Windungen der Wahrheit zu verstehen.«
»Fünfundsiebzig«, sagte Van Veeteren und seufzte. »Erwähne das Elend nicht.«
»Ich habe gar keine Einladung zu einer Party bekommen«, sagte Mahler und schien erneut dieses Lächeln zu versuchen. »Aber das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet.«
»Hättest du die Einladung angenommen?«
»Nein. Natürlich nicht.«
»Du und ich, wir feiern unsere Geburtstage nicht«, erklärte Van Veeteren. »Zumindest nicht in Gesellschaft des anderen. Wir beide spielen Schach.«
Mahler nickte nachdenklich.
»Vollkommen richtig«, sagte er. »Heißt das, der Tag wird auch unbemerkt vom Rest der Menschheit vorübergehen?«
»Wir verreisen«, erklärte Van Veeteren.
»Aha, so, so.«
»Verteufelt weit. Nach Neuseeland.«
Mahlers Augen drückten Besorgnis aus. »Auf langen Flugreisen bekommt man leicht eine Thrombose. Habe ich mal gehört.«
»Auch fünfundsiebzigjährige Jünglinge?«
»Es kann einen jederzeit treffen«, erwiderte Mahler. »Warum ausgerechnet Neuseeland?«
»Warum nicht? Sie keltern da unten einen guten Pinot Noir.«
Mahler zuckte mit den Schultern.
»Es war Ulrikes Idee«, erläuterte Van Veeteren nach kurzer Pause. »Sie kennt da jemanden.«
»Einen Mann?«
»Nein, verdammt. Eine Freundin aus der Schulzeit, die sie seit fünfzig Jahren nicht mehr gesehen hat.«
»Ich verstehe«, sagte Mahler. »Ja, in fünfzig Jahren haben viele alte Wahrheiten Zeit, eine andere Gestalt anzunehmen.«
Van Veeteren trank einen Schluck Bier und versuchte sich vorzustellen, was Mahler zu verstehen behauptete. Aber es kam nichts. Weder in seinem Kopf noch aus Mahlers Mund. Ich bin müde, dachte er. Ich bin schlichtweg alt und müde. Kann keine gescheiten Fragen mehr stellen. Die Worte kommen und gehen einfach … wie sinnlose Regenschauer. Und der Mann mir gegenüber ist noch älter.
Außerdem sitze ich hier und lüge ihn an, aber darauf haben wir uns schließlich geeinigt. Ulrike und ich.
»Übrigens«, fiel ihm ein, »du hast schon länger nichts mehr veröffentlicht. Seit deiner letzten Gedichtsammlung sind bestimmt fünf Jahre vergangen.«
»Sieben«, sagte Mahler. »Es kam zu einer Verzögerung.«
»Und warum?«
»Mein Lektor hat beschlossen, in Pension zu gehen. Es gibt sonst niemanden, der mich versteht.«
»Wie heißt er?«
»Brahms. Er heißt Eugen G. Brahms. Nicht älter als achtundsiebzig, aber er hat Probleme mit den Knien. Jedenfalls schiebt er es darauf.«
»Was haben seine Knie mit Dichtung zu tun?«
»Exakt mein Standpunkt. Aber er hat einen Nachfolger bekommen, mal schauen.«
Van Veeteren trank einen Schluck Bier und versuchte, einen Gedankengang festzuhalten, der ihm zwischen seinen Ohren entglitten war wie eine Schlange in einen Steinhaufen.
»Und worin versinkst du jetzt?«, sagte Mahler, als eine Minute oder vielleicht auch zwei vergangen waren. »Du schläfst mir hier doch nicht etwa ein? Es sieht jedenfalls nicht so aus, als würdest du über einen Zug nachgrübeln. Soll ich dich daran erinnern, was du 1988 getan hast?«
»Ja, bitte«, sagte Van Veeteren. »Tu das.«
»D6«, sagte Mahler.
»Der Springer?«
»Ja.«
»Und wie ist die Partie ausgegangen?«
»Du hast verloren«, antwortete Mahler.
Eine halbe Stunde später war er auf dem Heimweg. Springer auf e3 hatte auch nicht funktioniert, nach gut vierzig Zügen musste er aufgeben. Sie hatten den Abend mit einem kleinen Glas Genever abgerundet und sich wie üblich vor Bijnerts Weinhandel an der Ecke Zwille- und Falckstraat getrennt. Mahler wohnte in Deijkstraa, seit vierzig Jahren schon; Van Veeteren dachte, dass er nur bei zwei Gelegenheiten einen Fuß in die alte, verrauchte Wohnung des Dichters gesetzt hatte und es wahrscheinlich nie wieder tun würde. Mahler und er waren keine engen Bekannten, nicht im herkömmlichen Sinne des Wortes; sie trafen sich ein- oder zweimal im Monat und spielten Schach in Vlissingen. Das war alles, und so war es schon immer gewesen.
Wie gesagt.
Es herrschte generell ein Mangel an Zukunft, und Mahler hatte einen Sohn, der sich sicher um den Nachlass kümmern würde, auch wenn er dafür zunächst einmal aus Südamerika anreisen musste. Bolivien oder Kolumbien, Van Veeteren vergaß immer wieder, aus welchem Land.
Wenn der Tag gekommen war.
Aber vielleicht würde sein eigener ja zuerst kommen? Er schlug den Mantelkragen zum Schutz gegen einen plötzlichen Windstoß über der Langgraacht hoch und dachte, dass dies keine Rolle spielte. Hauptsache, er selbst durfte sich aus dem Staub machen, bevor Ulrike es tat. Seine Tage in Einsamkeit zu beschließen, war ein höchst unangenehmer Gedanke. Vor ein paar Nächten hatte er von seinem Tod geträumt: Er war eine vergessene Scheibe von Gruydermanns Leberwurst gewesen, die jemand auf einem Untersetzer in einem Kühlschrank stehengelassen hatte – und als jemand anderes, nach einem halben Jahr oder so, die Tür zu diesem Kühlschrank öffnete, es war eindeutig eine junge und schöne Frau gewesen, hatte er sich für seinen schimmeligen, verfaulten Zustand geschämt, und die Frau hatte, wie nicht anders zu erwarten, mit einem unverkennbaren Ton von Enttäuschung und Vorwurf in der Stimme ausgerufen:
»Aber Herr Kommissar. Dass Sie sich nicht schämen!«
Genau, sie hatte ihn tatsächlich Herr Kommissar genannt, und bevor sie angeekelt wieder die Tür vor ihm verschloss, hatte er erkannt, dass es Ewa Moreno gewesen war.
Eine junge Ewa Moreno, so wie sie ausgesehen hatte, als sie vor vielen, vielen Jahren zur Kriminalpolizei im Präsidium von Maardam kam. Als er selbst noch als deren unbestrittene Achse und ihr Anker aktiv gewesen war.
Achse und Anker? Konnte man beides sein, fragte er sich und bog in die Kellnerstraat. Etwas, das sich sowohl dreht als auch festsitzt? Oder eher festsitzt und versucht, sich zu drehen. Ein Bild für sein ganzes Leben? Oder bloß Worte, die zufällig in seinem Kopf zusammengeprallt waren?
Wie gesagt.
Er trat den Fetzen eines Pizzakartons in den Kanal und dachte, dass es lange her war, seit er sie das letzte Mal gesehen hatte. Lange her, dass er irgendwem von seinen alten Kollegen begegnet war. Münster war irgendwann im Frühjahr im Antiquariat gewesen, aber das war jetzt sicher ein halbes Jahr oder noch länger her, und an einem Sommerabend war er auf dem Grote Markt Rooth begegnet. Aber das war auch schon alles.
Reinhart war seit ein paar Jahren in Pension und lebte, soweit er wusste, in Spanien, aber viele der anderen waren noch im Dienst und schufteten in den Hinterhöfen der Gesellschaft.
Münster … er hatte vermutlich noch zwei oder drei Jahre. Moreno, Rooth und Jung … ja, mein Gott, dachte Van Veeteren, those were the days.
Zehn Jahre waren vergangen, seit er seinen letzten Beitrag zur Verbrechensbekämpfung geleistet hatte. Sein letzter Fall. So nahe wie damals war er dem Tod noch nie gewesen. Weder zuvor. Noch danach.
Was für ein ewiges Gerede über den Tod das ist heute Abend, stellte er fest, als er dem Wind entkam und um die Ecke zur Moerkerlaan bog. Zwanzig Schritte später hob er automatisch den Blick und sah, dass im Schlafzimmer zwischen den Linden in der dritten Etage von Hausnummer 14 Licht brannte. Ulrike war offenbar mit einem Buch ins Bett gegangen; sie hatte Besuch von einer alten Freundin gehabt, aber anscheinend war diese früh gegangen. Es war erst halb zwölf, und Ulrike hatte angedeutet, dass sie eigentlich gar keine Lust hatte, Agnieszka zu treffen. Oder wie sie hieß. Vielleicht waren die beiden ja aneinandergeraten. Er hatte es so verstanden, dass es noch eine alte offene Rechnung gab, ohne dass die einzelnen Posten darauf näher erläutert worden wären.
Fünfundsiebzig, dachte er erneut, als er die Tür aufschob. In zwei Wochen habe ich ein Dreivierteljahrhundert gelebt. Eines langen Tages Reise in die Nacht.
Und er würde den großen Tag ganz sicher nicht in Neuseeland verbringen.
Das war lediglich ein Konzept, auf das Ulrike und er sich geeinigt hatten. Für den Fall, dass irgendein verdammter Idiot auf die Idee kommen sollte, ihm gratulieren zu wollen.
Zum Beispiel eine Tochter in Paris oder eines der Enkelkinder.
Was wünschst du dir, hatte man aus Paris trotz allem gefragt.
Ein Telegramm am halbwegs richtigen Tag, hatte er geantwortet. Ohne gründlicher darüber nachzudenken, ob es so etwas wie Telegramme überhaupt noch gab.
Ulrike hatte die Nachttischlampe schon ausgemacht, als er ins Schlafzimmer tapste, schaltete sie jetzt aber wieder ein.
»Wie ist es gelaufen?«, fragte sie.
»Was?«
»Die Schachpartie natürlich?«
Das fragte sie ihn sonst nie. Er begriff, dass es die Einleitung zu etwas anderem war.
»Ich habe verloren«, antwortete er. »Mahler wird im Alter immer schlimmer. Hattest du einen netten Abend mit Agnieszka?«
»Paula.«
»Paula? Ich dachte, sie heißt Agnieszka?«
»Das war vor zwei Wochen.«
»Ich bitte um Entschuldigung. War es die Mühe wert?«
»Für etwa eine Stunde. Danach haben wir uns ausgesprochen. Sie ist gegen zehn gegangen, und das war auch gut so.«
»Ich verstehe.«
»Aber es ist etwas passiert.«
»Ja?«
»Münster hat angerufen.«
»Münster?«
»Ja. Er wollte dich sprechen. Hatte ein Anliegen.«
»Warum hat er hier angerufen?«
»Du hast dein Handy liegengelassen. Ich bin aus irgendeinem Grund drangegangen.«
»Es geht ja wohl hoffentlich nicht um diesen verflixten Geburtstag? Du hast ihm doch klargemacht, dass wir verreisen?«
Ulrike schob sich in eine halb sitzende Position. Er dachte, dass sie tatsächlich auch schon über siebzig war, aber eher wie sechzig aussah. Oder fünfunddreißig. Oder was auch immer. Womit hatte er dieses Wunderwerk von einer Frau verdient? So lautete die Frage, die er sich in der Regel dreimal am Tag stellte, und er war nie auch nur in die Nähe einer Antwort gekommen.
Außer eventuell, dass die blind gewährte Gnade manchmal schwerer wog als der Lohn der Tugend.
Gut, dachte er. Endlich ein gediegener Gedanke.
»Nun, es ging wohl eher nicht um deinen runden Geburtstag«, sagte sie. »Es ging um … tja, ich weiß es nicht genau.«
»Du weißt es nicht genau?«
»Nein. Aber ich hatte den Eindruck, es dreht sich um … na ja, du weißt schon?«
»Was? Was weiß ich?«
Sie lächelte vorsichtig. »Um eine … wie soll ich mich ausdrücken? Eine alte Polizeiangelegenheit.«
Er musste sauer aufstoßen. Ich hätte einen größeren Genever trinken sollen, dachte er. Oder zwei.
»Eine Polizeiangelegenheit?«
»Ja, also um einen Fall. Aber sicher bin ich mir nicht. Er will morgen im Antiquariat vorbeischauen. Er hat mich gebeten, dir das auszurichten, damit du … ein bisschen vorgewarnt bist.«
»Vorgewarnt?«
»Das waren seine Worte.«
»Verdammt«, sagte Van Veeteren.
3 September 1991. Loewingen
Als Qvintus Maasenegger sich am Morgen seines Geburtstags am zehnten September im Badezimmerspiegel betrachtete, konnte er drei Dinge feststellen.
Er war dreiundvierzig Jahre alt.
Er sah aus wie dreiundfünfzig.
Er fühlte sich wie dreiundsechzig.
Ich sollte endlich anfangen, Sport zu treiben, dachte er.
Das hatte er auch früher schon gedacht, vor allem in den letzten Jahren, aber aus irgendeinem Grund war nie etwas daraus geworden. Irgendetwas war ihm immer dazwischengekommen; so sah das Leben aus, nicht nur, wenn es darum ging, in Form zu bleiben, sondern im Allgemeinen. Die langfristigen Pläne und Strategien wurden stets zunichtegemacht, weil der Zufall es nicht lassen konnte, sich einzumischen und die Visionen zu beschämen. Das Schicksal war generell eine Niete.
Oder nicht? Er blieb einen Moment vor dem Spiegel stehen und versuchte zu zählen, wie viele Frauen er beispielsweise gehabt hatte, weil das ein nicht unwesentlicher Aspekt des Schicksals war. Wie viele es insgesamt gewesen waren und wie viele von ihnen mehr oder weniger geschworen hatten, für den Rest ihres Lebens mit ihm zusammenzuleben. Außerdem, wie viele ihm mitgeteilt hatten, dass er ein Riesenarschloch oder etwas damit Verwandtes war – aber nach einem knappen Dutzend in jeder Kategorie gab er auf und ging stattdessen dazu über, Jobs zu zählen. Die Berufe, in denen er sich versucht hatte, und die kürzeren oder längeren Arbeitsstellen, die er gehabt hatte. Besonders viele längere Arbeitsverhältnisse gab es nicht, seit er als Dreiundzwanzigjähriger den Steinmetzbetrieb in Mindelo verlassen hatte und zur See gefahren war, nachdem er die Tochter des Geschäftsführers geschwängert hatte. Es war eine üble Geschichte, und als er an sie dachte, kam er auch beim Zählen seiner Jobs aus dem Konzept. Sie hieß Marion und war die Sorte junge Frau gewesen, die man nicht so leicht vergisst. Ob man nun will oder nicht. Vielleicht hätte er die Verantwortung übernehmen und sie heiraten sollen, aber um die Wahrheit zu sagen … tja, um die Wahrheit zu sagen, hatte der Schuh eigentlich nicht dort geklemmt. Vater Steinmetzgeschäftsführer hatte für seine Tochter andere Pläne, das kapierte nun wirklich jeder. So ein Kesselflickerbastard wie Qvintus Maasenegger würde ihr Leben verdammt nochmal nicht ruinieren, und als er nach gut einem Jahr auf den sieben Meeren zurückkehrte, stellte sich heraus, dass dieses Kind niemals zur Welt gekommen war. Natürlich nicht, und Marion war bereits mit einem Offizier der Luftwaffe verlobt, ihr eingerahmtes Foto hing für alle Welt sichtbar im Schaufenster von Wauters Foto und Film am Marktplatz von Mindelo.
Viele Jobs waren es jedenfalls gewesen, aber was brachte es, sie alle zu zählen? Außerdem war er momentan arbeitslos. Qvintus seufzte, wusch sich das Gesicht mehrmals mit kaltem Wasser und putzte sich die Zähne. Klemmte seine bleiche und traurig schlaffe Bauchmuskulatur zwischen Daumen und Zeigefinger ein und kam auf das Thema Sport zurück. Gerade heute sah das Wetter richtig vielversprechend für diese Art von Aktivitäten aus; er registrierte dies durch das Badezimmerfenster und eine Viertelstunde später, als er mit der ersten Tasse Kaffee des Tages und der ersten Zigarette am Küchentisch saß. Eine blasse Herbstsonne war über dem Tribünendach des Sportplatzes aufgestiegen, und im großen Blau war nicht eine Wolke zu sehen. Kein Wind, wie es schien, und vermutlich eine Temperatur von etwa fünfzehn Grad.
Mit anderen Worten wie gemacht zum Joggen, und möglicherweise wäre das Projekt tatsächlich in die Tat umgesetzt worden, wenn ein Klappern im Wohnungsflur die Lage nicht verändert hätte. Die Post war gekommen; aller Wahrscheinlichkeit nach eine Handvoll neuer Rechnungen oder Mahnungen zu alten Rechnungen, die nie bezahlt worden waren. Oder Reklame für Produkte, die er niemals gebraucht hatte und niemals brauchen würde. Etwas anderes war selten dabei, aber Qvintus machte sich dennoch die Mühe, hinzugehen und nachzusehen. Drei Schreiben, das war alles. Zwei waren von der erwartbaren Sorte, ein Brief von seiner Bank, einer von einem Inkassobüro. Das dritte war ein hellblaues Kuvert ohne Absender oder Andeutung des Inhalts. Sein Name und die Adresse in eckigen schwarzen Großbuchstaben. Er ließ die beiden Forderungsschreiben auf dem Flurtisch liegen, nahm den hellblauen Umschlag und kehrte mit ihm in die Küche zurück. Er suchte ein Messer aus einer Schublade heraus, setzte sich an den Tisch und schlitzte ihn auf.
Was zum Teufel, dachte er. Eine Geburtstagsgruß von einer Frau, die ihn immer noch mochte und zum Essen einladen wollte, oder was? Dream on baby, aber so, wie das Leben aussah, war das wohl das einzig Vernünftige, womit man seine Zeit verbringen konnte. Zu träumen.
Der Text war maschinengeschrieben und umfasste eine gute halbe Seite. Er las ihn dreimal, zunehmend erstaunt. Aber vielleicht war erstaunt das falsche Worte, denn es war etwas anderes, was in ihm erwachte. Eine unheilverkündende Sorge, eine alte Schuld, von der er geglaubt hatte, sie würde in Frieden ruhen, und der er sich beim besten Willen nicht stellen wollte. Kurzum, diese verfluchte Geschichte.
Bester Qvintus Maasenegger,
du wirst hiermit ersucht, dich zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Verein der Linkshänder einzufinden. Viele Jahre sind vergangen, aber wie du weißt, bedeutet die Mitgliedschaft im VDL, dass man ein Leben lang auf eine Verbindung eingeschworen ist. Handlungen zeitigen Konsequenzen, die guten Taten werden belohnt, für die schlechten gibt es eine tätige Gnade. Wichtiger als alles andere ist jedoch die Freude des Wiedersehens. Du wirst es bereuen, falls du beschließen solltest fernzubleiben, das schwören wir dir.
Ort: Mollys Pension, Oosterby.
Zeit: Zusammenkunft um 17 Uhr am Samstag, den 28. September.
Inhalt: Gutes Essen, gute Getränke, gehaltvolle Gespräche und ein angenehmes Beisammensein im Kreise guter alter Freunde. Übernachtung zum Sonntag in einem Einzelzimmer, das dir am Samstag ab 14 Uhr für vierundzwanzig Stunden zur Verfügung steht.
Herzlich willkommen!
Der Vorstand
bei Verhinderung wird u. A. g. unter 011–161718
PS: Verbrenne diesen Brief, sobald du dir Zeitpunkt und Ort eingeprägt hast. Du weißt, warum!
Er schob die Einladung in den Umschlag zurück und blieb am Küchentisch sitzen, während die Gedanken in seinem Kopf Amok liefen. Der Verein der Linkshänder? Diese verfluchten Irren. Was zum Teufel hatte das zu bedeuten? Qvintus Maasenegger hatte in seinem unsteten Leben nicht viele private Schreiben erhalten, aber der Brief, der in diesem Moment vor ihm auf der verklebten Tischplatte lag, war zweifellos das seltsamste von allen.
Außerordentliche Mitgliederversammlung?
Hiermit ersucht …?
Auf eine Verbindung eingeschworen …?
Was für verflucht gestelzte Formulierungen!
Handlungen zeitigen Konsequenzen?
Du wirst es bereuen, falls du beschließen solltest, fernzubleiben. Und Verbrenne diesen Brief. Du weißt, warum, nicht wahr?
Und plötzlich, ganz plötzlich war diese längst begrabene Erinnerung ans Licht geholt worden.
Das Mädchen.
Zink.
Die Zwillingsschwestern. Was passiert war. Das Geld.
Warum, um Himmels willen, plumpste ausgerechnet heute diese Einladung in seinen Briefkasten? Nach so vielen Jahren. Mindestens zwanzig; er versuchte nachzurechnen und kam auf zweiundzwanzig. Es war doch im Frühjahr 1969 passiert?
Qvintus Maasenegger kratzte sich am Kopf und hatte daraufhin eine Fuhre fettiger Schuppen unter den Fingernägeln. Aber was bedeutete eine solche Lappalie in diesem Moment? Er unternahm eine mentale Anstrengung und versuchte, sich ein Vierteljahrhundert in die Vergangenheit zurückzuversetzen. In seine Jugendjahre in dem verdammten Kaff.
Dieser Raum, wie hatten sie ihn noch genannt? Diese Clique … an ihre Namen konnte er sich immerhin noch erinnern. Marten irgendwas. Rejmus irgendwas und Kuno irgendwas … und, wie gesagt, die Zwillingsschwestern. Unmöglich auseinanderzuhalten. Verteufelt hübsch, und zumindest die eine der beiden war auch durchaus willens gewesen, aber sie war mit einem der anderen zusammen gewesen, war es nicht so? Und dann, mit der Zeit, auch mit Zink, wahrscheinlich …
Zink.
Qvintus Maasenegger schauderte, als er an ihn dachte.
Und Mollys Pension. Mein Gott! Er schüttelte den Kopf und verließ die Küche. Ging ins Wohnzimmer und marschierte planlos umher. Mit dem Brief in der Hand.
Verbrenne diesen Brief … Er erinnerte sich an einige Abende in der alten, baufälligen Pension hinter … wie hieß das? Leroys Landzunge? Er hatte dort sicher auch die eine oder andere Nacht mit der einen oder anderen Braut verbracht.
Möglicherweise nicht mehr als eine Nacht, um bei der Wahrheit zu bleiben. Und nicht mehr als ein Frauenzimmer. Selma Verhoven, die mit dem fast schon berühmten Lächeln und den roten Zöpfen. Es war eigentlich nicht besonders gut gelaufen, wenn er es recht bedachte, aber er war damals auch nicht älter als sechzehn oder höchstens siebzehn gewesen. Selma musste damals mindestens zwanzig gewesen sein und hatte ihn ausgelacht, weil er zu früh gekommen war. Das war ja wirklich eine beschissene Erinnerung, die da aus heiterem Himmel auftauchte, nur weil ein verfluchter Brief auf dem Fußboden im Flur gelandet war.
Die anderen in der Clique hatte er nicht gekannt. Nicht wirklich. Sie waren ein oder zwei Jahre jünger gewesen, und der Club war, lange bevor er dazustieß, gegründet worden. Die Höhle! Auf einmal fiel es ihm wieder ein, so hatte der Raum geheißen. In diesem verdammten Rattenloch war doch … nein, an diese Geschichte wollte er nicht denken. War man davongekommen, dann war man …
Und dann sollte es eine Million Jahre später ein Wiedersehen in Mollys Pension geben.
Warum? Warum, zum Teufel?
Er ging ins Schlafzimmer und streckte sich auf dem Bett aus. Blieb eine ganze Weile liegen und glotzte die Decke mit den Stockflecken an. Die Gedanken fanden keine Ruhe. Er zündete sich eine neue Zigarette an und versuchte, den Weg in die Vergangenheit zu finden. In jenen Herbst, als er in die Gegend kam und endlich das erhielt, was man gemeinhin eine Kindheit nannte. Augustus Flinders war sehr darauf bedacht gewesen, dies zu unterstreichen, damit er ja nicht vergaß, dankbar zu sein.
Dankbar dafür, dass man sich seiner erbarmt hatte. Dankbar dafür, dass er auf dem großen Hof gemeinsam mit normalen Menschen leben durfte, Augustus und Elmira Flinders und ihren beiden Töchtern. Malvina und Regina. Dankbar dafür, dass er abends an dem großen Eichentisch sitzen, das Tischgebet hören und Vater Augustus’ Vorträgen über Großes und Kleines und seinen endlosen christlichen Ratschlägen und Ermahnungen lauschen durfte.
Dort zwischen den kleinen Schwestern zu sitzen, nun ja, sie waren natürlich nicht seine richtigen Schwestern, das durfte er sich niemals einbilden. Er war eher ein Knecht als ein Sohn, Augustus versäumte nicht, ihm dies einzubläuen, Blut war dicker als Wasser, und aus einer Ente wurde so schnell kein Mercedes.
So groß wie in Augustus Flinders’ Mund war er allerdings nicht, der Hof Höffenhaase, aber immerhin so groß, dass es Arbeit für ein Paar kräftige, jugendliche Jungenhände gab. Er lag in Richtung Brejvinskirke, nur ein paar Katzensprünge vom Meer entfernt, man brauchte zwanzig Minuten, um morgens mit dem Fahrrad zur Schule in Oosterby zu fahren, fünfundzwanzig zurück, weil man nachmittags immer Gegenwind hatte. Sowohl Vieh als auch Getreide, oh ja; vor dem Abendessen und besagtem Abendgebet ließen sich in der Regel zwei und auch mal drei Stunden Arbeit einschieben.
Was sich nachteilig auf solche Dinge wie Bücher und Hausaufgaben auswirkte, aber wenn es etwas gab, eine einzige Sache in der ganzen Welt, bei der Augustus Flinders und sein Pflegesohn (oder was immer er war) die gleiche Meinung vertraten, dann in dem Punkt, dass man der Bildung durch Bücher getrost den Rücken zukehren konnte. Es war ein deutlich überschätztes Kapitel.
Abgesehen von der Bibel natürlich.
Qvintus Maasenegger drückte seine Zigarette aus. Ging ins Badezimmer und pinkelte. Klatschte sich Wasser in die Achselhöhlen und dachte nach.
Sieben Jahre.
Er war zehn gewesen, als er dorthin gekommen war. Siebzehn, als er weglief.
Malvina war vierzehn gewesen. Also nicht unbedingt gesetzlich erlaubt nach den Maßstäben der damaligen Zeit, und eine dumme Gans, weil sie an dem Tag, nachdem es passiert war, ihrer Mutter davon erzählt hatte.
Aber damit, dass danach, im selben Winter, Vater Augustus starb und die drei dummen Gänse den Hof verkaufen mussten, hatte Qvintus nichts zu tun gehabt. Nachdem er ein halbes Jahr in Hamburg und Maardam umhergeirrt war, konnte er so jedoch in die Gegend zurückkehren. Er hatte schließlich nirgendwo Wurzeln, und in der Fischfabrik hatten sie Leute gesucht.
Der Verein der Linkshänder. Die hübschen Schwestern. Bei der einen war er, wie gesagt, fast zum Zug gekommen. Welche der beiden es auch immer gewesen sein mochte …
Jetzt waren die Erinnerungen zum Leben erwacht. Bewegten sich unwillig und versuchten, ins Vergessen zurückzusinken.
Zink, dieser Irre. Das kleine Mädchen … das Geld.
Nein, verdammt, dachte Qvintus Maasenegger, those were not the days. Er richtete sich auf der Bettkante auf. Betrachtete seine schmutzigen Laken und beschloss, sowohl die Wäsche als auch den Hausputz und das Neubeziehen des Betts auf eine bessere Gelegenheit zu verschieben.
Und das Joggen?
Unsinn. Im Westen sah der Himmel blau aus, und er beschloss, seine Geburtstagsfeier mit einem Glas Pils im Der dicke Pirat einzuläuten.
Dann würde man weitersehen. Alles hatte seine Zeit. Vielleicht sogar die Idioten in Mollys Pension.
Trotz allem.
Doch bevor er seine Wohnung verließ, machte er sich eine Notiz, die er in die Schublade für wichtige Papiere im Schlafzimmer legte. Und verbrannte im Spülbecken in der Küche einen Brief.
4 Oktober 2012. Maardam
Als er aus der Straßenbahn stieg, regnete es, und er fragte sich, wie viele Regenschirme zu Hause in seiner Wohnung herumstanden. Und im Antiquariat. Insgesamt vermutlich ein Dutzend, aber von der Haltestelle am Koplers Pleijn bis zur Kupinski-Gasse waren es schließlich nicht mehr als zweihundert Meter, und einen nassen Kopf bekam er nicht zum ersten Mal. Vielleicht war er nun in ein Alter gekommen, in dem es an der Zeit war, sich einen Hut zu kaufen.
Es hieß immer noch Krantzes, sein Tagesquartier, so stand es in mattem Gold in einem Halbbogen auf dem Schaufenster und auf der Tür. Krantze war vor ein paar Jahren gestorben und weitere Jahre zuvor ausgezahlt worden, aber warum sollte man den Namen eines Antiquariats ändern, das es seit mehr als hundert Jahren gab? Er hatte Ende der neunziger Jahre begonnen, hier seine Tage zu verbringen, jedenfalls die meisten. Also schon zu jener Zeit. Manchmal sieben, acht Stunden, meistens jedoch nur drei oder vier. Er hegte den Verdacht, dass Ulrike ihn mitten am Tag gern eine Weile loswerden wollte, insbesondere, seit sie selbst pensioniert war. Es war im Übrigen mehr als ein Verdacht, und erfüllte es vielleicht für beide Seiten die gleiche Funktion? Er liebte sie so sehr, wie er guten Wein liebte, aber das hieß ja nicht gleich, dass man vier Liter am Tag trinken musste.
Es hing zudem keine Information über Öffnungszeiten an der Tür. Nur ein Schild, das er nach Belieben umdrehen konnte. Geöffnet – Geschlossen. Wenn dort Geschlossen stand, hieß dies nicht zwangsläufig, dass er nicht da war. Mit jedem neuen Jahr, das verging, gefielen ihm die Bücher immer mehr, die Kunden immer weniger – abgesehen möglicherweise von der Handvoll, die im Viertel wohnte und das Antiquariat vor allem als Bibliothek nutzte. Man kaufte nach einer angenehmen Zeit des Auswählens und Argumentierens einen guten Roman oder eine Essaysammlung, bezahlte zehn Euro für das Buch und verkaufte es für denselben Preis, wenn man es ausgelesen hatte. Gentlemen’s agreement.
Frau Martinus, zum Beispiel. Herr Klimke mit dem Hund, der alte Konzertpianist Herkert, der vermutlich schon sowohl neunzig als auch hundert Jahre alt geworden war, dessen Verstand jedoch so klar war wie ein Alpensee. Sogar eine junge, schöne Frau gehörte zu dieser Klientel, sie kam seit dem letzten Jahr, nachdem sie in dasselbe Haus gezogen war. Sie war in tiefer Trauer, weil ihr Sohn gestorben war, und vor ein paar Monaten hatte Van Veeteren ihr gestanden, dass auch er einen Sohn hatte, der tot war. Seit mittlerweile dreizehn Jahren, aber trotzdem.
Er lud sie regelmäßig zu einem Glas Portwein ein, wenn sie ihre Bücher für die kommende Woche ausgewählt hatte, und fragte sich, ob Ulrike eifersüchtig wäre, wenn sie davon wüsste.
Wohl kaum. zwischen Frau Kuivers und ihm lagen gut und gerne vierzig Jahre, er hatte keine Absichten dieser Art. Es stellte sich die Frage, wie er das überhaupt hatte denken können, aber da er den Gedanken formulieren und sich von ihm distanzieren konnte, hieß dies wohl letzten Endes, dass er da gewesen war? Oder nicht?
Er schloss die Tür auf und trat in das Gewirr aus Büchern und Staub. Scherte sich nicht darum, das Schild umzudrehen. Wenn Münster seine Drohung wahrmachen wollte, ihm einen Besuch abzustatten, würde er klingeln, bis er hereingelassen wurde. So schlau war er schon.
Wenn es um meinen Geburtstag geht, werfe ich ihn hinaus, dachte Van Veeteren. Setzte Kaffee auf und nahm in dem Drehsessel im hinteren Zimmer Platz, wo er von der Straße aus nicht gesehen werden konnte.
Mit dem Kopf voraus in den Rinnstein. Da kann er dann liegen und es bereuen.
Und wenn es nicht um seinen Geburtstag ging, worum ging es dann?
Wie gesagt, verdammt.
Kurz vor elf hörte es auf zu regnen, und eine Viertelstunde später tauchte Münster auf. Er sah ein wenig abgezehrter aus, als Van Veeteren ihn in Erinnerung hatte, was daran liegen mochte, dass er sich gern an ihn aus seiner eigenen aktiven Zeit erinnerte. Den Achtzigern und Neunzigern. Als Van Veeteren noch im Dienst war und man sich fünfzig Stunden in der Woche gesehen hatte. Manchmal hundert. Er erkannte, dass Münster inzwischen älter sein musste, als er selbst damals gewesen war, welchen Wert eine solche Erkenntnis auch haben mochte.
»Guten Tag«, sagte Münster. »Du siehst fit aus.«
Das war keine gute Einleitung. Wahrscheinlich begriff Münster das auch, denn er hustete und schien sich plötzlich unwohl zu fühlen. So wie er gelegentlich vor zwanzig Jahren aufgetreten war, wenn ihm ein Schnitzer unterlief, dachte Van Veeteren. Man kommt halt nicht aus seiner Haut.
Obwohl Münster eigentlich niemand war, der sich Schnitzer erlaubte, das hatten andere übernommen. Im Gegenteil, wenn es einen Kollegen gab, auf den der Kommissar sich blind verlassen hatte – oder doch zu fünfundachtzig, neunzig Prozent –, dann war es Inspektor Münster gewesen.
Jetzt ist er in meinen Gedanken wieder Inspektor, erkannte er. Und ich selbst bin der Kommissar. Es ist, wie es ist, manche Dinge wird man einfach nicht los. Ich gehe jede Wette ein, dass irgendwer Kriminalkommissar auf meinen Grabstein kritzeln wird, wenn es so weit ist.
Und wenn ihn nicht alles täuschte, war Münster selbst in den letzten sieben, acht Jahren Kommissar gewesen. Auf jeden Fall seit Reinharts Pensionierung.
»Hm«, sagte er. »Die Höflichkeitsfloskeln können wir uns vielleicht sparen. Was willst du?«
»Ich habe gehört, dass du die Tage Geburtstag hast«, sagte Münster.
Die Fortsetzung gelang ihm nicht besser als die Einleitung.
»Komm rein und setz dich«, sagte Van Veeteren. »Aber wenn es um meinen Hundertsten geht, kannst du genauso gut wieder rückwärts rausgehen. Ulrike und ich reisen nach Neuseeland, und wer versucht, mir zu gratulieren, wird erschossen.«
»Das habe ich gehört«, erwiderte Münster.
»Was?«, sagte Van Veeteren. »Wo hast du das gehört?«
»Ulrike hat es mir gestern gesagt. Ich habe doch mit ihr gesprochen.«
»Ach so, ja«, sagte Van Veeteren.
Einige zögerliche Sekunden verstrichen. Münster richtete sich auf.
»Aber es geht eigentlich gar nicht um den Geburtstag.«
»Gut«, sagte Van Veeteren. »Du kannst eine Tasse Kaffee oder ein paar Tropfen Portwein bekommen. Oder beides … da draußen ist es anscheinend recht ungemütlich.«
»Ich glaube, ich bin im Dienst«, sagte Münster und nahm auf einem Rohrstuhl Platz. »Kaffee ist eine gute Idee.«
»Dann bist du also dienstlich hier?«, erkundigte sich Van Veeteren und löffelte Pulver in die Kaffeemaschine.
»Ja«, gab Münster zu. »Leider … oder was immer man dazu sagen soll.«
»Warte, bis ich mit dem Kaffee fertig bin, bevor du überhaupt etwas sagst«, erwiderte Van Veeteren. »Wenn es schon um etwas Wichtiges geht, möchte ich in aller Ruhe sitzen.«
Eine Minute verging. Münster saß, wo er saß, und hielt die Klappe. Die Hände im Schoß gefaltet, der Blick über die Bücherreihen wandernd.
Darin war er immer schon gut, erinnerte sich Van Veeteren. Für manche Menschen ist es ein Problem zu schweigen, aber nicht für Münster.
Ich glaube fast, das hat er von mir gelernt, dachte er.
Wie so vieles andere.
»Also gut«, meinte er, als er wieder in seinem Drehsessel saß. »Worum geht es?«
»Wenn ich Oosterby sage«, begann Münster.
»Oosterby?«, sagte Van Veeteren.
»Ja, genau. Oosterby«, sagte Münster. »Draußen bei Beerenzee und Werdingen. Herbst 1991, um genau zu sein.«
Van Veeteren runzelte die Stirn und nippte am Kaffee.
»Mollys Pension«, ergänzte Münster.
»Der Verein der Linkshänder?«, fragte Van Veeteren.
»Genau«, antwortete Münster.
»Vor zwanzig Jahren«, sagte Van Veeteren.
»Einundzwanzig«, korrigierte Münster ihn.
»Das war doch eigentlich kein besonders komplizierter Fall?«
»Nein.«
»Am Anfang vielleicht schon, aber gegen Ende nicht mehr. Was ist passiert?«
Münster zögerte eine Sekunde und sah fast entschuldigend aus. Als würde er um Verzeihung bitten.
»Sie haben Qvintus Maasenegger gefunden.«
»Maasenegger?«, sagte Van Veeteren. »War das nicht der Mann, der …?«
»Doch, leider«, bestätigte Münster. »Das ist es, was die ganze Sache ein bisschen knifflig macht. Ich dachte nur, dass du es vielleicht wissen willst …«
Und wie auf Bestellung spürte der ehemalige Kommissar ein Stechen in den Lendenwirbeln. Er schluckte einen Fluch hinunter und dachte, dass er das beim besten Willen nicht verdient hatte.
5 1960–61. Oosterby und Umgebung
Kuno Blavatskys Vater war Filmproduzent.
Er hatte widerspenstige, rabenschwarze Haare, ein griechisches Profil und einen eisernen Willen. Außerdem hatte er tief liegende, braune Augen mit tropfenförmigen Pupillen, weshalb zahlreiche Frauen bei ihm schwach wurden. Zumindest hob er im Kreise guter Freunde stets hervor, dass es an den Pupillen lag – und die guten Freunde stießen anschließend mit ihm an, protestierten und sagten, dass auch andere Umstände eine Rolle spielten. Zum Beispiel ein kräftiger Brustkorb, zum Beispiel ein stattlicher Schwanz, zum Beispiel ein nicht zu verachtendes Vermögen.
Und natürlich trugen auch solche Vorzüge dazu bei, dass das schöne Geschlecht Isidor Blavatsky umschwärmte. Wie die Fliegen einen frischen Kuhfladen. Die guten Freunde – wohlhabende Männer vom gleichen Schrot und Korn wie der Produzent selbst, wenngleich etwas untergeordneter – ließen gern solche Vergleiche fallen. Wenn besagte Damen nicht anwesend waren, versteht sich.
Fliegen und Kuhmist waren im Übrigen nur vorhanden, wenn man romantische Komödien in ländlicher Umgebung drehte. Sie hatte man gebraucht, um die Rekruten während des Krieges aufzuheitern, aber nach 1945 hatte man sich in den halbkulturellen Wildnissen, aus denen die Filmwelt bestand und seit jeher bestanden hatte, immer weiter von diesem bäuerlichen Genre entfernt. Aber das nur am Rande.
Worauf es ankam: Die Frauen wurden schwach.
Kunos Mutter war eine von vielen jungen Schauspielerinnen gewesen, die eine leichtbekleidete, aber anspruchsvolle Rolle in einem von Vater Isidors Filmen Ende der vierziger Jahre spielten, bei denen er übrigens selbst Regie führte, und weil sie die Erste war, die schwanger wurde, ohne Maßnahmen zu ergreifen, wurde geheiratet. Als Kuno geboren wurde, war sein Vater einundvierzig, seine Mutter dreiundzwanzig. Das war 1949.
Die Familie bezog ein Steinhaus in der Armastenstraat in Maardam, am Kanal, nur ein paar Blocks von den Filmstudios entfernt, die nach dem Krieg in schneller Folge unter dem hübsch klingenden Namen Futurisma Film Factory errichtet wurden, im Allgemeinen und im täglichen Gebrauch FFF genannt.
Die Ehe hielt vier Jahre. Obwohl Vater Isidor der offensichtliche Grund für die Trennung war, bekam er – im Widerspruch zum gesunden Menschenverstand und herrschenden Normen – das Sorgerecht für den Jungen. Die Mutter des Knaben (sie hieß Blanche mit dem Künstlernamen Blasie) hatte nämlich, als gewisse Dinge klar wurden, ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. Nachdem sie als Trostpflaster eine hübsche Geldsumme herausgeschlagen hatte, war sie an Bord eines Schiffs gegangen, quer über den Atlantik gefahren und hatte eine neue und vermutlich lukrative Karriere in Hollywood gestartet.
Man hörte nie mehr von ihr. Sah sie auch nicht auf der Leinwand, zumindest nicht in den Kinos des alten Europa. Aber vielleicht hatte sie ja erneut vorteilhaft geheiratet.
Als Kuno seine Mutter zum letzten Mal sah, war er gerade vier geworden, schon damals ein wohlgenährter Junge mit verschmierter Brille und phlegmatischem Wesen. Er interessierte sich in erster Linie dafür, in Bilderbüchern zu blättern und Süßigkeiten zu essen. Insbesondere Lakritz. Zu seinen übrigen Charakterzügen sei gesagt, dass er Bettnässer und Linkshänder war.
Die nächste Frau, die Isidor Blavatsky vor den Altar führte, hieß Disabelle Lemoncourt. Sie spielte eine Meerjungfrau in dem Film Der Matrose und die Liebe, und die beiden heirateten im Dezember 1956 in der Keymer-Kirche und verließen zwei Jahre später Maardam, um sich an der Küste niederzulassen. Sie kauften eine alte Fabrikantenvilla am Rande von Oosterby, oben auf der Vornehmen Klippe mit Aussicht auf den Jachthafen, das Meer und die Inseln Kleppener und Buygen. Außerdem erwarben sie ein größeres Segelboot, und weil Isidor im selben Jahr fünfzig wurde, gelangte er langsam, aber sicher zu der Erkenntnis, dass seine Sturm-und-Drang-Jahre vorbei waren. Kuno ging zur Schule, Disabelle zog sich von der Bühne zurück, und Isidor begnügte sich größtenteils damit, seine Investitionen in neue Filmprojekte aus angenehmer Entfernung zu überwachen. Geld hatten sie genug. Und neues strömte herein. Tränen und Lachen waren das Markenzeichen von FFF, heute wie damals. Tränen waren die sicherere Karte.
Das Segeln entwickelte sich zu Isidor Blavatskys neuem Faible und großer Leidenschaft, sowohl in der zweiten Hälfe der fünfziger Jahre als auch für den Rest seines Lebens. Disabelle erwies sich als außerordentlicher Gast, und in den Sommern unternahm die Familie lange Segeltörns die Ostsee hinauf, es ging durch den Nordostseekanal und rund um die britischen Inseln. Gelegentlich auch südwärts zur Biskaya und zur Iberischen Halbinsel.
Kuno war auf See genauso untauglich wie an Land, überwand mit der Zeit jedoch seine Seekrankheit und lernte, nicht alle naselang über Bord zu gehen. Den größten Teil der Zeit verbrachte er unten in der Kajüte, wo er gern unter einer Decke lag, Lakritz aß und Comics las, während er sich leicht gedankenverloren von den regelmäßigen oder unregelmäßigen Bewegungen des Meeres wiegen ließ. Sein Vater und seine Stiefmutter waren sich einig, dass es für alle Beteiligten das Beste war, ihn dort liegen zu lassen.
Der Sommer 1960 war außergewöhnlich schön, vor allem die zweite Hälfe, und aus diesem Grund beschlossen Isidor und Disabelle, dass es keine Eile hatte, nach Hause zurückzukehren. Stattdessen blieben sie zwei zusätzliche Wochen in den Segelrevieren rund um die englischen Kanalinseln Guernsey, Jersey und Sark, wo sie zahlreiche segelnde Freunde hatten, und liefen erst Ende September wieder in den Jachthafen bei Oosterby ein. Kuno war zu der Zeit elf geworden und wäre unter normalen Umständen in die vierte Klasse gekommen, das erste Jahr in der Großen Schule unter Magister Pommerstens harter, aber gerechter Rute.
So kam es jedoch nicht. Der Junge hatte es mit Mühe und Not geschafft, die Forderungen und Erfordernisse der dritten Klasse zu bewältigen, und als er nun mit mehr als drei Wochen Verspätung zum Schulstart erschien, beschlossen Lehrerin Bolster und Magister Pommersten einmütig und einvernehmlich, dass es reichte. Kuno Blavatsky bekam ein weiteres Jahr in der dritten Klasse, damit war das geklärt, manche jungen Menschen reifen einfach schleppender als die meisten anderen, und Kuno gehörte zweifellos zu dieser koagulierenden Kategorie.
Dass er nach drei Jahren voller Belehrungen und Ermahnungen immer noch Rückfälle ins Schreiben mit der linken Hand hatte, war ein unwiderlegbarer und trauriger Beweis dafür.
Dass er recht schnell neue Freunde in Gestalt von Marten Winckelstroop und Rejmus Fiste fand, veranlasste ebenfalls niemanden, die Augenbrauen zu heben. Sie hatten sich gesucht und gefunden, und Lehrerin Bolster konnte sich nicht erinnern, in ihrer langen pädagogischen Laufbahn jemals einem leistungsschwächeren Trio als diesen indolenten Knaben begegnet zu sein.
Dass der Verein der Linkshänder damit auch sein drittes Mitglied bekam, entzog sich ihrer Kenntnis. Auch gut.
»Super«, sagte Marten Winckelstroop. »Und vergiss nicht, dass wir geheim sind. Wenn du darüber auch nur ein Sterbenswörtchen verlierst, bist du des Todes.«
»To… To… To… Todes«, ergänzte Rejmus Fiste.
»Kein Sterbenswörtchen«, versicherte Kuno Blavatsky. »Übrigens wüsste ich auch keinen, dem ich etwas erzählen kann. Ich habe bis jetzt noch nie Freunde gehabt.«
Sie saßen wie üblich auf dem Dachboden bei Marten. Nun, für Kuno war es alles andere als üblich, es war das erste Mal. Aber seine beiden neugewonnenen Kameraden hatten Hunderte Stunden an diesem einfachen, aber gemütlichen Rückzugsort verbracht. Wenn nicht Tausende.
»Schön«, sagte Marten. »Schweigen ist Gold. Wenn man im Verein der Linkshänder ist, muss man zum … wie heißt das noch?«
»St… St… St…?«, schlug Rejmus vor.
»Genau«, sagte Marten. »Zum stillen und starken Typ gehören.«
»Und genau das bin ich«, erwiderte Kuno. »Still und stark. Wir können gerne armdrücken, dann werdet ihr es sehen.«
Kuno Blavatsky war tatsächlich kräftig für sein Alter, und dass er ein Jahr älter war als seine Kumpel, gereichte ihm natürlich auch nicht zum Nachteil. Marten und Rejmus spürten, dass Kuno genau die Vitaminspritze war, die ihr Verein benötigte. Im Frühjahr und Sommer hatte es um Versammlungen und Aktionen ziemlich schlecht gestanden, und keiner von ihnen konnte sich erinnern, was aus den Regeln und dem Zweck geworden war, die man anfangs formuliert hatte.
Ab dem Winterhalbjahr 1960 bekam alles jedoch neuen Schwung. Rejmus fertigte neue Mitgliedsausweise an, weil die alten verschwunden waren, man vermischte Blut und schwor einander Treue bis in den Tod, und als Zeichen dafür, dass sowohl die Mitglieder als auch der Verein selbst reifer geworden waren, begann man die Zusammenkünfte inzwischen damit, heimlich eine Zigarette zu rauchen, die Kuno mit großer und untrüglicher Verschlagenheit aus dem Vorrat seiner Eltern über dem Barschrank in dem großen Haus oben auf der VK, der Vornehmen Klippe, klaute.
Mit der linken Hand wurden neue Statuten geschrieben. Man begrüßte einander mit einem kräftigen linken Händedruck, und beim Armdrücken (nicht einmal gemeinsam konnten Rejmus und Marten den lakritzstrotzenden Kuno niederringen), ballte man die rechte Hand stets auf dem Rücken.
Ende Mai des folgenden Jahres, nur ein paar Wochen vor dem Beginn der Sommerferien, kam Lehrerin Bolster ums Leben. Einige fanden, dass dies unter merkwürdigen Umständen geschah, aber die meisten, beispielsweise die Polizei, behaupteten, dass es sich schlicht um einen Unfall mit tragischem Ausgang gehandelt hatte. Sie war auf dem Weg von ihrer Wohnung in das Klassenzimmer die Treppe hinuntergestürzt und hatte sich das Genick gebrochen.
Es war in der Nacht von einem Donnerstag auf einen Freitag passiert. Sie wurde am nächsten Morgen von Lehrer Klitschke gefunden, als dieser gegen acht Uhr nach unten ging, um die Schulglocke zum ersten Mal klingeln zu lassen, und er stellte schnell fest, dass sie mausetot war.
Die Fahne wurde auf Halbmast gehisst, und die Schule in Oosterby blieb anderthalb Tage geschlossen. Zu jener Zeit ging man normalerweise noch den halben Samstag zur Schule.
Welches Anliegen Lehrerin Bolster mitten in der Nacht in das Klassenzimmer geführt haben mochte, war eine Frage, die die Polizei sich selbst und anderen stellte (mit Hilfe eines Thermometers und Obduzent Bluums konnte festgestellt werden, dass sie gegen ein Uhr nachts gestorben sein musste), aber man nahm an, dass sie dort unten etwas auf dem Lehrerpult vergessen hatte, ein Schreibheft, eine nicht berichtigte Arbeit oder irgendein anderes didaktisches Detail. Man ging davon aus, dass sie vermutlich im Bett gelegen und einen Erdkundetest über Europas Flüsse und Seen korrigiert hatte, und vielleicht hatte sie zu diesem Zweck eine Karte konsultieren wollen. Sie hatte die Nachttischlampe angelassen, aber um Lehrer Klitschke am anderen Ende der Wohnung nicht zu wecken, hatte sie allem Anschein nach darauf verzichtet, das Licht im Treppenhaus einzuschalten – und dass diese Treppenstufe nachgeben würde, genau wie das Geländer, das mehr als hundert Jahre gehalten hatte, tja, das war natürlich nichts weiter als ein unglücklicher Zufall.
Oder das Schicksal, wie jemand vorschlug. Und dass Lehrer Klitschke von dem Krach, der Lehrerin Bolster auf ihrer letzten Reise begleitet haben musste, nicht aufgewacht war, nun, dies deutete wohl lediglich darauf hin, dass sein Schlaf besonders tief und gesund war. Was gut zu seinen übrigen Charakterzügen und Prinzipien passte.
Jedenfalls starb Lehrerin Bolster mitten in der Erfüllung ihrer Pflicht; dies betonte Propst Zimmermann bei dem Trauergottesdienst, der zehn Tage später in der vollbesetzten Kirche von Oosterby stattfand.
Auch wenn es wie gesagt mitten in der Nacht passiert war. Bis zuletzt war sie also damit beschäftigt gewesen, das heranwachsende Geschlecht zu erziehen. So wie es immer gewesen war.
Auf Marten Winckelstroops Dachboden wurde in aller Bescheidenheit gefeiert. Apfelsaft, Zimtkekse und drei Zigaretten der Marke Camorra, keine Verschwendung. Der Tod verlangt keine großen Gesten. Im Gegenteil: Er verlangt Respekt und Zurückhaltung.